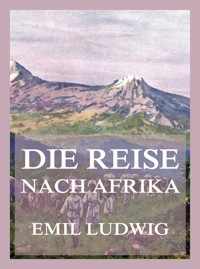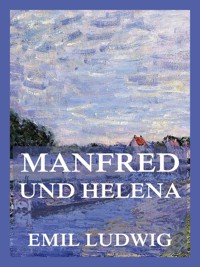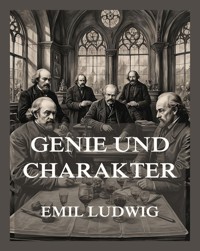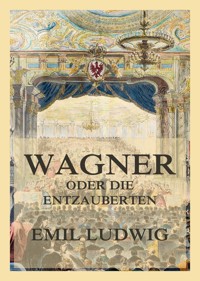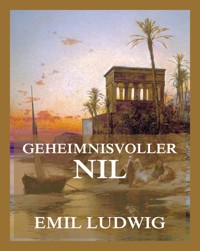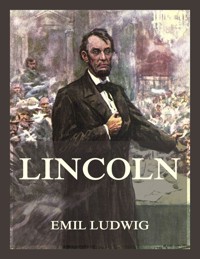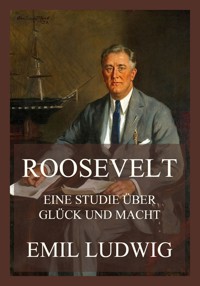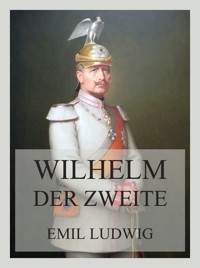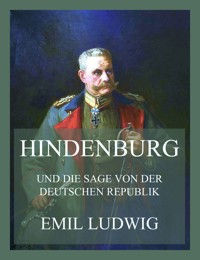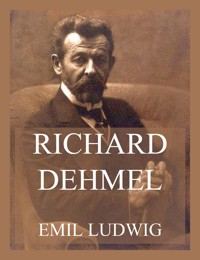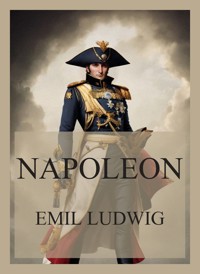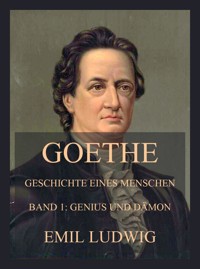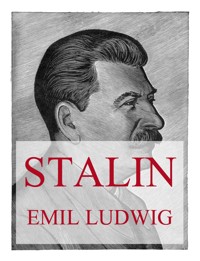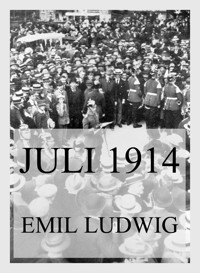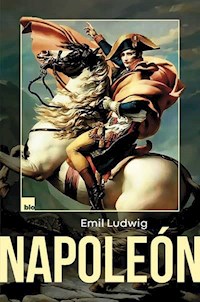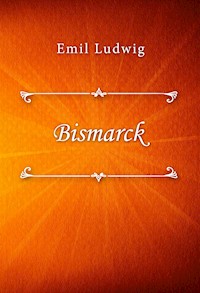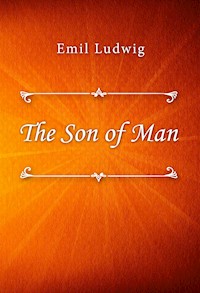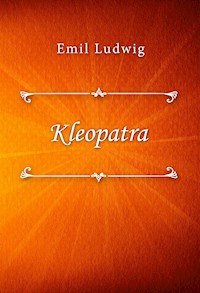
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Emil Ludwigs Bericht vom Leben der Kleopatra ist eine glänzende psychologische Studie der Königin und jener beiden Männer, mit denen ihr Name für immer verbunden bleibt: Caesar und Antonius. Statt der exzentrischen Amoureuse zeigt uns der eigenwillige Autor eine echt und tief Liebende, eine Mutter und Kämpferin.
Die Darstellung Emil Ludwigs bedient sich des historisdien Materials, das Plutarch und andere antike Autoren hinterlassen haben. Doch treten die äußeren Fakten hinter der Schilderung innerer Vorgänge zurück: Ludwigs „Kleopatra“ ist vor allem eine imaginativ entworfene Seelengeschichte der ägyptischen Königin. Was dabei sichtbar wird, ist nicht, wie man vermutet hätte, die verführerische, in allen Farben des weiblichen Spektrums schillernde Kurtisane, die Cäsar und Marcus Antonius mit ihren exotischen Reizen bezauberte und faszinierte, sondern die aufrichtig liebende, großgesinnte Frau und Kämpferin für das im Brennpunkt weltpolitischer Verwicklungen stehende Ägypten. „Möchten meine Leser“, schrieb Emil Ludwig, „diese Darstellung als einen Beitrag zur Geschichte des menschlichen Herzens aufnehmen, an der ich seit dreißig Jahren arbeite.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Copyright
First published in 1937
Copyright © 2020 Classica Libris
Vorwort
„Außerordentliche Menschen treten aus der Moralität heraus; sie wirken zuletzt wie physische Ursachen, wie Feuer und Wasser.“
GOETHE
Zuletzt bin ich ihr am Nil begegnet, aber da war ihr ganzes Sinnen nach Norden gerichtet, Ägypten blieb ihr beinahe fremd. Drüben, am Mittelmeer, war sie zu Hause, Meerwind weht durch ihre Geschichte.
Von allen Lebensbildern, die ich entwarf, ist dieses durch das fast völlige Fehlen von Zitaten unterschieden. Die intimen Dokumente, Briefe, Gespräche, Memoiren, die ich sonst häufte, um einen Charakter durch sich selbst oder seine Freunde und Feinde zu erklären, hier fehlen sie vollkommen: die Liebesbriefe der Kleopatra, die meisten Privata des Antonius und Cäsar sind als Dokumente verloren; es existieren noch drei Sätze aus einem einzigen Briefe des Antonius. Aber das öffentliche Leben der Königin ist bis auf eine kurze unbekannte Epoche sicher überliefert, und auch das nur, weil die drei Römer in die Weltgeschichte gehören, um die sich ihr Leben gerankt hat.
Und doch ergibt, was sich an Charakterzügen bei dem halben Dutzend antiker Autoren findet, die ihr rasch folgten, ein lebendiges Bild, dem wenigstens eine echte Büste zu Hilfe kommt. Vor allem ist es Plutarch, mein Meister, dem ich hier zum erstenmal unmittelbar folgen kann; denn obwohl ich nach Rasse, Lebenslauf und Bildung dem Mittelmeer und der Antike angehöre, habe ich griechische Gestalten nur dramatisch geschildert, historisch nie.
Im Anblick jener naiv-raffinierten Berichte der Alten erschienen mir alle modernen Historiker entbehrlich; einzig Ferreros große Römische Geschichte und die schönen Bücher über Kleopatra von Stahr und Weigall (1864 und 1927) habe ich gelesen und benutzt. Denn wäre Plutarch auch nicht moderner als alle Analytiker unserer Zeit, so war er doch seinen Gestalten näher, und wenn er schreibt, sein Großvater habe sich noch vom Küchenchef des Antonius in Alexandria die Geheimnisse seiner Braten erzählen lassen, so spricht mich dieser Bericht frischer an als jede Polemik zwischen zwei Gelehrten von heute, deren einer dem andern vorwirft, er habe dem Sueton zuviel geglaubt oder dem Appian zuwenig.
Dem Mangel psychologischer Dokumente verdanke ich die Freiheit, Stimmungen und Selbstgesprächen stärker nachzuhängen, als ich es bei reicheren Quellen durfte. Als ich 1919 mit „Goethe“ eine neue Kunst der Biographie begann, habe ich mir zuweilen mit Selbstgesprächen geholfen, auch noch in „Napoleon“, später nicht mehr. Hier aber, bei dieser vollkommenen Leere an psychologischen Quellen, waren Monologe geboten. Die Handlung ist auch hier überall verbürgt, auf die Gefühle aber konnte schon von Plutarch nur geschlossen werden. Und doch ist keine Schlacht, kein Parteikampf und keine Provinz aus jener Zeit für uns von irgendwelcher Bedeutung; nur die Gefühle sind ewig, sie sind zugleich die unsrigen, durch sie allein können wir uns in den Gestalten spiegeln.
Ist damit die Grenze des historischen Romans erreicht, so ist sie doch nirgends überschritten; denn alle die hundert Dialoge, die historische Gestalten vor den Ohren eines hingegebenen Betrachters tauschen, habe ich hier wie überall verschwiegen und bin auch in der Szenenführung den antiken Autoren exakt so weit gefolgt, wie sie eben gehen. Die wenigen Sätze, die in direkter Rede folgen, stehen in den Quellen.
So ist diese vielbewegte Historie fast ganz der Seelengeschichte der Heldin und ihrer drei Römer gewidmet. Freilich wird man hier nicht mehr die Psyche einer großen Amoureuse finden, als die Kleopatra entgegen sämtlichen Quellen in die Legende kam, sondern eine Geliebte und Mutter, eine Kämpferin und Königin. Jenseits aller Formprobleme mögen meine Leser diese Darstellung als einen Beitrag zur Geschichte des menschlichen Herzens aufnehmen, an der ich seit dreißig Jahren schreibe.
I
Aphrodite
„Nimmt das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Weib, das sich nicht vollkommener erdenken läßt.“
GOETHE
1
Oben, in der offnen Fensternische, im Schatten der Säulen, sitzt eine elfjährige Prinzessin und blickt über das Meer. Die Hände halb gefaltet zwischen dem braunen Lockenkopf und der Marmorwand, die Beine auf Kinderart angezogen, so daß sie auf den Sandalen sitzt, hockt sie in ihrem gelben Seidenhemd, denn viel mehr hat sie nicht an, und der leise Wind bauscht es ein wenig um die kleinen, spitzen Brüste, sie ist schon eine Jungfrau. Im Norden würde sie für fünfzehn gelten, aber wir sind am Mittelmeer, und der Palast steht in Alexandria an der afrikanischen Küste.
Groß ist sie nicht, aber unglaublich leicht, und wenn sie jetzt von ihrem Wachtposten herunterspränge, würde der Eunuch, der dort auf dem Boden kauert, zu spät kommen, um ihr zu helfen, denn da wäre sie längst bei der Tür, so schlank und behend ist die kleine Prinzessin. Aus seiner Schattenecke kann er sie ansehen und sich einbilden, daß sie es nicht merkt. Ach, sie merkt alles rings um sich her, und während ihr goldbrauner Blick dem großen Segel draußen folgt, das eben am Leuchtturm vorüberzieht, hat sie drinnen das feuchte Auge des kauernden Sklaven erhascht und zugleich das Knistern des Seidenüberzuges unterschieden, an dem er leise den braunen Rücken reibt; was er fühlt, kümmert sie nicht, er ist nur ein Sklave, ein Tier, er ist kein Mann. Zugleich hat sie etwas wie Teer gerochen und geschlossen, daß unter ihrem Fenster im Gewölbe die nassen Taue aufgehängt werden, mit denen man gestern ihre kleine Lustjacht an die Stufen zog.
Unbeweglich, wie eine stumme Klage, ruht der feuchte Blick des zerstörten Menschen auf der Prinzessin. – Sie ist weiß, denkt er. Berenice, die Schwester, ist gelblich, und der Vater, der König, beinah schon braun. Aber so weiß wird sie nicht bleiben, die Liebe und der Wein werden sie schon färben. Warum wohl die Nasenflügel zittern? Jetzt denkt sie sicher nach, wie man die Schwester am leichtesten vergiften könnte. Wenn sie’s mir anvertraute, täte ich’s gleich: ihre Stimme allein kann einen verrückt machen. Das war mein Vater, der ihren Großonkel damals umgebracht hat. Am Ende ist er dafür geköpft worden. Einmal muß man doch sterben. – Und er starrt auf die Prinzessin.
Unbeweglich sitzt sie, die Hände hinter den Locken halb gefaltet, die kleinen Füße angezogen, so blickt sie über das Meer: wenn sie das Segel des Vaters erkennen wird, dann wird ihre Gefangenschaft enden! Aber vielleicht haben sie ihn längst umgebracht, in Rom oder auf dem Meere? Nun, dann kommt vielleicht morgen ein lateinisches Segel und bringt einen Römer in den Hafen, mit kurzem Wams und kurzem Schwert, mit den scharfen strengen Zügen, um die Teufelsschwester abzusetzen, sie selber aber in ihres Vaters Namen zu befreien.
Von Rom kommt alles Heil und Unheil, denkt sie. Warum von Rom? Geht nicht die halbe Ernte in jedem Frühjahr hier aus dem Hafen auf den langen Seglern nach den italischen Häfen? Die schönsten Gewebe, herrliche Amethyste, die das Geheimnis des Dionysos bergen, das goldgelbe Ambra und Moschus und Weihrauch, alles, was hier im Hafen eingelaufen und hoch bezahlt worden ist, kaum ist es da, wird es umgeladen und geht auf den langen Seglern nach Rom. Was zahlen die dafür? Alle paar Jahre muß der Vater große Barren Gold aus den Gewölben heben lassen – und fort auf die Schiffe, und dann segeln wieder tausend Talente nach Rom. Je mehr sie von uns kaufen, um so mehr müssen wir ihnen bezahlen. Warum?
Jetzt sitzt der Vater schon wieder zwei Jahre drüben in dem Landhause des Pompejus und schachert, wieviel er zahlen muß, damit er die Krone behalten darf. Wer sind sie eigentlich, die immer fordernden, immer drohenden Männer? Auf der Münze sah er recht plebejisch aus, der große Pompejus! Cäsar, der andere, soll besser aussehen, aber von dem gibt’s noch keine Münze. Alles heraufgekommene Händler und Krieger! Und wir, die wir von Alexander stammen, dreihundert Jahre aus einem Geschlechte von Königen, Nachkommen der Götter und ihre Stellvertreter auf Erden, wir müssen betteln gehen nach Rom, damit sie uns in unserem Palaste dulden! Da fährt schon wieder ein Kornschiff die Mole entlang, das werden sie wieder nicht bezahlen!
Plötzlich erkennt die Prinzessin den Grund: sie stellt sich das gedunsene Gesicht ihres Vaters vor Augen; wie unköniglich er sich hier in seiner Hauptstadt gebärdet hat, wie er sich zu den Spielleuten setzt, auf der Straße die Flöte spielt und seine Sklaven nach seiner Pfeife tanzen läßt. Gibt es ein Kind in der riesigen Stadt, das den König nicht Auletes nennt, den Flötenspieler? Gibt’s einen Vornehmen, der seinen König nicht schon betrunken durch die Straßen wanken sah? Wie viele Weiber haben ihm nicht auf die Finger geschlagen, wenn er nach ihren Brüsten griff! Da ist es kein Wunder, daß sie ihn kurzerhand abgesetzt und Berenice zur Königin erklärt haben, die älteste Tochter, die er, selber ein Bastard, man weiß nicht, mit welcher dunklen Sklavin, gezeugt hat.
Vergiften! denkt die Prinzessin, so wie es andere Ptolemäer gemacht haben. So wie der vierte Ptolemäus Bruder und Schwester erwürgt hat. Immer, wenn ihr Lehrer in der Geschichte ihres Hauses einen plötzlich sterben ließ, war’s eine Verschwörung. Sie weiß Bescheid, sie hat noch andere Quellen.
Einen Taschenspieler zum Vater, zum König zu haben, denkt sie weiter. Eine Mutter, verschollen, niemand weiß, wer sie war. Eine Hure zur Schwester und Königin! Können dann die Sklaven, kann das Volk noch glauben, daß der König das lebende Bild des Gottes Amon sei, der Erwählte des Ptah, wenn er im Purpur, die Königsschlange auf der Stirn, zum Tempel fährt? Können die Gelehrten ihn noch in ihren Schriften feiern, seit er den weisen Demetrios, dessen Ruhm durch die Welt hallt, mit dem Tode bedrohte, wenn er sich nicht sofort auf offener Straße besaufe?
Da kommt Demetrios. – Wie tief er die schöne Stirn beugt, fast bis zum Boden! Er spricht das schönste Griechisch in der Stadt, so viel weiß er von den Göttern und den Elementen, und wenn er es mit milder Stimme seiner Schülerin vorträgt, fragt sie sich, ob der Geist nicht wirklich mehr wert sei als die Krone, so wie sie’s der jüdische Philosoph gelehrt hat; aber dann lächelt sie heimlich und glaubt es nicht.
Doch man muß lernen, alles, was die Griechen wissen, muß man lernen, damit man einst den Römern gewachsen ist, die nichts wissen und nur kämpfen können! Alle Weisheit und alle Schönheit stammt aus Athen: das lehren sie heute morgen wieder die drei Gelehrten, die in den Palast kommen, denn sie ist unersättlich nach Wissen, lernt mehr, als ihre Väter gelernt haben, und viel mehr, als ihre ältere Schwester und die drei jüngeren lernen. Das ganze Museion weiß es, daß im Palaste nach hundert Jahren wieder einmal eine Prinzessin lebt, die alles wissen möchte, alles im Fluge fängt und behält, was sie sie in dem großen Saal an Zeichnungen und Apparaten lehren: Mechanik und Schiffbau, Skelette und den Körper des Menschen, Münzen, viele Münzen, aus denen sie Gesichter verstehen lernt, dazu ein halbes Dutzend Sprachen vom Mittelmeer. Am liebsten steht sie vor der großen Karte, und wenn ihre feste Hand, die nie zittert, mit dem Nagel eine Linie vom Nildelta nach Osten zieht, und das macht sie oft und preßt dabei die Lippen aufeinander, so umreißt sie Syrien, Kappadozien, Epirus, wohl auch noch Brindisi, aber dann krallt der Nagel sich quer durch Italien und schnellt südlich direkt nach Hause, als fordere sie das ganze östliche Mittelmeer mit ihrer Heimat verbunden: alle Küsten unter Ägypten! Nur Rom umkreist ihr Finger nie.
Und doch ist ihr Ägypten nur ein Name: sie kennt das Land dort oben am Nil sowenig, wie ihre Väter es kannten, sie lebt nicht in seinem Kultus, in seinen Göttern, der Nil ist ein fremdes Gewässer, das man hier draußen auf der Lagune vor dem weiten Mörissee nicht mehr sieht. Denn Alexandria liegt nicht mehr am Nil wie Memphis; es liegt am Meere der Griechen. Was sie fühlt, die Sprache, in der sie träumt, was sie lernt und wie sie’s deutet, die Väter, die Bauten, der Trubel des Hafens mit seinen hundert Sprachen und Rassen, alles ist griechisch geleitet, und wenn sie durch die hallenden Säle des Palastes läuft, mit ihren leichten, hingetupften Schritten, dann blicken sie die Büsten der Ptolemäer an, zwar nicht mehr mit der klassischen Nase, aber in athenischer Form, in Haltung und Stil nachahmend den Großen Alexander, der damals an dem wüsten Strande landete, sich umsah und beschloß, hier die Hauptstadt der Welt zu begründen. War sie es nicht heute noch?
Abends ist die Prinzessin auf das flache Dach des Palastes gestiegen: dort kann man fast so weit Umschau halten, wie es der Leuchtturm tut, vielleicht bis nach Zypern, bis nach Griechenland, vielleicht bis nach Rom! Jetzt träumen die verankerten Schiffe. Sie träumen von ihrer Ladung, vielleicht ist es Glas und Papyrus, von ihrer Fahrt durch das blaue Meer, vom nächsten Hafen und den rauhen Händen, die sie an Tauen fassen und dann mit Gepolter löschen werden; sie träumen von ihrer ungewissen Zukunft, der großen Frage der Stürme, die schon warten, um sie zu vernichten, die Schiffe, Boten von einer Rasse zur andern, Träger des Handels, des Krieges und der Macht, immer der Gefahr entgegensegelnd, denn wenn sie je lange im Hafen verbringen, müßten sie faulen und sterben.
Ihrem Wasserpfade folgt die Prinzessin auf dem Dache des Palastes, aber sie träumt nicht mit ihnen. – Einst, so spricht ihr heißes Herz, einst, so sagt ihr heller Verstand, will ich auf einem dieser schnellen Segler an die Küste von Syrien und Kappadozien fahren, gefolgt von 600 dreideckigen Galeeren, nach Ephesus, Korinth und nach Athen! Alle Inseln in den großen Buchten werden mein sein! Berenice wird bei den Schatten sein, und ich werde die Krone mit der Königsschlange tragen, Aphrodite und Isis, und auf meinem Ring das Siegel wird sagen: Kleopatra die Siebente, Königin von Ägypten. Dann wird nur noch Rom in der Welt sein neben mir – und dann wollen wir einmal sehen, ob das Korn Ägyptens weiter diesen Italikern zusegeln soll, und wenn es segelt, ob sie nicht Gold dafür nach Alexandria senden werden, statt es zu holen, Gold und große Huldigung aus dem binnenländischen Rom in die strömende Hauptstadt der Erde!
2
Nächtlich versinken solche Zukunftsbilder des Ostens mit der Abendsonne im westlichen Meere.
Was sie aus Rom erfährt, bald durch die Philosophen, bald durch den Hauptmann, durch einen Eunuchen, ist dunkel und verworren, so wie die Vergangenheit ihres Vaters, so wie die Gegenwart der römischen Republik, die eben untergeht.
Sie wußte, was in den zehn Jahren ihres jungen Lebens vorgegangen war: Ein Ptolemäer hatte, dreizehn Jahre vor ihrer Geburt, Ägypten dem römischen Volke vermacht, aber der Senat hatte die Erbschaft nicht antreten wollen: so groß war die Eifersucht aller gegen alle, die dieses reichste Land zu verwalten berufen werden konnten. War nicht ein schwaches Königreich am Nildelta ungefährlicher als ein starker römischer Prokonsul? So hatte man lieber zwei illegitimen Söhnen jenes königlichen Erblassers Ägypten und Zypern übergeben, auf ihre Wüstheit vertrauend: je mehr man von ihnen erpreßte, um so schwächer würden sie werden. Jeder der drei oder vier Machthaber in Rom wartete heimlich auf den Tag, der ihn stark genug finden würde, das wunderbare Land zu fassen und zu halten, von dem sich Rom in Fabeln mehr als in Rechnungen zu unterhalten liebte.
Dann hatten die großen römischen Herren den flötespielenden König alle paar Jahre erwischt und, gleich den Katzen, wieder laufen lassen, dann wieder Gold aus dem sagenhaften Schatze der Ptolemäer holen, ihn wieder zahlen lassen, bis ihn schließlich zur Belohnung Volk und Senat von Rom endgültig anerkannten. Man schrieb das Jahr der Stadt, das dem Jahr 59 entsprach; Cäsar war Konsul. Aber er war noch lange nicht mächtig genug, um einen andern Machthaber, Clodius, seinen Feind und Rivalen, zu hindern, daß er, unzufrieden mit einer Bestechung, den König von Zypern absetzt, Bruder und Vasall des Ägypters. Sein Schatz wurde eingezogen, Zypern römische Provinz, aber der ägyptische König tat, als ginge ihn Zypern nichts an. Vielmehr suchte er gerade jetzt dem Lande 30 Millionen Goldfranken auszupressen, um damit Cäsars Partei in Rom zu bezahlen, ohne den Schatz seines Hauses anzugreifen.
Da brach ein Aufstand los in Alexandria: jetzt konnten die Großen des Palastes und der Stadt, Priester und Junker, Grundbesitzer und Hofbeamte, jetzt konnten sie leicht das immer labile, neuerungslustige Volk der Weltstadt von der Verächtlichkeit ihres Königs überzeugen. Er flieht nach Rom, Berenice, die älteste Tochter, wird von ihrer Partei zur Königin erhoben. Sein Bruder aber, jener König von Zypern, nimmt Gift und stirbt.
Staunend hatte die zehnjährige Kleopatra vor dieser Nachricht innegehalten. Viel Blutiges hatte sich in der Geschichte ihres Hauses zugetragen, durch 250 Jahre waren einander dreizehn Ptolemäer gefolgt, beherrscht oder verfolgt von ihren Frauen und Kindern, ganz wie die Pharaonen, ihre Vorgänger am Nil. Gift und Dolch hatte sie in den Schicksalen ihrer Väter wüten sehen, wie Brüder ihre Schwestern aus dem Leben rissen, Prinzen ihre Väter, Königinnen ihre Gatten, die zugleich ihre Brüder waren: alles um Macht, alles um ein gesteigertes Leben, oft nur, um nicht selber erschlagen zu werden. Von eigener Hand aber war noch keiner gefallen! Nun hob ein später Erbe dieses in Schande versinkenden Geschlechtes noch einmal das Zeichen des Stolzes empor. Aus einer verfallenden Dynastie erhob sich noch einmal ein männlicher Nachfolger jener Griechen, die die Legende verherrlicht hatte und deren Verse dem entthronten Inselkönig nachklangen, als er den Giftbecher nahm. Betroffen stand die Prinzessin. Hatte sie ihren Vater verachten gelernt, der sich die Macht von einem Lustrum zum andern in Rom erschacherte, nun mußte sie seinen Bruder verehren. Es war also doch wahr, was sie die Philosophen des Museion lehrten, noch heute gab es etwas über der Krone und über dem Golde. Die zehnjährige Kleopatra erkannte, daß der Stolz eines Königs noch schöner sei als die Macht; tief in ihre junge Seele senkte sich und verharrte für immer diese große Erfahrung, daß Knechtschaft, wie die ihres Vaters, unwürdig sei und Gift eine schnelle Erlösung.
Sie aber, in ihrer jungen Lebenskraft, war entschlossen, die Knechtschaft zu überwinden, in der sie ihre Schwester hielt. War Berenice glücklich? Der erste Mann, der bei ihr schlief, irgendein Vetter, den man ausgewählt, damit er König hieße und für Kinder sorgte, war so verdorben, daß er, dem Willen des Hofes gemäß, bald getötet werden mußte. Der zweite, den sie nehmen mußte, war besser, aber war dieser vorgebliche Sohn des Perserkönigs nicht doch vielleicht ein Abenteurer? Wer waren überhaupt diese Perser, die immer in engen Hosen herumgingen, gut reiten konnten, aber von griechischem Geist, von den Feinheiten des Lebens nichts verstanden? Und war er frei und nicht von den Eunuchen abhängig, die den Palast regierten? Liebte oder verachtete er seine Frau? Lebten sie einen Tag ohne Furcht vor Rom? Fordernd und frech lag das unsichtbare Rom im Norden, jeden Tag konnte es kommen, sie töten, alles rauben, alles zerstören.
Es war der Weg der Schmach, den ihr Vater ging; aber da man nicht gegen Rom regieren konnte, so mußte man sich mit ihm vertragen, das fühlte die Prinzessin. Das fühlten auch die Alexandriner und ihr Königspaar. Deshalb sandten sie dem abgesetzten König hundert vornehme Bürger nach, um Rom zu einem Bündnis mit ihrer Partei zu bewegen. Monat um Monat verstrich, nichts hört man von der Gesandtschaft; die einsame Prinzessin ist beinahe die einzige in Alexandria, die auf Abweisung jener Gesandten hofft; denn nur, wenn ihr verachteter Vater in Rom siegt, kann sie selber der Krone entgegenhoffen.
Als dann nach dem schiffelosen Winter die ersten Segler wieder am Pharos herangleiten, erfährt sie mit der ganzen Stadt, Auletes habe die Gesandten in Italien einzeln töten lassen. Doch die ungeduldige Prinzessin hat schon ihren eigenen Späher, sie hört noch manches, was andern verschlossen bleibt: ihr Vater habe 6.000 Talente aus seinem Schatze geboten, wenn man ihn wieder einsetzte, Rom sei jetzt arm nach seinen verlorenen Perserkriegen, Cäsar und Crassus, Crassus und Pompejus intrigierten gegeneinander, wer wohl Ägypten nehmen sollte und den Schatz der Ptolemäer, um damit Herr über seine Rivalen zu werden. Alles kommt darauf an, daß jetzt ihr Vater so viel zahlt, um nicht als unterworfener, sondern als verbündeter König aus Rom zu scheiden.
Da kommt schon neue Kunde über das Meer! Jetzt, heißt es, steigert sich in Rom der Endkampf zum politischen Kernstück; Cäsar, aus Gallien zurück, habe durch sein „Julisches Gesetz“ den flötespielenden König zum „Verbündeten und Freunde des römischen Volkes“ erklären lassen. Doch zugleich haben die schlauen Herren ihren neuen Freund und Verbündeten in Millionenschulden bei römischen Wucherern gestürzt, damit er sie am Ende nicht bezahlen und schließlich doch erliegen soll.
Schon bildet sich um die unterdrückte kleine Prinzessin ein Kreis von Schlecht-Weggekommenen, die einen neuen Umsturz wünschen, Auletes läßt geheime Weisung geben, man solle der kleinen Kleopatra folgen, und während der schlaue und feige Ptolemäer in Rom seinen Thron zurückerbettelt, rüstet sich hier im Palaste der Königin ihre schweigende Schwester und denkt nach, wie man die Römer benutzt, um aufzusteigen.
Eines Tages ist es soweit. Irgendein römischer Feldherr in Syrien, der seine Kohorten nicht mehr bezahlen kann, bricht auf, um sich 12.000 Talente zu holen, den Preis, den der Flötenspieler für seinen Thron zuletzt aussetzen mußte. Von Gaza marschieren ein paar tausend Soldaten durch die Wüste nach Pelusium im östlichen Delta, dort, wo drei Jahrhunderte zuvor Alexander und wo in früheren Jahrtausenden manch persischer, hebräischer, assyrischer Feldherr an den Nil gezogen kam.
Endlich war die Erlösung da – wenn auch durch verhaßte Römer. Die Pulse der Prinzessin schlugen, wie sie sich bald vor der mächtigen Schwester versteckte, bald zwischen der neuen Partei fordernd erschien. Nun hörte Alexandria den Kampf der heranreitenden Fremden immer näher dröhnen, die Tore der Weltstadt springen auf, die Fliehenden verstecken oder ergeben sich. Jetzt sah Kleopatra das verwüstete Gesicht ihres Vaters wieder, wie er, geschützt von fremden Legionen, sich Thron und Heimat wiedernahm; sie sah den entstellten Leichnam des jungen Königs, die Unterwerfung der Vornehmen und der Priester, die wehrlose Haltung der ewig neugierigen Alexandriner und wie sie dem einst verjagten, alten König schon wieder ihre Treue versicherten. Endlich sah sie auch den Kopf der verhaßten Schwester, vom Vater verurteilt, in den Sand rollen: Bedingung ihrer eignen künftigen Macht! Niemand stand mehr zwischen ihr und der Macht als ein alter, erschlaffter Verbrecher, den sie ihren Vater nennen mußte. Ein Tag des schweigenden Triumphes, als ihre Schwester umkam.
Noch höher schlägt das stolze Herz der kleinen Prinzessin, als sie die fremden Soldaten genau ins Auge faßt. Dies also sind die Römer? Dies das römische Heer? Blonde, wüste Germanengesichter, Männer, die ihr in keiner Zunge Antwort geben, kleine, wildblickende Asiaten, großäugige Juden, niederstirnige Byzantiner: so zerrüttet erschien das römische Heer in Afrika. Die schlechtesten Römer, nicht die besten bekam die Prinzessin zu sehen, die Rom so sehr mißtraute – und ihre alte Furcht begann zu weichen.
Und doch, zugleich stieg ihr Erstaunen. Ein Reiteroberst, derselbe, der Pelusium genommen und auch den Schlag vor der Hauptstadt geführt hatte, saß nun bei ihrem Vater im Palaste zum Mahle. Geehrt wie der Feldherr, schien er diesen in jedem Zuge zu übertreffen. War dies ein Römer, nun, das war ein Mann! Die weite Tunika sehr tief gegürtet, das große Schwert noch immer neben sich, halb saß, halb lag er da, mit seinem Herkuleskopf, dem kurzen Bart, der großen Adlernase. Schweigend revidierte die forschende Prinzessin ihr Vorurteil gegen die Römer.
Der Reiteroberst merkte die Unruhe der schönen Prinzessin nicht. Kleopatra war vierzehn Jahre, er siebenundzwanzig, als sie sich an diesem solennen Königsfeste zum ersten Male begegneten. Berge und Ströme, Meere und Städte mußten in Aufruhr geraten, das Schicksal eines Helden mußte sich steigern und erfüllen, bevor sich diese beiden Menschen nach dreizehn Jahren wieder treffen sollten. Vielleicht wäre es nie geschehen, hätten sie jetzt mehr miteinander getauscht als Worte und Blicke; vielleicht hätte die Begierde, zu blühen, Früchte zu tragen, später, zur Zeit ihres Sommers, sie nicht ineinandergeworfen, wenn sie schon damals, bei diesem kurzen Besuche, ein Frühlingswind zueinanderwehte. Dort saßen sie bei Tische, Aphrodite gleich der Mondsichel, der frische Herkules mit Jünglingszügen, beide gleich fern den reifen Göttern, die sie einst darstellen und spielen sollten: eine zarte griechische Jungfrau, ein römischer Offizier, Antonius und Kleopatra.
3
Drei Jahre später war sie Königin.
Kleopatra übernahm Ägypten im Zustande der Auflösung. Auch diese letzten Jahre hatte der königliche Flötenspieler in ständigen Schiebungen verlebt. Ein römischer Finanzminister hatte de facto alles beschlagnahmt, und als ihn der König wegjagen mußte, war die Losung in Rom, jetzt endlich müßte das Reich Ägypten, so wie die meisten andern Küsten des Mittelmeeres, annektiert werden. Damals wäre es römische Provinz geworden, wäre nicht in demselben Jahre Crassus auf seinem persischen Feldzuge mit dem ganzen Heere vernichtet worden. Rettete sich durch diesen Zufall das Land vor Unterwerfung, so war es doch in jedem Betracht zerrüttet, als der ruhmlose König starb.
In feierlichen Anrufen hatte er das römische Volk zum Vollstrecker seines Letzten Willens ernannt, denn als er die siebzehnjährige Kleopatra und den zehnjährigen Ptolemäus zur gemeinsamen Herrschaft einsetzte, zugleich nach pharaonischem Brauche die Ehe beider Geschwister fordernd, mußte er nach den Sitten dieses Palastes die Intrigen fürchten, die sich um seine beiden jüngeren Kinder gruppieren würden: die dreizehnjährige Arsinoë und einen zweiten, kleinen Ptolemäus. Wer von den vieren würde den andern unterdrücken, verbannen oder ermorden? Welche Partei würde solche Taten vorbereiten? Wie einen Gott, so flehte dieser Ägypter den römischen Senat an, er möge für Frieden und Ordnung sorgen, Rom, die große Schicksalsmacht, die über kurz oder lang Ägypten besiegen mußte oder ihm die Weltherrschaft lassen.
Die Ehe mit dem kleinen Bruder hat Kleopatra nicht vollzogen. Was sie zwischen siebzehn und einundzwanzig getan, ist unbekannt; es ist die einzige Lücke in der Geschichte ihres Lebens. Und doch geschah nichts weniger, als daß man sie vom Throne stieß und daß sie auszog, ihn wieder zu erlangen. Aus einer einzigen Begebenheit, die uns ein antiker Autor erhalten, läßt sich auf ihre Regentengefühle schließen:
In ihrer frühesten Regierungszeit hatte ein römischer Prokonsul von Syrien seinen Sohn nach Alexandria gesandt, um die Truppen zu holen, die noch aus der Zeit des Antonius als römische Besatzung dort geblieben waren; er fand statt geordneter Verbände verwilderte Horden, meist von Germanen und Kelten, vor, die dort mit ihren ägyptischen Frauen sich’s wohl sein ließen und keine Neigung hatten, sich im nächsten Perserkriege töten zu lassen. Statt dessen schlugen sie jenen Offizier tot und verjagten seine Begleiter. Was tat die Königin? Mußte sie in ihrem Stolze nicht froh sein, den hochmütigen Befehl des fernen Römers von diesen ihren Halbuntertanen durchkreuzt zu sehen? Kleopatra war nicht die Herrscherin, die ihren Gefühlen nachlebte; sie ließ vielmehr die Mörder fangen und schickte sie in Ketten dem römischen Prokonsul, dem Vater des Ermordeten, nach Syrien zu.
Aber was muß sie erleben! Der mächtige Römer lebt auch nicht nach seinen Gefühlen. Statt sich an den Mördern seines Sohnes grausam zu rächen, schickt er sie wieder zurück und läßt der Königin sagen: Römer zu verhaften hätten nur der römische Senat oder seine Beamten ein Recht. Eine bedeutende Lehre für die stolze Kleopatra. Was wird sie daraus lernen?
Nicht lange, und aufs neue landet ein römisches Schiff, Gnaeus Pompejus steigt heraus, der Sohn des Diktators, mit dem Auftrage, dieselben Truppen für seinen Vater abzuholen. Jetzt sind die Horden gleich bereit: diesmal sollen sie unter dem größten Feldherrn ihrer Zeit und nun gar gegen Cäsar kämpfen! In diesem großen Endkampf um die Macht muß man sich eilen, auf die Seite des Pompejus zu treten. Kleopatra hört es, sie läßt die Truppen frei, ja schenkt dem Römer fünfzig Schiffe, um die Mannschaft fortzuführen. Freilich, Pompejus hat als Boten einen Sohn geschickt, jünger und noch eleganter, als damals jener Antonius gewesen ist. Wenn alle Römer wären wie dieser! Siegt jetzt der Vater, so hat sie einem alten Freund ihres Hauses sich gefällig erwiesen.
Von Pompejus’ Rivalen dagegen, von Cäsar, hatte der Flötenspieler zur Tochter immer nur zweideutig gesprochen. Was von Cäsar als Legende über das Meer gedrungen war, schien fesselnder, als was sich von Pompejus die Welt erzählte; aber sie hatte keine Münzen von ihm gesehen, während der andere ihr doch das schönste Abbild, einen verjüngten Pompejus, zugeführt hatte. Das war, wo nicht Klugheit, doch ein guter Zufall, denn als Zuschauerin des großen Wettkampfes sah Kleopatra in beiden Feldherrn zunächst nichts als zwei alte Herren vor sich.
Der sonderbare Besuch dieses jungen Römers war ein willkommener Vorwand für den Palast, die junge Königin anzuschwärzen. Sie war also mit den Römern im Bunde und lieferte ihnen Ägyptens Flotte aus! Ein paar elegante Offiziersbeine hatten es ihr angetan! Was mußte man nicht von einer solchen Herrscherin fürchten! In Wahrheit war der Kamarilla diese Jungfrau zu stark, zu denkend und viel zu selbständig. Den Knaben, der mit ihr regierte, konnte man lenken, er war mit seinen zwölf Jahren eher zurückgeblieben. Was war leichter, als ihm zu zeigen, wie ihn die Schwester verachtete! Versagte sie sich nicht trotzig der Ehe? Ließ sie diesen jungen Gatten nicht mit heißem Kopfe vor ihrem verriegelten Schlafzimmer stehen? Der Palast wußte alles. In kurzem gelang es seinen drei Mentoren: einem Eunuchen, einem Philosophen und einem General, Palast und Armee, die Vornehmen und das Volk zum Aufstande gegen eine Königin zu reizen, die das Land an die Römer verkaufte.
Wie es geschah, weiß niemand mehr zu sagen; nur daß eines Tages die zwanzigjährige Königin entfliehen mußte. Nach Rom? Senat und Volk von Rom waren ja als Garanten jenes Testamentes angerufen, das sie zur Mitherrschaft bestimmte. Aber die junge Kleopatra, die ihren Gefühlen nicht nachlebte, wenn es Interessen galt, war nicht das Wesen, Interessen dort nachzuleben, wo ihre Gefühle beleidigt wurden. Sollte sie die Römer anrufen, sie heimzuführen wie ihren Vater, den sie darum verachtete? Lieber durch Gift sterben wie sein Bruder, wenn alles verloren war!
Kleopatra floh mit wenigen Truppen zum Roten Meer. Dort waren Araber und andere Stämme, deren Sprachen, deren Parteien und Eigenheiten sie studiert hatte. Dort hat sie auf eigene Faust ein Heer gesammelt, entschlossen, dem Heer ihres Bruders und seiner Einbläser entgegenzutreten. Kannte sie nicht die Schwäche dieser Truppen? Die Unbeständigkeit jenes Generals Achillas, der die Macht in der Hauptstadt hatte? So, eine neue Amazone, zog sie mit ihren eigenen Truppen gegen Pelusium, ein Stück am Nil entlang, ein Stück durch die Wüste. Vom Westen zog ihr Achillas entgegen. Dort, am östlichen Ende Ägyptens, sollte eine Schlacht die Herrschaft über das älteste Reich entscheiden.
Und doch blickte die Welt damals nicht nach dem Nil. Sie blickte nach Griechenland, denn dort standen sich zwei weit gewaltigere Heere gegenüber, auch sie zur Schlacht gerüstet, nur um einen größeren Preis! Nicht eine Amazone und ein Rudel Abenteurer, dort stellten sich die beiden größten Feldherrn ihrer Zeit auf, um die Weltherrschaft zu gewinnen; denn eine dritte Macht war damals nicht zu sehen. Während sich die ptolemäischen Geschwister am Nildelta rüsteten und ausspionierten, schlug Cäsar den Pompejus bei Pharsalus. Er schlug ihn ganz und gar, und diese Kunde flog an den Küsten des Mittelmeeres entlang, daß alle erbebten, denn bis gestern hatte Pompejus für unbesiegbar gegolten. Sie drang zum Nil. Die beiden feindlichen Königskinder erschraken und warteten. Dicht auf die erste Kunde folgte die zweite, fast noch erstaunlicher, sie traf zuerst bei der legitimen Regierung ein. Der gewaltige Römer, noch vor ein paar Jahren mächtig genug, den König von Ägypten ein-oder abzusetzen, war als ein Flüchtling im Anzug, um mit 2.000 Soldaten, den armen Resten seiner glänzenden Armee, beim Sohne des Flötenspielers Asyl und Hilfe zu suchen. Einen Monat nach der verlorenen Schlacht ging Pompejus in Pelusium an Land.
Er wollte an Land gehen, aber im Kriegsrate der Götter und der Menschen war es anders beschlossen, Pothinus, der Eunuch, der in Wahrheit gegen Kleopatra die Regierung führte, beschloß, den geschlagenen Römer gleich zu ermorden: damit verbinde man sich Cäsar, dem neuen Herrn der Welt, und brauche keine fremden Heere auf heimischem Boden kämpfen zu sehen. Dicht vor der Küste kommt dem Pompejus auf einem schnellen Boote der ägyptische Feldherr entgegen, mit ihm gedungene Mörder.
Der Strand ist seicht, man kann nicht landen, heißt es. Die Frau, Cornelia, in Vorgefühlen, erschrickt und warnt ihren Mann. Pompejus aber sieht das Ufer voll römischer Soldaten, steigt in das Boot, nicht leicht, denn das Meer geht hoch, das Boot ist klein, und er ist sechzig. Beim Landen wird er von hinten erdolcht. Seine Frau sieht es vom Deck der Galeere, sie sieht auch noch, wie ihm der Kopf vom Leibe geschlagen wird, sie schreit und flieht. Kopf und Ring werden aufbewahrt, der Körper wird ins Meer geworfen.
Drei Tage später landete Cäsar, Pompejus’ Feind und Besieger, in Alexandria. Er forderte durch Boten das streitende Königspaar in seinen feindlichen Lagern auf, sogleich zurückzukehren: er sei gekommen, um in Ägypten Ordnung zu machen.
4
Ordnung? dachte Kleopatra in ihrem Zelte. Sie warf sich auf die letzten Kissen, die in dem kriegerischen Durcheinander schmucklos und nicht gerade weich auf die Erde gebreitet waren. Nach ihrer Gewohnheit, wenn sie vor einem Entschlüsse stand, blieb sie lange auf dem Bauch und unbeweglich liegen, nur Brust und Kopf durch aufgestützte Ellbogen erhebend, um frei zu atmen, zu denken. Es war ein fliegendes Heerlagers, mit dem sie wochenlang ihre geringen Truppen den Bewegungen des feindlichen Bruders hatte anpassen müssen, immer am Rande der Wüste; dieses Soldatenleben hatte die Amazone nur gestärkt.
Ob sie nach heißen, gefährlichen Tagen des Nachts in ihrem Zelt einen Liebhaber hatte, wissen wir nicht; die antiken Historiker und Dichter, fast alle von der Partei ihrer Gegner und deshalb voll von Bosheiten, berichten bis zu jener Zeit keine Liebesgeschichte der Kleopatra. Doch mögen sie ihr damit Unrecht tun: ihre einsame Lage, Klima und Abenteuer, ihre Reife und ihr Mund machen Aphrodite als einundzwanzigjährige Jungfrau unwahrscheinlich. Aber das kriegerisch Jünglinghafte ihres Wesens drängte in der Jugend alle Wollust in die Ecke: rasch griff sie nach dem, was ihr Blut begehrte, um es wieder abzuschütteln, Herz und Kopf blieben kühl. Da lag sie nun in ihrem Zelt, entschlossen, das große Ereignis durchzudenken: ihre Hauptstadt besetzt von einem Römer, dessen erste Bewegungen die Späher ihr seit ein paar Tagen hinterbrachten; ihr Mitregent, Bruder und Gatte, nur ein paar tausend Schritte entfernt, im befestigten Lager am Nil, mit Wasser und einem fruchtbaren Hinterland im Rükken, ihr weit überlegen; sie selber von ein paar tausend Wilden umgeben, deren Speere und Pfeile sie so lange schützten, bis ein reicher Heerführer kam und ihnen Geld bot, die flüchtige Königin in ihrer Mitte auszuliefern oder umzubringen. Ihr Bruder würde dem Rufe des Römers folgen; denn wie konnten seine Ratgeber wagen, dem mächtigsten Feldherrn, der jetzt ohne Rivalen das Weltreich darstellte, ein Heer von Abenteurern vor die Stirn zu stellen, die selber zur Hälfte römische Soldaten waren! Er wird nach der Hauptstadt eilen, den Fußfall tun wie sein Vater, Gold zahlen, und seine Truppen unter dem Befehle des Römers werden die ungehorsame Königin mit einem Handstreich nehmen.
Wie aber, wenn das nervöse Volk von Alexandria sich gegen den Fremden erhob? Nur mit 34 Schiffen soll er gelandet sein, konnte also keine 4.000 Mann mit sich führen, und ihr Bruder hat 20.000! Hielt man den Römer nur eine Weile hin, so konnte man seine Verstärkungen aus dem römischen Syrien zurückhalten. Hätten sie ihn nur gehindert, zu landen, die Schurken, die ihr König zum Schutze zurückgelassen! Aber er kam, so sagt der Bericht, stellte mit echt römischem Hochmut seine Liktoren auf mit Beil und Rutenbündel und zog durch die Hauptstraße ein, alles mit einer barschen Musik, mit finsteren Mienen, gleich hinter der Spitze der Feldherr selber mit einem goldenen Helm. Dann aber kam der Tumult.
Wie mag der Lärm begonnen haben? denkt Kleopatra und erinnert sich, was sie zu Hause früher gesehen. – Sicher hat irgendein römischer Emigrant zuerst gepfiffen, drei andere haben ein Schimpfwort hinübergerufen, dann haben sich dreißig aufgemacht, eine kleine Truppe abgetrennt und einen von diesen frechen Römern erschlagen. Dann haben sie zu schießen angefangen, der Pöbel wirft mit Steinen zurück, der Aufstand wächst, und der großmächtige Römer ist froh, den Palast zu erreichen. Nicht allzu schwer, von dort mit regulären Truppen die Bürger niederzuschlagen und zugleich zu versöhnen: Friede sei mit euch! Wir kommen als Verbündete des großen Ägypten! – Ah, wie sie alle Schliche kennt, in denen sich ein erschrockener Eroberer gefällt! Am Ende war es doch eine riesige Blamage für den großen Cäsar, daß er drei Tage nach seinem finsteren Einzug klein beigeben mußte!
Wenn sie jetzt im Palast säße, allein regierend, wie lange könnte sie Ägypten halten? Selbst wenn es ihr gelänge, den fremden Feldherrn zu ermorden, seine Flotte ins Meer zurückzustoßen – würden sie nicht mit all ihrer Macht herüberkommen und das Land ihrer Väter zur Provinz degradieren, wie es der Senat schon zweimal beschlossen hatte?
Da, wie um sie aufs neue zu versuchen, tritt ein neuer Bote in ihre Gedanken, in ihr Zelt. Sie ist aufgesprungen, sie reißt ihm seine Nachricht aus den Zähnen: der kleine König ist dem Rufe des Römers nachgeeilt, mit ihm General, Eunuch und Philosoph, das erbärmliche Kleeblatt; mit vielen Bücklingen haben sie dort den Einbrecher begrüßt, der den Wirt spielte und sie ganz höflich einlud, in ihrem eigenen Palaste zu wohnen, soweit er die Räume nicht selber brauche. Ordnung!, so hat der große Herr wiederholt gepredigt. Das Testament des verstorbenen Königs soll erfüllt werden! Die Armee sei natürlich zu entlassen, dagegen erinnere er an die Schulden des verstorbenen Königs, die dem Diktator Roms in barem Golde auszuzahlen wären. Wenn all dies geschehen ist, dann solle Frieden zwischen beiden Völkern herrschen, denn niemand denkt daran, Ägyptens Freiheit anzutasten.
Töten! Vergiften! denkt die vertriebene Königin, winkt dem Boten ab und fängt an, im engen Zirkel ihres Zeltes auf und ab zu gehen, die Hände auf dem Rücken, den Kopf halb gesenkt, bald nach oben geworfen, wie es der Lauf ihrer Gedanken fügt. Ist denn kein Ausweg mehr? – Ah, wenn man die 20.000 hätte, die die Schurken drüben befehligen! – Pothinus? Dieser Verbrecher – und sollte nicht auf Mord an dem Römer sinnen? Hat er nicht eben den Pompejus umbringen lassen? Warum nicht Cäsar? Sicher verneigt er sich nur so tief, um seinen listigen Blick dem Fremden zu entziehen. Gewiß, sie täuschen den Fremden, sie komplottieren! Eine erste Schlacht, einen Erfolg, und sei es für ein paar Wochen, könnte Achillas leicht erzwingen, dagegen sind die Römer zu schwach an Zahl, man kann ihnen auch das Wasser absperren.
Dann aber ist sie selber verloren! Dann wird sich ganz Alexandria erheben, um mit dem tapferen Sieger die feige Königin aus ihrem Hinterhalte hervorzuholen: dann ist es aus. Und sie erkennt, daß es nur eine Rettung gibt: mit dem Römer! Wer aber ist dieser Römer? Wer ist Cäsar?
Nun tritt sie aus dem Zelt, als suchte sie Luft und Licht, doch draußen ist plötzlich alles dunkel geworden, und der Nordwestwind, der im Herbst übers Meer kommt, ist kalt, sie friert, beinahe ist sie erschrocken vor dem Wind. Leise knurrend wie Wachhunde vor ihrem Herren, so liegen und rühren sich die Wachen an ihren Feuern im Kreise. – Was für ein Hundeleben muß man führen – denkt sie – durch all die Monate! Dort drüben im Westen des Deltas liegt ihr Palast, und in den zartfarbigen, seidenen Betten wälzen sich jetzt die Barbaren des Nordens. Sie aber, die Königin, fühlt den Sand in den Sandalen und weiß nicht einmal, ob nicht ein Verschworener hier beim Feuer liegt, um mit seinem Messer an ihrem Halse ein paar Goldstücke zu gewinnen. – Das Leuchtfeuer des Pharos sieht sie nicht, Palmen und Hügel versperren ihr den Blick, es ist ja auch zu weit bis zur Hauptstadt. Sie friert und kehrt in ihr Zelt zurück. Dort liegt sie jetzt mit aufgestütztem Arm, die Knie angezogen, nachdenkend, was morgen zu tun sei.
Wenn sie, wie es der Römer fordert, mit ihren Truppen nach der Hauptstadt rückte, was für ein klägliches Bild! Was wird es für Epigramme regnen unter den zynischen Alexandrinern, wenn ihre sagenhafte Armee vom Roten Meer ins Tageslicht moderner Mauern und Geschütze rückt! Die Römer werden lachen. Cäsar? Man sagt, er lächelt nur.
Aufs neue beginnt ihr Geist den Fremden zu umkreisen, der noch vor ein paar Monaten für einen Abenteurer galt, heute für den Herrn der Welt, vor dem Ägypten zittert und dessen Züge sie doch nie gesehen hat. Aus allem, was ihr Vater in seinen nüchternen Stunden ihr erzählt, was Agenten berichtet haben, hatte sie sich längst ein Bild gemacht, dem doch der Schlüssel fehlte, das Porträt, und wäre es nur auf einer armen Drachmen-Münze gewesen, die ihrem weiblichen Instinkte die Wege wies. Denn alles, was sie in dieser Nacht bei sich erwägt, geht auf Grad und Form, auf die Natur und Suggestionskraft einer Männlichkeit aus, an deren Eroberung jetzt ihr Leben hängt.
Aber was Freunde und Frauen, was Legenden, Partei und Verleumdung von Cäsar erzählten, ergab nichts als Widersprüche: großer Kenner der Frauen, doch schon Mitte Fünfzig; drei- oder viermal vermählt, doch immer ohne Söhne gewesen; sein Liebesleben stets sorgsam verhüllend und doch der erste Römer, der beim Tode seiner Frau die öffentliche Leichenrede hielt; ganz männlich und doch einem alten Klatsch in immer neuen Epigrammen ausgesetzt, als Jüngling habe er beim König Nikomedes geschlafen. Einmal, heißt es, ist er selber betrogen worden: Pompeja habe beim Dionysosfest mit einem frechen Kerl gebuhlt, der sich in Frauenkleidern zu den Priesterinnen schlich. Bei der Anklage erklärte Cäsar feierlich, an keine Anschuldigung zu glauben, aber er ließ sich trotzdem scheiden: Cäsars Gattin dürfe keinem Verdacht ausgesetzt werden.
Was für ein rätselhafter Mann! denkt Kleopatra weiter. – Groß ist er, das ist sicher, auch soll er eine sehr weiße Haut haben, so wie sie selber, sich viel waschen, sogar in der Schlacht, immer locker und nur oberhalb des Purpurstreifens gegürtet sein, und doch entschieden elegant; auf seinen Feldzügen soll er Marmorfliesen und Mosaikböden mitnehmen, überall vornehm wohnen, und doch ist er beim niedrigen Volke beliebt. Während die letzten römischen Matronen alter Schule ihre Töchter vor diesem Verführer warnen, umgibt er sich beständig mit schönen Jünglingen und soll für schlanke Sklaven so hohe Preise zahlen, daß er sie nicht ins Kontobuch einschreiben läßt.
Was für ein Mann ist also dieser Cäsar? Wer liebt ihn? Sonderbar: der Pöbel liebt ihn, Freigelassene und Handwerker, die kleinen Leute, denen er Korn schenkt und Gladiatoren vorführt. Einmal hat er sogar jeden Plebejer vor dem Fest umsonst rasieren lassen, womit er wieder ein paar tausend Wähler fing. Im Felde sitzt er bei den Soldaten, ißt ihre Grütze und redet sie wie Kameraden an. Wie er spricht? Mit einem tiefen, vollen Ton, nicht witzig wie die Tribunen, nicht glänzend wie Cicero, nur klar und natürlich. Was aber alle rühmen und was niemand versteht, das ist die Schnelligkeit, mit der er überall erscheint, die rasche Nachricht, für die er überall am Mittelmeer Läufer und Sklaven bestellt hat, das kurze Wort, das er durch die Lüfte zu werfen scheint: so schnell erreicht es seinen Ort und wird Befehl. Sie sagen, Cäsar sei der schnellste aller Menschen.