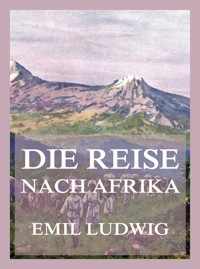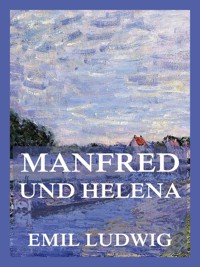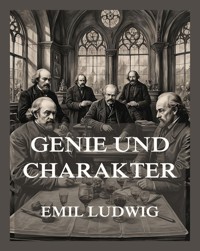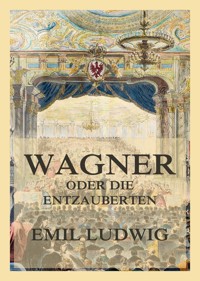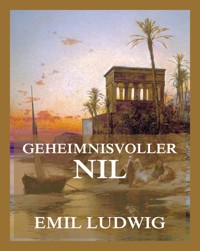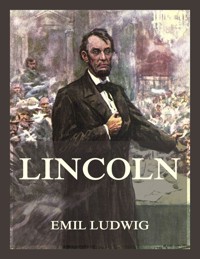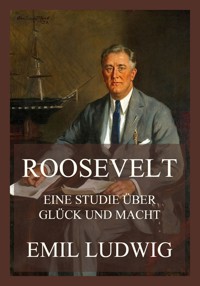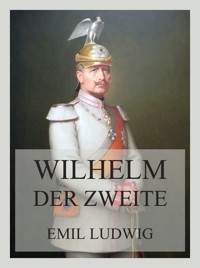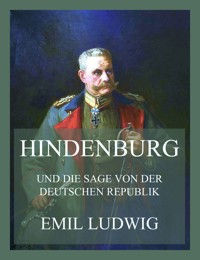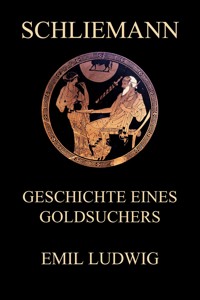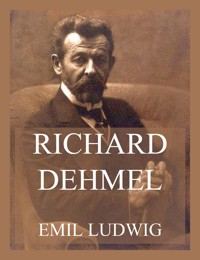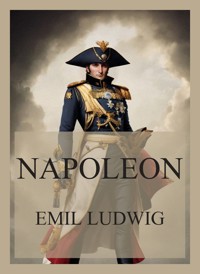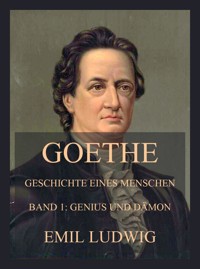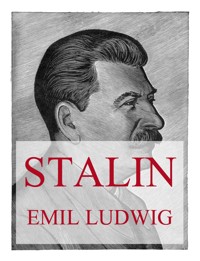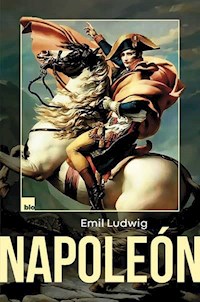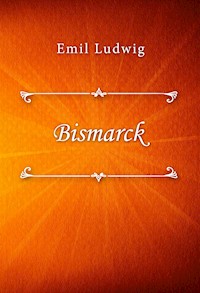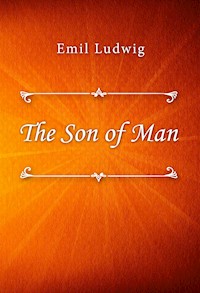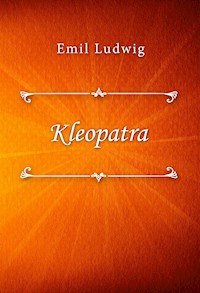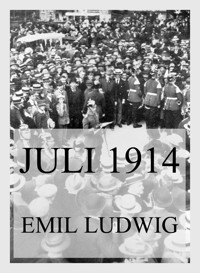
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Minutiös zeichnet der deutsche Autor Emil Ludwig die Ereignisse des Julis 1914 und ihre Auswirkungen auf die ganze Welt nach. Eine Reihe miteinander verbundener diplomatischer und militärischer Eskalationen zwischen den europäischen Großmächten führte letztendlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Krise begann am 28. Juni 1914, als Gavrilo Princip, ein bosnisch-serbischer Nationalist, ein Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger Österreich-Ungarns, und dessen Frau Sophie, Herzogin von Hohenberg, verübte. Ein komplexes Geflecht von Allianzen sowie die Fehleinschätzungen zahlreicher politischer und militärischer Führer (die entweder einen Krieg in ihrem Interesse sahen oder glaubten, dass es überhaupt nicht zu einem allgemeinen Krieg kommen würde) führten Anfang August 1914 zum Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den meisten großen europäischen Nationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Juli 1914
EMIL LUDWIG
Juli 1914, Emil Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663827
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
VORWORT.. 1
ERSTES KAPITEL. DAS ATTENTAT.. 4
ZWEITES KAPITEL. DIE KRIEGSGRAFEN... 14
DRITTES KAPITEL. DAS ULTIMATUM... 25
VIERTES KAPITEL. DIE ERSCHROCKENEN.. 35
FÜNFTES KAPITEL. DIE AUFGEREGTEN.. 40
SECHSTES KAPITEL. AUF SEE.. 48
SIEBTES KAPITEL. DIE BEDENKLICHEN... 53
ACHTES KAPITEL. DIE ERWARTUNGSVOLLEN... 61
NEUNTES KAPITEL. DIE PROTESTIERENDEN... 64
ZEHNTES KAPITEL. DAS EUROPÄISCHE KONZERT.. 76
ELFTES KAPITEL. DIE KLEINEREN... 102
ZWÖLFTES KAPITEL. DIE WAAGE.. 111
DREIZEHNTES KAPITEL. DIE BETROGENEN... 125
VIERZEHNTES KAPITEL. DIE LAWINE.. 142
VORWORT
Die Schuld am Krieg betrifft das gesamte Europa: das hat die Forschung in allen Ländern erwiesen. Deutschlands Alleinschuld und Deutschlands Unschuld sind Märchen für Kinder jenseits und diesseits des Rheines. Welches Land den Krieg gewollt hat? Stellen wir eine andere Frage: welche Kreise haben in allen Ländern den Krieg gewollt, erleichtert oder begonnen? Legt man statt eines waagerechten Schnittes durch Europa einen senkrechten durch die Klassen, so erkennt man: die Gesamtschuld lag in den Kabinetten, die Gesamtunschuld auf den Straßen Europas.
Denn nirgends hatte der Mann an der Maschine, in der Werkstatt, am Pfluge Wunsch oder Interesse den Frieden zu brechen, überall haben die unteren Stände den Krieg gefürchtet und bis zum vorletzten Tage bekämpft. Die Kabinette dagegen, die mit ihnen arbeitenden Stäbe und interessierten Kreise: Minister, Generäle, Admiräle, Kriegslieferanten, Redakteure wurden von Ehrgeiz und Furcht, von Unfähigkeit und Gewinnsucht vorwärtsgetrieben und trieben die Massen vorwärts. Je weniger Kontrolle eine Regierung dabei zu fürchten hatte, umso schwerer wiegt ihre historische Verantwortung. Darum sind mit der Schuld, die sich in Prozenten nicht errechnen lässt, Wien und Petersburg am stärksten belastet; Berlin und Paris folgen ihnen in sehr verschiedener Entfernung als Sekundanten; London folgt in viel weiterer Distanz.
Dies darzustellen ist umso weniger verfrüht, als hier nicht die wirtschaftliche und politische Vorgeschichte, sondern nur der Juli 1914 geschildert wird; hierfür sind die Dokumente nicht zu spärlich, sie sind zu reich: die Entstehung des letzten Krieges ist uns genauer bekannt, als die irgendeines früheren der Geschichte. Nur wer die Klarheit der europäischen Aussicht national trüben will, wirbelt immer mehr Staub aus den Akten. Schon 1921, als ich die folgenden Blätter, vier Jahre vor meinem Kaiserbuch, schrieb, war alles deutlich aus den Dokumenten abzulesen; ich ließ den fertigen Satz trotzdem auflösen, weil man den kaum vom Kriege erholten Parteien eine unparteiische Betrachtung noch nicht zumuten durfte. Seitdem war in wiederholten Überarbeitungen nur wenig zu verbessern, zu ergänzen.
Diese, wie jede historische Darstellung, besteht aus Dokumenten und ihren Deutungen. Als Dokumente dienen die überall verwendeten Farbbücher, ihre Ergänzungen, die Memoiren und andere anerkannte Quellen; nur sind die Gespräche der Staatsmänner, die sie ihren Regierungen meist in indirekter Form berichteten, unter sonstiger Beibehaltung des Wortlautes in den direkten Dialog zurückversetzt worden. Die Deutungen dagegen habe ich, um nicht durch Analysen zu ermüden, wiederholt in die Form von Monologen gebracht, in denen die handelnden Männer ihre Gedanken und Stimmungen schildern. Lesern und Kritikern sind diese beiden Arten der Darstellung durch verschiedenen Satz noch augenfälliger gemacht worden, indem alle Dokumente kursiv gesetzt und so Alle instandgesetzt wurden, sie von der Arbeit des Autors und seinen Meinungen zu unterscheiden. Das schien diesmal geboten, weil gewisse Historiker, die noch immer die Weisheit der damals verantwortlichen deutschen Staatsmänner einseitig zu erweisen suchen, meinen früheren, ihnen politisch unbequemen Darstellungen die Echtheit der Quellen bestritten haben.
Als Stücke aus diesem Buch 1928 in amerikanischen Zeitungen erschienen, wurde ich in der Heimat von jenem Teil der Presse verleumdet, der einst zum Kriege gehetzt hat und darum jetzt die Unschuld des Kaiserreiches propagiert; zugleich schrieb der Pariser „Figaro“, ich machte „leider keine Ausnahme von denen, die ihr Vaterland den Folgen der Niederlage entziehen möchten“, denn ich hätte durch Stabilisierung einer Gesamtschuld die Basis des Versailler Vertrages angetastet. So wird von zwei Seiten jeder attackiert, der einer übernationalen Gerechtigkeit nachstrebt.
Dies Buch ist eine Studie über die Dummheit der damals Mächtigen und den rechten Instinkt der damals Machtlosen. International wird hier erwiesen, wie eine friedliche, fleißige, vernünftige Masse von 500 Millionen von ein paar Dutzend unfähiger Führer durch gefälschte Dokumente, durch Lügen von Bedrohung und vaterländische Phrasen in einen Krieg gehetzt worden ist, der nichts von der Notwendigkeit des Schicksals an sich trug. Wirtschaftskrisen, Konkurrenz- und Kolonialfragen hatten die Lage Europas kompliziert, und doch war der Krieg wiederholt vermieden worden; drei fähigen Staatsmännern wäre abermals gelungen, was die große Mehrheit wollte. Lüge, dass ein einziges Volk als solches den Krieg gewollt hat oder dass es ihn heute will! Die Form des modernen Krieges hat den Begriff der „kriegerischen Nation“ illusorisch gemacht: es gibt nur noch Verführer, die sich schützen, und Verführte, die fallen. Keiner jener Minister und Generale, die ihn angezettelt haben, ist an der Front gefallen. Wenn sich Europa nicht in einen neuen Krieg stürzen lassen will, so müssen alle Länder Gesetze annehmen, nach denen jedem beteiligten Minister die Gasmaske entzogen wird: dann wird man sich plötzlich vertragen.
Wo die Geschichte nicht als Vorbild wirken kann, sollte sie doch als Warnung fruchtbar werden. Das Bild des Juli 14 zeigt einen Erdteil, dessen Nationen ihren Führern vertrauten und gehorchten, weil diese keinem Zentralorgan verantwortlich waren; der Mangel an Kontrolle über die einzelnen Regierungen hatte zu einem anarchischen Ganzen geführt. Wir wissen, dass die Kriegstreiber Getriebene waren; dass sie sich treiben ließen, ist eben ihre Schuld. Eile, Zufälligkeit, Überraschung, vor allem die Furcht Aller vor Allen haben neben dem Versagen gerade dieser Diplomaten zuletzt einen Krieg erzwungen, den eine vernünftige Gesellschaft der Nationen verhindern konnte; dass er deshalb mit dem ersten Versuch einer solchen Instanz endete, war logisch und moralisch.
Dies Buch, das die friedliche Gesinnung der Massen aller Völker im Juli 14 beweist, will beitragen zum Gedanken eines Schiedsgerichtes, das nicht Utopie ist, sondern Realität wird, nicht unlösbares Problem bleibt, sondern unausweichliche Folgen der letzten Erfahrung. Seit Europa de facto nur noch aus Republiken besteht, kann es sich leichter vor Katastrophen schützen.
Es bleibt ihm nur die Wahl, dies bald nach neuen Kriegen am Ende doch zu tun.
ERSTES KAPITEL. DAS ATTENTAT
Im Mittagslicht brannte die breite Terrasse. An der untersten Stufe wartete der Wagen, hinter unbeweglichen, höfisch erzogenen Pferden, auf dem Kutschbock der unbewegliche Mann im Dreispitz; vier Lakaien flankierten die Treppe aufwärts. Groß und weiß sperrten drei Flügeltüren ihre Schlünde, um die Junisonne in den roten Salon des Belvedere-Schlosses in Wien zu lassen, den der Herr des Hauses von seiner Kapelle her durchschreiten musste.
Da flogen im Schloss die Türen, es rasselte, stampfte, trappelte, rief, Kinderfüße neben Mannestritten: jetzt steht der Erzherzog selbst hinter der Mitteltür. Die massige Gestalt in Generalsuniform gepresst, das Auge wunderlich verschleiert, scheint er wenig zu sehen, wie einer, der aus dem Dunkel der Kirche und aus der Inbrunst einsamen Gebetes plötzlich vortritt, geblendet von Sonne und Welt.
Eine kräftige Frau steht neben ihm, den Arm hat sie leicht in seinen eingehängt, drei hübsche Kinder warten auf den Abschiedskuss, und so stehen sie im Rahmen der weißen Pforte, ein Bild des einfachen Glücks und Schicksals der Menschen, auch der Mächtigsten.
Franz Ferdinand blickt in diesem Augenblicke nieder auf seine künftige Hauptstadt Wien, ungewisse Gedanken kreuzen sich im seinem Kopf, ehrgeizig-skeptische. Unter den geschnittenen Hecken, den geschweiften Fontänen, Pyramiden und Dreiecken lebender Stämme, dort hinten, rauscht eine Weltstadt hinauf zu dem Schloss, in dem er wartend lebt. Wieder steigt vor seinem Blicke gerade aus den Häuserblöcken die hohe Schulter und der steile Turm des alten Doms, aber zur linken schwingt sich in aufgelöster Bläue die elegante Kette der Berge und Kogel. Er wendet sich, umarmt Sophie, die ihm bald auf die Reise folgen soll; alles ist vorbereitet. Jetzt lächelt er, was seinen dunklen Ausdruck mildert, nun drängen sich auch die Kinder heran. Wie abwesend küsst er sie: jedes Vorgefühl eines ewigen Abschieds erspart ihm das Schicksal. Rasch in den Wagen, durch Schlosstor, vorbei an der lächelnden, steinernen Sphinx.
Wer ist der Mann, der jetzt nach Süden weist? Quadratisch, doch nicht eigentlich brutal, sitzt der massive Kopf auf männlichen Schultern, merkwürdig unösterreichisch scheint dieser weder elegante noch schmierige Mann, und gar nicht habsburgisch.
Nichts ist liebenswürdig an ihm, wenig liebenswert, alles schwer, trotzig: Stirn, Haaransatz, Schnurrbart. Hier ist der Ausdruck eines Menschen, der Schweigen und Leiden lernte, herrisch und trotzig ist, der die Menschen verachtet und auch die Welt nur als Eisen auf seinem Amboss achtet, eines gewaltsamen, furchtlosen Menschen. Aber sein Auge, dunkel und groß schwimmend, verrät eine Weichheit, die er sich nicht gestehen will, verrät in der Liebe plötzliche Hingabe, Schwermut. Auch seine Frömmigkeit scheint echt zu sein, sein Geiz freilich nicht minder. Fröhlich kann man sich diesen Kopf schwer vorstellen, zwischen Machtwillen und Verachtung gestellt, scheint er schicksalsvoll bestimmt von beiden. Es ist der Kopf eines Moriturus.
Jetzt ist er 50 Jahre, ist gefürchtet und mächtig, aber das Leben, das hinter ihm liegt, war doch nicht reich. Hass und Eifersucht der kaiserlichen Vettern erfüllten seine Jugend. Als er zwanzig war, suchten die Durchlauchtigsten Erzherzöge, die an nichts zu denken hatten, als wer in der Thronfolge am genehmsten wäre, den rauen Menschen loszuwerden: man zwang ihn zum Verzicht auf die Krone, er sei leidend, ein Todeskandidat. Dann machte sich Otto, der an seine Stelle trat, durch wüstes Leben frühzeitig krank, er aber, Franz Ferdinand, gesundete und wurde zum Ärger des Erzhauses doch wieder Thronfolger. Wie sie nach Macht hungern; wie sie herrisch und kalt, können sie schon den Tod nicht überwinden, ihn wenigstens zeitweilig zu benutzen suchen!
In diesem Habsburger lebte ein Stück Phantasie. Die Liebesgeschichten, mit denen müßige Prinzen ihr leeres Leben aufzuputzen trachten, der Zug dieser dekadenten Familie nach Erfrischung durch Liebschaften aus dem Volke, die Mode dieser Erzherzöge, Abenteuer zu sammeln, wie Hunde oder Stöcke, scheinen dem Mann mit dem quadratischen Kopfe fremd; er träumt von einer Ehe aus Liebe und ist entschlossen, sich seine Vorstellung vom Glücke nicht durch den eigenen Ehrgeiz verstellen zu lassen. Er sucht sich eine Gräfin aus, die will er heiraten, von ihr will er seine Kinder.
Jetzt sind es gerade 14 Jahre, da kämpfte er mit dem siebzigjährigen Kaiser um seine Sophie. Der sagte Nein. Rudolf, sein eigener Sohn, hatte sich um eine Frau umgebracht, die er als Thronerbe nicht heiraten durfte, und jetzt sollte irgendein Neffe, den er nicht leiden konnte, ihm samt dem Erbanspruch auch noch eine kleine Adlige oktroyieren und die legitime Reihe der Kaiser durch irgendein minderes Blut verderben? Aber der Neffe gab nicht nach, hartnäckig und hasserfüllt, wie er vor dem Alten stand, blieb er bei seinem Willen, wohl wissend, dass man ihn ein zweites Mal nicht loswerden konnte.
Schließlich stand er doch, zwei Tage vor seiner ertrotzten Hochzeit, in der kleinen Ratsstube der Hofburg und schwor vor Kaiser und Reich für jedes Kind, das er mit der böhmischen Gräfin erzeugen würde, im Voraus Habsburgs Erbfolge feierlich ab. Erschütternder Augenblick für einen Mann, den Frömmigkeit, Einsamkeit, vielleicht Sentimentalität zur Ehe drängte, und nun muss er die Sprossen dieser Ehe aus ihrem Rechte verstoßen, ehe sie erzeugt sind!
Musste mit jedem Jahre der glücklichen Ehe der Wunsch in ihm sich nicht steigern, die Kameradin, deren Kinder ihn herzlich liebten und die gut anzuschauen waren, auf Umwegen am Ende doch zu legitimieren? So setzte er durch, dass sie Herzogin wurde, und suchte unter ebenbürtigen Fürsten ein Vorurteil zu bannen, das ihn doch selbst in anderer Gestalt noch überall umfing. Nach Jahren erlebte er den Triumph, dass selbst die deutsche Kaiserin seine Frau empfing. Wilhelm Il., der große Verbündete, von dessen Stimmung die Staatspläne Franz Ferdinands abhingen, war immer artig zu Sophie gewesen, und wenn sich die Freundschaft der beiden, ziemlich gleichaltrigen Männer nicht gerade darauf gründete, so wäre sie doch bei Brüskierung der Herzogin durch den Kaiser unmöglich gewesen. Das dankte der Erzherzog dem Deutschen Kaiser, gerade weil Franz Joseph, starr und unbeugsam, zu Haus an seinem Zeremoniell festhielt und seine Nichte beim Hofzirkel hinter die letzte Durchlauchtigste verbannte.
Und doch erfüllte den Erzherzog, in seiner Hingabe und seinem Trotze, kein Wunsch stärker als eben der, seine Frau zur Kaiserin, seine Kinder zu Thronfolgern zu machen. Lange genug ließ ihn der alte Herr warten: jetzt war er über Achtzig.
Darum waren heute und morgen wichtige Tage für ihn: die Frau, die ihm nach Serbien nachreisen würde, wollte er nach Inspektion des XV. und XVI. Korps nach Sarajewo führen: auf dem Balkon der Monarchie, nicht bloß in Bukarest und Berlin, sollte Sophie in diesen Tagen zum ersten Male feierlich einziehen, die Gattin des künftigen Kaisers. Eine Überraschung, die er sich ausgedacht und deren Geheimnis vor seinen Wiener Feinden er sich noch gestern von Freunden hatte versichern lassen.
Unruhig schweifen Franz Ferdinands Gedanken zwischen persönlichem und Staaten-Schicksal. Wenn er an Kaiser Wilhelm denkt, so hält er sich an den streng monarchischen Grundzug seiner Ideen und verehrt in dem mächtigsten Freunde einen Legitimismus, den er in seiner eigenen Ehe erschüttert hat. Auch als Jäger imponiert ihm der Kaiser, denn beide jagen nicht, wie Franz Joseph, tagelang nur ein Tier, die schwer zu fassende Gämse; sie freuen sich an der Strecke vor sie hingetriebenen Wildes und schreiten nach der Jagd die lange Front ab, als ob es Soldaten wären.
Übrigens halten beide einander mit Recht für friedlich. Als eine Zigeunerin dem Erzherzog weißagte, er würde einen großen Krieg entfesseln, lachte er sie aus: ihm stand der Sinn auf keinen Fall nach Sieg oder Lorbeer. Von innen her dies morsche Reich noch einmal festigen, das war sein Wunsch, und dafür hatte er einen Einfall. Den Ungarn, die er hasste, Siebenbürgen nehmen, Rumänien in irgendeiner Form der Monarchie annähern, den alten Wunsch der Tschechen erfüllen, in Prag sich krönen zu lassen wie in Budapest, den Dualismus in Trialismus, oder das ganze Reich, wenn nötig, aus fünf Teilen als Bundesstaat neu aufbauen: das war sein Plan.
Dafür musste man die Serben gegen die Bulgaren nach außen, gegen die Ungarn nach innen zu decken suchen, musste die treuen Kroaten vor Ungarns Spitzeln retten und mit Vorsicht die verwandten Stämme so scheiden, dass sich die Slawen im Lande zu wohl fühlten, um weiter nach außen zu streben. Franz Ferdinand war Freund der Serben, und wenn er jetzt an ihre Grenze fuhr, so durfte er für sich und seine Frau freundliche Mienen erhoffen.
*
Weiß glänzen die niedrigen Häuser von Sarajewo, von flachen Dächern prallt Himmelsbläue, bunt strahlen Feströcke und Kleider der Bosniaken, die sich im Mittagslichte tummeln, von weit her in die Stadt geeilt, begierig auf den fremden Fürsten, der bald Landesvater heißen soll. Alles rauscht durcheinander, heute ist ein Doppelfest: zu den Bosniern kommt Österreichs Thronfolger zu Gaste, die Serben aber unter ihnen feiern den Tag, an dem vor fünf Jahrhunderten ihre Väter in der Schlacht auf dem Amselfelde vernichtet wurden eine Nation, die ihre größte Niederlage als furchtbare Mahnung in Reden und Liedern feiert, immer neu.
Dies Jahr aber, zum ersten Mal, ist es ein Auferstehungstag geworden, denn nun haben sie Türken und Bulgaren endlich geschlagen, und jene Hunderttausende, die Österreich zwingt, seine Untertanen zu heißen, weil Aehrenthal vor sechs Jahren die beiden okkupierten Provinzen raubte, Bosnien und die Herzegowina, Fleisch von ihrem Fleische, sie fühlen verdoppelten Groll, weil heute der fremde Kronprinz seinen Anblick als Zeichen der Herrschaft ihnen aufzwingen will, samt seiner Frau, die droben in Wien nicht für voll gilt. So haben’s diesen Bürgern und Bauern Advokaten und Agenten erklärt.
Auch Pfaffenrede wühlt heute lebendig und verwirrend in den aufgeregten Herzen dieses religiös gemischten Volkes, durch die überfüllten Straßen ihrer Hauptstadt. Römisch beten und beichteten die Kroaten, orthodox nur die Serben im Lande, und seit J ahrzehnten fragt sich’s auch hier, was stärker sei, Religion oder Rasse: im Glauben halten sie zu Westeuropa und so zu Österreich, im Blut zu ihren serbischen Brüdern. Heute werden wir ihn befragen denken die bunten Kroaten wenn er beim Festmahl im Konak ein paar Gläser intus hat von dem süßen Schweren: ob man uns weiter von Budapest aus wie eine Horde Diebe behandeln soll, oder ob man sich nicht in Wien erinnern möchte, an unsern Jellachich, der sein blutendes Schwert auf den Stephansaltar legte und Österreich rettete vor den rebellischen Ungarn!
Wie viel Fremde heute in der Stadt sind, denkt der Polizeichef, ein ungarischer Doktor, durch die Straßen fahrend, und schweigt. Da der Besuch „rein militärisch“ bleiben sollte, wird der Schutz den Truppen überlassen; Zivilpolizei, im Ganzen 150 Mann, hat nur für Ordnung zu sorgen wie jeden Tag. Wie wenig Soldaten man sieht, denkt der Polizeichef und schweigt. Was wohl der Minister in Wien denken mag, wenn er nicht für Sicherheit sorgt? Aber der Gouverneur hat auch nichts Besonderes befohlen: Truppen, sagte er, könnte er nicht gut als Spalier aufstellen, denn der Erzherzog kommt ja mit Gemahlin, und so wär’s eigentlich ein Thronfolgereinzug.
Rasch passieren vier Autos die Vorstadt, man hört von weitem Zivio rufen, fröhlich, nicht wild. Jetzt biegen sie in den Appel-Kai ein, im ersten Auto Regierungskommissar und Bürgermeister, im zweiten das Thronfolgerpaar, rückwärts Potiorek, Gouverneur von Bosnien und Herzegowina, neben dem Chauffeur ein Graf Harrach, der Besitzer des Wagens, vom Autokorps. Im dritten und vierten Gefolge. Da staut sich die Menge, das Rufen schwillt an: an der äußersten Grenze seines Reiches fühlt sich der Erzherzog begrüßt, an der umstrittenen Wetterecke, und neben sich weiß er die Frau und sieht sie wie eine Kaiserin dem Rufen danken. Der Augenblick berauscht ihn leicht: um ihretwillen, und weil er seinem jahrelangen Wunsch Erfüllung ertrotzt hat. Man nähert sich dem Rathaus.
Plötzlich, um halb Elf: Knall wie von einem Gewehrschuss, rechts vom Auto, ein kleines Ding fällt hinter dem Paar an den Wagenschlag, prallt zurück: erst als das nächste Auto passiert, platzt mit dem Knall eines Geschützes die Bombe.
Alle Wagen halten. Zwei Offiziere des Gefolges sind verwundet. Der Erzherzog schickt Hilfe, man schafft den schwer verwundeten Oberstleutnant in ein Hospital. Inzwischen ist der Attentäter über die Miljacka-Brücke gerannt; man rennt ihm nach, fasst ihn am anderen Ufer; es ist ein österreichischer Serbe, der junge Schriftsetzer Cabrinovic. Nach zehn Minuten fahren alle weiter.
Rathaus, Empfang durch die Stadtväter; bleich herrscht sie jetzt die Zornige an: „Hier werden die Gäste also mit Bomben empfangen?“ Niemand antwortet. Entsetzt hält der Bürgermeister seine Rede, unrührig hört man sie an. Wie der Erzherzog antworten will, bemerkt er, dass seine Stimme zittert, zwingt sie zur Festigung. Seine Frau empfängt die Frauen der Spitzen. Fühlt sie, fühlt er nicht, wie lächerlich diese Szene, von der sie aus Grundsatz so viel erwarten durften, sich nun in kleinbürgerlicher Wirklichkeit abrollt? Dazu also Gefahr des Lebens, der man um ein paar Zoll kaum entging, damit in diesem niedrigen Hause, das mit ein paar Teppichen mühsam sich festlich gebärdet, zwei törichte Reden aufklingen?
Sie treten heraus. Stärker applaudiert die Menge. Graf Harrach fragt erstaunt den Gouverneur:
„Haben E. E. Kein Militär zum Schutze S. K. Hoheit befohlen?“
„Glauben Sie, Herr Graf, Sarajewo ist voll von Attentäter?“ erwidert spitz der Gouverneur.
Bleich, schwer beherrscht, ändert der Erzherzog das Programm, will allein ins Hospital, um nach dem Verwundeten zu sehen, die Frau soll in den Konak vorausfahren, wo das Déjeuner wartet. Doch sie besteht darauf, ihn zu begleiten; stumm gibt er nach. Man beschließt zur Vorsicht einen anderen Weg zu wählen als vorher. Der junge Graf Harrach, der Besseres nicht durchsetzen konnte, will auf dem linken Trittbrett neben dem Erzherzog stehen. Der ruft ihm unwillig zu: „Lassen Sie doch diese Dummheit!“ Wie vorher, nur schneller folgen einander die vier Wagen.
Die Menge ist stärker, unruhiger, sie schreit Zivio, doch erst, als eine alte Frau auf Tschechisch Nazdar! ruft, lächeln Sophies bleiche Lippen. Bei Beginn der Franz-Joseph-Straße, die auf dem ersten Wege lag, hatten die Leute, immer alles ohne die Polizei, den Weg zur Durchfahrt freigelassen.
„Durch einen fatalen Missgriff“ biegt jetzt das erste Auto an der Ecke in die Straße ein. Hierdurch getäuscht, folgt der zweite Chauffeur. Der Gouverneur aber, der eben die spitze Antwort gab, Potiorek, der für alles verantwortlich ist, ruft ihm den Irrtum zu, heißt ihn am Kai weiterfahren. Dadurch kommt das Auto dem rechten Trottoir ganz nahe, während der Chauffeur sein Tempo verlangsamt.
Plötzlich fallen von der rechten Straßenseite, keine drei Meter entfernt, zwei Schüsse. Niemand scheint verletzt. Der Gouverneur, der zu spät bemerkt, dass Sarajewo voll ist von Attentätern, ist aufgesprungen und heißt den Chauffeur wieder rückwärtsfahren, um eine andere Brücke zu erreichen. Bei dieser Bewegung fällt die Herzogin gegen die Brust ihres Mannes. Der Gouverneur hört, wie beide Gatten ein paar Silben murmeln. Jetzt kommt es dem Manne erst zum Bewusstsein, vielleicht sei etwas geschehen.
Doch der Erzherzog sitzt aufrecht. Das Gefolge ist herbeigelaufen. Noch bemerkt niemand, dass er getroffen ist, auch bei der Frau glaubt man an Ohnmacht. Da quillt Blut aus seinem Mund, er sinkt schief halb um, man öffnet die Uniform: rechts am Hals aus der großen Schlagader schießt jetzt das Blut über den grünen Generalsrock, über die Kissen des Wagens.
Die Herzogin, die an ihn gelehnt saß, als hätte sie sich zu ihm geflüchtet, ist ohne Bewusstsein, doch sieht man keine Wunde. Fahrt zum Regierungsgebäude. Sie werden hinaufgetragen neben den Saal, wo die Champagnerflaschen kühlen. Ärzte finden sie am Unterleib zerschossen, ihn durch die Schlagader verblutend. Ein Franziskaner gibt ihnen zusammen Absolution, dann kommt der Erzbischof, der ihn gewarnt hatte. Nach einer Viertelstunde ist er tot, Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, Thronfolger in der Habsburger Monarchie. Ein paar Minuten vor ihm Sophie, Gräfin Chotek, Herzogin zu Hohenberg, der einzige Mensch, den der Menschenfeind anerkannte, und gerade diesem versagte sich die Mitwelt. Ihr galten vielleicht seine letzten Silben, ihm die ihren: Niemand hat sie verstanden. Niemand betrauert ihn. Nur die Kinder weinen im Schloss Belvedere.
Inzwischen hatte die Menge den Mörder ergriffen. Rasch hatte er Zyankali geschluckt, doch gleich wieder erbrochen. Er ist Gymnasiast, neunzehn Jahre, Serbe von Nationalität, Österreicher der Staatsangehörigkeit nach. Doppelt symbolisch ist sein Name: Gabriel Princip. „Verkünder?“ Warum Verkünder? Und welchen Principes Verkünder?
*
Drei Stunden später näherte sich in der Kieler Bucht ein Motorboot der Kaiserjacht „Hohenzollern“. Kaiser Wilhelm, als Admiral, stand an Deck unter dem Sonnensegel und leitete das Rennen. Wandte er den Blick etwas östlich, so sah er ein paar schwarze Schiffe ihren Schattenriss vor die Sonne werfen, sie trugen den Union Jack. Auch Churchill, der Marineminister, wollte mit diesen englischen Schiffen kommen, die seit 19 Jahren zum ersten Mal wieder auf der Kieler Woche erschienen waren, doch Tirpitz hatte sich gewehrt, „mit diesem Abenteurer sich an einen Tisch zu setzen“. Der Kaiser vermisste den Engländer nicht, ihm war schon zu viel, was ihm sein Botschafter gestern von Englands Friedensliebe vorerzählt hatte. Briand, ja, den hatte er erwartet, mit diesem Bürger von Paris wollte er gern reden, durch den Fürsten von Monaco hatte er ihn eingeladen. Aber der war ausgeblieben. Warum?
Vorsicht, Misstrauen zwischen den drei Ländern. Der kleine Italiener hielt sich auch immer mehr zurück. War noch auf jemand Verlass als auf den alten Herrn in Wien?
Jetzt hat das Motorboot die Schiffswand erreicht, man winkt nach oben. Der Kaiser winkt ab: man soll ihn ungeschoren lassen. Doch der Offizier im Boot gibt nicht nach, hält eine Depesche hoch, legt sie sinnfällig in ein Etui, wirft es an Bord, die Ordonnanz hebt sie auf, steht stramm vor seiner Majestät. Der Kaiser liest, was eben in Sarajewo geschah. Er beißt die Lippen, dann sagt er: „Jetzt muss ich wieder von vorn anfangen.“ Die Rennen werden abgesagt, die Kieler Woche ist aus. An Bord geht der Kaiser auf und ab, vielleicht denkt er:
Fürstenmörder! Mir waren diese serbischen Schweine immer widerwärtig! Keine Religion im Leibe! Wie dieser Peter aussah, damals, als ich die Ehre hatte! Durch Mord auf den Thron gelangt, da kann man kein Gefühl für seine Sendung züchten! Bei uns einfach ausgeschlossen! ... Kommt also gleich der kleine Karl an die Reihe. Vollkommene Null, aber streng legitim, also durch Artigkeiten schwer zu erfassen. Wenn man die gute dicke Chotek zu Tische führte, war Franz zu allem zu bringen... Man wird nach Wien fahren müssen. Aber wie wird denn da begraben? In die Kaisergruft kann sie unmöglich! Der alte Herr konnte ihn ohnehin nicht leiden. Eigentlich war er doch ein netter Kerl. Fünftausend Hirsche mit Mitte Vierzig: das ist doch 'ne Leistung! Nur gar keinen Sinn für was Höheres, Musik und Dichtkunst, die höchsten Güter der Menschheit, waren ihm langweilig und störend. Höchstens Antiquitäten. Leider auch keine Sprachen, manchmal plötzlich beängstigend still... Ob die Wiener Schritte tun, weil der Kerl Serbe ist? Keine Idee, diese Helden haben doch immer Angst... Telegramm!
Und er schreibt: „Mit tiefster Erschütterung empfing ich die Kunde von dem ruchlosen Morde...“
*
Wie war das möglich! Ruft Europa. Wehe den Verantwortlichen! Peinlich werden sie Rede und Antwort stehen!
Erstaunliches geschieht, Erstaunliches wird unterlassen. Wenige Tage dauert die Unterredung, sonderbar geheim verläuft sie. Soll hier jemand geschont werden? Was geschieht mit Potiorek, dem Herrn Gouverneur, der sich für Sicherheit verbürgt hat und nach dem ersten Knall noch beleidigt tat? Der zwischen den Schlachten keine Truppen zum Schutze seines Herrn befahl? Der an der kritischen Stelle, wo niemand rasch fahren kann, den falschen Weg erwischte, ihn korrigierte, rückwärtsfuhr und gar nicht bemerkte, dass Herr und Herrin längst verbluteten? Zwar verteidigen könnte er sich nicht, umso lieber lässt man ihn ungeschoren.
Was hat der Chef der Verwaltung auszusagen? Ritter von Bilinski, der wohl mehr wusste, als dem Erzherzog lieb war? Und wird sein Polizeichef nicht peinlich vernommen, dessen Leute „sechs oder sieben“ ihn bekannte Gestalten mit Bomben und Revolvern auf der Einzugsstraße stehen ließen, vor und nach der ersten Bombe? Kein Polizist wird gefasst. Stecken stärkere Mächte dahinter?
Der Stadthauptmann von Agram hat später nicht vor Gericht, also schwer kontrollierbar seinen Freunden anvertraut: Anfangs Juni erhielt er anonym eine Denunziation aus Belgrad, in der die Namen der späteren Attentäter standen. Diese gab er der kroatischen Regierung weiter, diese der ungarischen. Doch keine Antwort kommt von Budapest nach Agram, und so ist niemand befugt, den avisierten Mördern aufzupassen, als sie dann wirklich pünktlich über die Grenze kommen. Dazwischen erscheint der Agramer Jurist Dr. Gagliardi auf dem Polizeiamt mit dem gleichen warnenden Bericht. Auch auf dies Protokoll schweigt die ungarische Regierung.
Doch indem man die Einheimischen so brüderlich schont, das heißt, indem sie einander schonen, bleibt Zorn und Rache für die Serben frei, die als Nation an diesem Mord schuld sein müssen. Könnte man doch die Fäden bis nach Belgrad finden! so hofft man in Wien. Wäre doch wenigstens ein serbischer Minister verwickelt: endlich könnte man ihnen ans Leder! Finden Sie das Mögliche heraus! Ruft man am Ballplatz Herrn von Wiesner auf den Weg, der rasch am Ort der Tat die Akten studieren soll. Material. Herr Sektionsrat, gegen die serbische Regierung!
Der sucht und stöbert, was er kann; doch nach vierzehn Tagen kann er als ehrlicher Mann nur dies nach Wien drahten. Erstens: „Material aus der Zeit vor dem Attentat bietet keine Anhaltspunkte für Förderung der Propaganda durch serbische Regierung. Dafür, dass diese Bewegung von Serbien aus, unter Duldung seitens serbischer Regierung, von Vereinen genährt wird, ist Material wenn auch dürftig, doch hinreichend.“ Zweitens „Mitwisserschaft serbischer Regierung an der Leitung des Attentates oder dessen Vorbereitung und Beistellung der Waffen ist durchaus nichts erwiesen... Es bestehen vielmehr Anhaltspunkte, dies als ausgeschlossen anzusehen“. Drittens: „Ursprung der Bomben aus serbischem Armeemagazin objektiv einwandfrei erwiesen, doch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie erst jetzt ad hoc Magazinen entnommen wurden, da sie aus Vorräten der Kamitadschis vom Kriege stammen können. Sonstige Erhebungen nach dem Attentat geben Einblick in die Organisierung der Propaganda der Narodna Odbrana. Hier wertvolles verwertbares Material, das jedoch noch nicht nachgeprüft ist; schleunigste Erhebungen sind im Zuge.“ Der Bericht nennt als einzige, fast sicher Belastete: serbische Grenz- und Zollbeamte, einen serbischen Major und einen bosnischen Eisenbahnbeamten.
Politische Folgen sind also nicht zu befürchten: Kroaten und Ungarn sollen, Serbien von Rang können nicht bezichtigt werden.
Indessen werden die Mörder vernommen. Der eine, Cabrinowic, Sohn eines Österreichers in Sarajewo, hat die Führung übernommen, den jüngeren Genossen geschult und eingeweiht, die Waffen über die Grenze geschmuggelt. Mit mehreren anderen verschworen sie sich in Belgrad gegen das Leben des Thronfolgers.
War nicht der Tag wie ein Gleichnis? Der Einzugstag fiel auf das Datum, an dem ihre Väter einst von den Türken geschlagen wurden, doch zugleich ermordete damals der junge Milosch Obilitsch den sieghaften Murad und wurde Held der Nation, so dass noch heute Miloschs Name aus den Gesängen der Frauen und Männer wiederklingt. Ein zweiter Milosch werden und kostet es das Leben!
Princip, seit vier Jahren Gymnasiast in Belgrad, später den Nationalen Vereinen befreundet und so in großserbischen Ideen erzogen, ein junger Mensch mit dunklen entschlossenen Zügen, erklärt vor Gericht:
„Den Erzherzog hielt ich für unseren Todfeind: er wollte die Einheit aller Südslawen hindern!“ Darum hat er beschlossen, ihn zu töten, dann aber sich selbst, damit alles geheim bleibe. Jeden, der hineingezogen wird, verteidigt er, verweigert Namen, um andere zu schützen, hat nie Vorteil aus seinen Gedanken gezogen: frei wollte er sein Leben dem höchsten Wunsche seines Volkes opfern. Männlich, einfach, mit dem monomanen Idealismus eines Anarchisten tritt er auf. Nichts spricht gegen seine Gesinnung als die Tat, die er als einziges Mittel erkannt hat. Er wird zu 20 Jahren Kerker verurteilt. Nach drei Jahren dauernder Dunkelhaft geht er ein. Drei andere werden hingerichtet. Wiesners Bericht aber wird der Öffentlichkeit, wird selbst dem Bundesgenossen vorenthalten: die serbische Regierung muss schuldig bleiben.
Schwarz zieht und stürmisch Nebel über das Land; Fackeln werfen abenteuerliche Lichter über den durchweichten Weg, vor zwei hohen, schwarzen Wagen, in denen die Särge der ermordeten Gatten der Donau zuwanken. Sie wollen nach Artstetten, zu der vom Erzherzoge selbst gebauten Gruft. Lieber mit Sophie auf unserm Gut, als ohne sie in der Gruft der Kapuziner, hatte einst Franz Ferdinand gedacht, der diese Frau mehr liebte als den Ausdruck der Macht.
Mit einem Mal bricht ein furchtbares Gewitter los; man spannt ab, man wartet, man trägt die Särge zurück in die kleine Halle des Bahnhofs Pöchlarn. Wieder stehen sie kalt und schweigend nahe den Kisten und Koffern, als sollten sie die Ruhe nicht finden, die sie Tag um Tag suchten nach langer Totenreise. Spät erreichen sie die Donau, in schweren regengepeitschten Wellen schwillt sie vorüber.
Pöchlarn! wo einst Graf Rüdiger regierte. Und wie die Särge endlich auf schwarzer Fähre über die Donau schwimmen, plötzlich taucht Hagens Gestalt am Ufer auf, Giselher, Krimhild und Etzel sind zur Stelle, den Nachfahren nach tausend Jahren schweigend zu empfangen.
Hier, an derselben Donaubiegung, war einst ein Weltreich entstanden, weil zu Worms ein Schuldloser fiel.
ZWEITES KAPITEL. DIE KRIEGSGRAFEN
Tief in die barocken Lehnsessel versunken, schlanke Beine hoch überschlagen, in schmiegsamem hellgrauem Tuch: so sitzen zwei Grafen mittleren Alters in dem goldroten Arbeitszimmer des Wiener Außenministers. Durch die Hohen offenen Fenster steigt Lindenduft vom Volksgarten herauf. Anfangs Juli noch in Wien? Haben sie Staatsgeschäfte? Ja, sie verhandeln die Frage, ob man auch in gelber Rohseide oder nur in Grau gehen kann, Hoftrauer im Sommer ist immer fatal, und der schwarze Flor, den sie am linken Arm tragen, würde zu Gelb gar zu national-österreichisch wirken. In dem dumpf brütenden Gespräch versuchen beide einander den Eindruck düsterer Stimmung durch Etikettenfragen zu erwecken: in Wahrheit sind beide durch den Zwischenfall von Sarajewo freudig belebt.
Die Namen dieser k. u. k. Kavaliere? Sie sind lang, und die Geschichte wird sie nur Berchtold und Forgách nennen. Da wir sie aber in ihrem historischen Momente belauschen, gebietet geschichtliche Treue, sie vorzustellen. Leopold Graf Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratting und Pullitz, Minister des k. u. k. Hauses und des Äußeren der Vereinigten Königreiche und Länder: ovaler Kopf, etwas spitzes Kinn, feine Nase, ermüdete Augen, früh haarlos, kurzgeschnittener Schnurrbart um den sinnlich weichen Mund, zynisch-blass, einer der elegantesten Herren von Wien, Charmeur, wenn er will, charmant, wenn er muss, oberflächlich im Denken, leichtsinnig im Handeln, unsicher bei Entschlüssen, mit dem Ausdruck des übersättigten Welt- und Sportsmannes, der Pferde zum Rennen und zur Schlacht lieber züchtet als reitet, der überhaupt das Leben am liebsten von der Tribüne lenkt und darnach trachtet, um Hengst und General, Soldat und Traber nach seinen Ideen drüben starten zu lassen.
Der andere sieht männlicher aus, Typ des Husaren-Rittmeisters, brünett, Magyare. Auch ein schöner Name: Graf Forgäch von Ghymes und Gäcs, bis vor kurzem Gesandter der Monarchie in Belgrad, wo er im Friedjung-Prozesse auf gefälschte Akten hereinfiel, mit denen Österreich gegen seine Kroaten focht; also bewährt genug im diplomatischen Dienst, um jetzt Unterstaatssekretär seines Intimus zu sein, zugleich heimlicher außerordentlicher Gesandter Ungarns beim Grafen Berchtold. Er ist es, der den rasch ermüdeten Minister seit drei Jahren immer wieder aufscheucht: es muss etwas geschehen!
Voriges Jahr unter uns, große Blamage Berchtolds. Diese Scharte: Friede von Bukarest muss ausgewetzt werden: das ist der Grundgedanke des Ehrgeizigen Grafen. Damals wuchsen Land und Macht von drei Balkanstaaten, besonders Serbiens. Vor den Militärs ist man lächerlich geworden, die zweimal vergebens mobil gemacht haben; will man sich überhaupt noch im Amt und Ruf erhalten, dann ist Revision unumgänglich. Das Jahr vorher hatte Bulgarien den Serben Waffenhilfe auch gegen uns zugesagt, obwohl wir Bulgariens Freiheit überall stützten. Damals hatte Berlin aufgemuckt und die beiden nichtslawischen Staaten gegen uns geschützt, Rumänien und Griechenland. Zwei schwere Niederlagen des Ministers!
Jetzt ist der Augenblick zur Revanche! Ein Schlagwort braucht’s nicht, das alte goldene Wort Prestige genügt. Stehen nicht ohnehin fast nur serbenfeindliche Demokraten hinter der Judenpresse? Und wenn auch den Thronfolger kein Bürger leiden konnte, außer vielleicht in Tirol, wo ihn der päpstliche Segen populär gemacht hat, so wird doch der Schrei des beleidigten Volkes leicht zu machen sein: Österreichs Prestige ist nicht in Gefahr unter den meuchelmörderischen Serben! So wird der Ballplatz gefestigt, Iswolski knirscht, San Giuliano F pfeift leise durch die Zähne, und die Berliner, die uns immer schlapp schimpfen, reißen das Mail auf.
Alle Tage wachsen die inneren Gefahren: an allen Ecken und Enden Verzagtheit, Hass, Leidenschaft, Obstruktion, Sprachenverwirrung. Regierungsbeamte, die verhandeln statt handeln. Parlamentarier ohne Mut. Hinter der dünnen Intelligenz in den modernen Großstädten eine Riesenmasse schwerfälliger Bauern, die weder lesen noch schreiben können, an der Scholle kleben, in Siebenbürgen noch Bären jagen oder in Nordböhmen Arbeiter für die Fabriken liefern. Kramarz kann nur durch eine Kraftäußerung der Monarchie erfahren, dass sie noch lebt, aber mobil zum dritten Mal und dann nicht an den Feind? Dann gehen Gewehre im Innern los, und wir haben den Kladderadatsch. Also nichts mehr von diplomatischen Siegen! Jede Demütigung macht diese serbischen Banditen nur frecher. Entweder müssen wir ihnen ihre Schweine abnehmen, oder los! Seit Bukarest ist in Bosnien, wo beinah die Hälfte serbisch ist, nicht mehr zu atmen. Bilinski, der Pole, scheint auch zu stänkern. Den Rumänen mindestens an der neutralen Stange halten, Ferdinand sacht herüberziehen, wofern man Berlin