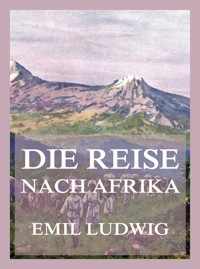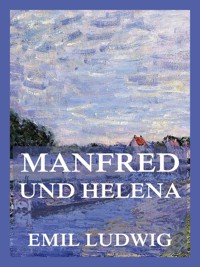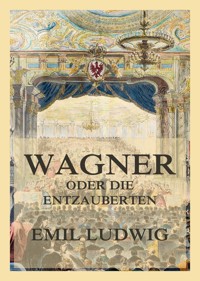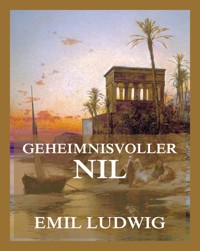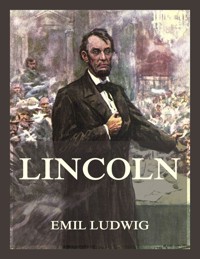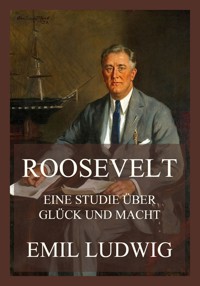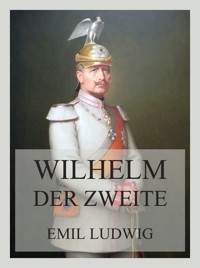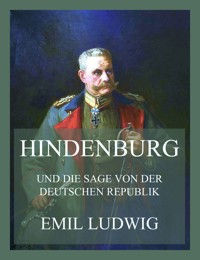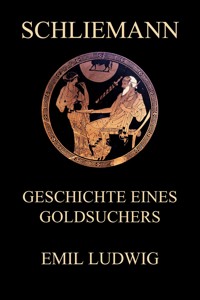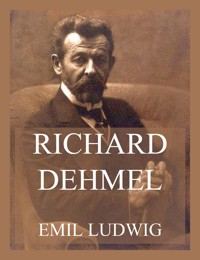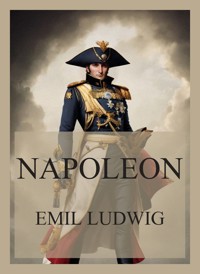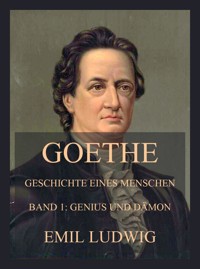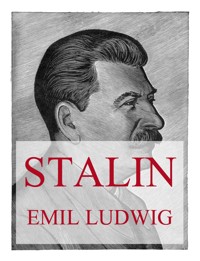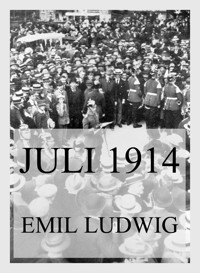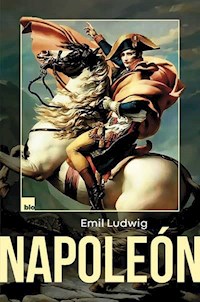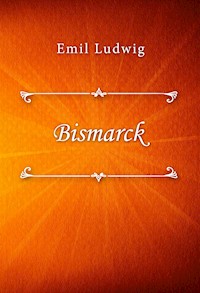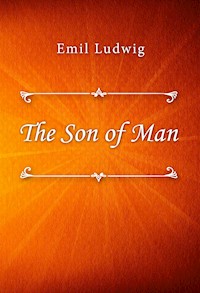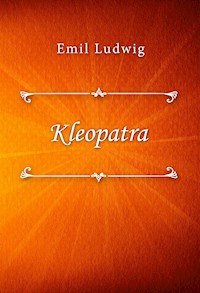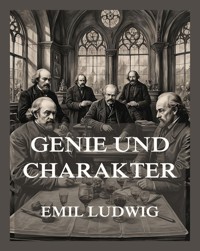
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Werk zeichnet Emil Ludwig biographische Skizzen der für ihn persönlich wichtigsten oder beeindruckendsten Personen der Weltgeschichte. Seine "Zwanzig" sind drei deutsche Staatsmänner, Friedrich der Große, Stein und Bismarck; drei Afrikaner, Stanley (der amerikanische Reporter-Typ), Peters, Rhodes (der Mann, der alles Wesentliche für seinen Zweck weiß und sonst nichts); drei moderne Staatsmänner, Lenin (mit Lloyd George der ausgeprägteste praktische Realist seiner Generation), Wilson (Vater eines posthumen Kindes, nämlich der Vereinten Nationen), Rathenau (ein Deutscher, der sowohl denken als auch handeln konnte, aber nicht fühlen); drei Künstler, Leonardo , Shakespeare (der verschmähte Liebhaber), Rembrandt (studiert in seinen vierundachtzig Selbstporträts); Voltaire (er lieferte seine eigene Charakterisierung, feiner als alles, was Ludwig entdeckt hat), Byron und Lassalle (Männer, die ihr eigener Zweck und Ziel waren), Goethe und Schiller ( "Schiller kämpft, Goethe wächst" ), Richard Dehmel ( ". . . dieser zur Ruhe gekommene Vulkan, der keineswegs erloschen war"); Bang; und der unerbittliche preußisch gewordene österreichische General Karl von Sendler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Genie und Charakter
EMIL LUDWIG
Genie und Charakter, E. Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680648
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
ÜBER HISTORISCHE GESTALTUNG.. 1
I. TEIL.. 6
FRIEDRICH II.6
STEIN... 12
BISMARCK.. 23
STANLEY.. 30
PETERS. 39
RHODES. 44
LENIN... 52
WILSON... 65
RATHENAU.. 82
II. TEIL.. 88
LEONARDO... 88
SHAKESPEARE.. 107
REMBRANDTS SELBSTBILDNIS. 112
VOLTAIRE.. 117
LORD BYRON UND LASSALLE.. 126
GOETHE UND SCHILLER.. 144
DEHMEL.. 166
HERMAN BANG... 172
BILDNIS EINES OFFIZIERS. 176
Über historische Gestaltung
Amor fati.
Der modernste unter allen Porträtisten ist jetzt grade achtzehnhundert Jahre tot, er hieß Plutarch und war, paradox genug, ein Böotier. Aber in Wahrheit war er Athener an Kultur, Franzose an psychologischer Verve, Engländer an Puritanismus, an Gründlichkeit ein Deutscher. Zur Zeit Trajans hat er die Grundsätze ausgesprochen und selbst erfüllt, denen wir heut wieder zu genügen trachten:
"Nicht Geschichte schreibe ich nieder, sondern Lebensschicksale; nicht in berühmten Taten liegt allein der Beweis von Tugend oder Schlechtigkeit; oft zeigt vielmehr ein kleiner Umstand, ein Wort, ein Scherz den Charakter besser als große Schlachten und Belagerungen. Wie der Maler vor allem nach Gesicht und Zügen die Ähnlichkeit bestimmt, worin sich der Charakter kundgibt, so gestatte man auch mir, mich an die Anzeichen des Geistes zu halten und durch sie dem Porträt seine Form zu geben, Großtaten aber und Kämpfe anderen zu überlassen."
Zu allen Zeiten haben große Männer den Plutarch geliebt, hier fand der Kenner des Menschen seine eigenen Motive, Fähigkeiten, Dunkelheiten wieder. Napoleon führte ihn durch 20 Jahre mit sich, er las am Abend mancher Schlacht in seinem Zelt das Leben Cäsars, und zugleich schrieb sein Todfeind, der Freiherr vom Stein, wie häufig "große Männer in der Jugend durch Lesen der Geschichte sich zu edlen Taten angefeuert, in reiferen Jahren deren Lehren benutzt, im Alter durch Rückblick auf ihr eigenes Schauspiel sich über das Erlittene beruhigt und gestärkt haben."
Nach einer Zeit, die den Menschen aus Abstammung und Erziehung zu bestimmen suchte, ist uns, der darwinistischen Welt Entfremdeten, die Persönlichkeit als solche, zeitlos beinahe, wieder Studium geworden: Maße, Spannung und Lähmung ihrer Lebenskräfte, Trieb zur Tat und Hemmung durch Gedanken, das wechselnde Fluidum ihrer Stimmungen. Während unsere Väter fragten, wie der einzelne mit der Welt harmonierte, fragen wir zuerst: harmoniert er in sich selber? Siege und Verantwortungen sind aus dem Milieu in die Seele des einzelnen zurückverlegt worden, so dass die Darstellung ins Innere zu dringen sucht, die früher der Sphäre gewidmet war. Auch das erneute Interesse an Memoiren ist ein biologisches, der Porträtist von heute, vor allem Psychologe, steht vielleicht dem Biologen näher als dem Geschichtsschreiber.
Umso freier ist er in seinen Formen. Er kann die dramatische Form benötigen oder den kurzen Essay, die mehrbändige Lebensbeschreibung oder den Leitartikel; alle diese Formen sollten ihm vertraut sein und je nach Objekt und Zweck der Darstellung von ihm ausgewählt werden; wie sein Bruder, der stumme Porträtist, Öl, Stift oder Kohle, Radiernadel oder Wasserfarben wechselweise benutzt.
In allen Fällen ist seine Aufgabe die gleiche, es ist die Entdeckung einer Menschenseele. Freilich baut der Porträtist auf dem rein wissenschaftlichen Biographen auf und bleibt immer sein Schuldner. Mit einer gewissen zynischen Naivität reißt er ihm mühsam erforschte Wahrheiten weg, um sie auf seine Art zu benutzen; ein Künstler, der die Beete einer Gärtnerei durchstöbert und, ist er fort, einen beraubten Garten dem grollenden Gärtner zurücklässt, doch in den Händen glüht ihm der schönste Strauß.
Denn wenn der Philologe mit seinem Studium beginnt, aus dem sich ihm allmählich das Bild des Menschen enthüllt, so hat der Porträtist mit der Vision seiner Gestalt begonnen und sucht aus den Akten im Grunde nur Bestätigungen seines inneren Vorgefühls. Wehe ihm aber, wenn er dabei zu phantasieren anfängt, wenn er Daten auch nur um Nuancen verschiebt, sich also dem Romancier annähert!
Denn der historische Roman ist immer ein unhistorischer Roman und darum das Schreckbild des echten Porträtisten. Wer schweift und erfindet, während er seine Gestalten mit historischen Namen schmückt, versündigt sich nicht bloß an der Gestalt, er verliert obendrein auch die Partie; denn Gott ist immer weise und überdies phantastischer als der Dichter und hat dem Lebenslaufe seiner Wesen stets eine tiefere Logik mitgegeben, als sie der feinste Konstrukteur erdichten kann. Wer nicht mit Anbetung vor der Notwendigkeit aller Lebensdaten des Menschen steht, sollte nie wagen, einen historischen Menschen nachzubilden; er mag nur immer in seinen Träumen schweifen!
Darum tut der Porträtist vor allem gut, nur den Menschen darzustellen, der tot und also, wie die Sprache sagt, vollendet ist, denn Zeitpunkt, Art und Umstände des Todes geben oft erst den Schlüssel zu allem Vorangegangenen; das Porträt eines Lebenden bleibt immer nur unter Vorbehalten richtig, wie ja auch unter den gemalten Bildnissen eines Menschen das Letzte –– die Maske des Toten –– immer das Wahrste bleiben wird, wenn auch keineswegs immer das Schönste.
Überhaupt geht vom Bildnis des Menschen meist die Vision seines Wesens aus, und die großen Porträtisten mit Pinsel oder Feder sind sämtlich große Physiognomen gewesen. Bildnisse, diese stummen Verräter, sind darum für den Biographen Materialien von demselben Wert wie Briefe, Memoiren, Reden, Gespräche, soweit sie der wissenschaftliche Vorgänger für echt erkannt hat, oder wie die Handschrift. Darum ist eine Biographie ohne voranstehendes Bildnis unmöglich.
So geht es auch mit den Gewohnheiten des Menschen: sie wurden früher wie Kuriosa eingefügt, kleine Bonbons für den Gaumen des Lesers; vollends die Anekdote wurde nur mit Fragezeichen, verschämt und gleichsam bei verdunkelter Forscherwürde überliefert. Uns anderen weist die kleinste Gewohnheit zuweilen die Richtung, um auf bestimmte Züge des Charakters zu stoßen, und die verbürgte Anekdote wird zum Epigramm.
Noch heute schließen wissenschaftliche Biographien zuweilen mit einem Kapitel, das den Helden "als Menschen" schildern soll; ein Anhang, wie die Tafel einer Schlacht oder das Faksimile eines Notenblattes. Was aber soll denn der Porträtist darstellen als eben sein Objekt als Menschen? Und welche andere Aufgabe ist ihm gestellt, als alle Taten und Gedanken, Wünsche und Motive dieses Menschen zurückzuführen auf nicht mehr teilbare Elemente der Seele?
Dies zu erfüllen, muss er freilich mehr als ein Kenner der Epoche, Kenner des Menschen muss er sein, Psycholog und Analytiker. Die Deutung einer Seele aus den Symptomen des Handelnden muss ihm geläufig sein, aus Intuition wie aus Erfahrung. Sicher sind in großen Diplomaten große Biographen versteckt; sicher könnten diese im Kreise der Diplomatie fruchtbar werden.
Doch auch Kenner des Genius muss der Darsteller sein, und eben hierin liegt die größte Schwierigkeit begründet. Dichterische Kraft ist Bedingung zur Erkenntnis und Darstellung eines Dichters, weltliches Leben zur Darstellung eines Weltmannes, politische Einsicht zur Darstellung des politischen, Kenntnis der Frauen zur Darstellung des erotischen Menschen; ein verwandtes Fühlen, mit einem Worte, ist Bedingung zur Darstellung genialischer Naturen. "Ich finde Gefallen in dem Gedanken", schrieb Vauvenargues, "dass, wer so große Taten versteht, nicht außerstande gewesen wäre, sie auszuführen, und mir erscheint das Schicksal ungerecht, das ihn darauf beschränkt hat, sie niederzuschreiben."
Wer seine Aufgabe in so großem Sinne fasst und entschlossen ist, in der Erzählung eines Lebenslaufes zugleich ein Exempel für das Wesen des Genies zu geben; wem sein Held nur immer eine Art von Beispiel bedeutet, um die Grenzen der Menschheit zu bezeichnen, der ist im Vorhinein jeder Gefahr der Parteinahme überhoben; er kann weder national noch sonst verblendet sein, parteilos steht er vor seinen Helden und ist, wie Shakespeare und Balzac, die Menschenschöpfer, durch keine sogenannte Weltanschauung begrenzt.
Hier liegt ein neues Problem: muss der Biograph kalt sein wie der Richter oder leidenschaftlich Stellung nehmen wie der Advokat? Uns scheint die rein platonische Darstellung salzlos und langweilig; doch auch die Forderung ist einseitig, man müsse seinen Helden von Grund aus lieben.
Auch hierin ist Plutarch Vorbild und Meister. Indem er immer einen Griechen in Parallele mit einem Römer stellt, kann er die Kunst des Abwägens und jede Freiheit von Vorurteilen erweisen. Immer erkennt er den Genius und bleibt vor ihm unbestechlich. Mit der Intuition des Dichters durchdringt er die Motive seines Helden, erspürt die Leidenschaft und wiederum die Freiheit als Motiv. Durch beinah unsichtbare Anzeichen, wenn sie nur schlagend sind, lässt er sich leiten, durch die sichtbarsten Daten lässt er sich nicht blenden. Den Charakter entwickelt er ohne Rücksicht auf das Genie, doch unversehens entfaltet sich dieses mühelos aus dem Charakter.
In dieser Kunst sind die Franzosen groß; unter den Deutschen ist sie vielleicht nur Goethe in seiner Psychographie Winckelmanns gelungen, die sich der Skizze eines Dramatikers nähert.
Dies sind die Vorbilder der folgenden Versuche. Man wird darin tätige und betrachtende, handelnde und bildende Menschen finden, alle genialisch, alle problematisch. Auf den Schnittpunkt dieser Eigenschaften kommt es an. Auch dort, wo sie im Politischen wirken und noch aus unseren Tagen stammen, wird der Versuch gemacht, sie von oben zu sehen, wie denn diese zwanzig Bildnisse, die sechs Jahrhunderten und neun Nationen angehören, nur durch ihre Seelenzustände, doch eben durch diese stark verbunden sind.
Aus Skizzen solcher Art können sich Vorbilder des Menschlichen entwickeln. Und eben dies ist hier der Sinn und Zweck. Dem Leser jeder Sphäre, besonders aber der Jugend darzustellen, wie große Männer keine Götter sind, wie sie von denselben allzu menschlichen Passionen, Hemmungen und Lastern geschüttelt wurden, die jeden andern Sterblichen beunruhigen, und wie sie dennoch sich zu ihren Zielen durchkämpfen: das ist unsere erzieherische Absicht. Auf diese Art spornt man den Menschen an, sich selbst, trotz allem, das Höchste abzufordern.
Eine andere Schule der Darstellung, mit der man auf Universitäten das Genie in seinem Werk aufzulösen strebt, während wir das Werk in der Persönlichkeit aufgehen lassen, bringt dem Leser den Vorteil eines Systems, das uns durchaus fehlt; sie hat dafür den Nachteil, nie als lebendiges Vorbild zu wirken. Was sich daneben in psychiatrischem Hochmute tummelt, wird nie einen vollen Menschen, stets nur seine verdunkelte Provinz beschreiben.
Wozu aber überhaupt Geschöpfe nachbilden, wenn nicht ein Vorbild, vielleicht auch eine Warnung daraus entsteht! Dies war zu allen Zeiten Sinn des Dramas; es sollte dem Porträtisten auch dann das hohe Ziel bedeuten, wenn er sich biographischer Formen bedient.
Doch dazu ist berufen nur, wer die Rhapsodie seines eigenen Lebens immer wie eine fremde vernimmt, wer in seinem Schicksal, auch wenn es unbewegt erscheint, ein Gleichnis noch des bewegtesten erfühlt: nur wer sich immer in der Menschheit spiegelt, ist geschaffen, Menschen nachzuschaffen. Er allein, der sein Leben als ein Gleichnis erlebt, ist reif, das Gleichnis anderer Menschen zu erfassen.
Denn wie er selbst Notwendigkeit in seinen Tagen spürt, so wird er mit Ehrfurcht in fremden Geschicken nichts anderes als Notwendigkeit erkennen und mit behutsamer Hand das, was geschah, aus dem verschlungenen Gewebe der Charaktere deuten, in denen Gottes Finger winkt.
I. TEIL
FRIEDRICH II.
"Die Kugel die mich treffen soll, kommt von oben."
Im Gleichgewicht beginnen manche Naturen ihre Bahn, dann werden sie von den Ereignissen beunruhigt und enden ohne Harmonie. Manche tragen von Anbeginn den Geist des Widerspruchs in sich, so tief, dass auch die glücklichste Entwicklung sie nicht heilen kann. Wenige sind es, die treten ein voll Unruh, Dunkelheit und innerer Spaltung, dann aber werden sie in ihrem Lauf von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewisser, werden klarer, bis sie am Ende ihrer Bahn zu jener Harmonie gelangen, für die sie die Natur vorausbestimmt.
Zu diesen zählt Friedrich.
Zwei Neigungen gefährdeten ihn: sein Hang zur Philosophie und zur Lebensform des Weltmannes.
Zwei Ereignisse reiften ihn: der Zorn des Vaters und die Folgen seiner Ruhmsucht.
Mit 16 Jahren war Friedrich nur ein zarter, hübscher Junge, die langen Locken wohlgekräuselt, mit einem Hang zu den Künsten der Frauen. Mit Recht schilt ihn der Vater effeminiert, denn auf preußische Throne gehört kein van Dyckischer Prinz. Nun kommt er an den Dresdener Hof, der Rausch, die Feste überfluten ihn. Früh sinnlich, schmachtend, weiblich, wie er ist, beginnt er mit einem Raffinement: sterblich verliebt er sich in ein älteres rassiges, heiteres Mädchen, die schöne Gräfin Orzelska, die man in Männerkleidern kaum erkannte. Doch als ihm dann auf einem Maskenfest eine andere Schöne, wenig verhüllt, hinter einem Vorhang gezeigt und angeboten wird, verlässt er die Gräfin. Von nun ab tanzt er leidenschaftlich.
Wieder in Berlin, wird er schwermütig und dichtet die ersten Liebesoden. Dies ist der Auftakt einer höchst unpreußischen Prinzenbahn. Mutig von Natur ist er keineswegs. Sein Vater schilt ihn, dass er sich so schmählich behandeln lasse, doch als er ihm anträgt, auf die Krone zu verzichten, um dafür seinen Neigungen zu leben, lehnt Friedrich entschieden ab. Es folgen zwei Versuche zur Flucht. Beide scheitern. War ihm zu wünschen, dass sie glückten? Was wäre aus ihm in England geworden, aus diesem haltlosen jungen Herrn? Sofern er zur Harmonie in reiferen Zeiten ausersehen war: hier musste der Unruhige straucheln und Strafe leiden:
Er schwört, nie werde er nachgeben. Zwei Monate später, in der Küstriner Zelle, schwört er: alles zu tun, was der Vater verlange, dem König wie ein Knecht zu gehorchen. Vor seinem Fenster wird der geliebte Freund, wird Katte hingerichtet. Er sieht's und zittert nur für sein eigenes Leben, misstraut dem Prediger, der ihm beruhigendes Wasser reicht, misstraut noch seinem Zuspruch, den er für letzte Tröstung vor dem Tode nimmt. Männlicher in jedem Betracht, kehrt er in Freiheit und Stellung zurück. Hier beginnt Friedrichs Verschlossenheit, sein Rationalismus. Auch Verlöbnis und Ehe nimmt er, bei allem Abscheu vor der Ausgewählten, gern an als Mittel zu größerer Freiheit. Da diesen geistigen, anomalen, den eigenen Vätern fremden Mann nie der Gedanke der Generationen erfasste, blieb er recht froh ohne Kinder und hat den Wunsch nach solchen, auch nach illegitimen, nie geäußert oder verwirklicht. Seine Unruhe hat andere Quellen.
Kredo des 20jährigen: "Ich bin all mein Lebtag unglücklich gewesen; vielleicht dass ein plötzliches Glück auf all den Verdruss mich zu stolz gemacht hätte. Es steht mir noch immer eine Zuflucht offen: ein Pistolenschuss kann mich von diesem Leben und Leiden befreien. Ich fühle, wenn man jeden Zwang so hasst wie ich, dann treibt einen das heiße Blut immer zum Extremen hin."
Die Jahre von Rheinsberg gelten für Friedrichs glücklichste Zeit. Es war nur seine ruhigste: ein 25jähriger nahm vorweg, was zwei Jahrzehnte später in Sanssouci dieselbe Lebensform zur Reife brachte. Ein junger Mensch, ganz unerprobt, sehr tatenlustig, nicht in der Lage abzusehen, wann er zum Handeln berufen würde, lässt sich von Knobelsdorff auf das Portal seines Landhauses meißeln: Federico tranquillitatem colenti. Lustschiffe auf dem See, er selbst als Liebhaber den Philoktet, den Mithridates spielend, spielerische Gründungen von Ritterorden, die den altfranzösischen Ritterstil erweckten, frühreife Aperçus bei Tische, Prachtausgabe der Henriade, Herbeiholung der neusten Schriften des Herrn von Voltaire aus Paris, von Friedrich "mein Goldenes Vlies" genannt, Abfassung schlechter Verse im Geschmack der Zeit: das ist alles.
Doch es sind Züge der Entsagung: aus Glücksbestreben sich zum Platoniker zu stempeln, da man vom Händeln ausgeschlossen ist. "Ich gehöre zur Klasse der betrachtenden Menschen, was sicher das Angenehmste ist." Man spürt die herrische Verschlossenheit. Das Angenehmste? Warum dann nennt er Verse und Weltweisheit nur "Trost" in schlimmen Tagen, nur "Berauschung im Glück"? Gehört zur Klasse der Betrachtenden, wer aus der gesamten Philosophie sich immer nur für praktische Ethik interessierte, die der Lebendige sich noch am meisten fruchtbar machen kann? Die Metaphysiker verachtet er und setzt sie mit gewissen chinesischen Geheimniskrämern in Vergleich, und als man ihm Wolfs Metaphysik übertragen hatte, nahm ihm einer jener exotischen Sonderlinge, die er in den Zimmern hielt, nahm ihm ein Affe die Arbeit ab und steckte das Werk unaufgefordert in den brennenden Kamin.
Machiavellis Buch vom Fürsten hat er ganz falsch verstanden, es war allein für jene Zeit geschrieben: ein italisches Vademecum um 1500, das niemand nach 200 Jahren im kalten Preußen widerlegen musste. Doch nicht zuerst aus ethischer Leidenschaft: aus Tatenlosigkeit, kronprinzlicher Langeweile ist der ",Anti-Machiavell" geschrieben, wie sein Verfasser später Voltaire gesteht. Man ist geneigt, seine Leidenschaft für dies pathetisch-zynische Genie als Signum seines Inneren zu überschätzen. Voltaire war für Friedrich nur die Blüte eines Geistes, einer Sprache, in die sich notwendig versenken musste, wer um 1740 Geist besaß.
Den Prinzen schützte vor Überwucherung des Literarischen sein Temperament, auf der Lauer.
Kredo des 27jährigen: "Ich fange endlich an, die Morgenröte eines Tages aufdämmern zu sehen, der meinem Auge noch nicht voll leuchtet." Ein andermal: "Es soll doch eine Lust sein, ganz allein in Preußen König zu sein!"
Mit 17 ein durch Zwang dämonischer, mit 27 ein durch Zwang platonischer Mensch. Die Synthese war ein König.
Nun endlich, frei von jeder Nötigung, brach Leidenschaft sich Bahn. Ins Erotische konnte sie sich nicht wenden: "Ich liebe das weibliche Geschlecht, aber meine Liebe zu ihm ist eine sehr flüchtige. Ich suche nur den Genuss, und hernach veracht' ich es." Sie wurde Ehrgeiz, wurde Ruhmsucht. Dieser Mann wird von der Glorie erfasst und hingerissen.
Wenige Monate ist er König: und schon benutzt er den ersten Anlass, Karls VI. Tod, um alte Forderungen auf Schlesien zu erheben. Kaum ahnt er, was er tut, –– was ganz Europa toll nennt: "Ich denke meinen Schlag am 8. Dezember auszuführen und damit die kühnste, durchschlagendste und größte Unternehmung zu beginnen, deren sich jemals ein Fürst meines Hauses unterfing." An den Freund Jordan: "Mein Alter, das Feuer meiner Leidenschaft, die Sucht nach Ruhm, ja Neugier selbst, um Dir nichts zu verschweigen, kurz, ein geheimer Instinkt hat mich aus der süßen Ruhe gerissen, und die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und dann im Buche der Geschichte zu sehen, hat mich verführt." Dies ist Friedrich, der von sich sagte, er könne sich einer Sache nicht halb ergeben, "ich muss immer kopfüber hinein".
Auf dem Kampfplatz erschrickt er vor dem, was er gewagt. Vor seiner ersten Schlacht, bei Mollwitz, ist er geflohen und erst nach 16 Stunden wieder erschienen, als alles vorbei und gewonnen war, er war noch kein Feldherr. Ein Schlachtenheld, einer, der die Schlacht als Steigerung liebte wie Napoleon, ist Friedrich nie geworden. Er hasste die Jagd und liebte den Tanz. Zu jener Zeit war er so wild, wie ein Kalender ihn darstellt, der ihn dem Rasenden Roland verglich. Alles sprengte durch. Die Macht, die endlich seine Faust umspannte, war er gesonnen, gründlich zu genießen.
Am Tage, in der Stunde der Thronbesteigung hatte er sich bereits als Autokrat erwiesen; der alte Dessauer fuhr zusammen. Friedrich war tolerant, doch hasste er die Menge. Kanaille, das war das Wort, das der aufgeklärte König gern gebrauchte. Eine burleske Leutseligkeit machte ihn spät populär. Er liebte nur seine Soldaten und seine Hunde.
Zwei überstürzten Kriegen folgte ein Jahrzehnt der Ruhe. In Sanssouci wurde Friedrich zum Fürsten. "Wenn Sie hierherkommen," schrieb er Voltaire, "so sollen Sie an der Spitze meiner Titel stehen: Friedrich, König von Preußen, Kurfürst von Brandenburg, Besitzer von Voltaire." Besitzer? Dies ist symbolisch, doch sicher nicht schön. Er sammelte Philosophen um sich, wie einst sein Vater Lange Kerle gesammelt hatte: als Liebhaber, doch nicht als Philosoph. Das war so auffallend nicht. Gab es damals nicht Philosophen, die Gesandte waren, und Fürsten, die über die Freiheit des Willens schrieben? "Ein Mensch, der die Wissenschaften pflegt und ohne Freundschaften lebt, ist ein gelehrter Werwolf. Nach meiner Ansicht ist die Freundschaft zu unserem Glück unerlässlich." Niemand lebte geselliger als er, –– als "Philosoph von Sanssouci" hätte er einsam leben müssen.
Freilich glich dieser Hof durchaus nicht dem in Rheinsberg. Nun war Friedrich der König, nun hatte er Macht vor sich, Ruhm hinter sich, nun hatte er Freiheit und Geld, nun war er — Herr, hochgebildet, genial –– gerüstet, einen Fürsten großen Stils darzustellen. Alles, was nicht den Staat betraf, betrieb er als Liebhaber mit den anderen im geselligen Stil des Rokokos: Briefe, Memoiren, Essays, das Flötenblasen selbst, das ihn zuweilen, wie er berichtet, zu neuen Gedanken angeregt, indem er es promenierend übte.
Dieser Autor lief sich selber nach: schon 1746 schrieb er die Geschichte seines zweiten Krieges, der 45 geendet hatte. Doch da er allmählich ein größerer Feldherr wurde als ein Skribent, kam seine Feder nicht mit. Als Weltmann schrieb er Französisch, jedoch so unorthographisch wie deutsch, und nicht nur die Rechtschreibung mussten Sekretäre ihm verbessern. Seine berühmten Worte sind fast durchweg deutsch gesprochen worden. Die deutschen Marginalien enthalten eine sehr ungewollt preußische Philosophie.
Doch Zeichen wunderbarer Reife sammeln sich allenthalben. Er errichtet eine Gruft für sich, überbaut sie mit einem schlanken Sockel, auf dem eine marmorne Flora ruht. Zu diesem Wahrzeichen von Tod und Leben blickt er täglich vom Fenster hinüber. Kredo des 35jährigen Märkers: "Ich liebe den Krieg um des Ruhmes willen, aber wenn ich nicht Fürst wäre, würde ich nur Philosoph sein. Schließlich muss in dieser Welt jeder sein Handwerk treiben."
Erst die schweren Folgen seiner ersten leichtsinnigen Unternehmung reiften den König. Nun erst, in dem Krieg von sieben Jahren, gewannen seine Gaben ihre höchste Form. Die großen Gefahren steigen auf, die tiefen Depressionen, die ihn klärten. Gleich im ersten Kriegsjahr hat er mehr Verse in 3 Monaten geschrieben als je im ganzen Jahr; so viel Entlastung brauchte seine Seele. Er gab sich auf (nach Kunersdorf), Thron und Leben gab er verloren und redete schon den Neffen als König an. Im Getümmel der Schlacht hatte er gerufen: "Gibt es keine verwünschte Kugel für mich!" Und nach Kolin, der einzigen Schlacht, in der Friedrich den Degen gezogen, sagte er zum jungen Grafen von Anhalt: "Wissen Sie nicht, dass jeder Mensch seine Schicksalsschläge haben muss?"
Berlin, Potsdam, Sanssouci fällt in die Hand der Feinde, der König konnte nicht wissen, wie klug sich diese dort verhalten würden. Dies waren, trotz aller Strenge der Jugend, zum ersten Male Schläge eines Geschickes, das der eigene Dämon herbeigerufen. Da sich lawinenartig nun vergrößert, was er einst selber ins Rollen gebracht, wird Friedrich immer strenger, pflichtbewusster. Seines Vaters einst gehasste Züge werden in seiner Seele sichtbar. Sollte er gefangen werden, so verbietet er, irgendwelche Entschädigung für ihn zu zahlen. Er fürchtet nicht den Tod, nur den Schmerz: "Der Schmerz ein Säkulum, der Tod ein Augenblick." Nun wird es ihm mit einem Male klar, dass er nicht zur "Klasse der Betrachtenden" gehöre: "Es scheint," schreibt er 50jährig an d'Argens, "dass wir viel mehr zum Handeln als zum Denken geschaffen sind." Es scheint.
Ermüdet kehrt der Siegreiche heim.
Kredo des 55jährigen: "Ruhm ist eitel. Verdienten Menschen je eine Lobrede? Man hat sie nur gerühmt, weil sie Lärm gemacht haben."
Im kleinen Hause sitzt der große Mann. Zwanzig Jahre segnet dieser nun erst wunderbar geklärte Sinn seine Länder. Nun gab es keinen Voltaire mehr, keine Tafelrunde. Die meisten Franzosen hat er davongejagt. Die Schwester ist tot: der einzige Mensch, den er je liebte; ihrem Gedächtnis baut er einen Tempel. Zeitlebens hat er Freunde gesucht, kaum einer hat ihm Treue gehalten. Die Generale, die er liebte, waren dennoch seine Freunde nicht. Fouqué und Lord Keith sind da und altern neben ihm. Ihnen schickt er hundertjährigen Wein, ersinnt Instrumente, da sie die Sprache, Rollstühle, da sie das Gehen verlernen. Ganz klein hat Menzel es gezeichnet: wie Friedrich neben dem Rollstuhl des Freundes die Terrasse abschreitet, er selber noch rüstig. Dann sterben sie, sterben auch die Entfernten, mit denen er korrespondierte: Voltaire, d'Alembert. Die Flöte blies der König nun nicht mehr.
Der Alte Fritz arbeitet. Am Morgen nach der Heimkehr aus dem endlosen Kriege, buchstäblich am andern Morgen, beginnt dieser König die innere Arbeit des Landes systematisch, wie einer, der bereut. Verwüstungen waren in dem neuen Lande: er löscht sie aus. Er trocknet Moore, pflanzt Wälder neu, schafft Wege und unzählige Gebäude. Nach einem weiten Leben voll Leidenschaft und Betrachtung, voll Wildheit und Kühle, voll europäischer Pläne und Weltwirkung gleicht seine reifste Weisheit der des letzten Voltaire.
Kredo des 70jährigen: "Wer seine Ländereien verbessert, unbebautes Land urbar macht und Sümpfe austrocknet, der gewinnt der Barbarei Eroberungen ab."
Er ist einsam, verschlossen. Auch den Neffen, den er noch am meisten liebt, verliert er; nur die Tiere sind noch um ihn. Die Windhunde liegen auf seinen Sesseln, in seinem Bett. Wenn sie sterben, begräbt sie der König unter Marmortafeln, neben den Bildsäulen römischer Kaiser. Condé, der Schimmel, läuft frei umher und auf den Herrn zu, der ihm Früchte gibt.
Sein letzter Besucher heißt Mirabeau. Es ist Fortinbras. Friedrich ist, auf einem Wege, unendlich verschieden von Goethes, zuletzt zu einer Entsagung gelangt wie dieser. Seine letzten Worte waren:
"Le montagne est passé, nous irons mieux."
STEIN
"Ich habe nur ein Vaterland, und das heißt Deutschland."
Auf dem Gerüst eines wuchtigen Körpers sitzt ein quadratischer Schädel mit rein gewölbter Stirn und schmalen, verschwiegenen Lippen; doch herrschend streben aus dem Kopf hervor zwei klare, blaue Blicke und eine riesige Nase: Zeugen des Glaubens und der Energie. Das sind die Grundzüge in der Seele dieses gewaltig einfachen Mannes.
Kein deutscher Staatsmann ist von der Verschmelzung dieser beiden Eigenschaften in so reiner Stärke bestimmt worden. Während aber in dieser kristallenen Tatennatur nichts problematisch bleibt, während sich Reinheit der Intuition und Wucht des Willens nie stören, wird seinen Resultaten dieser lebenslange Wettkampf von Glauben und Handeln Verhängnis: er nimmt ihm die Möglichkeit der letzten Lösungen. Weil keine Enttäuschung unter den Menschen, die er im Einzelnen aufs strengste beurteilte, ihn zur Menschenverachtung, zu jenem Zynismus verleiten konnte, ohne den Bismarck nichts erreicht hätte, erreichte er im entscheidenden Punkte nichts Positives: zu gläubig war er für so gesunden Weltsinn, zu tatkräftig für so tiefen Menschenglauben. Dafür war sein Ideal eines deutschen Reiches auch reiner als das jenes Nachfolgers, der doch nur eine gewisse Form zustande gebracht hat,
So brannte das Herz des Freiherrn vom Stein ein Leben lang als einsame Fackel durch den Dunst deutscher Fürsten- und Diplomaten-Politik, brannte und losch einsam, jedoch entschwindend das zukünftige Licht mit seinem Licht verbindend.
Dieser ständige Kampf gegen die Trägheit der Herzen entwickelte ihn, wie jeden tätigen Idealisten, zum Choleriker. Da er aber die Gefahr der Leidenschaft für die Auswirkung seiner Ideen erkannte, zwang er sich Quietive auf, ersann sich Rezepte der Stetigkeit. Unermüdlich von Natur, dazu durch echten inneren Standesstolz getrieben, ein Muster des Adels zu werden, gedrängt vom rapiden Tempo der Zeit, gestärkt vom Hasse gegen den feindlichen Eroberer, beschwingt von den Möglichkeiten formloser Augenblicke des Staates, die sich von einem Jahrfünft zum andern steigerten: so kämpfte er immer heißer für seine Idee, für dies Vaterland, an dessen Einigung er mit Inbrunst glaubte.
Er kämpfte gegen das Vaterland. Was erreicht wurde, die Befreiung, war nur zum Teil sein Werk und schließlich eine Frage der Bündnisse und Waffen, die zu schließen oder zu schaffen nicht seine direkte Aufgabe war. Was missglückte, die Einigung, war seine eigene Grundidee, die große Leidenschaft, der Motor seiner Tatkraft. Zwar war der Erste Napoleon in viel tiefer erlebtem Sinne sein Feind, als es der Dritte jemals Bismarck werden konnte; beiden aber war der Kampf mit dem Franzosen nur das Mittel, durch Krieg und Sieg nach außen den inneren Zusammenschluss zu ertrotzen.
Weil aber Stein, wahrhaft ein Volksmann, die deutschen Stämme zusammenfassen wollte, weil er die Dynastien verachtete und von 36 Fürsten höchstens 6 duldete, zerrieb er sich in seiner höfefremden Gradheit zwischen den Intrigen und Launen der übrigen 30 und sah am Ende seiner Bahn vor sich eine Zerrissenheit, schlimmer als bei Beginn. Bismarck, volksfremd und dynastisch, erreichte das in Deutschland Mögliche so ganz, dass es noch über den Sturz der Fürstenhäuser standhielt, erstaunlicher, als er es in Form der Gegenprobe auch nur gewünscht hätte. Es scheint, als siege vor konstruktiven Aufgaben bei gleicher Tatkraft ein amoralischer Wille eher als ein offenes Herz.
Denn Stein war gläubig. Immer der Vorsehung hingegeben, immer sich selbst als Werkzeug fühlend in höheren Händen, Gott verantwortlich, doch immer zugleich den Menschen: durchaus ein Protestant. Volle Ergebenheit in den Willen des Himmels machte ihn keinen Augenblick zum passiven Fatalisten, und nie hat er diesen unlösbaren Zwiespalt zwischen Ergebung und Aktivität kräftiger gefasst als in den Tagen, da sich das Fatum seines Todfeindes wandte. Er saß in Petersburg und lud die Freunde zum Wein, um Napoleons Flucht und Moskau zu feiern: da, in einer Art seelischer Trunkenheit, die dieses klare Leben selten duldete, erhob er sein Glas und rief den Gästen die herrlichen Worte zu: "Schon oft im Leben habe ich mein Gepäck hinter mich geworfen. Stoßt an! Weil wir sterben müssen, sollen wir tapfer sein!"
Er war's. 70 Jahre lang war er's, und mehr als mancher Feldherr. Zivilcourage war die Form, in der sich Steins Tatkraft moralisch darstellte. Er fürchtete niemand, und weil er zugleich niemand zu gehorchen brauchte, war er der Freiesten einer. Der einzige, dem er sich freiwillig unterworfen, dieser König von Preußen, war sein Herr nur als Friedrichs Erbe geworden.
Denn Stein berührt noch den Stärksten und schon den Schwächsten in unserer Königsreihe. Er ist es, der zuerst von "Friedrich dem Einzigen" spricht, um seinetwillen tritt er in preußische Dienste, und von dem Vogelauge des Uralten wird er in seinem Talent noch erkannt und erfolgreich benutzt. Und er ist es wiederum, der nachher die Charakterlosigkeit des Großneffen ertragen musste: ihn lernte er rasch verachten.
Mit der naiven Frische, die ein edles Herz und ein starkes Hirn ihm unermüdlich speisten, mit der Unerschrockenheit seines ritterlichen Wesens hat er auch über andere, später zu Größen erhobene Figuren Wahrheiten nicht bloß vertraulich gesagt, auch vor der Welt in seinen Schriften ausgebreitet: gefallsüchtig und schwach nennt er die Königin Luise, falsch und oberflächlich Hardenberg, unerträglich deutschtümelnd den Turnvater Jahn, den zu empfangen er stets abgelehnt hat; nur über den König hat er öffentlich geschwiegen.
Und doch anstatt, wie Bismarck, einen Preußenkönig zu finden, der sich leiten und der ihn niemals fallen ließ, fand Stein einen Hohenzollern, beschränkt und trotzig, feig und herrisch, der nach zwei knappen Jahren ihn aus dem Amte jagte, und als er ein Jahr darauf den Unersetzlichen zurückholen ließ, nicht einmal den Anstand hatte, ihm ein versöhnendes Wort vorweg zu schreiben oder zu sagen.
Seit sieben Jahrhunderten saßen die Reichsfreiherren vom Stein auf ihrer Burg in Nassau an der Lahn, doch erst in diesem Letzten des Geschlechtes wurde der Name zum Symbol. Denn wirklich war er wie ein Felsblock mächtig, frei und Herr. Nimmt man dazu, dass dies Geschlecht reichsunmittelbar gewesen, bis gerade diesem Sprossen das Schicksal der Mediatisierung drohte, so fühlt man stärker das Gleichnis seiner Abkunft. Denn dieser Freiherr stand buchstäblich unmittelbar beim Reich, ihn kümmerte kein Fürst, er war es selbst, sein eigenes Erbe sollte nach seinen Plänen samt all den andern im Reiche aufgehen –– und nur der Kaiser bedeutete seinem durch Geschlecht und Kenntnis der Geschichte gleich stark bestimmten konservatorischen Wesen die übergeordnete Macht.
Doch eben, weil er von seinem begünstigten Stande so viel fordert, wird er zum stärksten Kritiker dieses Standes, seiner Genossen. Wer hat aus diesen Kreisen vor oder nachher zu deutschen Fürsten zu sprechen sich erkühnt, wie er! Als ihm 1804 der Herzog von Nassau zwei Dörfer stiehlt, weil ja die reichsunmittelbare Ritterschaft nun durch Napoleon aufgehoben sei, erwidert Stein, wenn diese Strecken einer der beiden deutschen Großmächte zufielen, das nützte dem Reich und das hoffte er noch zu erleben. Wo aber wären die kleinen Fürsten, die heut alles rauben, in den letzten Kriegen geblieben? "Sie entzogen sich aller Teilnahme und suchten die Erhaltung ihrer hinfälligen Fortdauer durch Auswanderungen, Unterhandeln und Bestechung der französischen Heerführer." Und plötzlich bricht er einen noch böseren Gedanken ab, mitten in einem Satze, und endet: "— doch es gibt ein richtendes Gewissen und eine rächende Gottheit. Ehrfurchtsvoll verbleibe ich Euer ––Stein." So wörtlich, mit den Gedankenstrichen.
Aus seinen Denkschriften, geschrieben und übergeben an Könige und Fürsten, strahlen Sätze, wie sie kein um 1750 geborener Europäer wagte, er wäre denn Revolutionär: ",15 Millionen Deutsche sind der Willkür von 36 kleinen Despoten preisgegeben, ... der Laune kleiner Sultane und Wesire.... Die Selbstherrscher sollten nicht vergessen, dass auch die Völker von Gottes Gnaden frei sind!"
Als in Petersburg nach Napoleons Rückzug die alte Kaiseri-nWitwe, geborene Württemberg, nach der Tafel die Worte affektiert: "Entkommt aber jetzt noch ein französischer Soldat durch die deutschen Grenzen, so würde ich mich schämen, eine Deutsche zu sein", da erhebt sich der Freiherr, roten Kopfes bis in den Nacken, verneigt sich, sagt: "Majestät haben sehr unrecht, solches hier auszusprechen über ein so großes treues, tapferes Volk, dem anzugehören Sie das Glück haben! Sie hätten sagen sollen, nicht des Volkes, sondern meiner Brüder und Vettern schäme ich mich, der deutschen Fürsten! Denn hätten Die in den neunziger Jahren ihre Pflicht getan, so wäre kein Franzose über Elbe und Oder, geschweige denn über den Dnjestr gekommen!"
Diese Verachtung der Fürsten, entspringend aus der Reinheit seines Pflichtgefühls als Fürst, der stets nach Ehre, nie nach Ehren strebte, war Steins erstes und tiefstes Erlebnis, sie hat seine Vision der neuen Reichsgestaltung, hat sein ganzes soziales Weltbild begründet. Weil er sie mit den Franzosen schachern und für den Verrat am gemeinsamen Vaterlande Provinzen und Titel annehmen sah, erschien ihm die Begründung einer Einheit durch so kompromittierte Faktoren nicht mehr denkbar, die Schleifung von fünf Sechsteln nötig. Nicht nach Ständen, nach Stämmen wollte er Reich und Verfassung aufbauen.
Denn auch der nächste Stand, dem er mitangehörte: der Adel hatte, was etwa noch fehlte, getan, um Stein die Vorurteile seiner Genossen vorzuführen und ihn zum ersten Demokraten der deutschen Wappenträger zu machen:
"Nicht durch Hunde, Pferde, Tabakspfeifen, starres Vornehmtun wird der Adel den angesprochenen ersten Platz im Staate halten, sondern durch Bildung, Teilnahme an allem Großen und Edlen ... Nicht durch Steuerfreiheit und Ausschließung von der Gesellschaft derjenigen, die keinen Stammbaum vorzuweisen haben... Die schönen Zeiten unseres Volkes wissen nichts vom Stammbaum: Erzbischof Willigis von Mainz war der Sohn einer armen Frau, Herzog Billung von Sachsen der Sohn eines Besitzers von sieben Hufen." Und in einer geheimen Sitzung vor Beginn des vernichtenden Krieges hat Stein den Generalen ernsthaft vorgeschlagen, der König solle den Adel aufheben und nach dem Kriege nur die anerkennen, die sich hervorgetan hätten! Freilich war Stein Gegner der Revolution, doch eben wie Goethe aus Demokratie und mit fast wörtlich der gleichen Begründung: "Das sicherste Mittel gegen das Fortschreiten des revolutionären Geistes ist Befriedigung gerechter Forderungen der Völker." Aus diesem Volksgefühl, das sich aus Menschenliebe und aktiver Pflicht ernährte, ist der gesamte Aufbau seiner Reformen bedingt.
Ein mächtiger Unterbau schwer erworbener Erfahrungen hat ihn getragen. Mit 24 Oberbergrat, von 27 bis 40 an der Spitze des Hüttenwesens an der Ruhr, dann bis 47 Oberpräsident in Westfalen: da hört ein großes Herz das Herz des Volkes schlagen, da lernt ein ernster Geist Menschlichkeit und Mittel zur Besserung. Das Nest, in dem er viele Jahre dieser Zeit verbringt, heißt denn auch Wetter.
Dies ist Steins glücklichste Zeit gewesen, die einzige glückliche, hier hat er sein aufbrausendes Wesen durch präzise Arbeit beruhigt, hier rühmt er "Ruhe, Einsamkeit, bestimmte Beschäftigung". Selten überkommen ihn nach dem 40ten Jahre noch Anfälle wie der, als er dem Kanzleidiener, der Tinte statt Sand auf die Unterschrift streute, den nassen Bogen ins Gesicht wischte. Wie andern Tags der Diener wieder eintritt, steht Stein rasch auf, drückt ihm ein Papier in die Hand, darin zwei Goldstücke. Zeit zu verlieren kann er freilich nicht vertragen, "schneidend bestimmt in seinen Meinungen, heftig, für weiche, nachgiebige Gemüter abschreckend" nennt ihn ein Mitarbeiter.
Aber in Sorgen für Menschen und Werke, in der Arbeit an Verbesserungen gewinnt er Stetigkeit, und, nach einer kurzen Mission für den alten Fritzen, lehnt er den Nachfolgern jeden Dienst an Höfen und Diplomaten ab, –– die nennt er "eine frivole, wichtigtuende, gehaltlose, müßige Menschengattung" –– und bleibt befriedigter im engen, weiten Kreise seiner Gruben, Fabriken, Kanäle, Chausseen; zuweilen schießt er dem Staate bis zu zehntausend Talern aus eigener Tasche vor.
Nur einen Fehler zeitigt diese Epoche gewaltsamer Mäßigung.
Nachdem er sie mehrere Jahre recht kritisch beobachtet, entschließt er sich, eine Komtesse zur Frau zu nehmen "wegen Reinlichkeit des Charakters und Richtigkeit des Verstandes... Um das Harte, Heftige und Übereilte, das in meinem Charakter liegt, durch den Anblick dieses wohlwollenden und sanften Geschöpfes und die Äußerungen ihres richtigen Verstandes zu mildern." Aber die 21 jährige, die fast seine Tochter sein könnte, sucht Sammlung weniger als Geselligkeit, bald nach der Hochzeit geht sie zu ihrer Schwester, vereinsamt schreibt ihr Mann, der eigentlich mit Frauen nie recht gelebt hat, einer älteren Freundin, wie sehr er eine mitfühlende Seele vermisst. Auch bleibt sie ihm den Sohn schuldig, den er zum Erben des Geschlechtes wünschen muss.
Erst spät haben sich die Gatten, im Anblick dreier Töchter, freundwillig aufeinander eingerichtet.
In solche Bitterkeiten mischen sich die großen Kämpfe. Im 48. Lebensjahr –– wie Bismarck –– wird er Minister, wie dieser von einem skeptischen König fast wider Willen berufen. Doch Stein sind kaum drei Jahre gegönnt, die Masse der Ideen zu verwirklichen, von denen nach zwanzig praktischen Jahren dieser Kopf wirbelt. Dem wachsenden Druck von außen –– wir schreiben 1804 bis 6 –– sucht er eine neue innere Konsistenz des Landes entgegen zu bauen, indem er Korruption und Verschwendung, Bürokratie und Bevormundung bekämpft, und mit Erfolg. Wirklich, er ist auf dem Wege, die Stände auszugleichen.
Nur der Eine Stand, dessen Symbol er sich zum Herrn erkoren, nur der absolute König von Preußen, der in Wahrheit ein sehr relativer war, bleibt unüberwindlich; an dieser unzerstörbaren Mauer scheitert Steins große Attacke. Das erste Mal, dass dieser so humane wie mutige Ritter sich großen Stiles an der Wirklichkeit versucht, in deren kleineren Kreisen er Alleinherrscher und darum Sieger gewesen, wird ihm die Lanze zersplittert. "Ich kann", so schreibt er in protestantischer Loyalität über den König, "dem, dem die Natur diese Kraft versagte, so wenig Vorwürfe machen, als Sie mich anklagen können, nicht Newton zu sein, ich erkenne hierin den Willen der Vorsehung, und es bleibt nichts übrig als Glaube und Ergebung."
Doch fast zugleich mit diesem entsagenden Satze versucht er's auf seine getroste Art noch einmal: er stellt dem König in einem grotesken Schreiben, das er der Königin zur Weitergabe sendet, ungeniert wie ein Hofnarr dar, wer seine wirklichen Vertrauten sind, diese "Kabinettsräte", die alle Kraft der Minister brechen und faktisch regieren.
Nach grundsätzlicher Darlegung, warum man heut nicht mehr auf solche Art regieren könne, entwirft er dem Könige von seinen drei Räten und Freunden dies Bild: "Die gemeine Aufgeblasenheit seiner Frau ist ihm nachteilig, seine Verbindung mit der Familie (des zweiten Rates) untergräbt seine Sittenreinheit (Dieser) ist physisch und moralisch gelähmt und abgestumpft, seine Kenntnisse schränken sich auf französische Schöngeistereien ein, die ernsthaften Wissenschaften haben diesen frivolen Menschen nie beschäftigt." Dann der Dritte: "In den unreinen und schwachen Händen eines französischen Dichterlings von niederer Abkunft, eines Roués, der mit der moralischen Verderbtheit eine gänzliche physische Hinfälligkeit verbindet, der Seichtheit in den Gedanken mit leeren Menschen am Spieltisch vergeudet, ist die Leitung der diplomatischen Verhältnisse dieses Staates in einer Periode, die in der neueren Geschichte nicht ihresgleichen hat."
Den Außenminister nennt er schließlich "gebrandmarkt mit dem Namen eines listigen Verräters ... eines abgestumpften Wollüstlings". Daraus folge "das Missvergnügen der Bewohner dieses Staates über die gegenwärtige Regierung und die Notwendigkeit einer Veränderung... Sollte Seine Kgl. Majestät sich nicht entschließen, die vorgeschlagenen Veränderungen vorzunehmen, so ist zu erwarten, dass der preußische Staat sich entweder auflöst oder seine Unabhängigkeit verliert und dass die Achtung und Liebe der Untertanen ganz verschwinde."
Geschrieben: sechs Monate vor der Schlacht bei Jena, vom Minister des Innern an den König durch Vermittlung der Königin. Diese hat die letzte Warnung den Augen ihres Gatten sorgfältig entzogen.
Zusammenbruch, Flucht, Memel.
Als nun der ratlose König das Außenministerium dem Freiherrn anbietet, macht dieser, gichtkrank, wie er ist, die Annahme von der Entlassung nur eines jener Kabinettsräte abhängig. Da gerät der König außer sich:
"Jetzt sehe ich..., dass Sie als ein widerspenstiger, trotziger, hartnäckiger und ungehorsamer Staatsdiener anzusehen sind, der, auf sein Genie und seine Talente pochend, weit entfernt, das Beste des Staates vor Augen zu haben, nur durch Kapricen geleitet, aus Leidenschaft, aus persönlichem Hass und Erbitterung handelt. dass, wenn Sie nicht Ihr respektwidriges und unanständiges Benehmen zu ändern willens sind, der Staat keine Rechnung auf Ihren ferneren Dienst machen kann. Königsberg, 8. Januar 1807."
Acht Monate später, als ihn der König in voller Verzweiflung wieder beruft, liegt Stein fieberkrank in seinem Schloss, aber er schreibt wie ein Preuße: "E. M. Allerhöchste Befehle wegen des Wiedereintritts in Dero Ministerium ... befolge ich unbedingt und überlasse E. M. die Bestimmung jedes Verhältnisses." Halb geheilt reist er dann von Nassau über Kopenhagen nach Tilsit. (So sieht damals die Karte von Deutschland aus.)
Doch nun ist es, als fühlte er die Kürze der Zeit voraus, die ihm noch einmal zu regieren bestimmt ist; es wird kaum ein Jahr sein. Mit beiden Händen greift er in diesen halb aufgelösten Staat, um ihn nach seinen Plänen zu kneten. Auf einem einzigen Bogen Papier durchstreicht er die Leibeigenschaft der preußischen Bauern, auf einem zweiten gibt er allen Städten Selbstverwaltung, auf einem dritten dehnt er die Wehrpflicht von den unteren Ständen auf alle, auch den Adel, aus, auf einem vierten wird der Stockprügel abgeschafft und jedem gemeinen Soldaten die Offiziersbahn eröffnet, ein fünfter streicht die Kabinettsregierung aus, ein sechster macht Ost- und Westpreußens Domänenbauern zu freien Eigentümern, ein siebenter streicht alle höheren Gehälter im Staate einschließlich des des Königs auf die Hälfte zusammen: alles durchdacht in 25 einsamen Jahren, durchgeführt im Exil in ein paar Monaten, ermöglicht durch das Unglück der Nation. Schon plant er Verwirklichung seines Herzensgedankens: Errichtung eines preußischen Reichstages mit Wahlrecht für jedermann –– da findet er eines Morgens in Berlin den neuesten Moniteur aus Paris und darin einen verteufelt offenherzigen Brief von sich selber mit drohenden Glossen abgedruckt, den auf dem Wege zu einem vertrauten Adressaten die Franzosen gefasst, beschlagnahmt und nun als Beweis der Insurrektion vor aller Welt ausgebreitet haben. Bald folgt ihm ein Steckbrief gegen den "nommé Stein", unterschrieben: Napoleon, Madrid.
Stein muss sogleich mit seinem Amt nach dreißigjährigem Dienst das Vaterland verlassen, nach 700jährigem Herrenrecht seines Hauses, lebt zunächst vom Verkauf seines Silbers, bleibt agitierend, ratend, schreibend in Böhmen, bis ihn beim Beginn des russischen Krieges der Zar Alexander in warmem Schreiben auffordert, zu ihm zu stoßen.
Der deutsche Reichsfreiherr, der die deutschen Fürsten bis nach Berlin und Wien verachtete, Franzosen hasste, Hannoveranern misstraute, findet im Kaiser von Russland die Fürstentugenden, die er seit 30 Jahren träumt: Idealismus, Tatkraft, Gradheit, Fleiß, Takt, Tapferkeit. Als sein Berater im Lager und in der Hauptstadt, dann bis Paris, ohne bestimmte Stellung, hat Stein diese letzten, aufregendsten Jahre seines öffentlichen Wirkens in russischem Sold durchfochten. Dem Zaren allein reicht er den Lorbeer, ihn immer wieder erklärt er für den Befreier, hier endlich glaubt der strenge, noble Mann seinen wahlverwandten Herrn gefunden. Eine Weile hielt er tatsächlich den Zaren für einen Engel, der den Teufel Bonaparte zu vernichten kam, 1813: Stein fiebert: Unablässig, zwischen den Schlachten, die diesen echten Staatsmann nur als Mittel interessieren, feuert er seine Entwürfe, Denkschriften, Briefe an die verbündeten Könige und ihre Minister, alle nur dem einen Ziel der Einheit zu. Kurz, klar, naiv ist der Stil dieser Entwürfe, nur in den Briefen an Freunde dröhnt das Pathos seines Glaubens an die große Sache leise wider.