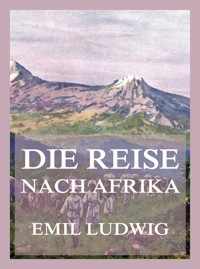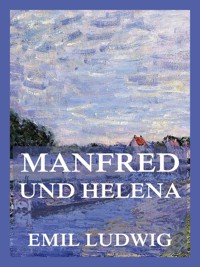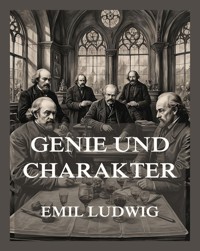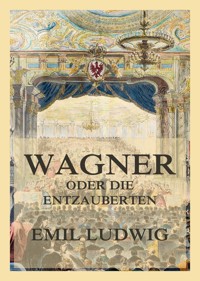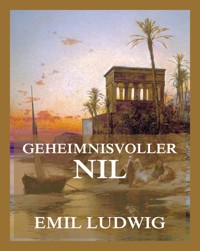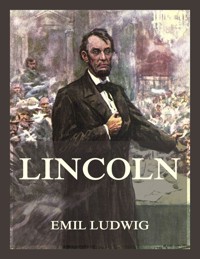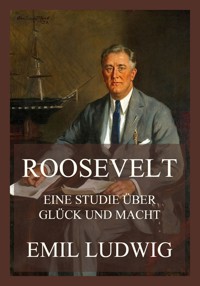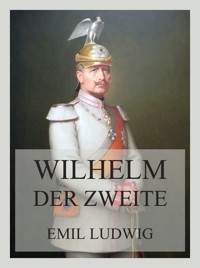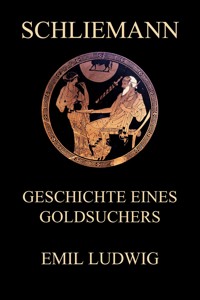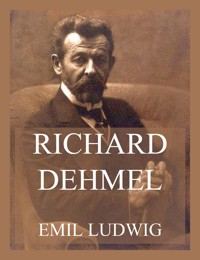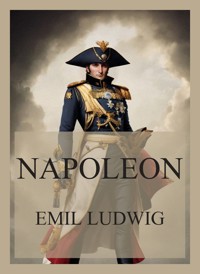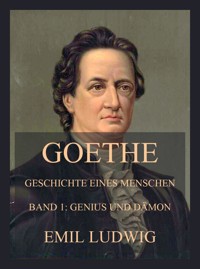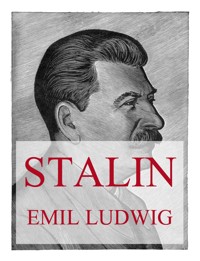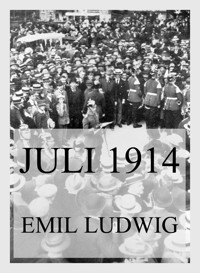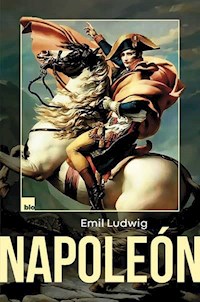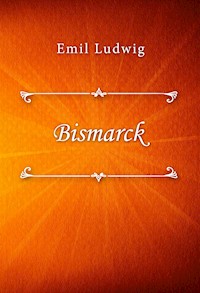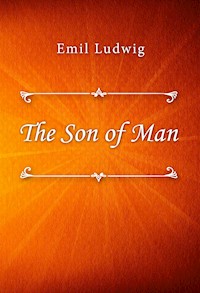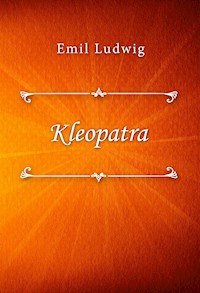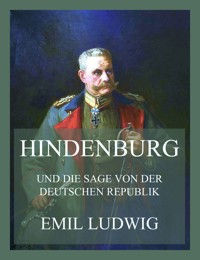
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer die Geschichte Hindenburgs schreibt, dem mehr geschah als er tat, zeichnet in diesem Symbol immer auch eine Skizze des deutschen Charakters, und versucht an eben diesem zu beweisen, warum die Republik nach dem Willen des Volkes so rasch zu Grunde ging. Emil Ludwig schildert in diesem beeindruckenden Werk, wie ein Offizier nicht vom Ehrgeiz, sondern von der Legende weit über seine Grenzen getrieben wurde, und wie er sich dabei auf die natürlichste Art im hohen Alter zu Grundlagen zurückfand, die er nur scheinbar kurz verlassen hatte; wie ein Junker als Feldmarschall und Präsident, zuerst von seiner Umgebung, zuletzt von alten Herren-Instinkten zur Diktatur gedrängt wurde und schließlich auf eine tragische Art im höchsten Alter die Macht an eine Gruppe von Draufgängern verliert, um in Verbitterung zu sterben. Aus der Dämmerung des Durchschnitts wurde er erst im biblischen Alter ins Licht gehoben, und so ist die späte Entwicklung zu schildern, die ein Charakter von entschiedener Stabilität durch eine ihm aufgedrungene Rolle noch so spät durchmachen musste. Dieser Band ist unentbehrlich für jeden, der sich für die deutsche Geschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts interessiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hindenburg
Und die Sage von der deutschen Republik
EMIL LUDWIG
Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik, Emil Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680167
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort1
Die erste Fahne. 3
Die Kriegsfahne. 38
Die zweite Fahne. 138
Zwischen den Fahnen. 187
Die dritte Fahne. 221
Vorwort
In dem Augenblick, da das klassische Soldatenvolk durch seine Rüstung aufs neue Europa zum Rüsten zwingt, scheint es lehrreich, den berühmtesten deutschen Soldaten der letzten Epoche zu zeichnen. An diesem Beispiel könnte die Welt erkennen, in welche Irrwege und Konflikte der deutsche Wille zum militärischen Kommando einen tüchtigen Soldaten treibt, indem man ihm die größten politischen Entscheidungen im Kriege wie im Frieden auf die Kniee legt. Vielleicht begreift der Leser außerhalb Deutschlands, wie wenig sich dieses Volk in seiner neuen Staatsform geändert hat; nur dass der Geist des Angriffs wilder geworden ist im Vergleich zu den Jahren 1912 oder 13, denen unsere Epoche entspricht. Wer die Geschichte Hindenburgs schreibt, dem mehr geschah als er tat, wird deshalb in diesem Symbol eine Skizze des deutschen Charakters zeichnen, und eben an diesem beweisen, warum die Republik nach dem Willen des Volkes so rasch zu Grunde ging.
Zu den drei Darstellungen, die ich, zwischen größeren Arbeiten, unserer Gegenwart im letzten Jahrzehnte gewidmet habe, – zu Wilhelm dem Zweiten, Juli 14 und dem Schauspiel "Versailles" – füge ich deshalb das Bildnis Hindenburgs; auch dies ein Beitrag zur Psychologie der Deutschen. Darin soll geschildert werden, wie ein Offizier nicht vom Ehrgeiz, sondern von der Legende weit über seine Grenzen getrieben wurde, und wie er sich dabei auf die natürlichste Art im hohen Alter zu Grundlagen zurückfand, die er nur scheinbar kurz verlassen hatte; wie ein Junker als Feldmarschall und Präsident, zuerst von seiner Umgebung, zuletzt von alten Herren-Instinkten zur Diktatur gedrängt wird und schließlich auf eine tragische Art im höchsten Alter die Macht an eine Gruppe von Draufgängern verliert, um in Verbitterung zu sterben. Aus der Dämmerung des Durchschnitts wurde er erst im biblischen Alter ins Licht gehoben, und so ist die späte Entwickelung zu schildern, die ein Charakter von entschiedener Stabilität durch eine ihm aufgedrungene Rolle noch so spät durchmachen muss.
Als zweites Thema wird man hier einen pragmatischen Abriss der deutschen Republik finden, dagegen keinen ähnlichen des "Dritten Reiches". In jene hat die Hauptfigur bedeutsam, in dieses hat sie nicht mehr eingegriffen; auch würden meine Fähigkeiten den Ansprüchen seiner Führer zur Darstellung nicht genügen.
Dieses biographische Unikum: ein Mann, dessen Geschichte erst mit 67 Jahren beginnt, verschob den harmonischen Aufbau, den ich sonst in allen Lebensbildern versuchte, so dass ein halbes Jahrhundert seiner Geschichte weniger Raum fordert als vier Jahre. Das Fehlen fast aller privaten Dokumente erschwerte dabei die Darstellung; aus der Zeit der Präsidentschaft fehlen überdies die meisten amtlichen Papiere. Hier ist man auf persönliche Beobachtungen und auf Berichte angewiesen, die mir von beiden Seiten, von den Mit- und Gegenspielern zugeflossen sind, ohne dass ich ihre Namen nennen dürfte. Auch die vorzüglichen Bücher von Rosenberg und Konrad Heiden wurden benutzt. Wenn einmal alle Quellen erschlossen sein werden, wird niemand mehr ein Buch über Hindenburg lesen.
Dann wird man nur noch das Märchen von dem alten deutschen Riesen erzählen, der einst nach manchen Abenteuern an einem Staudamm Wache hielt, bis er zuletzt in einer Verwirrung das eiserne Tor öffnete und über das Land eine große Flut brausen ließ, die alles zerstörte, was ihm teuer gewesen, bis er am Ende selber darin ertrank.
Moscia, Dezember '34.
Die erste Fahne
Die Deutschen sind, ein gut Geschlecht,
ein jeder sagt: Will nur, was recht;
recht aber soll vorzüglich heißen,
was ich und meine Gevatter preisen.
GOETHE
Ostpreußen ist kein heiteres Land, und um Landschaft und Menschen zu lieben, muss man wohl in ihrer Mitte geboren sein. Weite Ebenen grenzen mit Dünen und Hügeln ans Meer, Heideland und Dünenland, aber die Ostsee ist fast ein eingesperrtes Wasser. Schöne Buchenwälder gibt es dort auch, aber die Güter liegen meist im flachen Feld, und auch die Schlösser ragen nicht von Hügeln, es sind nur große, feste Häuser in der Ebene, erbaut von Menschen, die ringsum niemand zu fürchten brauchen.
Wenn sich das Gutshaus des Junkers nicht trotzig erhebt, so war es nicht Bescheidenheit des Herrschenden, die ihn zurückhielt, sondern die volle Ruhe, in der er seinen Besitz gesichert wusste. Um Schmuck oder Schönheit zu suchen, fehlte ihm Kultur, Wissen und Welt; das Beste, was er sich denken konnte, waren zwei Kanonen, die er zur Erinnerung an eine Schlacht mit des Königs Gnade vor dem Tor seines Hauses aufstellen durfte. Sonst freilich spricht bis heute in dieser Provinz wenig von Kriegen, die nur selten darüber hin fegten, und auch dass alle diese Herren Offiziere waren, könnte man höchstens aus der Kunst und Leidenschaft des Reitens schließen, die alle besitzen.
Im Allgemeinen gleichen diese weiten, angebauten Strecken den benachbarten polnischen und russischen Kornfeldern und Waldgürteln, zu denen sie ehedem gehörten; Wege und Häuser sind besser, sonst ist alles wie früher, wenig Neuerung in der Landwirtschaft, Herr und Volk als Kavalier und Arbeiter übereinander geschichtet wie im Rokoko, dazwischen der vergebliche Versuch des Bauern, sich zu verbessern, und der gelungene Versuch des Junkers, mit wenig Geld, wenig Arbeit und viel Hypotheken im Stil eines großen Herrn zu leben, wie die Väter.
Auch die Hindenburgs, die früher nur Beneckendorff hießen und die als solche seit fünf Jahrhunderten in märkischen, später in ost- und westpreußischen Landstrichen auf ihren Gütern lebten, hatten als ostelbische Junker neben Verwandten und Standesgenossen dort residiert, manchmal ärmer als ein großer westfälischer Bauer, aber immer im Stil der Herren. Wenn der Knabe seine Ferien um 1855 bei den Großeltern verlebte und auf deren Stammgut Neudeck aus dem einfachen Gutshaus trat, so hatte er sein Dachzimmer im hohen Giebel verlassen und ein rechtes Bauernfrühstück hinter sich. Hühner und Enten trieben sich ums Haus herum, und die Fliederbüsche blühten schön und wild durcheinander, denn zum kunstgerechten Schneiden fehlte es an einem Gärtner, und die Großmutter hatte im Haus, in Stall und Küche genug zu tun. Irgendeine Magd mag sein Zimmer aufgeräumt, der alte Reitknecht des Großvaters sein Pferd geputzt haben. Anzäumen musste er sich's selber und tat es gerne, denn es geschah drinnen im Stall.
Nun aber, da er es aus der alten Stalltür herauszieht, durch die seine Vorfahren ihre Pferde führten, nun sitzt der Zehnjährige auf, reitet los: plötzlich ist er "der junge Herr". Der Knecht, der ihm das Gartentor aufmacht, steht mit der Mütze in der Hand, brummt: "Morgen, Herr Baron!", und der Junge führt die Peitsche leicht zur Mütze und ruft mit seiner Kinderstimme zurück: "Morgen, Gustav!" Er duzt ihn, aber jener siezt ihn bereits, oder er wird es in zwei Jahren tun, während der alte, der mittlere und der junge Herr ihn, Gustav, zeitlebens duzen werden. Reitet der Knabe jetzt bis zum Fluss und kommt an der Schafherde vorbei, die im Staub der Straße leise vorüberrauscht, so grüßt ihn der Hirt, im Dorf drüben grüßt ihn jeder Mann und jede Frau, denn sie sind alle Kinder von Erbuntertänigen, die älteren sind selber noch unfrei geboren, und drüben über der russischen Grenze sind es die Bauern noch immer.
Was hatte sich im Grunde seit 1807 verändert, als der Bauer in Preußen frei geworden? Wenn Hindenburgs romantischer jüngerer Bruder den Ton jenes Stammgutes beschreiben will, spricht er von der "alten, unermüdlichen Glocke, die sich nie so verwandelt und durch ein Jahrhundert oder länger täglich zur Arbeit frühmorgens und mittags gerufen hat". Sie rief den Bauern mit Frau und Kind zur Arbeit, als der zehnjährige Hindenburg aus dem Gutshof abritt, und der Bruder hört sie noch im Alter tönen und kann sich nicht denken, dass sie jemals aufhören sollte, seine Leute zur Arbeit zu rufen, während er selber der Herr bleibt, ziemlich müßig, auch wenn er dies und das im Laufe des Tages selber tut, auch wenn er ein paar Dutzend Rekruten drillt oder ein paar hundert Soldaten kommandiert.
Wenn der Bauer um 1860 vom Junker für seine Arbeit bezahlt wurde, so war es doch nur ein schmales Almosen, fast so freiwillig gegeben wie von den Vätern, denn die Macht des Herrn war damals und ist noch heute groß genug, jeden widerspenstigen Bauern in seinem Bezirk unmöglich zu machen. Der Junker ist der erste Mann im Land, hat über die Hintersassen eigne Gerichtsbarkeit, und wenn ihn der Fiskus mit Steuern drückt, so hat er Mittel genug, den Fiskus zu drücken; Pfarrer und Lehrer stellt der Junker an, bestimmt den Tageslohn, wie es ihm gefällt, regiert durch den Vetter Landrat den Kreis und durch den Onkel Präsident die Provinz. Denn ihn schützt der mächtigste Mann in Preußen, ihn schützt der König in Berlin. Warum schützt ihn der König in Berlin? Weil der Junker den König vor seinem Volk schützt.
Der König ist die Quelle des Lebens, ihm muss man treu sein, weil und solange er seine Hand über den Junker hält; ihm haben die Väter Treue geschworen, als sie als Reiteroffiziere oder auch als Gardeleutnants der Infanterie aus der Kadettenanstalt kamen. Denn ihnen hat der König die erste Macht im Staat gegeben, und wenn sie ihm zuweilen grollten, haben sie doch einander nachgegeben; schließlich ist es immer wieder zum ungeschriebenen, aber beschworenen Vertrag gekommen: dass König und Junker einander schützen und ehren, damit Bürger und Bauern nicht aufsässig werden und die neuen Ideen aus Welschland vergessen, die diese verrückten Franzosen in die Welt gesetzt haben. Darum sang man gegen die Junker: "Und der König absolut, wenn er unsern Willen tut!"
Der Großvater war über Achtzig, als der siebenjährige Knabe sich auf den Schemel setzte, um ihm zuzuhören. Er hatte einen freundlichen Kopf, weit besser als der Vater Hindenburgs, und wenn er von Napoleon erzählte, wird der Junge die Ohren aufgemacht haben. Wahrscheinlich saß der Alte nach Tisch bei seiner Pfeife auf einem der beiden langen Sofas im Saal und sah auf die Bilder seiner Vorfahren, die dort von den Wänden niederblickten. Hier saß er jetzt über fünfzig Jahre, seit Neudeck ihm zugefallen war. Ein ruhmreicher Soldat war er gerade nicht, früh abgegangen und Landwirt geworden; auch die Not der Zeit hatte diesen Ritter in besten Jahren nicht zu den Waffen zurückgeführt; während sein König auf der Flucht, der Feind im Land war, ist der alte Hindenburg auf seinem Gut geblieben. Da erzählt der Alte wohl den Enkeln, wie er den großen Napoleon in Schloss Finkenstein aufgesucht hat, um Nachlass von den Lieferungen für seinen Kreis zu erreichen, aber der böse Franzose hat ihn hart angefahren, er müsse seine Truppen ernähren. Damals kamen die Herren Franzosen auch hierher nach Neudeck, dort oben im Giebelzimmer ist durchs Fenster geschossen worden.
Wenn die Enkel nach den verblichnen Bildern an den Wänden fragen, so erzählt ihnen der Alte auf seinem Sofa –– und wahrscheinlich schnupft er dazwischen ––, dass die Beneckendorffs in den Schlachten von Brandenburg und von Preußen dreiundzwanzig Söhne verloren haben im Laufe der Jahrhunderte, dass ein Vorfahre Kanzler eines Kurfürsten war, und mancher war Offizier unter Friedrich dem Großen. Aber die Väter von diesen Vätern gingen zurück bis zur Stammburg bei Quedlinburg, die die aufrührerischen Bauern in der Reformation erstürmt und verbrannt hätten: das waren wüste Zeiten, dergleichen heute nicht mehr vorkommen könnte! Woher der Name kommt? Ben ist Galgen und Ecke ist Eiche: die Gerichtseiche, die sie im Wappen haben; woraus die Kinder sehen können, dass ihnen Recht und Macht seit Urzeiten zustehen.
Was Hindenburg heiße, wollten sie wissen? Die braune Hindin vor dem grünen Baum, dort über der Tür im Wappen, das bedeute Hirschkuh, aber auch Hund, wovon Hundertschaft kommt, und wieder der Gerichtsbaum: Führer einer Hundertschaft und Gerichtsherr, wieder die Herren und die Gebietenden. Aber Hindenburg, so erklärt der Alte und zeigt mit dem Stock nach einem anderen Bild, hießen sie erst seit sechzig Jahren. Denn als der letzte unvermählte Oberst von Hindenburg zu Sterben ging, dem Neudeck hier und drüben Limbsee gehörte –– ja, das gehörte auch einmal ihnen, jetzt haben's leider die Daliwitze in den Krallen ––, da vermachte er die beiden Güter seinen Verwandten von Beneckendorff mit dem Bedingen, Namen und Wappen des aussterbenden Geschlechtes der Hindenburgs neben dem ihrigen zu führen, was der König 1789 gnädig genehmigte. Woher der letzte Hindenburg die Güter hatte? Vom König natürlich! Für Tapferkeit, versteht sich! Sicher, denn als er neben dem großen Friedrich einmal in der Schlacht ritt, zerschlug ihm eine Kanonenkugel das Bein. Das war im Siebenjährigen Krieg. Für das zerschlagene Bein und für die Kugel, die seinem Herrn daneben gegolten, schenkte ihm sein gnädiger König die beiden Güter.
Nun lässt der Alte die Kinder eine Kassette bringen, die Schlüssel dazu und die Brille, und wenn er umständlich aufgeschlossen, liest er ihnen einen brüchig gewordenen Bogen vor, und wer von den Kindern schon lesen kann, liest über die Schulter mit: das letzte Schreiben jenes Mannes, dem sie die Güter und den Namen verdanken:
"Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die Du, Herr, an Deinem Knecht getan hast. Ich hatte nicht mehr denn einen Stab, als ich über die Weichsel ging, und nun bin ich zweier Güter Herr worden! Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass Du mich hierhergebracht hast! Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er wird mich hiernach aus der Erde auferwecken, und ich werde hiernach mit meiner Haut umgeben werden und werde mit meinem Fleisch Gott sehen."
Ganz anders erzählt die Großmutter und auch andere Dinge. Damals, als der Junge alle Ferien in Neudeck verbrachte, war sie erst um die Siebzig und überlebte noch lange ihren Mann. Die Hindenburgs und die Beneckendorffs waren ein gesundes Geschlecht, ohne Skrupel und Nerven, mit viel Landluft und wenig geistiger Tätigkeit, darum sind fast alle 70 und 80 und 85 Jahre geworden. Diese Großmutter, eine geborene Brederlow, hat unter allen Familienbildern den einzigen interessanten Kopf. Eine schöne, stolze, kräftige Frau mit dunklen Augen und einer Art von weißem Nonnentuch, die Hand auf der Bibel: so blickt sie den Beschauer entschlossen an, zusammenhaltend, rüstig, fest auf der wohlgerundeten Erde, Gestalt und Kopf aus Holz geschnitten, wie nach ihr der Enkel, der Feldmarschall. Vierzehn Kinder hat sie geboren und steht noch immer kerzengrade.
Den Enkeln zeigt sie das alte kleine Häuschen, in das sie als 17jährige Braut einzog, bis sie dann später das Gutshaus bauten. Da hat sie Rinder und Schweine zerlegen gelernt, den Flachs vom eigenen Feld, die Wolle von den eignen Schafen genommen und die Kleider für ihre Kinder selber spinnen helfen. Das Tischchen, an dem sie jetzt näht, hat keine Politur, sie zeigt's den Enkeln und sagt, wie sie daran mit dem heißen Messer Pflaster für die Verwundeten gestrichen habe in der Franzosenzeit; einer, den sie gepflegt hat, wäre lange dankbar geblieben. Aber ein anderer Offizier hat aus ihrem Strickkorb die kleine goldene Tabatiere ergriffen und vor ihren Augen eine Prise daraus genommen. Damals war sie sehr jung, aber sie sagt nicht, dass sie schön war; nur dass sie geklingelt hat und dem Diener befohlen, die Dose auszuschütten. So hochmütig waren damals die Franzosen.
Wenn sie mit der Alten nach der Kapelle hinübergehen, damit sie sieht, ob auch bei den Toten alles in Ordnung sei, da zeigt sie den Kindern das Grab der Schwester jenes letzten Hindenburg, der ihnen die Güter vermachte. Die hatte genau ihr Begräbnis bestimmt, bis wohin der Lehrer mit den Kindern mitzugehen habe, und dafür eine Stiftung von 500 Talern für ewige Zeiten gemacht, wovon der Schulmeister jedes Jahr fünf Taler für guten Unterricht in der Religion bekommen sollte. Dafür erzählen sich die Kinder im Dorf, die alte Barbara reite mit goldenen Sporen auf einem Ziegenbock im Gutshaus umher. Auch mit der Stiftung ging es nicht, wie die fromme Jungfrau sich's gedacht hatte. Die Behörden, gestützt auf ihre fünf Taler, wollten sich selber Vorbehalten, wieviel sie zahlten, und schrieben in einen Vertrag: "Wenn sich der Lehrer Schiller so führt, wie es einem guten Lehrer zukommt, erhält er am Schluss des Jahres ein generöses Douceur." Das war dem Großvater Hindenburg auch noch zu viel, und er schrieb mit eigener Hand hinein: "ein zwar unbestimmtes, aber generöses Douceur."
Diese Geschichte, die uns Hindenburgs Bruder in einem hübschen kleinen Buch überliefert, wird die Großmutter den Kindern nicht miterzählt haben. Aber grade all das, was Großeltern und Eltern ihren Kindern nicht miterzählen und was auch die Biographen des Feldmarschalls heute verschweigen, ist interessant, denn es beleuchtet das helldunkle Verhältnis des Junkers zum König, auf dem Macht und Leben beider in Preußen beruhte.
Nicht dass die Hindenburgs eigensüchtiger waren als ihre Standesgenossen; was ihre Familie meldet, findet in anderen seine Parallele. Seit Friedrich dem Großen gibt es drei Fakten, mit denen sie in den preußischen Geschichtsbüchern verzeichnet stehen. Das erste stellt die Schlacht bei Kolin dar, in der Friedrich 1757 entscheidend geschlagen wurde: der Kavalleriegeneral, der den von der preußischen Familie vergötterten König schlug, war ein Graf Beneckendorff, der, unter den Hohenzollern in Ansbach geboren, trotzdem in sächsische Dienste ging und als den Höhepunkt seines Lebens Jene Reiterattacke schildert, die die Schlacht gegen den Hohenzollern entschied. Ein zweiter, 1873 in Reval geboren, nahm russische Dienste, wurde Graf und General und schuf die berühmte zaristische Polizei, die Vorgängerin der "Tscheka".
Denn diese Familien waren gewohnt, dort zu dienen, zu schwören und zu kämpfen, wo ihnen Ruhm und Stellung winkten, gleichviel, wie die fremden Herren und Staaten mit dem in ihrer Familie angestammten König von Preußen standen. So gab es außer dem Sachsen und dem Russen dort auch einen, der um 1650 Königlich Polnischer und Schwedischer Kammerherr, sogenannter Starost geworden war, ein Beneckendorff, der die heute recht gefährlichen drei Namen trug, Israel, Köhn, von Jaski.
Den dritten und berühmtesten Fall hatte ein Vetter des Großvaters, der Major von Beneckendorff, zu verantworten, der die Festung Spandau bei Berlin gegen die Franzosen verteidigen sollte und dies am 23. Oktober 1806 in der üblichen Form versprach, er werde "die Zitadelle halten und dem Feind nur die Trümmer überlassen ... Am nächsten Tag berief er einen Kriegsrat, in welchem mit Ausnahme des Ingenieurhauptmanns Meinert alle Mitglieder für die Übergabe stimmten, und zwar... unter Angabe trauriger Ausflüchte. Major von Beneckendorff wurde 1808 zum Tode durch Erschießen verurteilt, jedoch vom König zu lebenslänglicher Festungsstrafe begnadigt".
Eine solche Episode wird einen jungen Mann derselben Familie im selben Beruf zur höchsten Anspannung aufrufen. Sicher hat der Verrat dieses Beneckendorff, den er später las, den Feldmarschall angespornt, den kriegerischen Ruf der Familie wiederherzustellen, die seit dem Offizier mit dem zerschossenen Bein keine Helden mehr vorzuweisen hatte.
Eine andere Episode aus der Familie liegt weit zurück. Der deutsche Ordensritter Beneckendorff hatte sich, um 1330 von einem Urlaub in die Heimat heimkehrend, eigene Pferde zum persönlichen Gebrauch mitgebracht. Der Ordensmeister hatte dies getadelt, weil kein Ritter Eigentum besitzen dürfe, und die Pferde in den Stall des Ordens geschickt. Darüber ergrimmte der Ritter Beneckendorff so sehr, dass er den Ordensmeister, als er von der Messe aus der Kirche trat –– nach anderer Überlieferung im Kampf ––, mit dem Dolch erstach; worauf er vom Papst Johann zum ewigen Gefängnis verdammt wurde. Diese Geschichte hat erst der Bruder des Feldmarschalls dem deutschen Volk erzählt und scheint, indem er sie ohne jede Kritik preisgab, damit zu beweisen, dass diese Rache eines Ritters einem Nachfahren noch 600 Jahre später nicht so übel gefällt. Der Feldmarschall aber, als ihn im Krieg sein Maler fragte, warum denn der Ahnherr den Meister erstochen, erwiderte nur: "Er wird sich wohl über ihn geärgert haben."
Denn was ein Junker über Recht und Gewalt, König, Freiheit und Dienst denkt und fühlt, ist von besonderer Art, und ohne es zu begreifen, kann man Hindenburgs Charakter nicht verstehen, der ganz typisch ist und fast gar nicht individuell. Aus der Psychologie des preußischen Junkeroffiziers ist Hindenburg vor seinem Ruhm einzig und ist er vollständig zu erklären.
Aus der Armut des Bodens, aus der gefährlichen Lage zwischen fremden Staaten ergab sich schon für die ersten Kurfürsten von Brandenburg die Nötigung, dieses Lehnsland, in das sie aus dem fruchtbareren Franken gezogen, als Militärkolonie zu behandeln, um, etwa wie die Ägypter aus dem Sudan, vor allem Soldaten daraus zu ziehen. Da ihnen zuerst der Kriegsdienst galt, dann erst der Ackerbau, entwickelte sich der Lehnsdienst hier reiner als anderswo zum Verhältnis des gegenseitigen Schutzes. Volksfremde Fürsten, Erben und Eroberer konnten das Brot für ihr Land vom Bauern nur erzwingen, wenn sie ihn mit Hilfe ihrer Ritter in Zucht und Gehorsam hielten. Je weiter sie sich durch das kulturlose Land östlich der Elbe nach Russland hin ausdehnten, umso weniger Widerstand war unter diesen dumpfen, beständig unterdrückten Bauern und Bürgern zu überwinden.
Die Kultur, die der preußische Adel in die eroberten östlichen Provinzen gebracht hat, konnte das Maß seiner eignen nicht übersteigen, und da die preußischen unter allen deutschen Adligen von alters her am wenigsten Kultur hatten, musste die Kolonisierung des Ostens auf dem Niveau der Junker bleiben. In diesem einzigen Teil Deutschlands, dem Kultur und Wissenschaft bis in die Zeit des Rokokos fehlten, konnten die Junker regieren, in einem Staat, den Lessing noch unter Friedrich dem Großen "das sklavischste Land Europas" genannt hat. Sehr früh, schon als sich jener Adel festsetzte, waren die Bauern der sandigen Mark Brandenburg zu Tausenden über die Elbe nach Osten gewandert, nicht wie die Pioniere Nordamerikas, weil andere Ansiedler nachdrängten, sondern um einen Rest von Freiheit zu retten: auf der Flucht vor den Junkern.
Unter den Fürsten, die sich aus den Nöten des Dreißigjährigen Krieges erhoben, hatten es die Hohenzollern am besten, eben weil ihr Land am meisten zerstört, jede Kraft und Lust zum Widerstand gebrochen, jeder willkommen war, der einigen Schutz vor den raubenden Landsknechten versprach. So wurden die stehenden Heere, mit denen sich im 17. Jahrhundert die Fürsten zu schützen suchten, in dem verwüsteten und wehrlosen Brandenburg und Preußen von den Bürgern begrüßt, während sie in Österreich verhasst waren, wo sich der Besitz der alten Landstände erhalten hatte. Die absolute Macht, die ein stehendes Heer dem Landesfürsten gab, ist in Preußen am spätesten –– eigentlich ist sie nie überwunden worden.
Hier hatten die Kurfürsten und Könige sich ihren Adel zum Schutz gegen ihr Volk auf russische Weise geschaffen, indem sie, wie Zar Nikolaus, die Familien ohne Heeres- oder Staatsdienst für erloschen erklärten, andere tüchtige Diener dagegen adelten, so entstand das Paradoxon des "Dienstadels": plötzlich bekam einer nach rückwärts Ahnen, während der Mensch sonst nur nach vorwärts Kinder zu bekommen pflegt. Da drängten sich denn die herumliegenden, rasch verarmten "Krautjunker" zu einem Dienst, der leicht, einträglich und ehrenvoll war, und da sie alle gut reiten und schießen, auch alle das Kommandieren gelernt hatten, waren sie zu Erziehern und Führern kleiner Trupps geeignet, bewährten sich im Krieg, bekamen dann zum Dank für eine Reiterattacke ein neues Gut im Osten geschenkt, fuhren im Winter mit ihren Frauen zum Hofball nach Berlin, schimpften untereinander auf den König, schwärmten aber doch nach der Parade beim Burgunder von künftigen Schlachten. Wenn sie dann ihren Entschluss bekundeten, in den Krieg zu ziehen, das heißt den Beruf auszuüben, für den sie bezahlt wurden, so nannten sie das: für ihren König fallen.
Dafür setzten diese Junker und "Krippenreiter" ihre Interessen drohend auch beim König durch, und wenn sie anfänglich fünf Hufen frei von Zins haben sollten, erhöhten sie dieses Recht bald auf 25, ohne dass der Landesfürst wagen konnte, sie zu zwingen, denn andere Ritter als diese hatte er nicht. Er musste ihnen auch die "Gutsherrlichkeit" kodifizieren, die Verfügung über den Bauern, der alle Lasten trug und vor dem Neger in Virginia unter den Baumwoll-Baronen nur das voraushatte, dass er nicht getötet und verkauft werden durfte.
Denn bis auf den heutigen Tag heißt das Rittergut in Preußen "Dominium", Herrschaft, und bis vor 100 Jahren durfte kein Bauer seine Scholle verlassen, heiraten, ein Handwerk ergreifen, eine Kuh verkaufen, eh es der Junker erlaubte. Dieser durfte ihn prügeln, ins Gefängnis stecken, wenn er etwas gegen die Bräuche tat, und wenn er sich brav verhielt, so musste er dem Edelmann alles versteuern, Schafe und Bienen, Flachs und Hanf, das Wasser im Bach, den Docht auf der Lampe, sogar den Sumpf vor seinem Haus: 750 Nummern feudaler Herrenrechte hat man zusammengestellt. Dem Bauern blieb dagegen kein anderes Recht, als sonntags für seine Herrschaft zu beten. Mit Bürgern durfte der Junker nicht umgehen, wie's ihm gefiel: trat er in eine Zunft ein, zu deren einer auch ein Teil der Gelehrten zählte, nahm er ein Mädchen aus dem geringen Bürgerstand, so verlor er den Adel.
Diese Rechte hat Hindenburgs Großvater noch in der Jugend ’ ausgeübt, von ihrem Abbau durch die Zeit hat er dem Enkelsohn erzählt. Musste der Alte, erschreckt durch diese demokratischen Unsitten, ihn nicht lehren, den Standesstolz zu wahren, ihm des Königs Grundsatz einprägen, Offizier dürfte nur der Adlige werden, um jede Revolte von unten zu ersticken?
König Friedrich nannte in seinen Schriften "die Anstellung bürgerlicher Offiziere den ersten Schritt zum Verfall des Staates". Je nötiger unter dem Druck fremder Völker eine starke Armee wurde, umso mächtiger wurden die Junker, denen der König Landgüter im Osten schenkte; man hat die neuen adligen Kompanie-Chefs sogar Unternehmer in einer Waffen-Genossenschaft genannt, denn jede neue Kompanie, die die Soldatenkönige aufstellten, bedeutete für diese Kaste ein neues Rittergut: daher der Kriegsgeist, die Beutelust, daher die Königstreue.
Dieser neue Dienstadel, der ein Drittel des preußischen ausmachte und dem König im großen Ganzen gehorchte, stellte allein den vornehmen Faktor im Staat dar, während Bürger und Bauern samt Universität, Musik und Handwerk etwas ziemlich Verächtliches, zumindest Inferiores waren, gut genug, Steuern zu zahlen, zur Führung in Staat und Armee aber nicht zu gebrauchen. Diese Kerls wurden Kanonenfutter genannt, seit Friedrich Wilhelm I. mit seinem Kantonssystem eine Art Fronde oder Menschensteuer eingeführt, das heißt, den Heeresdienst des Bürgers, wenn er nicht zahlt, erzwungen und damit die Dienstpflicht vorbereitet hatte. Als durch die Dritte Teilung Polens sich Preußen noch weiter vergrößerte, fanden die Krautjunker arme Leute zum Exerzieren vor, denen sogar sie an Kultur überlegen waren.
Da diese Kaste das Monopol der Offiziersstellen besaß, brauchten sie sich nur noch gegen die Konkurrenz von Talent und Tatkraft ihrer Freunde zu schützen, indem sie den König zur Einhaltung der sogenannten "Anciennität" zwangen. Ein paar Dutzend Familien, die im Staat ihren Pensionsvater sahen, liefen die Bahn nach oben nur auf Grund ihres Lebensalters, und kam einmal ein bürgerlicher Offizier dazwischen, so wurden sie durch ein "Spring Avancement" über dessen Kopf weggehoben, so wie der Springer beim Schach.
Im wachsenden Heer stiegen zugleich die Einnahmen der Junker. Das Pauschale, das jeder für seine Kompanie aus der Kriegskasse vom König erhielt, wurde stark von ihnen eingespart. Sie beurlaubten den größten Teil ihrer Rekruten für viele Monate, bekamen dadurch ihre Hörigen wieder, die ihnen den Acker bebauten, machten die Uniformröcke enger, strichen die Westen, schnitten die Ärmel oben ab, führten "Tote Seelen" weiter in ihren Fouragelisten, weshalb der Feldmarschall von Boyen die preußischen Junkeroffiziere um 1780 "nicht mehr Soldaten, sondern wuchernde Krämer" nannte. Gegen ihre Macht konnte nicht einmal der Alte Fritz angehen, und als er nach den Kriegen die berühmten 24 Millionen Taler zum Wiederaufbau hergab, eine Art innerer Reparation, bekamen die Städte und Bauern so wenig, die Junker so viel wie um 1930 bei der sogenannten "Osthilfe". Da sie Jahrhunderte regierten, wurden sie die gerissensten Politiker in Preußen. Sie betrogen die befreiten Bauern schon nach fünf Jahren um ihre Rechte. Mit Trotz und Schlauheit der preußischen Junker ist seit 400 Jahren kein König, keine Regierungsform fertig geworden.
Kein Bürger hat die Junker tiefer begriffen als der Reichsfreiherr vom Stein, der ihnen an Zahl und Verdiensten seiner Väter nicht nachstand, aber als Christ und Edelmann von Königen und Fürsten mehr verlangte, nicht weniger als vom Bürger und darum 1808 schrieb: "Der Adel im Preußischen ist der Nation lästig, weil er zahlreich, größtenteils arm und anspruchsvoll auf Gehälter, Ämter, Privilegien und Vorzüge jeder Art ist. Eine Form seiner Armut ist Mangel an Bildung, Notwendigkeit, in unvollkommenen Kadettenhäusern erzogen zu werden, Unfähigkeit zu den oberen Stellen ... Diese große Zahl halbgebildeter Menschen übte nun ihre Anmaßungen zur größten Last der Mitbürger in ihrer doppelten Eigenschaft als Edelleute und Beamte aus."
Aber auch der Freiherr vom Stein blieb machtlos. Der Groll der Bürger und Bauern gegen sie wuchs stets bis zu einer gewissen Windstärke, um dann aus Ohnmacht wieder abzuflauen. Als einige von ihnen durch Verrat und Feigheit 1806 Napoleon das Land und die Festungen überließen, war die Freude der Bürger über die Niederlage der "Federbüsche" groß; als sie im November 1918 sich die Abzeichen von der Achsel reißen ließen, glaubte das Volk ihre Vorherrschaft gebrochen. In beiden Fällen war es im Irrtum.
Doch zuweilen gingen aus seltenen Kreuzungen von Junkern und Bürgern bedeutende Führer hervor, die bei glücklicher Mischung, die besten Züge beider Klassen vereinigten: Bismarck, Gneisenau, Bülow, alles Junker mit bürgerlichen Müttern, hoben sich durch die geistige Erziehung ihrer mütterlichen Vorfahren aus der Schicht ihrer Standesgenossen empor.
Auch Hindenburg stammt zur Hälfte von Bürgern, und die Verlegenheit der deutschen Biographen wird nur wenig dadurch gemildert, dass sie seine Mutter "ein Soldatenkind" nennen dürfen und seinen Großvater "Generalarzt der Division". Weder der Feldmarschall noch sein Bruder, die sich beide über ihre adligen Vorfahren verbreiten, schreiben in ihren Memoiren ein Wort vom mütterlichen Stamm; erst nach dem Tode Hindenburgs hat ein Adelsforscher diese Seite untersucht. Keine Erzählung aus ihrer Jugend weist darauf hin; auch Großmutter Schwickhardt sprach nur von Heldentaten und wie ihr Mann über die Beresina gegangen sei. Dabei hatten diese Bürger nichts zu verheimlichen.
Unter diesen bürgerlichen Vorfahren Hindenburgs sind Maurer, Tuchscherer, Heringsfänger, Seiler, Hufschmiede, auch Pfarrer gewesen: alles westdeutsche Katholiken, die erst später nach dem Osten kamen. Der wichtigste dieser Vorfahren war der Urgroßvater des Feldmarschalls, der Grenadier Schwickhardt, denn von ihm und nicht von den kürzeren Junkern hat er die Körperlänge geerbt. Dieser Vorfahr hatte seine Laufbahn wesentlich seiner Figur zu verdanken, da er mit 1,86 Meter Höhe unter den Riesen Friedrichs des Großen diente; 39 Jahre war er Grenadier, später Totengräber, und zwar als Katholik auf einem protestantischen Friedhof in Berlin. Diese Kleinbürger gingen mit der jeweils förderlichen Religion, so wie die Junker mit dem jeweils förderlichen Fürsten gingen; lauter Realisten mit und ohne Wappen. Jener Grenadier hatte Marie Puhlmann, Leibwäscherin bei der Prinzessin Wilhelmine, zur Frau genommen, und der Stammforscher von Gebhardt fügt hinzu: "Wann und wo Schwickhardt, der Grenadier, sie geheiratet hat, ist nicht festzustellen. Sein in Potsdam 1773 geborener Sohn Johann Franz wird im Garnison-Kirchenbuch noch als unehelich bezeichnet, während dieser Vermerk bei dem 1780 geborenen Karl Ludwig, dem Großvater des Feldmarschalls, von alter Hand durchstrichen ist."
Dieser, der Arzt und später Militärarzt wurde, übernahm in der Schlacht bei Kulm gegen Napoleon 1813 die Führung der Kompanie und bekam zur Belohnung vom General zwar keine Güter in Ostpreußen, doch eine Kassette mit Silberzeug für seine künftige Braut geschenkt. Das ist das einzige, was seine soldatischen Enkelsöhne von ihm erzählen, obwohl er nur an diesem einen Tag seines Lebens Menschen getötet, aber an tausend anderen Tagen Menschen geheilt hat.
So sind die beiden Urgroßväter Hindenburgs wahrscheinlich im selben Potsdamer Schloss einander zuweilen begegnet: der eine, riesige, stand am Tor stramm und präsentierte das Gewehr, wenn der andere aus seiner Kutsche stieg, um zum Hofball beim König zu gehen. Die eine Urgroßmutter wusch die Wäsche der anderen, die sie, als Gast im Schloss, morgen tragen wollte. Das merkwürdige war nur, dass sie einander nicht kannten.
Von beiden Eltern, dem Lieutenant und späteren Major von Hindenburg und von der Tochter des Arztes, lernten die Kinder, von einer kleinen Garnison in die andere verschlagen, Religion, etwas Geographie und Französisch, vor allem aber, wie Hindenburg im Alter schreibt, "Liebe zu dem, was sie als die stärkste Stütze des Vaterlandes anerkannten, nämlich zu unserem preußischen Königtum." Auch die Eltern erzählten gleich den Großeltern aus ihrer Jugend nichts als Kriegsgeschichten –– es müssten denn die beiden Brüder Hindenburg, die nur solche nacherzählen, alles andere vergessen haben. Als der Feldmarschall ein Jahr alt war, in der Revolution von 1848 in Posen, wo er geboren ist, fühlten sich alle Offiziere bedroht: "Für jeden war ein Meuchelmörder gedungen, der im passenden Augenblick sein Werk tun sollte. Wenn die Eltern abends ausgingen, schlich ihnen, sich im Schatten der Bäume haltend, eine unheimliche Gestalt nach." Und als alle für die siegreiche Revolution schwarz-rot-gold flaggen und die Fenster illuminieren mussten, ging die Mutter in ein Hinterzimmer, setzte sich an die Wiege des Kindes und dachte: Heut ist der Geburtstag des Prinzen von Preußen, "so dass die Lichter an den Fenstern im Vorderzimmer in ihrem Herzen diesem galten".
Mit diesen, in früher Kindheit erzählten Erinnerungen wurden die Knaben zum Hass gegen jede Freiheit des Volkes erzogen, mit Leidenschaft gegen alles erfüllt, was gegen den König und ihre Kaste sich zu erheben wagte und Schwarz-Rot-Gold trug. Zugleich lernten sie aber, wann man dem siegreichen Gegner seinen Gefallen tun durfte: man stecke die Lichter im Fenster an, wie es die Mutter in ihrer Sorge an jenem Revolutionstag getan, man darf es ruhig tun, wenn man dabei nur was Loyales denkt.
Kindern, die jeden Morgen den Vater seine Kompanie drillen sahen, die ihre Kameraden immer wieder verlassen mussten, weil der Vater versetzt wurde, prägte sich dieser Wechsel als eine Notwendigkeit ein, nicht düster, aber schicksalsvoll, und wenn sie traurig fragten, warum sie schon wieder packen mussten, so hieß es einfach: Der König will's!
In der Unruhe einer solchen Kindheit, die kein Verweilen erlaubte, blieb als Heimat nur das Stammgut Neudeck, das ihnen die Ferien bedeutete. Dorthin hatte sich nach dem Tode des Großvaters der Vater im Jahre 1863 zurückgezogen, nach 30 Dienstjahren pensioniert; dort waren die Kinder glücklich, denn dort waren sie frei und zugleich kleine Herren, und der Zusammenhang zwischen Dienst und Herrschaft wurde ihnen am Beispiel des Vaters deutlich. Weil er von diesen Rittergütern stammte, hatte er in einem vornehmen Regiment Offizier werden dürfen, zwar wenig erworben, das wenige aber über seinen Abgang hinaus sicher, sein Leben lang vor Not geschützt, von Fünfzig an auf seinem Gut schaltend, eigentlich immer arm, doch stets mit den Allüren der Herrschenden.
Krieg hatte der Vater nicht erlebt, und als er den Dienst verließ, ergriff er die gebietende Stellung im kleinen Kreis wieder, aus der er kam. Dies alles hatte den König zum unsichtbaren Motor. Das Wechselspiel von Gehorchen und Befehlen, von Dienst und Herrschaft, welches das Junkerleben kennzeichnet, stellt sich dem heranwachsenden Knaben unter dem Zeichen des Königs dar, von dem die Gaben des Lebens ausgingen und dem dafür dieses Leben gewidmet wurde. Der gesunde älteste Sohn hatte eine vorgezeichnete Bahn im Dienen und Herrschen: mit elf Jahren verließ er den bürgerlichen Weg und schlug den des geborenen Gardeoffiziers ein.
Diesen Abgang ins Kadettenhaus muss der ernste Knabe sehr schwergenommen haben, denn er schrieb vor der Abreise spontan sein Testament. Hier haben wir ein Testament Hindenburgs, das unbedingt echt ist, denn in diesem Fall besitzen wir die Urschrift. Darin verteilte er sein Spielzeug unter die Geschwister und bat, einem armen Kameraden auch weiterhin eine Semmel zum Frühstück abzugeben. "Dass ich dies wahr und wahrhaftig geschrieben habe, bescheinige ich hiermit." Dann aber schrieb er in die Ecke darunter: "Friede und Ruhe bitte ich mir für immer aus."
Dieser Zusatz, mit dem er auf rührende Weise aus der Rolle des Testators fällt, gibt schon den Grundzug seines Wesens wieder: Wille zur Ruhe, Gelassenheit, keine Aufregung, dies und die grandiose Gesundheit, die er durch 80 Jahre bewahrte, bilden das Fundament, auf dem er seine nervenlose Existenz aufbauen konnte.
Es heißt, der Soldatenkönig habe das Kadettenkorps (1717-1919) nur neu begründet und in Berlin vereinigt, um seinen "effeminierten" Sohn, den späteren Großen Friedrich, für das Militär zu interessieren, das dieser als Jüngling verachtete. In acht preußischen Anstalten wurden die Jungen bis zum 17. Jahr, dann in Berlin erzogen. Dort brachten die reichen Adligen ihre zweiten und dritten, die armen oft alle Söhne unter, denn da sie dann mit 18 Jahren unbedingt Lieutenants wurden, gingen sie dem Vater von der Tasche, während sie einen Studenten bis 25 und länger erhalten mussten. Ein Junker sank zum Diplomaten oder gar Gelehrten nur herab, wenn er körperlich nicht ganz intakt war.
Der Reiz für den Jungen, der Kadett wurde, lag also nicht in glänzender Zukunft, sondern in sicherer Versorgung. Um diese Lebensform aus ihrer dienstlichen Eintönigkeit zu heben, wurde dem Jungen eingeprägt, er erhielte bald die höchste Ehrenstellung im Staat, zu der nur der Adel berufen war. In der Tat hat die Armut des preußischen Offizierskorps während seiner besten Zeit, etwa von 1770 bis 1890, das große Äquivalent der Ehre als zureichend empfunden; da sie die unbestrittenen Herren im Land waren, akzeptierten sie ein karges Leben. Die "Offiziersehre", die mit der Soldatenehre nicht zusammenfiel, gab ihnen Ehrenrat und Ehrengerichte, die auch "Meinung und Ansichten" durchaus im Sinne der Inquisition verfolgten, denn das Offizierskorps war eine Zunft, wenn auch keine freiwillige. Je höher ihr Standesgefühl gezüchtet wurde, umso größer wuchs in ihnen die Verachtung des Volkes. "Das Bewusstsein eines besonderen, persönlichen Verhältnisses zu seinem König, der Vasallentreue", –– schreibt Hindenburg in seinen Memoiren, " –– durchdrang das Leben des Offiziers und entschädigt ihn für manche materielle Entbehrung... Das Wort 'Ich diene' hatte dadurch einen ganz besonderen Klang."
Als er Kadett wurde, 1859, waren die meisten Offiziere der preußischen Armee von Adel; zu den höheren Posten und zu den vornehmen Regimentern war kein Bürgerlicher zugelassen. Von 2900 Offizieren waren 1800 aus dem Kadettenhaus hervorgegangen. Von diesen 2900 waren 2000 von Adel; prozentual zur Zahl der Adligen in Preußen wären es 80 gewesen. Der Adel war 25mal so stark vertreten wie das Bürgertum. Bürgerliche Generale gab es nicht. Im Ersten Garderegiment zu Fuß waren alle 85 eigentlichen Offiziere von Adel, die sechs Ärzte aber, die Offiziersrang hatten, alle bürgerlich. Im selben Jahr 1859 waren von den 94 Offizieren, die das französische Erste Garderegiment zählte, elf Adlige. In Preußen lebte damals der vierte Teil der gesamten 68 000 Adligen vom Militärbudget, das also die verarmten oder untätigen Adligen von Staats wegen versorgte. Wenn später, um 1900, einmal ein Bürgerlicher General wurde, so wurde er schnell geadelt; die Badenden warfen dem armen Adam eine Badehose zu.
Die Volks Verachtung des Kadettenhauses wird etwa in Roons Biographie geschildert: "Im Kadettenkorps atmete er eine Luft, die von den politischen Ideen der Reformzeit und der Freiheitskriege nicht einen Keim enthielt; man warnte die Kadetten vor den Idealen der Burschenschaften, ihrem Freiheitsschwindel..." Als strenger Absolutist verachtete Roon die politischen Bestrebungen des deutschen Volkes, schilderte noch drei Tage vor dem Untergang des absoluten Regimentes, im März 1848, den Aufstand des Volkes als "das Treiben bezahlter und betrunkener Handwerksburschen" und nannte das Frankfurter Parlament eine politische Menagerie.
Im selben Geist wurden um 1860 die Kadetten erzogen, mit besonderem Misstrauen gegen den gemeinen Soldaten; ein Freiherr von Manteuffel nannte es einen "gefahrvollen, ja unerträglichen Zustand, das Schicksal Preußens und seines Königtums von dem mehr oder weniger guten Willen von 50 000 Bauernjungen abhängig zu machen."
Was das Kadettenkorps an trefflichen Gefühlen heranzog, Korpsgeist und Kameradschaft, Tugenden, durch die man sich beleben, von denen man aber nicht leben kann, das war nicht der Kern, der hieß: Gehorchen und Befehlen. Indem der Gehorsam bedingungslos gefordert wurde, bis zur Auslöschung der Persönlichkeit, wurde der Wunsch zu befehlen herangezüchtet; alle schweren Stunden und Jahre im Kadettenhaus wurden erträglich, wenn man sich den Augenblick vorstellte, von dem an man selber befehlen würde, wären es auch nur 20 Mann. Indem eine spartanische Erziehung nur die Söhne des Adels traf, der sich für auserwählt halten durfte, fiel jede Demütigung fort, und der Junge, der angeschrien und eingesperrt wurde, konnte sich immer noch sagen: Wir sind die Edelsten der Nation, die große vorletzte Stufe der Pyramide, auf welcher der König steht.
So erzog das Kadettenhaus durch Gehorsam zum Befehlen, schloss Ideen aus, um Charaktere zu bilden, und nannte das Ganze Dienst. Damit wurde die Grundlage für den Charakter nicht eines siegenden, sondern eines dienenden Soldaten gelegt; die Begriffe Pflicht und Mut wurden herangezogen, und man nannte das Ganze "ein Leben für König und Vaterland". Da der König durch Gottes Gnade regierte, waren die mittelalterlichen Verbindungen von Thron und Altar hergestellt, der Dienst am König war zur religiösen Handlung gesteigert, die Stufenleiter zu Gott hin war gebaut. "Die Anschauungen", schreibt Hindenburg in seinen Memoiren, "die ich in der großen Schule der Pflichterfüllung, im deutschen Heer, gewonnen habe, ... gipfeln in dem Satz, dass Pflicht vor Recht geht und dass jederzeit, besonders aber in den Tagen der Not, einer für alle und alle für einen einstehen müssen." Diese Formel, die an die Gebote geistlicher Orden erinnert, nur dass an die Stelle Gottes hier der König trat, zeigte zugleich die befohlene Blindheit des Gehorsams an und durchdrang schon die Knaben mit dem Gefühl, dass sie nur nach unten, niemals nach oben Verantwortung übernehmen müssten. Auf solchen moralischen Grundlagen erzog das Kadettenhaus vorzügliche Männer des Dienstes: wenn sie von Natur schöpferisch waren, mussten sie ihre Gaben verheimlichen, bis sie sie später im Generalstab entwickeln durften. Das Kadettenhaus hat nur Feldherren zweiten Ranges hervorgebracht.
Wie verging ein solcher Tag, wie er Hindenburgs Jugend sieben Jahre lang, mit Ausnahme der Ferien, bestimmte?
In einem kalten Schlafsaal erwachten etwa 30 Kadetten früh um sechs in ihren schmalen, harten Betten vom Signal der Reveille, wuschen sich mit eiskaltem Wasser, fuhren schnell in ihre Kleider, liefen unter den ersten schallenden Kommandos –– alle Räume dieser steinernen Kasernen hallten durch ihre Leere wider –– zum ersten Turnen in den Hof, immerfort angetrieben, denn von jetzt an musste 15 Stunden lang alles schnell gehen. Eine dämonische Eile schien die Lehrer in ein immer erhöhtes Tempo zu treiben, der Zustand drohender Gefahr wurde beständig suggeriert, jede Pause der Betrachtung oder des Denkens war verboten. Dann zur Mehlsuppe, Butter in schmale Streifen abgeschnitten, auf Kommando werden die Teller an die Suppenschüssel geschoben, worauf das eigentliche Essen nur drei bis vier Minuten dauern darf. "Die jüngeren Kadetten", schreibt Hindenburgs Bruder, "mussten sogar Brot, das sie von den Mahlzeiten gesammelt hatten, in einen Kasten brocken, den sie auf dem Schoss hielten, damit es bei einer Besichtigung durch den Offizier nicht bemerkt wurde. Dies wurde dann zum Frühstück im Esssaal in die gemeinsame Suppenschüssel geschüttet und mit der Mehlsuppe zu einem Pams verrührt." Diese und die beiden anderen Mahlzeiten waren so schnell, die Räume so kalt, dass alle Kadettenbriefe von Essen und Wärme zu Hause träumen und auch der junge Hindenburg sich schon vor Abreise in die Ferien besondere Speisen bei der Mutter erbittet.
Die Schulstunden in den Zimmern, die je sechs bis zehn Kadetten bewohnen, ohne darin zu schlafen, mit einem dem Gymnasium ähnlichen Lehrplan, werden von Offizieren gegeben, nur der Pfarrer ist ein halber Offizier. Der kahle Raum enthält außer dem Arbeitstisch und Schränken und kleinen Eisenofen, einen Spucknapf, eine Uhr und das Bild des Königs. Während des Unterrichts reißt ein höherer Offizier die Tür auf, alle Stühle knallen zurück, der älteste Kadett meldet brüllend: "Stube belegt mit acht Kadetten. Acht Kadetten zur Stelle", alle Bücher knallen zusammen, der Offizier reißt irgendeinen Schrank auf, prüft, ob in den vier Fächern, die jeder für seine Sachen hat, alles in Ordnung liegt: im zweiten die Waffenröcke gefaltet, Futter nach außen, Ärmel nach innen, im dritten Drillichzeug, alles gefaltet, im vierten Bürsten, Kamm, Nähzeug.
Das oberste Fach jedes Schrankes bildet den Winkel, in dem sich die Phantasie des Kadetten in bestimmten Grenzen äußern durfte: das Nippes-Fach, wo Fotos, Muscheln und Andenken aufgehoben werden. "Ich will mir", schreibt der 13jährige Hindenburg nach Hause, "meinen Putzspind jetzt so einrichten: hinten an der Wand einen großen preußischen Adler, in der Mitte auf einer Erhöhung den Alten Fritz mit seinen Generalen, am Fuß derselben eine Menge Schwarzer Husaren, vor das Ganze eine Kette gezogen, hinter welcher Kanonen stehen, und vor der Kette zwei Schilderhäuser und zwei Grenadiere zu Friedrichs des Großen Zeiten, doch hierzu fehlen mir die Sachen; ich hoffe auf Weihnachten."
Liegt oder steht das Kleinste nicht in den rechten Winkeln oder Parallelen, so reißt der Offizier alle Kleider aus dem Schrank und anderen sie unter beständigem Anschnauzen von den Kadetten in einer Minute wieder einräumen. Lacht einer, oder sein Heft hat einen Klecks, so muss er zur Strafe das Putzbrett seines Schrankes mit den zerbrechlichen Nippesfiguren oder den wackligen Bleisoldaten herausnehmen, Kniebeuge machen, mit einem Zirkel zwischen den geschlossenen Fersen, dessen andere Spitze an seinem Hinterteil anliegt, drei Minuten unbeweglich das Brett halten, auf dem nichts klirren darf. Zittert er, so sticht ihn der Zirkel oben oder unten.
Dreimal am Tag muss jeder Kadett seine Stiefel und die Metallknöpfe seines Rockes putzen; dann tritt beim Exerzieren der Offizier vor ihn hin, prüft, ob er sich in jedem Knopf spiegeln kann, dreht einen, der ihm nicht fest zu sitzen scheint, so lange herum, bis er abreißt. Plötzlich werden alle vom Hof in ihre Stube gejagt, müssen nach vier Minuten in einer anderen Uniform wieder zur Stelle sein, ausgerichtet, und der Offizier prüft mit dem Zentimetermaß, ob die schwarze Halsbinde, die ins Innere des Kragens gesteckt wird, anderthalb Zentimeter vorragt wie vorgeschrieben oder zwei, was strafbar ist.
Das beständige Stürzen, Brüllen, Knallen, Schnarren halt alle den Tag über in Bewegung und Furcht, alles hallt wider von: "Stillgestanden! Richt' euch! Augen rechts! Erste Kompanie stillgestanden! Richt' euch! Rührt euch!" Bei "Stillgestanden!" werden die Füße nicht neunzig, sondern fünfundachtzig Grad gegeneinandergestellt, bei "Hände an die Hosennaht" wird der Mittelfinger an die Naht gelegt, Brust heraus, Bauch herein, Kinn an die Binde, Augen fixieren, Schulter zurück, ganzer Körper in grader Linie leicht vornüber geneigt. Beim Exerzieren in Abteilungen immer acht Schritte Abstand, bei Ehrenbezeigung drei Schritte vor, drei zurück, Hand an die Mütze fliegend. In drei Minuten müssen achtzehn Knopfe so geputzt werden, dass sie spiegeln, aber kein Fleck vom Putzpulver auf dem Tuch entsteht; mit Bringen, Holen, Anziehen werden die Jungen über die Treppen gejagt, Kirchgang, Spaziergang, alles muss klappen, auf die Sekunde, auf den Zoll, nichts darf bequem sein, alles in beständiger Spannung, als wären die letzten Meldungen vom Feind zu überbringen. Da zittern die Beine, die Hände schwitzen, Wut durchwühlt das junge Herz, aber der Mund muss schweigen.
Wenn sie dann abends eine halbe Stunde Briefe schreiben durften, die der Zensur unterliegen, wird getrommelt, im Zuge nach dem Schlafsaal marschiert, in drei Minuten muss alles im Bett hegen, die Sachen parallel auf dem Stuhl neben jedem Bett, kein Wort ist erlaubt. Der Offizier, der durch ein Loch im Holzverschlag alle übersehen kann, kommt plötzlich in der Nacht, findet eine Hose schräg gelegt, reißt alles durcheinander und lässt den Jungen im Hemd seine Kleider zusammenlegen.
Ist es ein Wunder, dass der junge Hindenburg, so berichtet der Bruder, einmal am Ende der Ferien das Gut durchaus nicht verlassen will und heulend erklärt: Nie wieder! Dafür kann er das nächste mal nach Hause schreiben, sie hätten hohen Besuch gehabt, den Kronprinzen, und fügt hinzu: "Wir sahen fast alle bei dieser Gelegenheit zum ersten Male Mitglieder unseres Königshauses. Noch nie hatten wir beim Parademarsch unsere Beine so hoch geworfen." Denn das ist die Form, in der der Kadett seine Gottheit verehrt, den König.
Mit Sechzehn darf er ihn leibhaftig sehn: in der Berliner Hauptanstalt. Zunächst aus der Ferne, wie sich s für einen Gläubigen ziemt. Als Leibpage der Königin-Witwe erhält er eine Uhr, die er sein Leben lang trägt. Dann "durfte ich endlich bei den Frühjahrs- und Herbstparaden meinen Allergnädigsten Herrn, König Wilhelm L, sehen". Als er aber sein erstes Offiziersexamen bestanden hat, in dem viele Kameraden durchfallen, werden die Glücklichen dem König vorgestellt und berichten über diesen schönsten Augenblick. Bismarck, 1863 die wichtigste Person in Preußen, fehlt in den Briefen ganz; nur immer König und Prinzen. Das Misstrauen dieser Junker gegen ihren abenteuerlichen Standesgenossen kündigt sich schon in diesem Schweigen an, und was den Geist überhaupt betrifft, den en bloc gering zu achten zum guten Ton gehört, so spottet der sechzehnjährige Hindenburg über seinen lesenden und nachdenklichen Bruder, über seine "gelehrten Studien... Außerdem wirst du hoffentlich den Geheimrat und Gutsbesitzer fahrenlassen und Vorliebe für den Soldatenstand gewinnen".
Zu dieser Zeit, als er als Stubenältester zum ersten Male befiehlt, statt nur zu gehorchen, wird er von einem Kameraden aufs freundlichste geschildert: "Streng gegen sich selbst, wohlwollend, gütig gegen seine Untergebenen. Jeder Neue fühlte sich unter seinem Schutz wohl und geborgen. Das war nicht auf allen Stuben derartig. Er schloss seine Ermahnungen häufig mit den gewichtig ausgesprochenen Worten: Sie wollen Offizier werden! Er hatte keinen aktiven Humor, aber viel Sinn und Verständnis für fröhliche Laune und einen guten Witz... und war von der Bedeutung seines stolzen Berufes durchdrungen."
In diese Welt des Siebzehnjährigen schlägt zum ersten Male die Trommel des Krieges, als er drei ältere Kadetten in den dänischen Krieg ziehen sieht und dann hört, wie sie dabei waren, als die Düppeler Schanzen erstürmt wurden; einer schickte seine Sachen zurück. "Den Rock, den er beim Sturm getragen" –– schreibt Hindenburg nach Hause ––, "trägt jetzt ein Unteroffizier, damit wir ihn stets vor Augen haben. Prinz Karl erzählte, er habe nach dem Sturm einen Bombardier gefragt, ob er müde wäre, worauf er geantwortet hat, wie kann ich müde sein, wenn unsere Offiziere so tapfer sind und unsere jungen Kadetten so mutig allen voraneilen! Der König hat befohlen, dass alles dies in unser Archiv eingetragen werden soll."
Mit so naiver Frische, mit den typischen Anekdoten von Ehre, Mut und Wetteifer betrachtet der junge Hindenburg den Krieg zuerst aus der Ferne. Kein Wunder, dass er auf einen neuen hofft, bald soll er ihn haben. Denn kaum hat der achtzehnjährige Lieutenant im Neudecker Saal vor dem Spiegel seine neue Gardeuniform probiert, mit Stolz und sicher auch mit Sorge von den Eltern geprüft, so wird er einberufen, denn wir schreiben 1866, und Bismarck hat beschlossen, Deutsche auf Deutsche schießen zu lassen. Was Hindenburg in den wenigen Wochen vor Kriegsausbruch zu leisten hat, ist eine große Zeremonie, vergleichbar der Einkleidung des Mönches: er leistet seinem König den Treueid.
Dieser Eid war neu. Die deutschen Völker kannten den Heereseid nicht, als der Krieg nur von Freien geführt wurde. Die alten Söldner schwuren ihn nur für die Zeit eines einzelnen Krieges, damit sie Zucht hielten, Kaiser und König vereidigten weder Offiziere noch Beamte auf Lebenszeit. Der Schwur auf Zeit war frei, wer ihn nicht leisten wollte, weil ihm sein Führer nicht passte, mochte daheimbleiben. Erst als das Reich in einzelne Länder zerfiel, die Fürsten ihre Untertanen zum Kriegsdienst zwangen, als also kein Vertrag mehr vorlag, formten sie den freien in einen Zwangseid um, den Soldateneid; diesen Akt umgaben die Priester mit heiligen Formen, um den Soldaten vor Flucht und Desertion zu schrecken. Hindenburg schwor:
"Ich, Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und Hindenburg, schwöre zu Gott dem Allwissenden und Allmächtigen einen leiblichen Eid, dass ich Seiner Majestät dem König von Preußen, meinem Allergnädigsten Landesherrn, in allen und jeden Vorfällen, zu Lande und zu Wasser, in Krieg- und Friedenszeiten, und an welchen Orten es immer sei, getreu und redlich dienen, Allerhochstdero Nutzen und Bestes fördern, Schaden und Nachteil aber abwenden, die mir vorgelesenen Kriegsartikel und die mir erteilten Vorschriften und Befehle genau befolgen und mich so betragen will wie es einem rechtschaffenen, unverzagten, pflicht- und ehrliebenden Soldaten eignet und gebühret. So wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum und sein Heiliges Evangelium!"
Hindenburg sprach noch im fünfundachtzigsten Jahr von seinem Soldateneid zu einem Besucher, den wir kennenlernen werden. Erzogen im Glauben an den König, glühend in Offiziersehre und Vasallentreue, erlebte er diese Zeremonie mit der ganzen Kraft des Symbols und hat sie niemals vergessen.
Auf erstaunlichen Umwegen wird er im Alter mit diesem feurig geschworenen Jünglingseid zu kämpfen haben.
"Ich freue mich über die buntbewegte Zukunft, für einen Soldaten ist ja der Krieg der Normalzustand, und außerdem stehe ich in Gottes Hand. Falle ich, so ist es der ehrenvollste Tod eine Verwundung muss ja auch nur zum Besten dienen, und kehre ich unversehrt zurück, umso schöner ..."
"Wenn ich die Gefühle schildern soll, die mich vor der Schlacht befielen, so wären es ungefähr folgende: zunächst eine gewisse Freudigkeit, dass man nun auch einmal Pulver riechen lernt, dann aber auch ein banges Zagen, ob man auch seine Schuldigkeit als so junger Soldat genügend tun wird. Hört man dann die ersten Kugeln, so wird man in eine gewisse Begeisterung versetzt (sie wurden teils mit Hurra begrüßt), ein kurzes Gebet, ein Gedanke an die Lieben in der Heimat und den alten Namen, und dann vorwärts! Mit der Zahl der Verwundeten macht die Begeisterung einer gewissen Kaltblütigkeit oder mehr Gleichgültigkeit gegen die Gefahr Platz. Die eigentliche Aufregung kommt erst nach dem Gefecht, wo man die Gräuel des Krieges in den schrecklichsten Gestalten mit mehr Muße übersehen muss; dies zu beschreiben, vermag ich nicht..."
"Mein Ziel auf dem Kriegsfelde ist erreicht, das heißt, ich habe Pulver gerochen die Kugeln pfeifen gehört, alle Arten, Granaten, Kartätschen... bin leicht verwundet worden, somit eine interessante Persönlichkeit, habe fünf Kanonen genommen etc. etc!!! Vor allem aber habe ich die göttliche Gnade und Barmherzigkeit an mir kennengelernt, Ihm sei Ehre, in Ewigkeit, Amen!"
Alle Gefühle des feurigen, jungen Offiziers sind in diesen Briefstellen aus den Kriegen von 1866 und 1870 enthalten: Gläubigkeit und Fatalismus, Pflichtgefühl und Stolz auf die alte Familie, Freude am Sieg und Schrecken beim Anblick der Sterbenden. Nimmt man hinzu, wie er nach der Schlacht bei St. Privat berichtet, er habe alle wichtigen Momente des Gefechts mit der Uhr festgestellt, wie er sich über den ersten Orden freut, den man sich damals ernstlich verdienen musste, so ergibt sich das Bild eines vorzüglichen Offiziers, den keine falsche Schneidigkeit zur Übertreibung verlockt. Alles ist Dienst im besten Sinn. Wie sehr ihn das Standesbewusstsein treibt, zeigt eine Stelle aus dem Brief des Achtzehnjährigen vor seiner ersten Schlacht: "Es ist die höchste Zeit, dass die Hindenburgs mal wieder Pulver riechen. Unsere Familie ist darin leider seltsam vernachlässigt." Hier hört man, wie ihn die Unehre von Spandau nach sechzig Jahren kränken mag.
Als er in dieser Schlacht, bei Königgrätz, verwundet wurde, schreibt er: "Mir fuhr eine Kugel durch den Adler meines Helmes' streifte den Kopf, ohne mich schwer zu verwunden und ging hinter dem Adler wieder heraus." Diesen Helm hatte der Feldmarschall bis zum Lebensende auf seinem Schreibtisch stehen. Früher hatten ihn die Eltern aufgehoben, eine Bibelstelle in den verbrannten Adler gesteckt, und der gläubige Vater, der nur als Leiter eines Spitals am Krieg teilnahm, schrieb damals seiner Frau: "O Du heiliger Gott, welche Zuchtrute ist die Fackel des Krieges in Deiner Hand! Gelobt sei Jesus Christus, der unser geliebtes Kind so gnädig behütet und nicht in diesen Raum gebracht, wo das Bild des Entsetzens einem entgegenstiert und die Tränen des Jammers so zahlreich geflossen sind und lange fließen werden!"
Zugleich mit dem Brief ihres Mannes las Hindenburgs Mutter diese Zeilen ihres Sohnes: "Die Trennung von dem lieben Vater ist Dir gewiss recht schwer geworden, doch ist er ja hingegangen, um eine edle, ritterlich-christliche Pflicht zu erfüllen. Welch wunderbares Verhältnis ist es doch, die Wunden, die der Sohn schlagen musste, darf der Vater heilen, und doch tun beide ihre Pflicht."
Bis zu diesem Punkt vermag ein redlicher junger Offizier, Nachkomme vieler Offiziere, den Widersinn der Kriegsmoral durchzudenken. Kann man von ihm erwarten, dass er, der hier in einem einzigen Satz die ganze Paradoxie des christlichen Krieges enthüllt, kann man von einem achtzehnjährigen Junker erwarten, dass er den Zwiespalt zwischen Gottes und des Königs Gebot durchdringt und sich für einen entscheidet? Schon hier erreicht Hindenburg die äußerste Grenze seiner Denk- und Gefühlskraft und wird noch sechzig Jahre später versuchen, solch widerstrebende Pflichten, sei es für Gott und König oder für Volk und König, zu vereinen.
Auch politisch wurden die Grundlagen seines Denkens in den beiden Kriegen gelegt, die ihn in der preußischen Armee mit achtzehn und dreiundzwanzig Jahren von Sieg zu Sieg führten. Im ersten Krieg trug der süddeutsche Feind die schwarz-rot-goldene Armbinde. Der Hass gegen diese Farbe, den ihn bei jenen Erzählungen aus der Revolution schon Vater und Mutter gelehrt haben, musste sich in Augen und Herzen bestätigt fühlen, als er dieselbe Farbe der Revolution und Demokratie beim Feind fand. Dass er diese Leute jetzt töten, während er vier Jahre später mit ihnen verbündet gegen Frankreich kämpfen sollte, dieser Widersinn des deutschen Bruderkrieges konnte ihm nach seiner Erziehung so wenig klarwerden wie der zwischen dem schießenden Sohn und dem heilenden Vater. Der Befehl des Königs entschied, Dienst war Gebot, Pflicht war das Wort der Stunde und blieb das Wort seines Lebens.
Damals hat ihn Thomas Couture, in Versailles aushaltend, in einem reizenden kleinen Bild festgehalten, weil ihm der schlanke Lieutenant wohlgefiel. Es zeigt einen noch immer etwas romantischen Jüngling, der gegen die Fotos der zurückliegenden Jahre an Männlichkeit zugenommen, aber noch nichts von der harten Gefasstheit hat, die ihn von dreißig an kennzeichnet.
Nach der Schlacht von Sedan spricht er schon wie ein Habitus des Schlachtfeldes: "Man muss es den Franzosen lassen, dass sie sich brav geschlagen haben ... Das Gefecht war insofern originell, als wir, die von Nordosten kamen, uns bei den Bewegungen vorsehen mussten, nicht auf belgisches Gebiet zu treten." Vielleicht wird einst der Augenblick kommen, wo an Hindenburgs Beurteilung derselben Frage die Zukunft des Reiches hängen soll.
Vier Monate später stand der junge Lieutenant in der Galerie des Glaces zu Versailles, da er "zur Kaiserkrönung kommandiert war... Um ein Uhr ist große Cour und Erklärung von Kaiser und Reich, und wir sind dann zur Tafel befohlen". Auch damals waren Blick und Herz ganz auf seinen König gerichtet, und noch fünfzig Jahre später kommt in den Memoiren seine Begeisterung für diesen König, dagegen Bismarcks Name auch an dieser Stelle nicht vor. Wie sehr er Soldat ist, wie wenig Politiker, zeigt die Kühle, mit der er über Sedan und Versailles berichtet, sachlich, ohne Phrasen; als aber Paris fällt, gibt es plötzlich einen Ausbruch, und er schreibt den Eltern: "Hurra, Paris hat kapituliert!!!"
Zwei Orden auf der Brust, zwei Einzüge durchs Brandenburger Tor: die Chance, seinen schleppenden Beruf so jung zur stolzen Verwirklichung zu steigern, ersparte ihm zugleich die Spannung jüngerer Kameraden. Durch Siege und Schreckbilder war Hindenburg mit dreiundzwanzig Jahren saturiert; sicher hat er in seinem Leben keinen Krieg mehr gewünscht. Die heroische Epoche dieses Lebens war sehr früh vorüber. Was folgte, war vierzig Jahre lang nichts als Kommiss, nur noch Handwerk, Theorie, nur noch Dienst im Frieden.
Umso stärker musste alles Fühlen und Denken dieses Mannes, während er in die Breite ging und schließlich alterte, auf jene Jahre der Jugend zurückgreifen. Durch glückliche Rettung aus mehreren Schlachten musste sein Glaube sich gestärkt fühlen, und wenn auch sein protestantisch-einfaches Wesen an keine Mission dachte so konnte er sich doch für ein Kind des Glücks halten und einen Mann des Erfolgs dazu. In dem Maße, wie sich der Glanz jener Kriege in der Erinnerung steigerte, musste sein simples Denken auch sozial und politisch hier die erreichbaren Höhepunkte er musste in den siebziger Jahren Deutschlands Kulmination erkennen und zu dem natürlichen Konservatismus des Junkers noch den persönlichen eines Mannes fügen, dessen Gefühlsleben keine Steigerung erwartete oder vertrug. Den Franzosen-Kaiser hatte er gefangen nehmen, Paris kapitulieren sehen, seinen König zum Kaiser erhoben, alles mit eignen Augen, alles in begeisterter Jugend: wie hatte er von da aus weiter fortschreiten, die Gefahren des Kaiserreiches, die Verführungen der Macht und des Geldes im Offizierskorps und in der Dynastie erkennen können! Durch vierzig Jahre kreiste das Seelenleben dieses Offiziers um den Polarstern jenes Tages, da er in die eroberte Hauptstadt des Erbfeindes mit einreiten durfte.
Wie wenig er in den folgenden vierzig Jahren innerlich erlebte, zeigt die Beschränkung seiner Memoiren auf zwanzig Seiten, die er diesem Zeitraum widmet. Der König und die Fahne, das waren die Symbole, in denen sein inneres Pathos Genüge fand, wobei er wohl, ähnlich Wilhelms eigenen Gefühlen im Kaiser weiter den König, in der deutschen die preußische Fahne verehrte. Preußen hatte als das einzige Land der Welt eine Fahne ohne Farben: schwarz-weiß, ein korrekte Fahne, die Tag und Nacht kalt nebeneinandersetzte. Nun war zu diesen beiden Nichtfarben das Rot getreten, das der schlaue Bismarck dem König gegenüber aus dem Rot-Weiß der Brandenburgischen, den Hansestädten und Holsteinern aus dem Rot-Weiß ihrer Fahne erklärte. Hindenburg blieb im Herzen ein Preuße und ahnte damals nicht, in welch phantastischer Zwangslage er 60 Jahre später im höchsten Alter für das Reich und gegen Preußen optieren sollte.
Nur die Ehe, die er im zweiunddreißigsten Jahr mit einer Generalstochter schloss, ist als Ereignis jener vierzig Jahre anzusprechen; sie hat ihm Glück und Zufriedenheit gebracht und wahrend vierzig Jahren ein Leben erwärmt, in dem weder Freundschaft noch Reisen, noch Studien den grauen Dienst verschönten. Seine natürliche Ruhe ist durch dieses Leben bestätigt und vertieft worden, und wie er von nun an, den Zügen der vornehmen väterlichen Großmutter sich nähernd, den wuchtigen, quadratischen Schädel entwickelte, so bekommt sein Blick eine gewisse Bauernschlauheit, die ihm die kleinbürgerlichen Vorfahren der Mutter als brauchbare Erdengabe überliefert haben mögen.
In dem Kommissleben, das er bei der Truppe während etwa dreißig von diesen vierzig Jahren führte, hatte Hindenburg so wenig wie ein anderer Offizier Gelegenheit, sich hervorzutun. Während es ihn stufenweise bis zum Kommandierenden General hinaufführte, hat doch kein Biograph ein Aktenstück, einen Einfall oder Vorschlag ausgraben können, die ihm des Zitierens wert waren. Fiel er also durch persönliche Talente niemand auf, so hat ihn auch keiner schneidig, scharf oder hochnäsig geschildert wie viele seiner Berufsgenossen; vielmehr wird er von allen als geduldig, gutartig und objektiv im Urteil, als Lehrer wie als Organisator gleich tüchtig gerühmt; nie unschlüssig, weil nie nervös, überall fest, einfach, in der Art eines Holzschnittes, wie es sein Kopf anzeigt. "Die Strenge seines Wesens", schreibt ein Kamerad, "zeigte sich weniger in seinen Worten als in seiner Haltung und seinen Augen, die dann eine eigentümliche Schärfe annahmen . . . War bei Besichtigungen das Urteil anderer Vorgesetzter zu scharf ausgefallen, dann wusste er den Tadel zu mildern oder, wenn nötig, zu entkräften." Sein Lieblingspferd, einen Goldfuchs, nannte er "Geduld".
Da er niemals "Kommisshengst" wurde, immer patriarchalisch mit den Leuten umging wie auf dem Gutshof, sah man ihn als älteren General noch jungen Rekruten Gewehrgriffe zeigen, sich mit seinen Soldaten in den Schützengraben legen, damit sie Deckung suchen lernten. Nur im Anzug ließ er nichts nach, und wenn einmal im heißen Sommer Kragen und Halsbinde hervorragten, wurde er grob, denn das war gegen die Disziplin. Dass er ein vorzüglicher Offizier war, zeigt seine Berufung als Kommandierender an eine der vierundzwanzig höchsten Stellen der Armee, für die immer zwei Generalleutnants kandidierten. Diesen Posten erreichte er, belastet mit einer bürgerlichen Mutter, ohne Protektion des Kaisers, ohne Geld und ganz ohne Hofgängerei oder Streberei, denn Hindenburg hatte sein Leben lang wenig Ehrgeiz, aber viel Standesgefühl.
Da hatte er denn, als er in Magdeburg als Korps-Kommandant mit Mitte Fünfzig landete, vor seinem Dienstpalais an der großen Auffahrt endlich die beiden Schilderhäuser, die er sich als Kadett in seinen Putzspind gewünscht hatte. Dass er in dieser vornehmen Stellung, die sogar über den Oberpräsidenten hinausging, den Habitus und die Bequemlichkeit eines großen Herrn in der Fülle seiner Gesundheit kennenlernte, musste dem Standesherrn in ihm als letzte Genugtuung erscheinen.
In diesen hohen und unter einem jungen König gefährlichen Stellungen sind Geduld und Nervenruhe bei ihm sprichwörtlich geworden. Sein großes Kaisermanöver, für einen preußischen General weit aufregender als ein Krieg, hat er samt der gefürchteten Parade trotz plötzlicher Launen seines kaiserlichen Herrn mit größter Ruhe bestanden; da konnte er inmitten eines lärmenden Saales auf hartem Stuhl einschlafen und zur rechten Zeit erfrischt wieder aufwachen. Als bei einer Kritik der General Bernhardi nicht aufhörte zu deduzieren, sagte Hindenburg nachher nur: "Im Krieg verläuft doch alles anders." In seinem Kasino sieht man ihn beim Wein oder Bier sitzen, gute Witze erlauben und belachen, aber keinerlei Zoten, dazu war er zu sauber.
Diese eintönige Laufbahn wurde durch acht Jahre Generalstab unterbrochen, der durch mehrere schwierige Examina gesperrt und nur begabten Offizieren zugänglich war. Als Hindenburg sich auf der Kriegsakademie darauf vorbereitete, 1873-1876, wurde der Lehrplan grade grundsätzlich verändert: Waffenlehre, Kriegsgeschichte, Militärrecht vermehrt, dafür Literaturgeschichte halb und Philosophie ganz gestrichen.
Über diese Jahre im Generalstab, die im Berlin von 1885 bis 1893 eine dramatisch bewegte Zeit umfassten, schreibt Hindenburg in seinen Memoiren nur vier Seiten, die Anekdoten inbegriffen. Mit den großen Politikern oder Gelehrten, deren Verkehr jedem Generalstäbler offenstand, hatte er so wenig Fühlung wie mit den unteren Ständen. Bismarck, den die Junker hassten, zuletzt auch stürzten, muss ihm unheimlich und antipathisch wie seinen Freunden gewesen sein. Dass er es war, der den Offizieren erst Gelegenheit gegeben, den Degen zu ziehen, wurde in diesen Kreisen bestritten oder vergessen; nicht er, sondern das Schwert hätte das junge Reich gegründet, von dessen Werden damals alles erfüllt war.