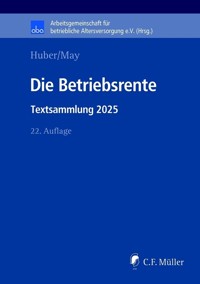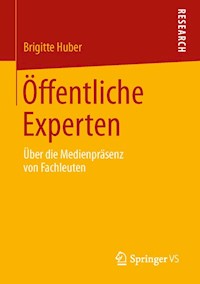18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nicht mehr jung, aber sich jung fühlend, reif ja, aber nicht alt, schon sechs Jahrzehnte gelebt – und mit etwas Glück noch ein paar vor sich: Wo stehen wir mit 60 und was fangen wir mit dem Lebensabschnitt an? Nur noch Rente? Da ist noch viel mehr drin! Brigitte Huber und Anne-Bärbel Köhle sind beide »Ü60« und liefern ihren ganz persönlichen Reiseführer für den unbekannten Kontinent, der erobert werden will. Denn diese neue Lebensphase lebt sich nicht von selbst. Sie will gelebt werden. Wie das am besten geht, dazu haben die Autorinnen überraschende Antworten, Ideen und wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt und sich von inspirierenden Vorbildern leiten lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Brigitte Huber | Anne-Bärbel Köhle
Endlich Ich!
Wie wir mit 60 anfangen, unser bestes Leben zu leben
Biografie
Brigitte Huber (geboren 1964) war als langjährige Chefredakteurin das Gesicht der BRIGITTE. Ab 2009 war sie Teil der Chefredakteurs-Doppelspitze und von April 2013 bis 2023 alleinige Chefredakteurin der BRIGITTE-Familie.
Anne-Bärbel Köhle, geboren 1962, ist Chefredakteurin im Wort & Bild Verlag, der u.a. die »Apotheken Umschau« herausgibt, mit Schwerpunkt Medizin und Gesundheit, und sie ist Autorin diverser Sachbücher sowie Dozentin.
Die beiden Frauen verbindet eine fast 40-jährige Freundschaft.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: FAVORITBÜRO, München
Coverabbildung: Gaby Gerster
ISBN 978-3-10-492282-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Neuland in Sicht
Kapitel 1 Wann, wenn nicht jetzt: Vorhang auf zur Premiere!
Das Premieren-Phänomen
Routinen – Anker und Zeitkiller
Je älter, desto schneller?
Zeit ist ein Gefühl
Der magische Reiz des Neuen
Premieren – die beste Zeit ist jetzt!
Die Schlüsselrolle der Achtsamkeit
Die Kunst des Meditierens lernen
Innehalten im Alltag
Das Potenzial des Augenblicks
Abendreflexion
Welche Premiere passt zu mir?
Kapitel 2 Jetzt ist noch lange nicht Feierabend!
Wie es im Job noch mal richtig gut wird
Ab Mitte 50 Richtung Abstellgleis?
Vom Wert der Silver Workers
Boomer gegen Gen Z?
Sich neu erfinden – jetzt noch?
Wieder zu Lernenden werden
Von 100 auf 0 – oder lieber fließend?
Kapitel 3 Mein Körper und ich. Oder: Wer später stirbt, bleibt länger fit und schön
Lernen von den Langlebigen
Was bedeutet Altern?
Unsere Schwachstelle stärken
Die Macht der Altersgene
Wie wir alle bald 100 werden
Das Longevity-Konzept
Vom Hoppeln und Gewichtestemmen
Bin das wirklich ich?
Kapitel 4 Meine grauen Zellen und ich. Oder: Endlich kristallklar denken
Unser Gehirn spart jetzt Stress, Ärger und Geld
Kampf der Demenz … mit Sport
… mit gutem Schlaf
… mit guten Augen, Ohren und Zähnen
… mit Spaß an Berührung!
Kapitel 5 Meine Nächte und ich. Oder: Der Traum vom ruhigen Schlummer
Wie sich der Schlaf verändert
Wege zum besseren Schlummer
Kapitel 6 Meine Seele und ich. Oder: Was kann bleiben, was muss weg?
Kluge Gedanken und gute Botschaften
Wie wir uns verändern können
Alte Muster – akzeptieren oder loswerden?
Die inneren Antreiber unter der Lupe
Die Kraft des Schreibens
Veränderung durch das Feedback anderer
Alte Wunden heilen – der Blick zurück
Wie wir uns selbst stärken können
Selbstwirksamkeit – mein Tun macht den Unterschied
Selbstmitgefühl – die Freundin in uns wecken
Die Geschichte mit den zwei Wölfen
Kleiner Hack: Grünes Licht für das Gute
Kapitel 7 Die anderen und ich. Oder: Der Blick von außen, der Blick nach innen
Einsam? Nicht mit mir!
Zeit für den Rollenwechsel
Liebe, Lust und Partnerschaft
Partnerschaft kann das Leben verlängern
Herausforderung für viele Paare
Will ich das noch?
Let’s talk about sex
Keine Lust ist auch eine Lösung
Feminismus und Sex
Kapitel 8 Die Suche nach dem Sinn. Oder: Die optimale Bucket List
Die Unsterblichkeitsillusion – wie viel Zeit bleibt mir noch?
Endlich ich: Gute Aussichten!
Anhang
Fragebogen
Literatur
Neuland in Sicht
Kapitel 1: Wann, wenn nicht jetzt: Vorhang auf zur Premiere!
Kapitel 2: Jetzt ist noch lange nicht Feierabend!
Kapitel 3: Mein Körper und ich
Kapitel 4: Meine grauen Zellen und ich
Kapitel 5: Meine Nächte und ich
Kapitel 6: Meine Seele und ich
Kapitel 7: Die anderen und ich
Kapitel 8: Die Suche nach dem Sinn
Dank
Neuland in Sicht
von Brigitte
»Der Countdown läuft. Noch 30 Minuten. Willst du nun doch in deinen Geburtstag reinfeiern?« Als mir der Mann an meiner Seite diese Frage stellt, fühle ich mich ertappt. Es ist der Vorabend meines 60. Jahrestags und eigentlich will ich mit diesem Geburtstag so umgehen wie mit allen anderen davor: kein Gewese, vor Mitternacht die Augen zu und das Ganze wegschlafen, es ist doch nur eine Zahl. Mit dieser Strategie bin ich immer gut gefahren. Meinen 30. zelebrierte ich niedrigschwellig mit einem Sonntagsbrunch. Den 40. atmete ich komplett weg, er fiel mitten in eine private Umbruchphase. Am 50. zog es mich auf eine große Reise nach Südamerika. Allein schon durch die Zeitumstellung konnte man gar nicht genau sagen, wann denn nun der ultimative Moment zum Anstoßen oder was auch immer war.
Feiern war nie mein Ding. Wobei: Ich feiere gern, nur nicht auf meinem eigenen Fest. Ich habe das immer auf ein schlecht verarbeitetes Teenager-Trauma geschoben. Meine Eltern fuhren so gut wie nie ohne uns Kinder weg, und als sie es doch mal taten, hielt ich es – damals 16 – für eine fabelhafte Idee, eine Party zu veranstalten. Die Stichworte dazu – Alkoholmissbrauch, teils unbekannte Gäste, Vasen-Weitwurf durchs Fenster in den gegenüberliegenden Kanal, ausgedrückte Zigaretten auf dem Wohnzimmerteppich und Polizeibesuch – sollten genügen, damit du dir ein Bild machen kannst. Dass mein Opa, Ehrenkommandant der örtlichen Feuerwehr, ausgerechnet an diesem Abend in unserem kleinen Zehn-Quadratmeter-Vorgarten ein Ständchen von der Feuerwehrkapelle bekam, während die ersten Gäste auf Mopeds eintrudelten, machte das Ganze noch spezieller. Er war es dann auch, der gegen Mitternacht die Veranstaltung beendete und dem Partyvolk ebenso wortlos wie unmissverständlich den Weg zur Tür zeigte. Danach hatten nicht nur meine Eltern, mein Opa und die unmittelbare Nachbarschaft von selbstinitiierten Festen die Nase voll, sondern auch ich. Und zwar nachhaltig. Minimal feiern – maximal entspannt wurde zu meinem Credo.
Und genau so wollte ich es auch mit diesem runden Geburtstag handhaben. Ist doch nur eine Zahl, oder? Nun aber ist es 23.30 Uhr und von gemütlich reinschlafen keine Spur. Ich bin hellwach, die Uhr tickt, ich spüre meinen Puls. Die Psychologin in mir würde sagen: Mein Unterbewusstsein spielt nicht mit, es hat wohl doch ein Problem mit dieser Zahl. Es realisiert: Die 60 ist keine Kategorie wie jede andere. Sie stellt eine Zäsur dar, beruflich wie persönlich. Natürlich ist sie ein Grund für Dankbarkeit, keine Frage, mein Vater wurde nur 55. Aber gleichzeitig empfinde ich sie irgendwie als eine Unverschämtheit. Waren wir nicht gerade noch jung? Oder wenigstens erst in der Lebensmitte angelangt?
Dass ich zum Zeitpunkt dieses Geburtstages gerade mal drei Wochen aus meinem Job raus bin, mehr als 20 großartige Jahre als Chefredakteurin verschiedener Marken mit wunderbaren Teams hinter mir gelassen habe, macht die Sache nicht leichter. In mir tummeln sich gemischte Gefühle und viele Fragenzeichen. Ein emotionaler Unruhezustand, mit dem ich nicht allein bin.
Und – wie geht es jetzt bei dir weiter? Auf 60. Geburtstagen, Ausständen von Kolleginnen oder auch bei privaten Treffen: Diese Frage steht seit geraumer Zeit jedes Mal wie ein ungebetener Gast im Raum, der irgendwann das Wort ergreift. Arbeitest du noch, und wenn ja, wie lange? Wartet da noch eine neue Aufgabe im Beruf oder auch ein ganz anderes Projekt auf mich? Will ich mehr chillen, reisen, in den Tag hineinleben? Aber kann ich das überhaupt? Und macht das meine Seele satt?
Auch meine Freundin Anne-Bärbel und ich kamen zwangsläufig an einem lauschigen Sommerabend auf dieses Thema: Seit fast 40 Jahren sind wir befreundet. Oft saßen wir als junge Frauen in einer Kneipe beim Bier und sprachen darüber, was als nächstes Aufregendes anstand. Unser Leben passierte fast von selbst, so schien es, wir mussten nur auf den Zug aufspringen. Die nächste berufliche oder familiäre Etappe zeichnete sich meist schon am Horizont ab. Inzwischen ist das anders: Diese neue Lebensphase, die wir jetzt betreten, lebt sich nicht – wie die Jahrzehnte davor – von selbst. Sie will gelebt werden. Alles ist möglich, nein, natürlich nicht alles, aber vieles. Mit dem Unterschied: Die Dinge kommen meist nicht mehr von selbst auf uns zu, wir müssen aktiv auf sie zugehen. Sie vielleicht auch erst mal aufstöbern. An diesem Abend trafen wir beide eine Entscheidung: Über dieses Abenteuer wollen wir alles wissen – und darüber ein Buch schreiben. Denn wir betreten Neuland, in beeindruckend großer Zahl. Allein in Deutschland sind heute 22 Millionen Menschen 60 Jahre und älter, das ist mehr als jeder Vierte.
Die Ausgangssituation könnte eigentlich kaum besser sein, denn eine Generation wie die unsere gab es noch nicht. Wir sind im Vergleich zu unseren Eltern und Großeltern fit und gesund: Wer heute 60 wird, hat gute Chancen, ein Alter von 90 zu erreichen. Wir sind erfahren, neugierig, oft auch lebenshungrig. 30 Jahre also, vielleicht mehr, liegen bei guter Führung noch vor uns. Und wir werden gebraucht: Ohne uns, die geburtenstarken Jahrgänge, werden die Probleme unserer Gesellschaft nicht gelöst werden können.
Auch entscheidend für diese Phase: Unsere Persönlichkeit ist in vielerlei Hinsicht in der Form ihres Lebens. Wir sind gelassener, selbstbewusster, offener geworden, haben weniger Zweifel, Ängste und andere Übel, die uns und anderen in früheren Jahren noch zu schaffen machten. Das zeigen nicht nur Studienergebnisse, sondern auch die vielen Antworten, die wir über unseren eigens entwickelten Fragebogen erhalten haben, die du über das ganze Buch verteilt findest. Wir befragten Menschen, die wir spannend und inspirierend fanden – Freundinnen, Bekannte, Wissenschaftlerinnen und Experten, die wir für unser Buch interviewt haben –, zu ihren Wünschen, Erwartungen und Erfahrungen. Denn wir wollten wissen: Wie tickt diese Generation ab Ende 50 wirklich, auch jenseits empirischer Daten?
»Ich bin nicht jemand anderes geworden, aber eine weiterentwickelte Version meiner selbst. Mutiger, selbstsicherer, weniger hysterisch, mit Freude an dem, was ich kann«, beschrieb eine Freundin ihr neues Lebensgefühl. Wenn ich Fotos von mir von früher anschaue, oft mit rebellischem, trotzigem Ausdruck, wildentschlossen die Welt zu verändern, kann ich die Anstrengung noch fühlen, die hinter dieser Einstellung lag. Wie viel friedlich-freundlicher bin ich heute, zu mir, zu anderen. Kann andere Meinungen stehen lassen, meistens jedenfalls. Andere ausreden lassen, zumindest oft. Ich bin eine deutlich entspanntere Version meiner selbst. Ganz im Sinne David Bowies. Der legendäre Sänger und das Meister-Chamäleon des Rock, der von Ziggy Stardust bis Major Tom in unterschiedliche Rollen schlüpfte, betrachtete das Alter als eine Serie von Übergängen. Für ihn lag der Sinn dieser Übergänge darin, sich seinem idealen Selbst anzunähern, was das Altern »zu einem außergewöhnlichen Prozess macht, bei dem man zu der Person wird, die man immer hätte sein sollen«, so der britische Autor Andrew J. Scott.
Endlich ich! Da trifft es sich gut, dass gerade in dieser Lebensphase viele von uns sich selbst mehr in den Mittelpunkt rücken können. Job- und Familienaufgaben werden allmählich weniger, wir gewinnen Freiräume, die wir – endlich – in uns selbst investieren können.
Also ist alles bestens? Tja, so einfach ist es nicht. An dieser neuen Lebensphase ist manches ganz toll, aber eben nur manches. Und ich spreche jetzt nicht allein vom Bindegewebe, höheren Dioptrin-Zahlen und kümmerlichem Social-Media-Verständnis. Wenn es so einfach wäre, hätte mich mein Unterbewusstsein am Vorabend meines 60. Geburtstages vermutlich ganz entspannt in mein neues Lebensjahr entschlummern lassen. Aber es weiß sehr wohl: Der neue Abschnitt ist auch eine Zeit der Verluste, die mit der 6 Einzug hält. Körperliche Einbrüche, der Tod von liebsten Menschen, das Thema Endlichkeit. Auch wer bislang von den großen Herausforderungen des Daseins halbwegs verschont blieb, wird ihnen früher oder später begegnen. Sinnfragen werden neu gestellt oder auch erstmals. Das war schon mal sehr viel einfacher: Als Kind lauschte ich dem Pfarrer gern im Religionsunterricht, wenn er vom Jüngsten Gericht sprach, für alle nicht-katholisch-geprägten Menschen: Das ist jener Tag, an dem alle Toten auf Gottes Geheiß auferstehen und sich versammeln. Ich war überzeugt, dass ich das quasi live miterlebe als noch Lebende, und freute mich schon auf das Wiedersehen mit alten Familienangehörigen und vor allem mit meiner Katze. Die Zeitspanne bis zu meinem eigenen möglichen Tod war für mich noch surreal und unvorstellbar lang. Diese Sicht der Dinge hat sich logischerweise inzwischen etwas verändert.
Was die Phase ab 60 auch nicht unbedingt leichter macht: Unsere Gesellschaft und die meisten von uns – ich inklusive – haben kein besonders schönes Bild vom Altern, um es mal diplomatisch auszudrücken. Darauf sind wir bei unserer Recherche immer wieder gestoßen. Altersdiskriminierung lauert hinter jeder zweiten Ecke, mit teils merkwürdigen Phänomenen. So ist es zum Beispiel völlig normal, dass man mit knapp 70 Kanzler wird (von etwa 80-jährigen US-Präsidenten ganz zu schweigen), aber mit 55 keine Weiterbildung mehr im Job bekommt. Der sogenannte Ageismus lauert auch in ganz banalen Dingen wie etwa meiner Pulsuhr, zu der ich ohnehin eine toxische Beziehung habe: Kürzlich teilte sie mir ungefragt meinen VO2-Max-Wert mit, ein spezieller Fitnesswert. Die Uhr verkündete, mein Wert wäre »ausgezeichnet – für dein Geschlecht und dein Alter«. Eine doppelte Diskriminierung als Kompliment getarnt. Danke schön! Ich werde mich übrigens niemals als »alte Frau« bezeichnen, darin hat mich die Arbeit an unserem Buch ebenso bestärkt: Sprache schafft Realität – auch in unserem eigenen Kopf – und wird irgendwann zur Selffulfilling Prophecy.
Also: Natürlich ist nicht alles gut. Aber diese Zeit, die nun vor uns liegt, dieses Neuland, das wir erobern, hat enorm viel zu bieten. Davon sind wir nun sehr viel mehr überzeugt als noch vor gut einem Jahr, als wir die Idee für dieses Buch an jenem Sommerabend auf die Welt brachten. Zum Glück: Die zurückliegenden Monate gehören für mich zu den spannendsten meines journalistischen Lebens. Wir haben mit zahlreichen Expertinnen und Wissenschaftlern gesprochen, aktuelle und wegweisende Langzeitstudien gelesen, und dabei sehr vieles erfahren, das uns Lust macht auf diese Phase und Antworten schenkt auf wichtige Fragen: Wie können wir die Zeit, die nun kostbarer ist, nutzen? Wie lässt sie sich zum Beispiel durch neue Erlebnisse dehnen? Warum hilft uns vor allem die Neugierde? Wie mache ich Frieden mit offenen Baustellen des Lebens und entwickele mein individuell bestes Selbst weiter? Denn das ist Fakt: Wir lernen ein Leben lang. Wenn wir es gut anstellen, kommen wir immer näher bei der Person an, die wir gerne sein wollen. Und vielleicht überraschen wir uns dabei auch immer wieder selbst. Ich werde übrigens meinen 60. nachfeiern, mit großer Verspätung, aber immerhin. Das erste große Fest meines Lebens.
Was aber will dieses Buch? Es ist auf jeden Fall kein klassischer Ratgeber, wir würden uns nicht anmaßen zu behaupten, dass wir den einen richtigen Weg kennen. Schließlich sind auch wir zum ersten Mal 60 geworden. Aber nahezu täglich haben wir auf unserer Recherche kluge Gedanken und wertvolle Fakten eingesammelt, die wir gerne weitergeben möchten, ebenso wie unsere persönlichen Erfahrungen und die anderer Menschen. Weil sie Lust und Mut machen können, dieses Neuland zu betreten und für sich zu entdecken. Schließlich kann es gut sein, dass genau das dritte Drittel zum besten Drittel unseres Lebens wird.
Kapitel 1 Wann, wenn nicht jetzt: Vorhang auf zur Premiere!
von Brigitte
Wir fuhren erst am späten Nachmittag los, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich hatte eine von uns noch irgendeinen Ferienjob. Früher wäre ich schlauer gewesen, anyway. Auf jeden Fall starteten wir – drei Frauen und ein Kind, mein Sohn – mit einem geliehenen VW-Bus in unserem oberbayerischen Heimatort Richtung Türkei. Dass der Bus genauso alt war wie wir, nämlich 23, fanden wir lustig. Fast ein Zeichen. Die besorgten Stimmen aus unserem Elternumfeld, dass das Auto schon ziemlich betagt und nicht gerade PS-stark sei, blendeten wir aus. Vorerst.
Bis wir etwa vier Stunden später am Wurzenpass angelangt waren. Dass der Alpenpass zwischen Österreich und dem damaligen Jugoslawien eine satte Steigung von 18 Prozent hat, wussten wir nicht, aber interessierte uns auch nicht wirklich.
Es war längst dunkel geworden, als der Bus den Berg hochkeuchte. Kurve für Kurve, immer kurzatmiger, mühsamer, irgendwann geriet er ins Stocken. Machte nochmal ein hässliches Geräusch, danach Stille. Ich saß am Steuer, inzwischen voll auf Adrenalin, zog die Handbremse, startete neu, versuchte wieder, bergauf zu fahren, doch die alte Kutsche tat sich schwer, ruckelte ein paar Zentimeter, gab schließlich den Geist auf. Dann rollte der Bus gar nach hinten. Wir schrien, ich bremste panisch, zog die Handbremse bis zum Anschlag. Wir standen. Mitten am Berg.
»Rot, rot, rot, sind alle meine Kleider« stimmte meine Freundin ein Kinderlied an, um meinen Sohn und vermutlich auch uns selbst zu beruhigen. Was nun? Die Grenze war nicht mehr weit, also machten wir uns zu Fuß dorthin auf und informierten den ADAC, der uns das letzte Stück hochzog. Oben angekommen, sprang der Bus wieder an – und wir fuhren weiter Richtung Slowenien.
Am nächsten Morgen ließen wir den Bus in einer Werkstatt checken. Diagnose: ein Achselzucken – das Auto sei wohl okay, der Motor aber altersschwach, also vorsichtig bei Steigungen etc. Kurze Besprechung – übereinstimmendes Urteil: Wir fahren weiter!
Was für ein Glück! Unsere Reise war ein einziges großes Abenteuer. In meinem Gedächtnis haben sich aus den vier Wochen, die wir unterwegs waren, so viele Erinnerungen eingebrannt wie sonst nicht aus vier Jahren. Denn so vieles, was uns in diesen Tagen begegnete, erlebten wir zum allerersten Mal: wir, drei Frauen, Tausende Kilometer allein unterwegs mit einem kleinen Jungen, der auf der Reise seinen vierten Geburtstag feierte.
Die große Gastfreundschaft, der wir überall begegneten, der Chai in kleinen Gläsern, der uns serviert wurde, der Ritt auf einem Kamel. Es gab Momente, die uns in Atem hielten, etwa als wir ganz nah am Meer durch kniehohes Wasser fuhren. Oder vor dem Topkapi-Palast in Istanbul, als Soldaten mit Maschinengewehren uns klarmachten, dass wir mit unserem Bus dort keinesfalls weiterfahren dürfen.
Berührend, aufregend, intensiv, abenteuerlich, horizonterweiternd: Dieser September in unseren Semesterferien war ein Premieren-Feuerwerk. Wir erlebten ganz vieles zum ersten Mal. Und darin steckt Magie: Denn Premieren können eine lebensverlängernde und glücksstiftende Wirkung entfalten.
Das Premieren-Phänomen
Jede und jeder von uns erlebt unzählige erste Male ganz automatisch, und zwar von der ersten Minute an. Lange bevor sich gezielt Erinnerung abspeichert, erfahren wir Premieren unterschiedlichster Art – eher unangenehme wie der erste Zahn, stolze und von außen bejubelte wie die ersten Schritte, verzückende wie das erste Eis. Die gesamte Kindheit und Jugend sind geradezu gepflastert von solchen neuartigen Erlebnissen: der erste Tag im Kindergarten, in der Schule, beim Ballett oder Fußball; der erste Kuss, der erste Urlaub ohne Eltern, und ja: auch das erste Mal Sex. Ein Ereignis, das anscheinend so prägend ist, dass es als »das erste Mal« schlechthin gilt. Auch wenn es meist gar nicht so prickelnd ausfällt wie die ein oder andere Wiederholung später.
Auch als junge Erwachsene erleben wir noch vieles erstmalig: die eigene Wohnung oder WG, Ausbildung oder Studium, Job oder auch eine Reise mit dem VW-Bus. Manche Premieren bleiben einmalig: wie meine Begegnung mit Kirschlikör als Teenager – bis heute wird mir schon flau im Magen, wenn ich das Wort nur höre. Oder die Führerscheinprüfung, wobei ich die fast hätte zweimal machen dürfen …
In der Regel aber bleibt es nicht bei dem einen Mal. Es folgen weitere, die dann aber meist viel leiser, unspektakulärer daherkommen. Vom zweiten Schultag gibt’s dann schon kein Foto mehr und meist auch keine Erinnerung, und der vierte Urlaub in die Toskana lässt sich im Nachhinein vom dritten oder sechsten kaum mehr trennscharf abgrenzen. Das ist völlig normal, hochgradig sinnvoll, führt aber dazu, dass sich die Zeit gefühlt beschleunigt, wenn Wiederholungen mehr und mehr das Ruder übernehmen.
Routinen – Anker und Zeitkiller
Während die Premiere durch den Haupteingang kommt, nimmt die Wiederholung den Nebeneingang. Sie wird zur Routine. Was sehr entlastend ist: Routinen machen uns das Leben leichter, wir müssen nicht mehr groß nachdenken, vorbereiten, abwägen. Jeden Dienstag Yoga? Donnerstags um elf Konferenz? Morgens immer Müsli? Das Gehirn kann auf Autopilot schalten, gleichzeitig stärken solche Strukturen, geben uns Sicherheit – und führen letztlich natürlich auch zu Kompetenz: Während ich diese Zeilen hier ins Laptop schreibe, denke ich nicht mehr darüber nach, wo sich verdammt noch mal auf meiner Tastatur das »A«, das »W« oder das Fragezeichen befinden. So wie sich meine Zahnärztin (hoffentlich) keine Gedanken mehr darüber macht, wie sie den Bohrer ansetzen soll. Also danke, Routine!
Die andere Seite der Medaille: Die x-te Wiederholung hinterlässt auch keinerlei Eindruck mehr in unserem Gehirn und eventuell auch nicht in unserer Seele, und an Silvester stehen wir kopfschüttelnd vor der Sektflasche und der Erkenntnis: Schon wieder ein Jahr vergangen, wo ist die Zeit bloß hin? Und sich vielleicht sogar die bange Frage einnistet: Rauscht mein Leben an mir vorbei?
Denn neue Premieren liefert das Leben mit fortschreitendem Alter meist weniger, und manche davon sind eher unangenehmer Art: die erste Trennung, das erste Mal zu alt fürs Nachwuchsprogramm, der erste Bandscheibenvorfall, irgendwann dann die erste Anzeige für Treppenlifte im privaten Web-Account oder die Androhung eines Seniorentarifs.
Je älter, desto schneller?
Je älter wir werden, so empfinden es die meisten, umso schneller vergeht die Zeit. Jetzt müssen wir alle ganz tapfer sein: Die ersten 18 Jahre vergehen gefühlt etwa so schnell wie der gesamte Rest des Lebens. Das habe ich zumindest mal gelesen und es hat mir schon damals einen Schreck eingejagt. Doch ist das wirklich so? Marc Wittmann vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene forscht seit Jahrzehnten zu unserem Zeitgefühl und gibt erst mal leichte Entwarnung: Ganz so krass sei es vermutlich nicht und das genaue Alter auch nur schwer zu bestimmen. Aber – und schon kommt das »Aber«: Natürlich gäbe es einen Beschleunigungseffekt. Ob und wie uns unser Zeitempfinden davongaloppiert, untersuchte er bereits 2005 mit seiner Kollegin Sandra Lehnhoff in einer großen Studie.
Wie schnell ist das letzte Jahr für Sie vergangen, wie schnell sind die letzten zehn Jahre für Sie vergangen? Diese beiden Fragen stellte das Forscherteam 500 Menschen zwischen 14 und 94 Jahren. Interessant: Während es in der Rückschau auf das letzte Jahr kaum Unterschiede gab, waren in Bezug auf den Zeitraum der letzten zehn Jahre signifikante Abweichungen zwischen den verschiedenen Altersgruppen festzustellen: Je älter die Teilnehmenden – und das belegten auch spätere Folgestudien in Neuseeland und anderen Industrienationen, umso schneller verging die jeweils letzte Dekade subjektiv. Bis zum Alter von etwa 60, da war dann meist ein Plateau erreicht. »Ab da vergeht die Zeit subjektiv nicht mehr schneller.«
Immerhin, der reißende Fluss verändert sein Fließtempo nicht mehr, so lautet die erste gute Nachricht. Die zweite: Wir können einiges aktiv steuern, um unser individuelles Zeittempo zu drosseln. Doch bevor wir auf diesen wichtigen (und unter Umständen sehr glücksstiftenden) Punkt kommen, lohnt es sich, einen intensiveren Blick auf uns und unser Zeitempfinden zu werfen.
Zeit ist ein Gefühl
Wir und die Zeit – eine etwas komplizierte Geschichte. Denn wir können Zeit messen und wir können Zeit fühlen. Ersteres ist simpel. Haben wir in München 13.01 Uhr, können wir uns blind darauf verlassen, dass es in Hamburg genauso spät ist. Ein Blick auf die Uhr als unbestechlicher Wächter genügt.
Wenn es hingegen um unsere innere Uhr geht, wird es gern mal paradox: Wir erleben ein Wochenende an einem Ort, an dem wir noch nie waren, lauter spannende Eindrücke reihen sich aneinander, die Zeit vergeht wie im Flug. Im Rückblick hingegen fühlt sich das aufregende Wochenende viel länger an als all die normalen Wochenenden in unserer Heimatstadt davor und danach. Unsere innere Uhr macht somit einen großen Unterschied zwischen Augenblick und Rückblick, zwischen der Zeit, die wir gerade erleben, und der Retrospektive.
Umgekehrt genauso: Wenn wir stundenlang im Wartezimmer, auf einer langweiligen Veranstaltung, im verspäteten ICE sitzen, dehnt sich die Zeit oft schwer erträglich. In der Erinnerung schrumpfen solche banalen Episoden des Wartens oft zusammen oder entgleiten unserem Gedächtnis gar komplett.
Etwas anders liegt der Fall, wenn angespanntes, sorgenvolles Warten unser Zeitgefühl bremst, wie mir ein ganz besonderer Winter meines beruflichen Lebens gezeigt hat. Damals war ich Chefredakteurin verschiedener Titel bei einem großen deutschen Verlag. Die wirtschaftliche Lage war angespannt, Ende September wurde mitgeteilt, dass alle Marken auf den Prüfstand gestellt würden, ein genauer Zeitpunkt der Verkündung der Ergebnisse war nicht bekannt. Beginn eines Ausnahmezustands. Die herausforderndste Zeit für viele von uns im Verlag. Jeden Tag, jede Nacht aufs Neue, oft schlaflos, grübelnd, stellten sich meine Kolleginnen und Kollegen die immer gleichen Fragen: Wird mein Magazin überleben? Wird es eingestellt? Oder verkauft? Was wird dann aus mir? Verliere ich meinen Arbeitsplatz? So vergingen Nikolaus, Weihnachten, Neujahr … bis Anfang Februar die meist bitteren Wahrheiten verkündet wurden. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit. Auch im Nachhinein fühlen sich diese Monate für viele von uns länger an, als sie tatsächlich waren, die Sorgen haben die Erfahrungen tief in die Erinnerung gebrannt. Emotionen spielen für unser Zeitempfinden eine tragende Rolle.
Ob sich positive oder negative Erlebnisse stärker im Gehirn verankern, erforscht Wittmann derzeit mit einer Kollegin. Was er allerdings jetzt schon weiß: »Ein erfülltes, abwechslungsreiches Leben ist ein langes Leben.«
Der magische Reiz des Neuen
Wenn es um Legosteine geht, sind sich Menschen und Mäuse einig: Sobald ein neues Objekt auftaucht, wird der alte Spielstein links liegen gelassen. »Das können Sie im Tierversuch genauso beobachten wie bei krabbelnden Kleinkindern«, erklärt Hannah Monyer. Von der preisgekrönten Gedächtnisforscherin will ich wissen, warum sich unser Gehirn manche Dinge merkt und andere nicht. Klar ist, das Überraschende lenkt unsere Aufmerksamkeit automatisch auf sich, das ist bei allen Säugetieren so, evolutionär gesehen geht es letztlich ums Überleben: »Ich muss ja wissen, ob das Neue gefährlich für mich ist oder nicht.« Und da muss dann wohl auch jeder Legostein genauer ins Visier genommen werden.
Ob das Ereignis dann wirklich haften bleibt oder die grauen Zellen rückstandslos durchläuft, hängt vom Hippocampus ab. In dieser zentralen Stelle unseres Gehirns entscheidet sich, ob etwas im Kurzzeitgedächtnis bleibt (und bald wieder verschwindet) oder sich die Tür ins Langzeitgedächtnis öffnet. Gute Türöffner sind neben intensiven Emotionen und erstmaligen Erlebnissen auch persönliches Interesse und Achtsamkeit. Dieser Begriff wird uns später noch begegnen, denn er spielt eine Schlüsselrolle.
Premieren – die beste Zeit ist jetzt!
Erst aber erfreut uns Hannah Monyer, selbst eine Vertreterin der Generation 60+, mit einer frohen Botschaft: »Dieses Alter jetzt ist wirklich eine Chance, etwas Neues zu machen«, so die ärztliche Direktorin am Universitätsklinikum in Heidelberg, »vorausgesetzt, wir sind gesund.«
Die aus Siebenbürgen stammende Neurobiologin, die mit 17 zum Medizinstudium nach Deutschland kam, holt sich gezielt und mit Lust erste Male ins Leben. Mit einer Mischung aus Ehrfurcht und zunehmend schlechtem Gewissen höre ich den guinessbuchrekordverdächtigen Ausführungen zu: Eine ihrer letzten Premieren war 5995 Meter hoch: der Kilimandscharo, den sie mit 66 erklomm. »Ich war mit Abstand die Älteste, die meisten waren Mitte 30.« Sportlich war sie schon immer, aber zur Vorbereitung auf die Bergtour kaufte sie sich ein Mountainbike, fährt seitdem jeden Morgen eine Stunde damit den knapp 550 Meter hohen Weißen Stein nördlich von Heidelberg hoch. »Ich bin so fit, wie ich mit 30 nicht war.« Ach ja, und beim Runterfahren lernt sie gern mal ein Gedicht.
Seit drei Jahren spielt sie Cello als Zweitinstrument neben Klavier. »Eine sehr sinnliche Erfahrung, absolut neuartig.« Auch eine oder zwei weitere Sprachen will sie neben Rumänisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch noch lernen: Spanisch und Russisch. Noch hat sie nicht sehr viel Zeit, weil sie voll im Job ist, auch das mit Leidenschaft, und gerade eine neue Studie macht, »ein hochriskantes Projekt«, aber was soll schon passieren? »Ich habe es ja vorher schon so oft geschafft, warum soll ich es diesmal nicht schaffen?!«
Natürlich bin ich nicht so verrückt, mich mit Hannah Monyers Mega-Premieren zu messen, dennoch mag ich ihre Sichtweise auf diese Lebensphase: Sich und anderen nichts mehr beweisen zu müssen, gut ausgestattet mit Resilienz und Erfahrung, das zeichnet diese Phase in Monyers Augen aus. »Natürlich lernt ein junges Gehirn leichter als ein älteres«, so erklärt sie. Doch das ließe sich kompensieren: durch Motivation zum Beispiel und kluge Lernstrategien: nie üben, wenn man müde ist. Hände weg vom Handy. »Das Gehirn kann in der Regel eine Sache gut machen. Es kann auch zwei machen, aber die sind dann weniger effizient.«
Es ist ein Mythos, dass man quasi alle Lernerfahrungen und Veränderungen nur in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter machen kann, meint auch der Psychologe Marc Wittmann. Der Mensch habe fünf Persönlichkeitseigenschaften, die unter dem Begriff NEO-FFI zusammengefasst werden und im Englischen auch als Big Five bekannt sind: emotionale Labilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrungen sind mit zunehmender Reife stärker ausgeprägt – also eine ideale Startrampe für Premieren. »Ich glaube, man wird auch einfach entspannter«, so Wittmann, selbst 59.
Doch lassen sich Premieren an dem Ort in unserem Körper, wo sich entscheidet, welche Erinnerung bleibt und welche nicht, bewusst verankern? Oder entscheidet allein die Intensität des Ereignisses? Nahezu jeder Mensch ab 40 erinnert sich zum Beispiel an 9/11. Weiß, wo er war, als die Schreckensnachricht und Bilder auftauchten. Das Ereignis hat sich kollektiv eingebrannt. Tatsächlich vertiefen sich Erinnerungen auch, je häufiger wir sie hochholen. Deshalb kann es sinnvoll sein, schwierige Erinnerungen erst mal bewusst ruhenzulassen. Zudem verändert sich eine Erinnerung bei jedem Hochholen. »Wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich als junges Mädchen Rumänien verlassen habe, wird diese Erinnerung von heute etwas anders aussehen als die vor zehn oder 20 Jahren, weil ich heute ein anderer Mensch bin«, erklärt Hannah Monyer.
Die Schlüsselrolle der Achtsamkeit
Ein kleines Geständnis zwischendurch: Ich mag Männer, sehr sogar. Einige der wichtigsten Menschen in meinem Leben sind Männer, ich wohne freiwillig mit ihnen zusammen, verbringe gern viel Zeit mit ihnen.
Was ich allerdings nicht so mag: mir von Männern etwas sagen zu lassen. So nach dem Motto: Jetzt mach dies und dann jenes. Egal ob Partner, Sohn, Chef, Fahrkartenkontrolleur – allzu klare Ansagen wecken schnell meinen Widerspruchsgeist. Große Ausnahme seit einigen Jahren: Boris Bornemann. Für den Psychologen und seine freundlichen Aufforderungen nehme ich mir sogar gezielt jeden Morgen zehn Minuten Zeit. Mit geschlossenen Augen lausche ich seiner angenehmen, tiefenentspannten Stimme, die aus meiner Meditations-App tönt, und mache genau, was sie mir sagt. Ich versuche es zumindest. Denn meist schweift mein unruhiger Geist dann doch ab Richtung Vergangenheit oder Zukunft, um sich mit weltbewegenden Fragen rumzuschlagen: Habe ich auf die E-Mail des Vermieters geantwortet? Haben wir noch Milch? Ist die blaue Bluse gebügelt? Doch jedes Mal lenkt mich Boris mit geduldiger Beharrlichkeit zurück ins Hier und Jetzt.
Wenn ich behaupten würde, Meditation hätte einen anderen Menschen aus mir gemacht, würde ich lügen. Aber die tägliche Praxis hat mich ruhiger, ausgeglichener, bereit für mehr innere Akzeptanz und Dankbarkeit gemacht. Jetzt habe ich noch eine weitere Motivation gefunden, um weiter am Ball zu bleiben: Achtsamkeit spielt eine Schlüsselrolle, um Erlebnisse bewusst wahrzunehmen, zu intensivieren und ihnen damit einen roten Teppich ins Langzeitgedächtnis auszurollen.
Wer könnte mir besser dabei helfen als mein persönlicher Meditationsguru Boris? Ich habe ihn vor etwa zehn Jahren kennengelernt: seine App Balloon und die Marken, für die ich gearbeitet habe, erschienen beim selben Verlag. Achtsamkeit ist sein Lebensthema. Als Student am Max-Planck-Institut in Leipzig arbeitet er an der weltweit größten Studie zu Meditation und Achtsamkeit mit. Nach Abschluss seiner Promotion gründet er Balloon, startet den Podcast »Verstehen, Fühlen, Glücklich sein« mit Flow-Chefredakteurin Sinja Schütte, gibt als Achtsamkeitslehrer MBSR-Kurse und Schweige-Retreats.
Bei unserem Videocall ist seine Stimme leicht belegt, er ist erkältet nach ein paar Tagen Skifahren in den Schweizer Bergen. Doch das bremst seinen Rede- und Ideenfluss keineswegs, er hat sich in Vorbereitung auf unser Gespräch bereits intensiv Gedanken gemacht. »Achtsamkeit kann beim Phänomen Premieren sehr hilfreich sein – und zwar auf zwei Wegen.« Ich bin gespannt!
Der erste Weg führt zu einer kleinen Premiere, wie ich es nennen würde. Es geht darum, das Besondere in einer vielleicht alltäglichen, bekannten Situation wahrzunehmen, bewusster, mit all ihren Feinheiten und Details. Denn, so Boris: »Wir erleben ja nie wirklich zweimal den gleichen Moment.« Wenn wir eine Sprache oder Fahrradfahren lernen, entstünden ständig neue Verknüpfungen im Gehirn, sogenannte Konditionierungen. Wenn wir uns in Achtsamkeit schulen, geschehe das Gegenteil: »Es ist quasi ein Dekonditionierungstraining. Wir werden uns der bestehenden Verknüpfungen gewahr – und können uns entscheiden, ob wir ihnen folgen oder aber einen anderen Weg gehen wollen.« Wir können das tun, was wir immer tun – zurückstänkern, wenn wir angestänkert werden, im Supermarkt zur gleichen Schokolade greifen wie immer – oder wir können gegenwärtig sein, den Impuls spüren und uns anders entscheiden. »Es entsteht innerer Raum«, sagt Boris. »In diesem Raum liegt unsere Freiheit.«
Er hat ein Beispiel vor Augen: einen seiner Vorträge »Einführung zur Meditation«. »Den habe ich bestimmt schon 150-mal gehalten.« Nach etwa 30-mal stellten sich bei ihm Ermüdungserscheinungen ein. Schon wieder das gleiche sagen? Irgendwie öde. Aber eine echte Alternative? Sah er nicht, denn im Grunde hielt er den Vortrag für recht ausgereift und seine Tätigkeit als sehr sinnstiftend.
»Da habe ich es mir zur Aufgabe genommen, jedes Mal frisch in diesen Moment reinzugehen. Ich selbst bin ja jedes Mal anders. Es sind jedes Mal andere Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Ich verbinde mich mit meiner Begeisterung für das Thema – und mit meiner Intention, das Leben der anwesenden Menschen zu bereichern. Wenn ich dabei bin, macht es dann doch immer wieder Freude. Ich fühle mich lebendig und der Moment erscheint mir kostbar. Ich bin in einer ähnlichen Situation wie ein Schauspieler, der 300-mal die gleiche Rolle spielt, oder eine Sängerin, die seit Jahrzehnten ein bestimmtes Lied singt. Oder auch wie ein Automechaniker, der immer wieder ähnliche Aufgaben zu erledigen hat. Die Herausforderung ist, den Moment frisch zu halten. Es gilt, sich mit der eigenen Motivation zu verbinden und mit Hingabe im Moment zu sein.«
Verstanden: Es gibt eine Premiere in der Wiederholung. Wie groß sie sich anfühlt, haben wir in der Hand. Für diese kleine Premiere müssen wir weder auf den Kilimandscharo, noch eine neue Sprache lernen.
Nun zu den großen Premieren. Parallel zur Belebung gewohnter Routinen ergibt es natürlich Sinn, sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen und gezielt neuartige Erlebnisse zu kreieren. Ganz gleich welcher Art die Erfahrung sein wird, die ich gerade plane – ich kann mich mithilfe von Meditation darauf einstellen. Wenn ich mich selbst besser spüre und innerlich klarer bin, kann ich die Dinge intensiver erleben. »Es ist wie bei einem Musiker oder einer Musikerin: Wir haben einen Auftritt vor uns und stimmen vorher unser Instrument.« Ein exzellentes Stimmgerät für uns und unsere inneren Saiten ist die Meditation.
Die Kunst des Meditierens lernen
Meditation wirkt. Es gibt unzählige Studien zu ihren positiven Auswirkungen. Was hättest du denn gern? Stressreduktion, verbesserte Konzentration, mehr Glücksempfinden? Niedrigeren Blutdruck, bessere Gehirnleistung, weniger Depressionen? Oder willst du langsamer altern und besser schlafen? Die Liste ließe sich noch fast beliebig fortsetzen. Eine Fee mit durchschnittlichen Zauberkräften hätte ihre liebe Not, mit den Benefits der Achtsamkeit mitzuhalten. Kleiner Unterschied: Während die Fee nur lässig ihren Zauberstab zückt, müssen wir unsere magischen Kräfte selbst entwickeln. Und dazu muss man etwas Zeit investieren. Die Betonung liegt auf etwas: »Jeden Tag zehn bis zwölf Minuten sind für den Anfang völlig ausreichend.« Wie aber gelingt der Einstieg?
Als einfacher, niedrigschwelliger Weg empfiehlt sich eine gut gemachte, didaktisch aufgebaute App wie Balloon. Neulinge finden darin Einstiegskurse mit aufeinander aufbauenden Übungen, Fortgeschrittene unterschiedliche Angebote zu jeder Gemütsverfassung. Wer gleich tiefer einsteigen will, kann auch einen MBSR-Kurs (Mindfulness-Based Stress Reduction) machen. Dieses Programm zur achtsamkeitsbasierten Stressreduktion wurde in den 1970er-Jahren von dem Molekularbiologen und Meditationslehrer Jon Kabat-Zinn entwickelt und gilt bis heute als fundierter Einstieg. Die Acht-Wochen-Kurse werden ebenso wie Kurse zur Stressreduktion per App häufig von der Krankenkasse bezahlt oder zumindest bezuschusst.
Beim Meditieren machen wir uns mit uns selbst vertraut. »Das tibetische Wort für Meditation gom bedeutet: sich vertraut machen«, erklärt Boris. »Wir spüren den Körper und Atem. Wir nehmen Gefühle und Gedanken wahr. Wir beginnen unsere inneren Dynamiken besser zu verstehen: Aus welchem Gedanken entsteht welches Gefühl? Wie entstehen Ruhe und Glück in mir, wie kommt es zu Unruhe und Leid? Außerdem kultivieren wir heilsame Eigenschaften, wie beispielsweise Geistesgegenwart, Gelassenheit oder Liebe und Mitgefühl für uns und andere. Das ist die Bedeutung des altindischen Wortes für Meditation ›bhavana‹. Es bedeutet ›Kultivieren‹. Wir kümmern uns beim Meditieren sozusagen um unseren inneren Garten.« Wer stärker mit sich selbst vertraut ist, sich besser spürt, erlebt jeden Moment intensiver und klarer – und entdeckt eben auch leichter das Neuartige und Besondere im Vertrauten.
Neben der – am besten täglich praktizierten – Meditation gibt es eine Reihe von weiteren Übungen, um den Blick für das Neuartige in gewohnten Routinen zu schärfen und Premieren zu vertiefen. Boris Bornemann hat ein paar Anleitungen zusammengestellt von Übungen, die er empfiehlt. Beginnen wir mit der 5-4-3-2-1-Übung. Sie dient dazu, sich in die Sinne zu bringen und wahrzunehmen, was in dir und um dich herum geschieht.
»Finde fünf Dinge, die du gerade siehst. Du kannst sie innerlich benennen – in jedem Fall aber genau betrachten. Benenne vier Dinge, die du im Körper spürst – zum Beispiel: Kribbeln in den Füßen, Glucksen im Bauch, Druck im oberen Rücken und Jucken auf der Wange. Dann: drei Dinge, die du hörst, zwei die du riechst, und eines, das du schmeckst (auch wenn du gerade nichts isst: Welchen Geschmack hast du im Mund, gerade jetzt?). Du kannst die Übung auch in einer Schnellversion machen und pro Sinn nur eine Sache benennen oder auch andere Varianten der Übung entwerfen. Hauptsache, die Übung führt dich in die Sinne. Sie hilft dir, die Geschichte im Kopf etwas in den Hintergrund treten zu lassen und wahrzunehmen, was genau jetzt wirklich geschieht.«
Innehalten im Alltag
»Ein sehr effektiver Weg, um im Alltag bewusster zu leben, ist: Halte kurz inne – zum Beispiel, nachdem du einen Arbeitsschritt beendet hast oder bevor du den Raum verlässt. Spüre deinen Körper. Nimm wahr, wie du dich fühlst. Vielleicht willst du es für dich in Worte kleiden, etwa: ›Ein wenig unruhig, nervös, ein bisschen vorfreudig.‹ Fokussiere dich dann auf eine gute Absicht für die kommenden Momente, zum Beispiel: ›Möge ich gut für mich sorgen.‹ Oder, wenn du dich mit jemand anderem triffst: ›Mögen wir die gemeinsame Zeit genießen.‹
Das Ganze braucht nicht länger als 20 oder 30 Sekunden zu dauern. Mach es mehrmals am Tag – drei-, fünf- oder auch zehnmal, vielleicht sogar öfter. Es ist ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung. Du steigst kurz aus der inneren Getriebenheit aus. Du kommst mit dir in Kontakt, spürst dich deutlicher. Du richtest dich auf das aus, was dir wichtig ist. Die einzige Herausforderung, die es gibt, damit du die Kraft dieser Übung spüren kannst: Du musst dran denken und sie tatsächlich machen.«
Das Potenzial des Augenblicks
»Frage dich: ›Worin besteht das größte Potenzial dieses Augenblicks?‹ Genau jetzt etwa, während du dieses Buch liest, worin besteht das größte Potenzial? Vielleicht, dass du wirklich aufmerksam bist – etwas lernst, was dein Leben bereichert? Dass du dich entspannt und zugleich angeregt und lebendig fühlst? Dass du das Lesen genießt? Du kannst diese Frage in jedem Augenblick stellen. Durch die Frage entsteht eine kurze Pause im Gedankenstrom. Du wirst neugierig und deine Aufmerksamkeit wird darauf gelenkt, was genau jetzt möglich ist. Wie könnte ein schöner Verlauf dieser Familienfeier aussehen – was könnte im Idealfall passieren? Wie könntest du dich fühlen? Was kannst du dazu beitragen? Wenn du in den Bergen wanderst – wie könntest du diesen Moment in seiner ganzen Fülle erleben und zur Entfaltung bringen? Integriere diese Frage in dein Leben und kein Moment wird dir mehr öde oder alt erscheinen.«
Abendreflexion
»Frag dich zum Ausklang des Tages: Was habe ich heute zum ersten Mal erlebt? Es können auch scheinbar kleine Dinge sein: Vielleicht hast du heute zum ersten Mal in deinem Leben ein Kartoffel-Curry gegessen. Oder du hast mit einem Freund das erste Mal über dessen Verhältnis zu seinem Vater gesprochen. Wir schärfen mit dieser Übung den Blick dafür, dass kein Tag dem anderen gleicht. Vielleicht kannst du im Rückblick bewusst wertschätzen, was am heutigen Tag besonders war.«
Nun geht’s zur Königsdisziplin: In welche Richtung soll sich mein Leben entwickeln? Und wie könnte ich meine Wünsche Wirklichkeit werden lassen?
Um sich dieser Fragen anzunehmen, empfiehlt Boris Bornemann eine wissenschaftlich fundierte Methode, das sogenannte WOOPing. Es wurde von Gabriele Oettinger entwickelt – einer Psychologin, die an der Uni Hamburg und der New York University forscht. Die Wirksamkeit dieser Methode wurde in Dutzenden von Studien bestätigt.
WOOP steht für Wish-Outcome-Obstacle-Plan (Wunsch-Ergebnis-Hindernis-Plan). Es geht darum, uns mit unseren Wünschen zu verbinden, Hindernisse auf dem Weg dorthin zu antizipieren und Pläne zu machen, wie wir diese überwinden. Wir laden uns quasi selbst dazu ein, »realistisch zu träumen«.