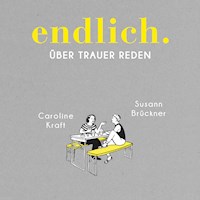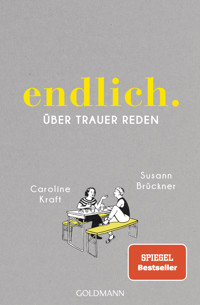
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Von den Macherinnen des Kult-Podcasts »endlich. Wir reden über den Tod«
Trauer hat ein schlechtes Image. Zu Unrecht! Trauer ist ein Prozess, durch den wir lernen, mit unseren Verlusten zu leben. Susann Brückner und Caroline Kraft zeigen, wie unterschiedlich wir trauern, und entlarven weitverbreitete Irrtümer darüber, was passiert, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Denn Trauer ist nicht das, wofür sie gehalten wird. Sie kennt keine Regeln, aber sie ist gestaltbar. Sie tut weh, aber sie ist wertvoll. Höchste Zeit, dass wir anfangen, Geschichten über das Trauern zu erzählen: krasse und zärtliche, schöne und wütende, fiese, berührende und überraschende. Wir können den gesellschaftlichen Umgang mit Trauer nur verändern, indem wir darüber reden: endlich.
»Dieses Buch ist (lebens-)wichtig für alle Menschen, die irgendwann mal trauern. Also für uns alle.« Mareice Kaiser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Autorinnen
Susann Brückner arbeitet und lebt im Literaturbetrieb in Berlin und Wien. Gelegentlich schreibt sie, meistens über Tod und Trauer, u. a. für das Almost Magazine oder die Berliner Zeitung.
Caroline Kraft schreibt als freie Autorin u.a. für Zeit Online. Ihre Kolumne »Schluss jetzt« erschien in der taz. Sie ist ausgebildete Sterbebegleiterin und chronische Bestatterpraktikantin und lebt in Berlin.
Gemeinsam betreiben Susann und Caro seit 2017 den Podcast »endlich. Wir reden über den Tod«. Er wurde für den Podcastpreis nominiert und unter die Top of the Pods von Zeit Online gewählt.
Das Buch
»Dieses Buch ist (lebens-)wichtig für alle Menschen, die irgendwann mal trauern. Also für uns alle.« Mareice Kaiser
Trauer hat ein schlechtes Image. Zu Unrecht! Trauer ist ein Prozess, durch den wir lernen, mit unseren Verlusten zu leben. Susann Brückner und Caroline Kraft zeigen, wie unterschiedlich wir trauern, und entlarven weitverbreitete Irrtümer darüber, was passiert, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Denn Trauer ist nicht das, wofür sie gehalten wird. Sie kennt keine Regeln, aber sie ist gestaltbar. Sie tut weh, aber sie ist wertvoll. Höchste Zeit, dass wir anfangen, Geschichten über das Trauern zu erzählen: krasse und zärtliche, schöne und wütende, fiese, berührende und überraschende. Wir können den gesellschaftlichen Umgang mit Trauer nur verändern, indem wir darüber reden: endlich.
Susann Brückner & Caroline Kraft
endlich.
ÜBER TRAUER REDEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Hinweis der Autorinnen:Wir verwenden in diesem Buch gendergerechte Sprache und nutzen den Doppelpunkt, weil dieser unseres Wissens nach momentan die barriereärmste Rezeptionsform für sehbehinderte Menschen darstellt.
Originalausgabe März 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © 2022 Caroline Kraft und Susann Brückner
Illustrationen: © Tine Fetz (www.fetz.net)
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München, unter Verwendung einer Illustration von © Tine Fetz
Redaktion: bookTRade UG, Berlin
DF | Herstellung: CF
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27869-4V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
In diesem Buch geht es um Verluste. Unsere Verluste. Wir widmen es allen, deren Trauer wir nicht oder nur am Rande thematisieren: Allen, die nach Trennungen und Jobverlust trauern oder nach Abtreibungen, die ihr Zuhause verloren haben, die Krieg und Gewalt erfahren mussten, deren Haustiere gestorben sind, die ungewollt kinderlos sind. Eure Geschichten sind wichtig, denn Trauer hat viele Gesichter.
Inhalt
1 Aus Scheiße Liebe machen
2 Alles darf, nix muss
Über die Realität der Trauer
3 Nicht ganz bei Trost
Über die Reaktionen auf Trauer
4 Kopfkino
Über das Begreifen
Im Gespräch mit Nora Gomringer
Ein Kind, das in seine Mutter verliebt war
5 Früher warst du anders
Über Trauer und Beziehungen
6 Ich muss laufen, laufen
Über die Körperlichkeit von Trauer
7 Durch Pfützen springen
Über Kinder und Trauer
Im Gespräch mit Rebecca Randak und Andy Steingrüber
Wir wollten ihn erst begrüßen
8 Alle Jahre wieder
Über Rituale
9 Kein Gestern und kein Morgen
Über Trauer und Sex
Im Gespräch mit Gabriele von Arnim
Die Amsel auf dem Balkon
10 Thirty years wiser
Über posttraumatisches Wachstum
11 Die Sache mit der schwarzen Wolke
Über Suizid
Sieben Forderungen für Trauer in einer modernen Gesellschaft
Dank
Literatur
Zitate im Buch
Quellen
1Aus Scheiße Liebe machen
Endlich über Trauer reden? Können wir nicht lieber mit der Liebe anfangen? Denn seien wir ehrlich: Kaum jemand hat so richtig Lust, über Trauer zu reden. Keine Trauerpower, nirgends. Trauer stört den Ablauf, belastet die Eingeweide, frisst die Zeit. Sie ist ein Partykiller, der die üblichen Verdächtigen im Schlepptau hat: Wut, Angst und Scham. Eine nette Truppe.
Dabei gibt es jede Menge gute Gründe, um die Trauer besser kennenzulernen. Um vertrauter mit ihr zu werden. Dann erkennen wir sie nämlich, wenn andere sie mit sich herumtragen. Dann gehen wir ihr nicht aus dem Weg. Dann verhalten wir uns zu ihr. Wenn sie dann bei uns auf der Matte steht – was sie früher oder später bei allen tut –, werden wir gar nicht erst versuchen, ihr die Tür vor der Nase zuzuknallen. Weil wir dann schon wissen, dass es so nicht funktioniert mit ihr. Weil sie gesehen werden will. Weil sie eine richtige Rampensau ist.
Wenn sie unsere ungeteilte Aufmerksamkeit hat, hat Trauer übrigens auch ihr Gutes. Dann merken wir, dass gar nicht sie das Problem ist. Sondern unser Blick, unsere Ablehnung, unsere Angst. Unser innerer Widerstand gegen ein so intensives Fühlen, wie sie es verlangt. Genaugenommen ist die Trauer ihrer großen Schwester, der Liebe, also gar nicht so unähnlich.
Beginnen wir damit, wie wir, Caro und Susann, aus Scheiße Liebe machten. Als wir uns zum ersten Mal privat trafen, abends in einer Kreuzberger Kneipe. Wir waren dazu verabredet, über unsere Toten zu sprechen. Ja genau, nicht über die Arbeit und unser letztes Date, sondern über unsere Toten. Butter bei die Fische, müssen wir an diesem Abend gedacht haben – ohne Rumgedruckse, keine verschämten Blicke, keine Floskeln oder peinliches Schweigen. Stattdessen kam das ganze Trauerding auf den Tisch: Was beschissen war, was verwirrend und wo die Liebe immer wieder hervorblitzte. Wir lachten, weinten und tranken viel Schnaps.
Endlich, dachten wir, reden wir über den Tod.
Dass daraus ein Podcast entstanden ist, überrascht uns noch heute. In »endlich. Wir reden über den Tod« sprechen wir mit Expert:innen, Betroffenen, Menschen aus dem öffentlichen Leben und Todesaktivist:innen über Tod und Trauer. In diesem Buch steckt alles, was wir in den letzten vier Jahren endlich.-Podcast über die Trauer gelernt haben. Es erzählt die Geschichten, die wir selbst gern gehört hätten, als wir ihr – jede für uns – zum ersten Mal begegnet sind.
2Alles darf, nix muss
Über die Realität der Trauer
Leid ist anders. Leid kennt keinen Abstand.
JOAN DIDION, DAS JAHR MAGISCHEN DENKENS
Mein Geburtstag, vor knapp sechs Jahren. Ein paar Minuten nach Mitternacht klingelt mein Handy. Ich liege schon im Bett und habe keine Lust auf Glückwünsche. Kurz darauf klingelt das Festnetztelefon, und mein Anrufbeantworter springt an. »Caro, ich stehe vor deiner Tür, geh bitte ran.« Die Stimme einer Freundin. Gerührt setze ich mich auf, vermute eine nächtliche Geburtstagsüberraschung. Ich laufe zur Wohnungstür. »Du bist ja süß«, setze ich mit der Hand an der Türklinke an und stocke, als ich ihr Gesicht sehe. Sie weint. Noch heute bin ich mir nicht sicher, ob ich sie jemals vorher habe weinen sehen. »Stefan ist tot«, sagt sie. »Er hat sich das Leben genommen.«
Stefan war mein Ex-Freund. Wir hatten eine wilde und leidenschaftliche Beziehung gehabt, gleichermaßen schön wie schmerzhaft, selbst in den zwei Jahren seit unserer Trennung, in denen sie immer wieder aufgelodert war. Trotz allem hatte uns eine tiefe Freundschaft verbunden, Stefan war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben gewesen.
Die Nachricht seines Todes veränderte von einem Moment auf den anderen alles. Nichts, was mir zuvor wichtig gewesen war, schien noch Bedeutung zu haben. Alles, was ich dachte, alles, was ich tat, führte unweigerlich zu Stefan. Ich war schiffbrüchig. Aber statt mich an Land zu spülen, trugen die Wellen mich immer wieder zu einem einzigen Ort: seinem Tod. Ich konnte nichts dagegen tun. Auch wenn ich mich mit aller Kraft dagegenstemmte.
Dagegenstemmen hieß: Weitermachen wie bisher. Ich ging mit Freundinnen essen und unterhielt mich, bis der Druck in meiner Brust unerträglich wurde. Ging auf Konzerte und wartete ketterauchend in stinkenden Toilettenkabinen darauf, dass meine Panikzustände abflauten und ich mit zitternden Beinen nach Hause laufen konnte. Ging einkaufen und fand mich schreiend an der Supermarktkasse wieder. Alles endete in Tränen, in Fragen meiner Mitmenschen, in hilflosen Blicken.
Am meisten quälte mich der Gedanke an seinen Körper. Stefan war nicht der erste Mensch, den ich in meinem Leben verloren habe, doch er war der erste, dem ich auch körperlich nah gewesen war. Ich glaube, dass diese Tatsache eine Rolle spielte. Der Tod und das Begehren. Wie, verdammt noch mal, sollte ich das zusammenkriegen? Ich starrte in die Lücke dazwischen und begann, Notizzettel zu füllen. Ich war dir nah, schrieb ich. Kannte deine Arme, deine Beine, deine Brust. Dein schöner Körper im Feuer. Ich starrte auf die einzelnen Worte. Auf meine Hände, die sein Gesicht gestreichelt hatten. Dachte an seine Hände, die ich so schön fand. Ich bin am Leben. Er ist tot. Mein Verstand arbeitete auf Hochtouren, und mein Körper wurde seltsam taub.
Funktionierenmüssen
Mehrere Monate vergingen. Ich hielt es kaum aus, zu atmen, zu essen und zu schlafen. Trotzdem versuchte ich zu arbeiten. Jeder Vorstoß endete vor einem eingeschalteten Bildschirm, dem ich stundenlang mit leeren Augen gegenübersaß. Ein Zusammenbruch folgte auf den nächsten, wechselte sich mit erneuten Anläufen ab, wieder ins Büro zu gehen. Eine endlose Kette aus Wollen und Nichtkönnen. »Warum glaubst du, dass du funktionieren musst?«, fragte mich meine Psychotherapeutin. Ich wusste damit nichts anzufangen. Stattdessen fragte ich mich immer wieder, ob das, was mir passierte, normal war. Ob dieser Schmerz, neben dem alles von einem Moment auf den anderen verblasst war, irgendwann wieder verschwinden würde. Ich war aus dem Leben gefallen und wusste nicht, ob ich je wieder zurückfinden würde. Was ich erlebte, hatte nichts mit dem zu tun, was ich über Trauer zu wissen glaubte. Ich kannte niemanden, der nach dem Tod eines geliebten Menschen einfach ausgefallen war. Eigentlich kannte ich offene Trauer gar nicht.
Ich fühlte mich schuldig. Offenbar kamen andere viel besser mit ihren Verlusten zurecht als ich. Ich fragte mich immer wieder, ob der Tod eines Ex-Freundes eine solche Wucht rechtfertigte. Ich wusste noch nicht, dass Trauer keine Relationen kennt. Dass es kein Zuviel oder Zuwenig davon gibt. Und dass sich der Schmerz, den man selbst empfindet, nicht am Schmerz einer anderen Person messen lässt.
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht für Arbeitnehmer bezahlten Sonderurlaub nach dem Tod eines Angehörigen vor.1 Dieser wird in der Regel für Verwandte ersten Grades gewährt, die Dauer ist von der Kulanz des Arbeitgebers abhängig. Gängige Richtwerte liegen bei zwei bis drei Tagen. Zwei bis drei Tage also, wenn meine Eltern, meine Lebenspartner:in oder mein Kind sterben. Von einem Ex-Freund ist da nicht die Rede.
Nachdem mich eine Kollegin wiederholt tränenaufgelöst im Büro vorgefunden hatte, dämmerte mir, dass es so nicht weitergehen konnte. Mit einem Mal gestand ich mir ein, dass es mir nicht gut ging – und dass ich nicht wusste, wann es mir wieder besser gehen würde. Noch am selben Tag rang ich mich zu einem Gespräch mit meiner damaligen Chefin durch. Die Unterredung verlief gut. Sie war viel einfacher, als ich geglaubt hatte. Meine Vorgesetzte schien fast erleichtert, ganz so, als hätte sie selbst erwogen, bald auf mich zuzukommen. Sie schlug vor, dass ich mich eine Weile vertreten lassen könne und machte deutlich, dass ich zurückkehren konnte, wann immer ich wieder arbeitsfähig sein würde.
Was sich damals wie eine Kapitulation auf ganzer Linie anfühlte, war der erste und womöglich wichtigste Schritt, um die Realität meiner Trauer zu akzeptieren. Ich glaube, dass wir nicht wählen können, wie wir trauern. Mit den Erscheinungsformen der Trauer zu hadern oder sie zu unterdrücken hilft uns nicht weiter. Wir müssen unsere Trauer als das erkennen, was sie ist, sie annehmen und uns mit ihr arrangieren – wie seltsam, wie fehl am Platz sie uns auch zunächst erscheinen mag. Und wie wenig sie gerade in unser Leben passt.
Nach dem Gespräch mit meiner Chefin ging ich nach Hause, legte mich ins Bett und schaute eine Serie: eine Farm vor der Kulisse der kanadischen Rocky Mountains, eine Familie, die durch dick und dünn geht, Pferde. Viele Pferde. Acht Staffeln lang, gut sechstausend Minuten, jede Folge mit einem Happy End. Ich ließ alles andere stehen und liegen und sagte jede Verabredung, jede Verpflichtung ab. Stattdessen ging ich spazieren, stundenlang. Und setzte mich an den Baum, den Stefans Freund:innen am Landwehrkanal für ihn gepflanzt hatten.
Mein Leben verlangsamte sich. Noch immer drehte sich alles, was ich dachte und worüber ich sprach, um Stefan. Und doch schlich sich ein weiteres Gefühl ein: Zum ersten Mal seit seinem Tod fühlte sich etwas richtig an. Es war richtig, meinem Schmerz den Raum zu geben, den er monatelang so nachdrücklich eingefordert hatte. In mir war etwas in Bewegung geraten: Aus meinem Schulwissen, notierte ich, tauchen Bilder von sich verschiebenden Erdplatten auf. Erdkruste und Tektonik, Begriffe, deren Bedeutung ich erst nachschlagen muss, um zu verstehen, wie zutreffend sie dieses Gefühl beschreiben, eine Ahnung von Bewegung aus dem tiefsten Inneren, nur seismographisch erfassbar. Was folgt, sind Hoffnung und Verzweiflung. Hoffnung auf ein Leben nach der Trauer. Und mit ihr die Ernüchterung, die zusätzliche Trauer um das langsame Verschwinden dieser ersten, alles verschlingenden, lähmenden Trauer. Was bleibt von dir, wenn auch die Trauer fortgeht?
Beim Arzt
Atmen, essen, schlafen. Was ich damals tat, war überleben – zu diesem Zeitpunkt hätte ich das jedoch nicht formulieren können. Erst viel später stieß ich auf das Modell der Trauerexpertin Chris Paul.2 Überleben ist darin die erste von sechs Facetten der Trauer, die im Lauf der Zeit mal mehr, mal weniger stark hervortreten können. Ich glaube, dass mir das damals geholfen hätte: zu wissen, dass es dieses emotionale Notprogramm gibt. Dass es okay ist, einfach nur durch den Tag zu kommen, nicht zu funktionieren. Dass das (auch) Trauer ist.
In der Alltagswelt da draußen ist es hingegen nicht so einfach, nicht zu funktionieren. Erwerbstätige Trauernde, bei denen sich dieses Notprogramm über einen längeren Zeitraum anschaltet, brauchen eine Krankschreibung, für die mich mein Hausarzt an einen Psychiater überwies, wo ich noch nie zuvor gewesen war. Ich erhielt die Diagnose Anpassungsstörung. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich behandelt wie eine Patientin mit einer langfristigen Erkrankung: Die dazugehörige Krankschreibung galt zunächst für vier Wochen und war, um für denselben Zeitraum verlängert zu werden, mit einem erneuten Arztbesuch verbunden. In den Nächten vor diesen wiederkehrenden Terminen überfiel mich Panik. Mir war klar, dass ich noch nicht wieder arbeitsfähig war, doch was, wenn der Psychiater das anders sah? Würde ich ihn erst überzeugen müssen?
Bei meinem zweiten Besuch schlug mir der Psychiater vor, in Kur zu gehen. Er gab mir Informationsmaterial mit, in dem von psychischen Störungen die Rede war, von Gruppen-, Gestalt- und Tanztherapie. Nichts davon fühlte sich richtig an. Ich lehnte ab. Daraufhin verschrieb er mir ein Antidepressivum, das ich jeden Morgen nehmen sollte. Die unendliche Liste von Nebenwirkungen, die im Beipackzettel genannt wurde, gruselte mich. Die Tabletten lagen wochenlang unangetastet auf meinem Nachttisch. Ich war hin- und hergerissen zwischen der Angst, ich könnte von einem Moment auf den anderen depressiv geworden sein, und dem vagen Gefühl, dass ich nicht Medikamente brauchte, sondern Zeit. Und zwar viel mehr Zeit, als ich mir jemals hätte vorstellen können.
Dieser Zwiespalt war alles andere als hilfreich. Einerseits konnte ich es mir dank der Krankschreibung endlich erlauben, nicht zu funktionieren, ohne mich um meine Existenzgrundlage sorgen zu müssen. Das empfinde ich als großes Privileg, denn ich weiß, dass nicht alle Trauernden diese Möglichkeit haben. Andererseits wurde meine Situation pathologisiert. Nun hinterfragte ich permanent meinen psychischen Gesundheitszustand, anstatt das zu tun, was mir wirklich half: zu trauern. So krass, so extrem, so schmerzhaft, wie es eben sein musste.
Trauer hat keine Lobby
Anfang 2022 wurde die Diagnose »Anhaltende Trauerstörung« von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in das ICD, das Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen, aufgenommen. Sie kann frühestens sechs Monate nach dem Tod einer nahestehenden Person gestellt werden und wird durch verschiedene Merkmale definiert, unter anderem »ausgeprägte Sehnsucht nach der verstorbenen Person, welche begleitet wird durch starke emotionale Schmerzen (z. B. Traurigkeit, Schuldgefühle, Wut, Verleugnung, Schwierigkeiten, den Tod anzunehmen, das Gefühl, einen Teil des eigenen Selbst verloren zu haben, die Unfähigkeit, eine positive Stimmung zu erleben, emotionale Taubheit, Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit sozialen oder anderen Aktivitäten).«3
Die Entscheidung der WHO leistet der Pathologisierung von Trauer Vorschub und ist dementsprechend umstritten. In Fachkreisen löste sie eine heftige Debatte aus. Einerseits war es begrüßenswert, dass Trauernde dadurch Zugang zu professioneller Unterstützung wie Psychotherapie bekommen und Anrecht auf Lohnfortzahlung haben, wenn sie nicht arbeiten können. Andererseits stieß die Klassifizierung von Trauer als psychische Störung auf scharfe Kritik. Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) betonte, wie individuell Trauerprozesse verlaufen können. »Der DHPV versteht Trauer als natürliche Reaktion auf einen schweren Verlust und als Kraft, mit dieser Situation umzugehen. (…) Die Trauer braucht Zeit, damit die Erfahrungen des Verlustes langsam in das Leben integriert werden können. Das ist bei Trauernden sehr unterschiedlich. Durch Festlegungen von bestimmten Zeiten werden Prozesse der Trauer eingegrenzt und normiert. Störungen in diesen Prozessen entstehen nicht durch die Trauer, sondern durch den Verlust einer nahen Bezugsperson. Trauer hingegen hat heilende Kraft und kann zum Beispiel dem Entstehen von Depressionen entgegenwirken.«4
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe selbst erlebt, wie sehr der Trauerprozess erschwert wird, wenn ihm der Stempel einer psychischen Störung aufgedrückt wird. Wenn ich heute auf die ersten zwei Jahre nach Stefans Tod zurückblicke, fühlt es sich nicht an, als sei ich krank gewesen. Ich trauerte. Doch das passt nicht in eine Gesellschaft, die in erster Linie auf Leistung ausgerichtet ist. Wir müssen Mittel und Wege finden, wie Trauer gelebt werden kann, ohne dass sie als krankhaft erfahren wird, ohne dass Trauernde, die längerfristig nicht arbeiten können, alle paar Wochen zum Psychiater rennen müssen. Dabei spielen auch Begrifflichkeiten eine Rolle. »Trauerstörung« vermittelt ein anderes Bild als beispielsweise »Trauerreaktion«.
Wenn es um die Frage geht, ab wann normale Trauer in eine pathologische Form übergeht, bewegen wir uns auf dünnem Eis. Denn was genau bedeutet hier »normal«? »Obwohl Trauer nach dem Tod einer nahestehenden Person ein universelles Erleben ist, fällt es nach wie vor schwer, eine Normierung eines nicht-pathologischen Trauerprozesses festzulegen«, sagt die Trauerforscherin Birgit Wagner. Es gibt also keine vorgefertigten Konfektionsgrößen für Trauer. Wagner unterstreicht, dass »es individuelle und kulturelle Abweichungen« gibt, »die nur schwer zu normieren sind.«5
Sicherlich gibt es Verläufe, bei denen Trauernde professionelle Hilfe brauchen. Traumatische Verluste können posttraumatische Belastungsstörungeni nach sich ziehen. Auch Depressionen können von Trauer getriggert werden. Doch das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wir neigen dazu, Trauer als ein Problem anzusehen, das möglichst schnell aus der Welt geschafft werden muss. Ist das nicht möglich, gelten wir als krank. Das hat auch mit unserem Gesellschaftsverständnis zu tun. Der Zukunftsforscher Matthias Horx stellt in seinen »Acht Thesen zur Trauerkultur im Zeitalter der Individualität« fest, dass moderne Gesellschaften die Trauer als »eine Störung ökonomischer und sozialer Routinen« tabuisieren.6
Hier läuft also etwas gehörig schief. Wir sollten damit anfangen, Trauer, egal wie intensiv und lang sie ist, als gesunde Reaktion auf einen Verlust zu begreifen.
Trauer auf der Spur
Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es also wichtig, Trauer und Depression nicht in einen Topf zu werfen. Das ist gar nicht so einfach, denn diese beiden Zustände können sich manchmal zum Verwechseln ähnlich sehen. Die Forschung bestätigt, dass Trauer und Depression Überschneidungen haben (zum Beispiel Traurigkeit, Schuldgefühle, gedrückte Stimmung und sozialer Rückzug), gleichzeitig aber auch deutliche Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Die Gedanken von Trauernden drehen sich vor allem um die verstorbene Person, während depressive Menschen in ihren negativen Gefühlen oft stark auf sich selbst fokussiert sind.7
In einer Folge des großartigen Podcasts On Being spricht die US-amerikanische Journalistin Krista Tippett mit dem Autor Andrew Solomon. Er beschreibt darin den Moment, in dem er nach dem Tod seiner Mutter von tiefer Trauer in Depression abglitt. »Als die Depression kam, war da keine Trauer mehr. Ich blieb zurück mit diesem stumpfen Gefühl der Taubheit. Plötzlich war alles egal: dass meine Mutter gestorben war, dass mein Buch Erfolg hatte. Auf beiden Seiten des Spektrums war einfach nichts mehr von Bedeutung.«8 Andere Betroffene berichten: »Alles ist vage, so unscharf, auch der Schmerz.«9 Vielleicht liegt darin ein Unterschied zur Trauer – oder sagen wir: zu meiner Trauer. Denn auch für mich hatte von einem Moment auf den anderen alles an Bedeutung verloren. Alles, nur eines nicht – dass Stefan gestorben war. Der Schmerz um ihn war messerscharf.
Wir sollten eins nicht vergessen: Dass Trauer einen guten Grund hat, nämlich den Verlust eines geliebten Menschen. Und einen Sinn – auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, wenn wir mittendrin stecken. Durch sie – wie schwer dieser Prozess auch sein mag – lernen wir, uns an eine neue Lebenssituation anzupassen. Und das kann eben dauern. Punkt.
Auf die Frage nach der Dauer hat die Wissenschaft übrigens auch keine eindeutige Antwort. Die Forschung tut sich schwer damit zu definieren, wie lange die sogenannte normale Trauer anhalten kann. Nur wenige Studien untersuchen Trauerverläufe langfristig. Eine 2006 durchgeführte Untersuchung mit verwitweten Personen zeigt, dass diese auch Jahrzehnte nach dem Tod noch Trauerreaktionen zeigen und außerdem im regelmäßigen inneren Dialog mit ihren verstorbenen Partner:innen stehen.10
Ich weiß noch, wie ich Susann drei Monate nach Stefans Tod verzweifelt fragte, wie lange das noch so gehen würde. Heute denke ich: Wie konnte es sein, dass ich so wenig über Trauer wusste, dass mir drei Monate lang vorkamen? Letztendlich vergingen vier Jahre, bis mein Leben wieder in normalen Bahnen verlief.
Wenn es um Trauer geht, geistern so einige irreführende Vorstellungen durch unsere Gesellschaft. Heilung ist eine davon. Wenn ein liebster Mensch stirbt, wird nichts wieder heil. Trauer ist ein Übergangsprozess vom Leben mit diesem Menschen in ein Leben ohne ihn. Dieser Prozess verändert uns. Es gibt kein Zurück. Wir sollten anfangen, in Erwägung zu ziehen, dass Trauer nicht einfach irgendwann wieder verschwindet. Dass sie leichter wird, aber ein Teil von uns bleibt. Für mich gilt: Nach diesen vier Jahren war meine Trauer nicht beendet. Ich hatte nur gelernt, mit ihr zu leben.
Trauer, genauso komplex wie wir
Auch die Idee, dass wir unsere Toten loslassen und nach vorne schauen müssen, ist großer Unsinn, der auf Sigmund Freud zurückgeht. Der Begründer der Psychoanalyse war der Meinung, dass die eigentliche Aufgabe des Trauerprozesses darin bestehe, sich von der verstorbenen Person zu lösen, um wieder nach vorne schauen zu können.11
Die neuere Trauerforschung verfolgt hingegen einen beziehungsorientierten Ansatz. Dabei geht es darum, mit der verstorbenen Person in Verbindung zu bleiben und ihr eine neue Rolle im eigenen Leben zuzuweisen. Von diesem Konzept werde ich mehr im Kapitel »Alle Jahre wieder«, in dem es um Rituale geht, erzählen.
Trauerprozesse sind komplex und von zahlreichen Faktoren abhängig. Die Begleitumstände des Todes (hat eine Person sehr gelitten, oder ist sie friedlich im Schlaf verstorben?), die Todesart oder die Beziehung, die wir zu der verstorbenen Person hatten, sind nur wenige davon. Auch unsere Lebenssituation und Persönlichkeit spielen eine große Rolle dabei, wie wir trauern – etwa, ob wir schon andere Verlusterfahrungen gemacht haben und wie wir mit ihnen umgegangen sind. Deshalb ist es so schwer, generelle Aussagen über Trauer zu treffen. Trotzdem ist es hilfreich, sich diese Faktoren genauer anzuschauen – nicht, um unsere Trauer zu bewerten oder zu hierarchisieren, sondern um uns bewusst zu machen, welche besonderen Herausforderungen ein Verlust mit sich bringt.
Die Wissenschaft benennt sogenannte Risikofaktoren, die Trauer erschweren können. Einer davon ist ein plötzlicher Tod, zum Beispiel durch einen Unfall. Wenn eine Person unerwartet stirbt, stehen wir zunächst unter Schock. Unser Verstand kommt nicht hinterher. Dass ein Mensch, der gerade noch mit uns am Frühstückstisch saß, jetzt tot sein soll, ist doppelt schwer zu begreifen. Auch ein gewaltsamer Tod wie der von Stefan erschwert den Trauerprozess. Ein weiterer Umstand, der fast unweigerlich auf einen erschwerten Trauerprozess hinausläuft, ist der Tod eines Kindes.
Doch Trauer ist tricky. Neben solch unübersehbaren Faktoren gibt es auch jene, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Sie haben mit unseren Beziehungen zu tun. »Keine Liebe ohne Trauer«, schreiben wir im Eingangsmotto unseres Buches. Da haben wir den Salat. Denn so unterschiedlich die Liebe ist, so unterschiedlich ist auch die Trauer. Die komplexen Beziehungen, die wir zu den Menschen haben, die uns nah sind, setzen sich in der Trauer um ihren Verlust fort. Wenn die geliebte 85-jährige Großmutter stirbt, mag ihr Tod womöglich nicht ganz überraschend kommen. Folgt er auf eine lange Krankheit, spielt möglicherweise sogar Erleichterung eine Rolle.ii Können wir uns auf den Tod vorbereiten, uns verabschieden, letzte Dinge sagen, ist das für den weiteren Trauerprozess hilfreich. Trotzdem ist da ein Mensch gestorben, mit dem man sein ganzes Leben verbracht hat. Damit leben zu lernen ist schwer, egal, wie erwartbar der Tod gewesen sein mag. Tiefe Liebe zieht tiefe Trauer nach sich.
Ambivalente Beziehungen wiederum behindern den Trauerprozess. Eine Leserin der Washington Post schrieb der Kolumnistin Carolyn Hax von dem Verlust ihrer Mutter, zu der sie ein schwieriges und eher distanziertes Verhältnis hatte. Sie fragte sich, woher die überbordende Trauer kommen mochte, die sie nach deren Tod in regelmäßigen Abständen einholte. Die Journalistin antwortete: »Sie trauern um die Mutter, die Sie hatten, und die Mutter, die Sie nicht hatten.«12 Sich der Realität des Todes zu stellen kann eben auch heißen, mit der eigenen Lebensgeschichte konfrontiert zu werden und sich von versöhnlichen Hoffnungen verabschieden zu müssen. Ich habe erst lange nach Stefans Tod begriffen, wie sehr ich noch in ihn verliebt war, als er starb. Wie sehr ich darauf gehofft hatte, dass wir doch nochmal die Kurve kriegen würden. Mir das einzugestehen und mir bewusst zu machen, was ich konkret betrauere, war für mich ein großer Schritt.
Traurig, traurig: Trauernormen
Welche Beziehung wir zu unseren Toten haben, hat auch Einfluss darauf, ob unsere Trauer gesellschaftlich anerkannt wird. Die erste Frage, die mir fast immer gestellt wird, wenn ich von Stefan als meinem Ex-Freund spreche, ist, ob wir zum Zeitpunkt seines Todes noch zusammen waren. Früher quälte mich das, die unausgesprochene Botschaft hinter dieser Frage dröhnte in meinen Ohren: Wenn ihr nicht mehr zusammen wart, ist es ja nicht so schlimm.
Es ist nicht so, dass ich diese Reaktion nicht verstand. Mehr noch: Ich zweifelte ja selbst daran, ob meine Trauer gerechtfertigt war. Heute weiß ich, dass es einen Begriff für dieses Phänomen gibt: aberkannte oder entrechtete Trauer.
Wir alle haben bestimmte gesellschaftliche und kulturelle Normen im Kopf, die auch vor der Trauer nicht Halt machen. Diese Normen bestimmen, welche Verluste betrauert werden dürfen, auf welche Art und Weise dies geschehen darf – und wer überhaupt das Recht hat zu trauern. Die Trauerexpertinnen Tanja M. Brinkmann und Chris Paul schreiben dazu, »dass Verluste, trauernde Menschen und ihre Trauerreaktionen regelmäßig in eine meist unbewusste Rangordnung gebracht werden«. Aus dieser Rangordnung resultieren Trauernormen, die »auch individuell durch Familiengeschichte oder Persönlichkeitsmerkmale bestimmt sind«. Das hat weitreichende Folgen: »Begleitende ebenso wie Nachbarn, Angehörige und Trauernde«, geben, so die Autorinnen, »selbst automatische Bewertungen«13 ab: Sie stufen Verluste unterschiedlich ein und ordnen Trauerreaktionen danach, wie angemessen sie ihnen erscheinen. Auch deshalb erfahren Trauernde unterschiedliche zwischenmenschliche Anteilnahme oder professionelle Unterstützung. Es ist also stark von sozialen Faktoren abhängig, ob und wie Trauer gelebt werden kann.
Ende der 1980er-Jahre prägte der US-amerikanische Trauerforscher Kenneth Doka den Begriff »entrechtete Trauer«. In seinem Buch Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow (etwa: Entrechtete Trauer: Verdeckten Kummer erkennen) definiert er diese als Trauer, die ein Mensch nach einem Verlust empfindet, der nicht offen anerkannt oder sozial sanktioniert wird. Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir um eine Person außerhalb der Familie trauern. »Die Nähe einer außerfamiliären Bindung wird in solchen Fällen nicht verstanden und gewürdigt, obwohl die Rollen von Liebhabern, Freunden, Nachbarn, Pflegeeltern, Kollegen, Schwagern oder Schwägerinnen, Stiefeltern oder -kindern, Pflegern, Beratern, Therapeuten oder Zimmernachbarn (zum Beispiel in einem Pflegeheim) über lange Zeit entstanden, etabliert und sehr interaktiv sein können«, schreibt Doka. »Obgleich solche Beziehungen bekannt sind, mögen Trauernde dennoch keine Gelegenheit haben, ihren Verlust öffentlich zu betrauern.«14
Ich muss es einmal ganz deutlich sagen: Trauernormen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Rollen sind, wie Susann sagen würde, bullshit. Sie führen zu nichts Gutem. Ich hatte sie so sehr verinnerlicht, dass ich meiner Trauer den Ausdruck absprach, den sie brauchte. Ich bin froh, dass sie mich mittlerweile nicht mehr im Griff haben.