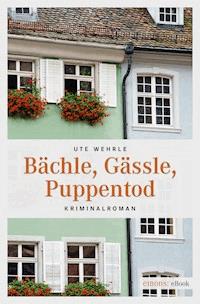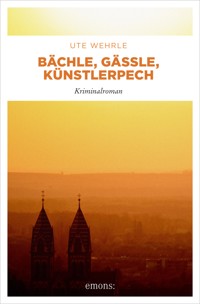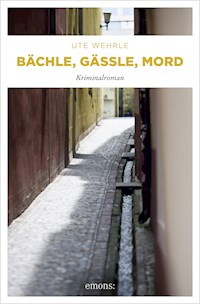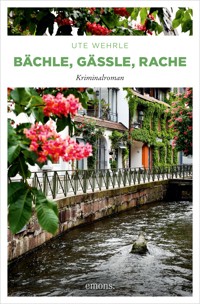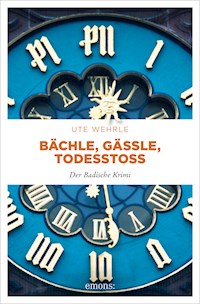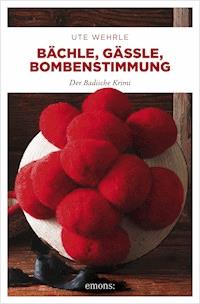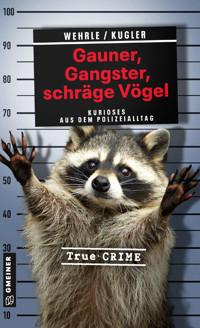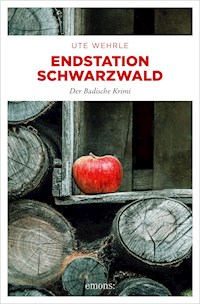
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Badische Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Freiburger Student in einem Fuchskostüm wird tot unter der Gutachtalbrücke aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Aber was für eine Bedeutung hat das Selfie mit einer überdimensionalen Kuckucksuhr, das der junge Mann kurz vor seinem Tod gemacht hat? Und warum das Tierkostüm? Ex-Polizist Thomas Braun und sein Kumpel Jockele stehen vor einem Rätsel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Wehrle ist gebürtige Freiburgerin und studierte Touristik-Betriebswirtschaft in Heilbronn. Sie arbeitet als freie Autorin und Journalistin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: dioxin/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-478-0
Der Badische Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meinen Vater
1
Verärgert verharrte das Eichhörnchen auf einem ausladenden Ast, der zu einer jener glücklichen Tannen gehörte, die den Angriff der Borkenkäfer nebst Orkan Lothar unbeschadet überstanden hatten. Verärgert deshalb, weil es zum einen unsanft geweckt worden war, zum anderen weil es, sosehr es sich auch das Köpfchen zerbrach, keine vernünftige Erklärung dafür fand, was sich sechs Meter weiter unter ihm direkt vor seinen Augen abspielte.
Gewöhnliche Wanderer waren das auf keinen Fall, die da mit ihrem Hund herumspazierten, so viel stand fest. Die blieben normalerweise auf den eigens für sie ausgeschilderten Wegen, die sich weiter entfernt durch den Wald zogen, und trampelten nicht wie eine wild gewordene Elefantenherde durchs Unterholz, schon gar nicht mitten in der Nacht. Oder sollte der Förster und einer seiner Kollegen Lust auf einen nächtlichen Pirschgang verspürt haben? Das Eichhörnchen verwarf den Gedanken wieder. Erstens benahm Förster Stiefvater sich sehr viel rücksichtsvoller, wenn er im Wald unterwegs war, und zweitens ließ er sich sowieso nur noch alle paar Monate in seinem Revier blicken. Und wenn er dort nach dem Rechten schaute, war er stets in Begleitung seiner drahtigen Hündin Stella, die zum Glück so gar keine Ähnlichkeit mit dem vierbeinigen Monstrum hatte, das schlimmer keuchte als ein Asthmatiker in einer verrauchten Eckkneipe. Nein, die beiden Männer – als solche hatte das Eichhörnchen die Zweibeiner sofort erkannt – führten etwas völlig anderes im Schilde, als nur frische Schwarzwaldluft zu schnappen, da war es sich hundertprozentig sicher. Nur was?
Bis gerade eben noch hatte es in seinem mit Moosen und Blättern ausgepolsterten gemütlichen Kobel friedlich geschlummert, wie es sich für ein anständiges Eichhörnchen nach Einbruch der Dunkelheit gehörte. Der Tag war schließlich anstrengend genug gewesen. Es wusste schon gar nicht mehr, wie viele Baumstämme es von morgens bis abends hoch- und runtergewitscht war, von den vielen rekordverdächtigen Sprüngen gar nicht erst zu reden. So viel Körpereinsatz haute selbst das stärkste Eichhörnchen um, weswegen ihm vor lauter Erschöpfung sofort die Augen zugefallen waren, als es in seinen Kobel zurückkehrte. Doch lange war ihm sein Schlaf nicht vergönnt gewesen, dafür hatte der riesige Köter, der von dem schmächtigeren der beiden Typen hinter sich hergezerrt wurde, viel zu laut gebellt. Rau und angsteinflößend, ganz anders als Stella, die nicht einmal dann mit der Wimper zuckte, wenn unverhofft ein Reh durch das Gebüsch brach.
Obwohl es in der Dunkelheit bestimmt nicht zu sehen war, sprang das Eichhörnchen einen Ast höher, als das seltsame Trio auf acht Beinen näher kam. Sicher war sicher, zumal der Hund so aussah, als könnte er einen possierlichen Nager wie ihn mit einem Bissen verschlingen. Eine Vorstellung, die nicht gerade dazu beitrug, dass sich das Eichhörnchen wohler in seiner Haut fühlte.
Wäre ihm die Art von Gefühlsregung vergönnt gewesen, hätte es in diesem Moment bitterlich geseufzt. Kaum war es vor wenigen Tagen umgezogen, weil sein Lieblingsschlafnest, besser gesagt der Baum, auf dem es sich befunden hatte, von Waldarbeitern umgesägt worden war, wurde es schon wieder bedrängt, ohne dass es sich dagegen wehren konnte. Ja, wäre es so stark und kräftig wie der Keiler, der sich erst am Morgen den borstigen Rücken am Baumstamm gerieben hatte, dann hätte es den Eindringlingen so richtig gezeigt, was es von ihrem ungebetenen Besuch hielt. Aber wenn man, den buschigen Schwanz nicht mitgerechnet, gerade mal über eine Körpergröße von zwanzig Zentimetern verfügte, hatte man naturgemäß schlechte Karten, gegen andere aufzumucken. Da hielt man sich besser zurück, vor allem, wenn die kleinen Zähne höchstens dafür taugten, Nüsse zu knacken.
Vielleicht sollte es sich wieder eine ruhigere Schlafstätte suchen, irgendetwas Nettes mit schöner Aussicht. Gab’s da nicht in der Nähe die verlassene Höhle eines Spechtes? Von außen betrachtet hatte die eigentlich ganz gemütlich ausgesehen. Und falls die schon belegt sein sollte, fanden sich fraglos andere passende Alternativen. Der Schwarzwald war schließlich groß genug.
Auch das noch. Das Eichhörnchen richtete seine Pinselöhrchen auf, als die Gruppe direkt unter seiner Tanne stehen blieb. Erst jetzt fiel ihm auf, dass einer der Männer eine Schaufel und einen großen Plastiksack mit sich geschleppt hatte, den er nun keuchend ablegte. Neugierig hob es seinen Kopf. Wollten die Störenfriede etwa Wintervorräte verstecken? Dafür wären sie aber ziemlich früh dran, der Herbst lag noch in weiter Ferne. Ratlos fuhr sich das Eichhörnchen mit den Pfoten über die Barthaare.
Ein gewaltiger Fehler, denn der Hund wandte prompt seinen Blick nach oben. Wild kläffend richtete er sich auf und fing an, mit den Vorderpfoten am Baumstamm zu kratzen. An seinem rechten Mundwinkel hing ein Speichelfaden. Er sah sehr, sehr hungrig aus.
Das Eichhörnchen bemühte sich verzweifelt, keinen Muckser mehr von sich zu geben. Obwohl es schon fast drei Jahre auf dem Buckel hatte, was für ein frei lebendes Eichhörnchen, das ständig von hungrigen Greifvögeln oder Baummardern bedroht wurde, ein stolzes Alter war, fühlte es sich zum Sterben definitiv noch viel zu jung.
»Ruhig, Wotan«, hörte es den schmächtigen Mann sagen. »Alles gut.« Der Hund wurde an der Leine zurückgezerrt.
Immer noch regungslos beobachtete das Eichhörnchen, wie der Mann etwas aus einem Rucksack zog, den er abgesetzt hatte, und es dem Köter hinhielt, der gierig danach schnappte.
»So ist es brav.« Der Schmächtige kraulte dem Hund, der jetzt friedlich vor ihm lag, liebevoll den Nacken, während der andere, der bis jetzt noch kein Wort gesagt hatte, begann, mit seiner Schaufel ein Loch im Waldboden auszuheben. Als es ihm tief genug erschien, legte er den Plastiksack hinein und schaufelte es wieder zu, bevor er es notdürftig mit abgebrochenen Zweigen und Ästen bedeckte. »Fertig. Jetzt bist du dran«, sagte er dann zu seinem Begleiter. Besonders vertrauenerweckend hörte sich seine Stimme nicht an, fand das Eichhörnchen.
Dennoch verspürte es einen Hauch von Erleichterung. Zumindest bei dem Schmächtigen, der Wotan mit Leckerlis fütterte und ihm unentwegt das Fell streichelte, musste es sich um einen harmlosen Vertreter seiner Gattung handeln, der seinen Hund, mochte er auch noch so hässlich sein, aufrichtig liebte.
Sapperlot, dieser Wotan hatte es echt gut, der musste keine Vorräte für den Winter sammeln und sich nicht zu allem Übel auch noch sämtliche Verstecke merken, schoss es dem Eichhörnchen durch den Kopf. Was im Übrigen gar nicht so einfach war, wenn man so wie es ein klein wenig zur Schusseligkeit neigte. Hund müsste man sein, befand es neidisch, als der Schmächtige erneut in seinen Rucksack griff.
In Erwartung eines weiteren Leckerbissens wedelte Wotan euphorisch mit dem Schwanz – dann peitschte ein Schuss durch die Nacht, der das Eichhörnchen entsetzt davonspringen ließ.
2
»Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder?« Der pensionierte Polizist Thomas Braun bockte wie ein junger Mustang, der zum ersten Mal in seinem Leben ein Halfter zu Gesicht bekam. »Nie im Leben. Vorher trete ich freiwillig im Zirkus auf.« Sein ganzer Körper strahlte Ablehnung aus.
»Aber, aber, wir wollen doch nicht gleich übertreiben.« Sein Hausarzt thronte leicht angespannt hinter einem gewaltigen Mahagoni-Schreibtisch, für den etliche Bäume ihr Leben hatten lassen müssen, und rang sich ein gequältes Lächeln ab. »Überhaupt verstehe ich nicht, warum Sie so stur sind. So eine Kur hat schließlich noch keinem geschadet. Und Sie müssen dringend etwas für sich tun. Bei allem, was Sie in letzter Zeit mitgemacht haben.« In seiner Stimme schwang tief empfundenes Mitleid mit.
»So, habe ich das?«, fragte Braun irritiert.
Der Arzt lehnte sich zurück, faltete die Hände und setzte ein ernstes Gesicht auf.
Braun wurde noch nervöser. Himmel, es musste echt schlimm um ihn stehen, wenn der Weißkittel jetzt schon anfing, für ihn zu beten. Bestimmt würde er ihm gleich mitteilen, dass es für ihn besser wäre, keinen Bausparvertrag mehr abzuschließen, weil er dessen Auszahlung mit Sicherheit nicht mehr erleben werde. Das hatte man nun davon, wenn man einen Medizinmann wegen ein bisschen Bluthochdruck und Schlafproblemen aufsuchte. Bis gerade eben hatte er sich zumindest halbwegs fit gefühlt, aber seit er in der Praxis saß, ging es mit ihm offensichtlich rapide bergab.
Doch Braun hatte sich getäuscht.
»Physisch gesehen ist mit Ihnen so weit alles in Ordnung, sieht man mal von ein paar Kilo Übergewicht ab. Und für Ihren Bluthochdruck schreibe ich Ihnen etwas auf, das kriegen wir schon wieder in den Griff. Hauptsache, Sie achten darauf, sich gesund zu ernähren und sich genügend zu bewegen. Im Klartext: Finger weg von salzigen und fetten Sachen. Und auf Alkohol sollten Sie ebenfalls verzichten.«
»Na, dann ist ja alles bestens.« Beruhigt, dass ihm zumindest aus medizinischer Sicht das Ableben in allernächster Zeit erspart bleiben würde, machte Braun schon Anstalten, aufzustehen, doch der Arzt bedeutete ihm mit einer Handbewegung, wieder Platz zu nehmen.
»Was mir viel mehr Sorgen macht, ist Ihr psychischer Zustand.«
»Was soll damit sein?«, fuhr Braun auf. Er bereute es bereits bitterlich, seinen Hausarzt aufgesucht zu haben.
»Herr Braun, ob Sie es nun wahrhaben wollen oder nicht: Eine Trennung hinterlässt bei jedem Spuren. Wenn man so lange wie Sie verheiratet war, steckt man so etwas nicht mal eben weg. Und dass Ihre Frau jetzt mit einem …«, der Arzt hüstelte, »anderen Mann zusammenlebt, macht die Sache für Sie bestimmt nicht angenehmer.«
Ach so, der Weißkittel meinte seine anstehende Scheidung. Wusste eigentlich der ganze Ort über seine gescheiterte Ehe Bescheid? Angestrengt musterte Braun den Buddha aus Jade, der ihn vom Schreibtisch aus geheimnisvoll anlächelte und höchstwahrscheinlich ein Souvenir aus Thailand war, wo der Doktor mit seiner Gattin regelmäßig die Weihnachtsferien zu verbringen pflegte, wie in Titisee allgemein bekannt war. Bevorzugt unter Wasser, da er ein leidenschaftlicher Taucher war.
»Mhm.« Braun, der das unbestimmte Gefühl hatte, dass von ihm in irgendeiner Form ein Kommentar erwartet wurde, fühlte sich in keiner Weise bemüßigt, den Weißkittel darüber aufzuklären, dass es nicht die Trennung von seiner Frau war, die ihm zu schaffen machte, zumal die friedlich verlaufen war und er Elvira ihr neues Glück, das sie bei einem streng vegan lebenden ehemaligen Standesbeamten in Karlsruhe gefunden hatte, neidlos gönnte. Auch wenn er ihren Neuen, den er bei ihrem Auszug kennengelernt hatte, für eine fürchterliche Spaßbremse hielt. Aber Elvira war nun auch nicht gerade für ihre ungestüme Lebenslust bekannt, so gesehen waren also die besten Voraussetzungen für das Gelingen der Beziehung gegeben.
Doch diese Einschätzung würde er selbstverständlich für sich behalten. Genauso wie den wahren Grund, warum er sich tatsächlich nicht ganz auf der Höhe fühlte, wie der Arzt, wenn auch in Unkenntnis der Sachlage, ganz richtig festgestellt hatte.
Es war ganz einfach so, dass er den Tod seiner langjährigen Freundin Rosi immer noch nicht verkraftet hatte. Obwohl ihre spektakuläre Beerdigung schon über ein Jahr zurücklag, fehlte Rosi ihm an allen Ecken und Enden. Dass er nicht wusste, was er als Pensionär mit seiner Zeit anstellen sollte, machte die Sache auch nicht besser. Nie hätte er gedacht, wie lang ein einziger Tag sein konnte. Und seit ihn Elvira verlassen hatte, fühlte er sich noch einsamer als vorher schon. Manchmal vermisste er es sogar, dass sie ihm ständig seine Kalorienzufuhr vorrechnete, wenn er zu einem Stück Schwarzwälder Schinken griff. Genauso wie die von ihr handgefertigten Filzvögel, die bis auf einen Buntspecht alle gemeinsam mit ihr das Nest gewechselt hatten. Sah man mal von R2-D2, dem Rasenroboter seiner Nachbarn ab, waren die einzigen Lichtblicke in seinem ereignislosen Leben seine Nichte Lilli und ihr Sohn Ramon. Nicht zu vergessen Max, der Enkel von Rosi und Lillis Freund, den Braun aufrichtig ins Herz geschlossen hatte. Sowie, wenn man es großzügig betrachtete, seinen ehemaligen Kollegen Jockele, fügte Braun gedanklich hinzu. Doch die waren alle berufstätig und hatten viel zu wenig Zeit, um sich ständig um einen alten – Braun korrigierte sich innerlich: älteren – Mann wie ihn zu kümmern. Nein, was er brauchte, war schlicht ein wenig mehr Abwechslung, völlig wurscht, wie die aussah – aber ganz gewiss keine Kur. So weit kam es noch, dass er sich freiwillig in die Fänge der Gesundheitsindustrie begab. Trotzig verschränkte er die Arme vor der Brust.
»Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass mit einem psychischen Erschöpfungszustand nicht zu spaßen ist. Der kann sich ruck, zuck zu einer schweren Depression auswachsen. Denken Sie also bitte noch einmal über meinen Vorschlag nach. Und spätestens in zwei Wochen möchte ich Sie wieder in meiner Praxis sehen.«
Als Braun den besorgten Blick des Arztes bemerkte, setzte er sich aufrecht hin und drückte sein Kreuz durch. »Mir geht es bis auf die Schlafprobleme blendend. Wirklich«, versicherte er im Brustton der Überzeugung, dann erhob er sich und stürmte aus dem Sprechzimmer, ehe ihn der Arzt zurückhalten konnte.
Der schaute ihm kopfschüttelnd hinterher, bevor er zum Telefon griff. »Hallo, Schatz. Was hältst du davon, wenn wir uns auf der ›Seeterrasse‹ treffen? Mein letzter Patient ist gerade weg, und ich kann ausnahmsweise pünktlich Mittagspause machen. Außerdem werde ich das Gefühl nicht los, dass mein ärztlicher Rat heute sowieso nicht gefragt ist. – Wie ich darauf komme? Ach, vergiss es. Bis gleich.« In letzter Sekunde war ihm seine Schweigepflicht eingefallen. Er legte den Hörer auf, fuhr den PC herunter, zog seinen Kittel aus und schmiss ihn über die Stuhllehne. Für heute war sein Bedarf an Patienten restlos gedeckt. Erst die junge Mutter, die partout nicht hatte einsehen wollen, dass die empfohlene Masern-Impfung für ihr Kind kein Angriff auf die Menschenrechte darstellte, und jetzt noch der Ex-Polizist, der sich aufgeführt hatte, als hätte er ihn in ein sibirisches Strafgefangenenlager schicken wollen. Manchen Menschen war eben nicht zu helfen, ging es dem Arzt resigniert durch den Kopf, als er die Tür hinter sich zuschmetterte. Der jadegrüne Buddha lächelte weiter allwissend vor sich hin.
***
Braun hingegen war das Lachen restlos vergangen, als er wieder auf der Parkstraße stand. Der Weißkittel war wohl verrückt geworden. Warum sollte ausgerechnet er in Kur gehen? So was war vielleicht das Richtige für Leute, die ihre Probleme nicht allein verarbeiten konnten, aber doch nicht für ihn.
Schon bei der bloßen Vorstellung, wie er hemmungslos auf eine selbst gebaute Buschtrommel eindrosch, um seine innersten Gefühle zum Ausdruck zu bringen, oder was man sonst noch so alles an Unfug in derartigen Einrichtungen trieb, stellten sich Braun die Nackenhaare auf. Nein, da besorgte er sich jetzt lieber eine gute Flasche Rotwein, einerlei, was sein überbesorgter Hausarzt davon halten würde. Entschlossen lenkte er seinen Schritt Richtung Fußgängerzone und betrat ein Geschäft, das original Schwarzwälder Spezialitäten anbot. Die Obststände vor dem Laden, die mit süßen Früchten lockten, ließ er links liegen.
Drinnen war es rappelvoll, weil sich gleich fünfzehn Japaner entschlossen hatten, sich mit Proviant für den restlichen Tag einzudecken. Die Verkäuferin hinter der Brottheke kam fast nicht mehr nach, um alle Wünsche zu erfüllen, die gleichzeitig in mehr oder weniger verständlichem Englisch geäußert wurden.
Braun kämpfte sich zum Weinregal durch und schnappte sich einen Spätburgunder. Der Abend war gerettet. Unwillkürlich stach ihm der abgepackte Schwarzwälder Schinken ins Auge, der nur darauf wartete, auf seinem Teller zu landen. Braun wollte schon danach greifen, als sein Blick zu seinem Bauch hinunterwanderte, der sich unübersehbar über den Gürtel wölbte. Zumindest was sein Gewicht anbelangte, hatte der Arzt mit seiner Einschätzung nicht völlig danebengelegen, gestand er sich ein. Ein paar Kilo weniger könnten ihm sicher nicht schaden. Schweren Herzens ließ er den Schinken Schinken sein und ging schnell zur Kasse, ehe ihm die Japaner zuvorkommen konnten oder er doch noch schwach wurde.
Die beiden Männer, die vor ihm ihre Einkäufe auf die Ablage stapelten, hatten sich diesbezüglich weniger Zurückhaltung auferlegt: an die fünf Kilo geräucherter Schinken, acht Schwarzwälder Kirschkuchen in Dosen, sechs Flaschen Zibärtle und dazu vier Eimer Honig, die ausgereicht hätten, um mehrere Bienenvölker auf einen Schlag in einen Glücksrausch zu versetzen. Es hatte ganz den Anschein, als wollten sie es richtig krachen lassen. Obwohl Braun sie nur von hinten sah, kamen ihm die beiden mehr als bekannt vor. Wenn das nicht die Brüder Ernie und Bert, zwei ehemalige Stammkunden von ihm, waren, die ihr Hartz-IV-Einkommen seit Jahren bevorzugt mit krummen Geschäften aufstockten.
Brauns Augenbrauen schossen in die Höhe. Seit wann hatten die Kleinganoven so viel Geld, dass sie sich gleich massenweise Spezialitäten leisten konnten? Und seit wann brannten die sich ihren Schnaps nicht mehr verbotenerweise selbst auf ihrem verfallenen Hof? Es war ein offenes Geheimnis in Titisee, dass Ernie und Bert diesbezüglich Meister ihres Fachs waren.
»Tag, die Herren. Ich hoffe, ihr habt noch was für die Touristen übrig gelassen. Habt ja den halben Laden leer gekauft. Seid ihr etwa unverhofft in den Genuss eines Lottogewinns gekommen?« Braun hätte beinahe aufgelacht, als er sah, wie Ernie und Bert beim Klang seiner Stimme zusammenfuhren.
»Grüß Gott, Herr Braun.« Ernie, der ältere der beiden Brüder, hatte sich als Erster wieder gefangen. »Schön, Sie zu sehen.« Was eine glatte Lüge war, wie sein Gesichtsausdruck verriet. Er kam ins Stocken, und Braun konnte beobachten, wie er angestrengt überlegte. »Stellen Sie sich vor«, Ernie machte eine kurze Pause, »wir haben geerbt. Von einem Onkel in Hamburg. Das wollen wir heute Abend feiern. Passiert ja nicht alle Tage, dass unsereins mal Schwein im Leben hat.«
Bert nickte eifrig. »Genau. Unser Onkel in Hamburg. Der war Kapitän von so einem, einem …«
»Kreuzfahrtschiff«, half ihm sein älterer Bruder aus, als Bert ihn fragend anschaute. »Der war in der ganzen Welt unterwegs und hat richtig Kohle gemacht. Sogar in Rio war der, wo die Mädels an Fasnacht halb nackt auf der Straße tanzen.« Man musste über keine allzu große Phantasie verfügen, um zu erahnen, dass Ernie es begrüßt hätte, wenn sich dieser schöne Brauch auch im Schwarzwald durchgesetzt hätte.
»Und jetzt ist er gestorben. Völlig überraschend. Und weil wir seine Lieblingsneffen waren, hat er uns sein ganzes Vermögen hinterlassen«, beendete Bert die Ausführungen und bedachte Braun mit einem unschuldigen Blick, von dem sich selbst die Jungfrau von Orléans noch eine Scheibe hätte abschneiden können. Dabei zupfte er nervös am Kragen seines gestreiften Hemds, aus dem unübersehbar ein Preisschild hing. Es wirkte genauso neu wie Ernies Jeans.
»Was ihr nicht sagt«, meinte Braun wider Willen amüsiert. »So einen großzügigen Onkel hätte ich auch gern.« Bestimmt hatten die zwei Galgenvögel wieder irgendein krummes Ding gedreht. Aber warum sollte er Ernie und Bert in die Mangel nehmen? Sollten sich doch seine Ex-Kollegen vom Revier Neustadt darum kümmern, die wurden schließlich dafür bezahlt. Als Pensionär musste er sich dankenswerterweise nicht mehr dafür interessieren, aus welchen undurchsichtigen Quellen der plötzliche und unerwartete Reichtum der Brüder stammte.
»Wollt ihr jetzt bezahlen oder weiterplaudern? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« Ungeduldig trommelten die Finger der Verkäuferin auf die Kasse. Sie machte den Eindruck, als hätte sie einen Urlaub dringend nötig. Was angesichts des Stimmengewirrs, das in dem Laden herrschte, kein Wunder war.
Schnell holte Ernie aus seiner Hosentasche ein dickes Geldbündel hervor und legte ihr zwei Hundert-Euro-Scheine hin, während Bert die Einkäufe in mehrere mit roten Bollenhüten bedruckte Jutetaschen verstaute. Was auch immer die zwei angestellt hatten, es musste sich gelohnt haben, dachte Braun.
»Einen schönen Tag noch, Herr Kommissar«, wünschte Bert Braun höflich, schnappte sich die Beutel und wieselte seinem Bruder hinterher, der schon auf der Straße auf ihn wartete.
»Sechs neunundneunzig, bitte.«
Braun bezahlte seinen Wein und packte ihn ein. Beim Verlassen des Ladens bekam er noch mit einem Ohr mit, dass sich die Japaner bei der Verkäuferin schlaumachten, wo es den besten »black forest cake« gab. Als hätte Brauns Magen nur auf das Stichwort gewartet, fing er an zu knurren. Es war höchste Zeit, dass er etwas zwischen die Zähne bekam. Er dachte daran, der »Seeterrasse« einen Besuch abzustatten – bis ihm einfiel, dass die vermutlich innerhalb von wenigen Minuten fest in asiatischer Hand sein würde.
3
Es war einer jener Sommertage, an denen die Touristen gleich scharenweise in den Schwarzwald einfielen. Ein strahlend blauer Himmel, der von keinem noch so kleinen Wölkchen verhangen wurde, auf den Wiesen bunte Farbkleckse, die emsig von Insekten umschwärmt wurden. Dahinter erhob sich das Bergmassiv des Schwarzwaldes, allen voran der Feldberg, der sich mit seinen eintausendvierhundertdreiundneunzig Metern stolz als höchster Berg Deutschlands bezeichnen durfte, wenn man die Alpen außer Acht ließ. Auf der B31 trödelte ein Wohnmobil mit holländischem Kennzeichen vor sich hin, im Schlepptau einen übermüdeten Lkw-Fahrer, der auf die Autobahn nach Stuttgart wollte, und einen frustrierten Mercedes-Fahrer, dem es wegen des dichten Gegenverkehrs trotz der Pferdestärken seines Neufahrzeugs immer noch nicht gelungen war, an den beiden Fahrzeugen vorbeizuziehen. Derweil sorgte ein Höhenlandwirt mit gleichmäßigem Verteilen von Gülle und Mist dafür, dass der Nitratgehalt im Grundwasser nicht absank. Mit sich und der Natur im Reinen, saß er am Steuer seines Traktors, eine unangezündete Zigarette zwischen den Lippen und das karierte Hemd so weit aufgeknöpft, dass sein Unterhemd, für das ein Schimpanse im Fernsehen die Werbetrommel gerührt hatte, hervorblitzte. Kurzum, es war ein Bild des Friedens.
Im Herzen von Titisee-Neustadt war indes der Teufel los. Soeben war ein Reisebus voller Chinesen angekommen, die sich darin überschlugen, Andenken für die Daheimgebliebenen zu erstehen. Dabei schreckten sie weder vor billigen Taschen noch vor schrägnasigen Stoffhexen zurück, die hämisch lachten, wenn ihr Arm gedrückt wurde. Der unangefochtene Renner aber waren die Schwarzwaldpüppchen, made in China, die gleich dutzendweise von freundlichen Verkäuferinnen eingepackt wurden, und natürlich die Kuckucke, die im Wechsel lautstark aus ihren Gehäusen herausplärrten, was die Stunde geschlagen hatte. Angesichts der ungezügelten Kaufwut, mit der Asiaten, Amerikaner und Europäer gleichermaßen die Souvenirgeschäfte stürmten, waren die in drei Sprachen gehaltenen Reklameschilder für Kitsch und Krempel eigentlich völlig überflüssig.
Neben sich zwei Papiertüten, gefüllt mit verwelktem Salat, den sie dem Lebensmittelhändler für Opas Hühner abgeschwatzt hatte, saß Michelle am Ufer und beobachtete eine indische Familie, die sich vergeblich bemühte, mit einem aufblasbaren Donut den Hafen zu verlassen. Stattdessen befand sich das Boot direkt auf Kollisionskurs mit der »Götz von Berlichingen«, deren Fahrgäste begeistert verfolgten, wie sich der Donut anschickte, die rechte Seite des Ausflugsschiffs zu rammen.
Entweder war der Donut komplett manövrierunfähig, was eher unwahrscheinlich war, oder seine kichernde Mannschaft zu dusselig, um damit in See zu stechen, überlegte Michelle. Es war schon merkwürdig: Da revolutionierten die Inder die gesamte IT-Branche, aber mit dem Steuern eines Gummiboots waren sie allem Anschein nach schlicht überfordert. Immerhin schaffte es der Kapitän der »Götz von Berlichingen«, abzulegen, ohne die indische Großfamilie zu versenken. Ein paar Passagiere applaudierten.
Benny, der zu Michelles Füßen saß, interessierte sich weniger für die Navigationskunst des Kapitäns, sondern vielmehr für einen Schwan, der zwischen den Tretbooten herumwatschelte. Er ließ ihn nicht aus den Augen, und sein kleiner Körper zitterte vor Aufregung. Es war nicht schwer zu erraten, was in seinem Kopf vorging.
»Denk nicht mal drüber nach«, ermahnte Michelle ihren Promenadenmischling. »Der macht Hackfleisch aus dir, wenn du ihm zu nahe kommst. Du müsstest doch am besten wissen, wie hinterlistig Federvieh sein kann. Oder hast du schon vergessen, was Berlusconi mit dir angestellt hat?« Opas Hahn, der sinnigerweise den gleichen Namen trug wie ein ehemaliger italienischer Ministerpräsident, war nicht gerade für seine Sanftmut bekannt. Schon gar nicht, wenn er es mit kleinen Hunden zu tun hatte, die ihm zu sehr auf die Pelle rückten. Erst vor fünf Tagen war Benny so heftig von Berlusconis Schnabel malträtiert worden, dass Michelle mit ihm zum Tierarzt hatte fahren müssen. Doch die Aufmerksamkeit des Vierbeiners galt bereits einer Schulklasse, die das schöne Wetter für einen Ausflug nutzte. Der Lärmpegel am Seeufer stieg schlagartig an.
»Frau Zöttlein, was ist das für ein großer weißer Vogel?«, erkundigte sich ein etwa zwölfjähriger Junge, der sein Basecap falsch herum aufgesetzt hatte.
»Den nennt man Schwan.« Die Lehrerin verzog keine Miene, als sie antwortete. Ein leichter Hauch von Resignation schwang in ihrer Stimme mit. »Und du bist gut beraten, wenn du ihn in Frieden lässt«, fügte sie eilig hinzu, als sie bemerkte, wie der Schüler sein Smartphone zückte und zielsicher auf den Wasservogel zusteuerte. Wie auf Kommando begann der, giftige Zischlaute auszustoßen, um deutlich kundzutun, wer Herr des Titisees war. Die Drohgebärde verfehlte ihre Wirkung nicht, der Knabe zog sich eilends zurück. Zwei Mädchen in kurzen Hosen kicherten, und selbst die Lehrerin gestattete sich ein schadenfrohes Lächeln, das augenblicklich erlosch, als ein Rapper lauthals bekannte, sein Weed unter Palmen aus Plastik zu verbrennen. »Geht’s noch? Ihr macht auf der Stelle die Ghetto-Musik aus. Und ab sofort will ich kein Handy mehr sehen, geschweige denn hören. Ist das klar?«, donnerte die geplagte Pädagogin los, ehe sie sich schleunigst mit ihrer Klasse davonmachte. Es war offensichtlich, dass sie den Musikgeschmack der ihr anvertrauten Schüler nicht in vollem Umfang teilte.
Michelle staunte, allerdings weniger über den Song. Großer weißer Vogel? Biologie gehörte definitiv nicht zu den Kernkompetenzen des Jungen. Es war manchmal schon erschreckend, wie wenig Ahnung die Kids von der richtigen Welt hatten. Kein Wunder, wenn die lieber den ganzen Tag auf ihrem Smartphone herumdaddelten. Wenn sie mal Kinder hätte, wüssten die aber besser Bescheid über alles, was in der Natur so kreuchte und fleuchte, nahm sich Michelle vor.
Obwohl, momentan musste sie sich deswegen keinen Kopf machen. Bevor Sebastian sein Studium nicht beendet und einen festen Job hätte, war an Familienplanung nicht zu denken. Doch wenn er in dem Tempo weitermachte wie in letzter Zeit, wäre sie so alt wie Janet Jackson, bis sie Mutter würde. Ganz abgesehen davon war er sowieso nicht allzu erpicht darauf, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Denn jedes Mal, wenn sie auf ihren Kinderwunsch zu sprechen kam, fand er einen fadenscheinigen Vorwand, um die Unterhaltung ganz schnell in eine andere Richtung zu lenken. Na ja, schließlich wollte sie ja auch nichts überstürzen, versuchte sie sich zu trösten. Potenzielle Arbeitgeber waren bekanntermaßen nicht gerade scharf darauf, eine Berufsanfängerin mit ständig krankem Säugling einzustellen. Trotzdem hätte sie gern Klarheit gehabt, wie Sebastian zu ihrer Lebensplanung stand. Allein das Wort »Planung« kam in jüngster Zeit kaum noch in seinem Wortschatz vor.
Vielleicht ergäbe sich ja heute Abend die Gelegenheit, in aller Ruhe mit ihm zu reden. Er hatte ihr fest versprochen, sie zu besuchen. Sie könnten gemütlich zusammen essen gehen – und dann würde man weitersehen. Hauptsache, sie rastete nicht wieder aus wie bei ihrem letzten Treffen.
Michelle senkte ihren Kopf, sodass ihr braunes Haar ihr wie ein Vorhang ins Gesicht fiel, und wuschelte gedankenverloren durch Bennys Fell. Der Hund schmiegte sich eng an ihr Bein und leckte ihre Hand ab.
Dabei war bei Sebastian bisher alles so glattgelaufen. Nach dem Bachelor hatte er einen der begehrten Plätze für das Masterstudium Medienkulturforschung an der Freiburger Uni bekommen. Was ganz praktisch war, weil Michelle auch dort studierte und sie gelegentlich die Mittagspause miteinander verbringen konnten. Eigentlich hatte er vorgehabt, noch in diesem Jahr seinen Abschluss zu machen – bis er vor ein paar Monaten in einem Seminar auf diese Verrückten gestoßen war. Seither war Sebastian wie verwandelt, was Michelle ganz und gar nicht gefiel. Am Anfang hatte sie es ja noch witzig gefunden, wenn er in sein Pelzkostüm geschlüpft war, das er selbst angefertigt hatte. Aber mittlerweile machte sie sich ernsthaft Sorgen, weil er sich immer häufiger in sein tierisches Alter Ego als Fuchs flüchtete. Als Fuchs, das musste man sich mal vorstellen! Zwar hatte ihr Sebastian schon x-mal erklärt, dass die Furrys, wie er und seine Freunde allgemein bezeichnet wurden, einfach nur Geschöpfe verkörperten, die menschliche und tierische Eigenschaften in sich vereinten, aber begriffen hatte sie das immer noch nicht. Michelle runzelte die Stirn. Meine Güte, sie fand Daisy Duck ja auch ganz sympathisch, aber warf sie sich deshalb gleich in ein Entenkostüm?
Einmal war Michelle dabei gewesen, als die Gruppe einen »Walk«, wie die Furrys ihre Ausflüge nannten, in Freiburgs Innenstadt veranstaltet hatte. Zugegebenermaßen war es ein rührender Anblick gewesen, wie sich Sebastian und die anderen von den entzückten Passanten streicheln ließen. Vor allem Kinder waren völlig aus dem Häuschen, wenn die Gruppe unterwegs war. Trotzdem wäre es ihr lieber, ihr Freund würde sich mehr auf sein Studium konzentrieren und vor allem ein anderes Hobby betreiben. Am besten eines, bei dem Nicole nicht ständig mit von der Partie war.
Michelle seufzte. Es war schon stressig genug, die Semesterferien im Haus ihres Großvaters zu verbringen, weil ihre Eltern endlich einmal ein paar Tage Urlaub machten, ihrem Hund Benny jedoch die Flugreise nach Teneriffa ersparen wollten und außerdem Bedenken hatten, den alten Mann so lange sich selbst zu überlassen. Was Michelle durchaus nachvollziehen konnte, denn Opa war in letzter Zeit gelinde ausgedrückt etwas schrullig geworden. Genauer gesagt verschusselte er alles, was er in die Hände bekam. Erst gestern hatte sie zufällig im Kühlschrank seine Armbanduhr gefunden, nachdem sie das ganze Haus danach abgesucht hatte. Wie sie da reingekommen war, würde auf ewig Opas Geheimnis bleiben. Auch seine Angewohnheit, ständig sein Gebiss zu verlegen, machte das Zusammenleben mit ihm nicht gerade einfacher.
Doch wenn sie etwas in der kurzen Zeit gelernt hatte, seit sie mit ihm zusammenwohnte, dann war es, ihm auf keinen Fall zu widersprechen. Insbesondere wenn er wieder von Wölfen erzählte, die im Wald den Mond anheulten und ihn um den Schlaf brachten. Allerdings hatte außer Opa noch nie jemand die Tiere gesehen oder gehört, soweit ihr bekannt war.
Ignorierte man aber diese Aussetzer, war der alte Mann immer noch erstaunlich klar im Kopf. Vor zwei Tagen hatte er ihr bei ihrer Bachelorarbeit geholfen, indem er ihr anschaulich die Zusammenhänge zwischen der Erhöhung von Ölpreisen und fallenden Aktienkursen erklärte. Und zwar wesentlich besser, als es ihr Dozent vermocht hatte. Überhaupt zeigte Opa erfreulicherweise immer noch großes Interesse am Weltgeschehen, egal, ob es um die USA oder um seinen Heimatort ging. Allerdings war seine Meinung über Politiker im Allgemeinen nicht besonders hoch. Vor allem an Donald Trump, von dem Opa behauptete, dass selbst Berlusconi mehr Ahnung vom Regieren habe als dieser orangefarbene Clown, ließ er kein gutes Haar. Genauso wie an Michael Trüb, der als Vertreter der Grünen im Neustädter Gemeinderat saß und mit ungewöhnlichen Ideen das kommunalpolitische Geschehen bereicherte. Opa nannte ihn nur »die trübe Tasse«, vor allem, seit der Kommunalpolitiker ernsthaft gefordert hatte, ab zweiundzwanzig Uhr die Straßenlaternen im Ort abzuschalten, um die nachtaktive Tierwelt nicht aus ihrem natürlichen Gleichgewicht zu bringen. Als Trüb seinen Vorschlag in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte, stand Opa, der sich unter den Zuhörern befand, auf und erklärte unter frenetischem Beifall, er habe nicht die Absicht, sich wegen ein paar degenerierter Fledermäuse im Dunkeln den Hals zu brechen, wenn er nach seinem Stammtisch den Heimweg antrat. Trübs Antrag war vom Gremium ohne Diskussion einstimmig abgeschmettert worden und Opa zum Helden des Tages avanciert.
Man musste es positiv sehen, versuchte sich Michelle selbst aufzuheitern. Solange sich Opa mit Trüb anlegte, war er wenigstens beschäftigt. Und in seinem Haus, wo sie schon als Kind häufig die Schulferien verbracht hatte, hatte sie viel mehr Ruhe, um ihre Arbeit zu beenden, als in ihrer Ein-Zimmer-Bude in Zähringen, die nicht viel größer als eine Puppenstube war und in der es im Sommer ganz schön heiß werden konnte.
Ein Knurren von Benny unterbrach ihren Gedankenfluss. War es schon wieder der Schwan, der ihn ärgerte? Michelle sah zu den Tretbooten hinüber, doch der große weiße Vogel, wie ihn der Schüler so treffend beschrieben hatte, war verschwunden. Stattdessen geriet ein wasserstoffblonder Mann in schwarzem Kapuzen-T-Shirt in ihr Blickfeld. Er zog einen Bullmastiff hinter sich her, der vermutlich mehr Gewicht als Michelle und Benny zusammen auf die Waage brachte. Obwohl sie normalerweise keine Angst vor Hunden hatte, wurde ihr beim Anblick des kräftigen Tiers ein wenig mulmig. Dem würde ganz bestimmt keiner ungefragt den Kopf tätscheln, was Benny hingegen häufiger passierte. Der Promenadenmischling teilte offensichtlich ihre Gefühle, er hatte seinen Schwanz eingeklemmt und winselte leise.
Als der Bullmastiff und sein Herrchen näher kamen, schnappte sich Michelle die Tüten und stand auf. »Hopp, Benny, wir packen es. Für heute haben wir genug Spaß gehabt. Opa wartet garantiert schon mit dem Mittagessen auf uns.«
Normalerweise ließ sich Benny immer gern bitten, wenn sie mit ihm unterwegs war, schnüffelte noch hier und da oder hob sein Beinchen, doch heute bedurfte es für ihn keiner zweiten Aufforderung, um in die Gänge zu kommen. Ohne dass sie es hätte verhindern können, rannte er los wie ein geölter Blitz – und hätte beinahe einen älteren Herrn zu Fall gebracht, der ihnen auf der Promenade entgegenschlenderte.
4
Sapperlot, da hatte er ja richtig Glück gehabt, dass ihm eben nur der winzige Fiffi zwischen die Beine geraten war, ging es Braun beim Anblick des Bullmastiffs, der, mit den Vorderpfoten im Titisee stehend, Unmengen von Wasser in sich hineinschlabberte, durch den Kopf. Eine Begegnung mit diesem sabbernden Riesenkalb wäre gewiss nicht so glimpflich abgegangen und hätte ihm womöglich einen neuerlichen Besuch bei seinem Hausarzt beschert. Worauf er nach seiner jüngsten Erfahrung absolut keinen Wert legte.
Noch suspekter als der Hund war ihm allerdings das dazugehörige Herrchen, was nicht nur an dessen wasserstoffblond gefärbten Haaren, sondern hauptsächlich daran lag, dass der Mann an Nase, Unterlippe und den Augenbrauen jede Menge Metall mit sich herumtrug. Braun mochte sich gar nicht vorstellen, welche Körperstellen sonst noch mit Blech versehen waren. Der Kerl sah übler aus als ein Zuhälter aus einer Vorabendserie.
Automatisch kramte der ehemalige Polizist in seinem Gedächtnis, ob ihm der Gepiercte im Lauf seiner Dienstzeit schon einmal untergekommen war, als er eine bekannte und vor allem gefürchtete Stimme hörte.
»Grüß Gott, Herr Braun, wie geht’s, wie steht’s?«
Herrschaftszeiten, die hatte ihm gerade noch zu seinem Glück gefehlt. Erika Gießhübel, Besitzerin eines ortsansässigen Friseurgeschäfts und berüchtigt für ihre Kommunikationsfreude, hatte sich ihm direkt in den Weg gestellt, sodass eine Flucht unmöglich war. Sie steckte in einem Jumpsuit, der mit knallroten Hibiskusblüten übersät war, die das Herz eines jeden Kolibris hätten höherschlagen lassen. Dazu trug sie pinkfarbene Pumps, deren Farbe sich in ihrem Lippenstift wiederholte. Und auf einem ihrer Schneidezähne, wie Braun schadenfroh feststellte. Dazu duftete sie wie ein dreistöckiges Freudenhaus.
Braun gab ein undefinierbares Geräusch von sich. So, wie er die Friseurin einschätzte, würde sie ihre Frage gleich selbst beantworten. Erika Gießhübel gehörte zu jenen Menschen, die immer mehr wussten als alle anderen und vor allen Dingen den unstillbaren Drang hatten, das auch kundzutun.
Er sollte recht behalten.
»Ist ja bestimmt nicht leicht für Sie, seit Sie von Ihrer Frau verlassen wurden, gell?«, meinte die Friseurin mit schlecht geheucheltem Mitleid. »Aber das Leben muss halt weitergehen, sage ich immer.«
Als Braun keinerlei Regung zeigte, beugte sie sich ihm verschwörerisch entgegen, sodass ihm ihr süßlich schweres Parfüm empfindlich in die Nase stieg.
»Aber wenn es Sie tröstet: Sie sind nicht der Einzige, dem die Gattin abhandengekommen ist.« Erika Gießhübel senkte ihre Stimme. »Die Vera vom Bauer Tritschler hat auch was Besseres gefunden. Die lebt jetzt mit ihrem Lover auf Mallorca. Und raten Sie mal, wie ihr Ehemann davon erfahren hat.«
Wohl kaum aus den Zwanzig-Uhr-Nachrichten, vermutete Braun spontan.
Die Friseurin stemmte empört die Hände in ihre ausladenden Hüften. »Die hat ihm einfach eine SMS geschickt. Eine SMS, das muss man sich mal vorstellen. Wenn mir der Tritschler die Nachricht nicht selbst gezeigt hätte, würde ich es nicht glauben. So etwas von kaltschnäuzig.«
Braun trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Ihm war es herzlich gleichgültig, auf welche Art und Weise die Ehe der Tritschlers, die er sowieso nur vom Sehen kannte, beendet worden war. Sein größtes Problem bestand momentan vielmehr darin, dass er keine Ahnung hatte, wie er Erika Gießhübel möglichst schnell wieder loswerden könnte. Es war einer jener Momente, in denen er zutiefst bedauerte, keine Dienstwaffe mehr zu besitzen. Mit der hätte er sie einfach erschießen können.
»Per SMS eine Beziehung beenden, das ist das Allerletzte. Das hab ich schon gesagt, als die Naddel mit dem Ralph Siegel genau das Gleiche gemacht hat«, quatschte die Friseurin unverdrossen weiter. In der Welt der Stars und Sternchen kannte sie sich bestens aus – dank der Regenbogenpresse, die sie im Salon für die Kundinnen bereithielt und in ihrer Freizeit selbst konsumierte. »Aber Starallüren hatte die Vera ja schon immer. Allein das Kleid, mit dem sie beim Silvesterball im Maritim-Hotel angerauscht ist. Der Ausschnitt reichte ihr fast bis zum Bauchnabel. So würde ich mich nie im Leben aufbrezeln.«
Eine weise Entscheidung, gab ihr Braun angesichts ihrer breiten Hüften stumm recht.
»Mich würde nur interessieren, woher sie die Kohle für so einen teuren Fummel gehabt hat, der Tritschler schwimmt ja nun nicht gerade in Geld. Diese auffälligen goldenen Diamantohrringe, ohne die sie nicht mal die Kühe gemolken hat, haben bestimmt auch ein Vermögen gekostet. Und jetzt ist sie noch nicht mal neun Monate verheiratet und schon mit dem Erstbesten abgehauen. Obwohl, überraschen tut mich das nicht. Die Vera hat doch allen schöne Augen gemacht, sogar dem Bürgermeister, das weiß ich aus sicherer Quelle.«
Erika Gießhübels Quellen waren in etwa so sicher wie Atomkraftwerke in Japan, das wusste Braun aus eigener leidvoller Erfahrung. Dank der Friseurin und ihren todsicheren Insiderinformationen hatte er vor einem Jahr sogar einen unschuldigen Gefängnispfarrer des Mordes verdächtigt.
»Zum Glück hat der Tritschler noch seinen Cousin Mike, der ihm bei der vielen Arbeit zur Hand geht. Das ist ein feiner Kerl, sag ich Ihnen. Kommt immer auf ein Schwätzchen im Frisiersalon vorbei, wenn er im Ort unterwegs ist.«
Was nicht gerade für den ihm unbekannten Cousin sprach, befand Braun. »Schön für ihn, aber allmählich sollte ich wirklich weiter«, läutete er seinen Abgang ein und machte einen Schritt rückwärts.
Er hätte es besser wissen müssen. Erika Gießhübel hielt ihn mit eisernem Griff am Jackenärmel fest. So leicht entkam man ihr nicht. »Haben Sie schon gehört? Bei den Mosers kriselt es auch gewaltig.«
Sollte er Erika Gießhübel im Titisee ertränken, um endlich seine Ruhe zu haben? Braun verwarf die Idee wieder. Zu umständlich. Und zu viele Zeugen.