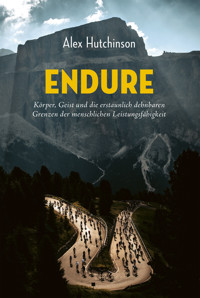
ENDURE: Körper, Geist und die erstaunlich dehnbaren Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit E-Book
Alex Hutchinson
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Covadonga Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
So viel mehr als nur ein Sportbuch: Eine Reise an die äußersten Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit »Das Entscheidende, wenn man im Ausdauersport an seine Grenzen gehen will, ist, dass man lernt, diesen Instinkt zu überwinden, so dass man in der Lage ist, seinen Finger ein wenig näher an die Flamme zu halten – und ihn weiter dort zu halten, nicht nur für ein paar Sekunden, sondern minuten- oder sogar stundenlang.« Vom Marathonlauf in zwei Stunden über den Traum, einmal beim Ironman Hawaii oder der Tour de France teilzunehmen, bis hin zur Besteigung des Mount Everest: Wir sind fasziniert von den extremen Grenzbereichen der menschlichen Ausdauer, und immer wieder aufs Neue werden von Athleten die physischen und psychischen Grenzen ausgelotet. Doch wie hoch hinaus können wir es schaffen? Wie weit können Menschen laufen, Rad fahren oder schwimmen? Wie schnell können sie dabei sein? Und wie sieht es mit dem individuellen Potenzial aus: Wo liegen die Grenzen eines bestimmten Athleten? Und wodurch werden sie definiert? In seinem aufwändig recherchierten Bestseller »Endure« legt der kanadische Sport- und Wissenschaftsjournalist Alex Hutchinson dar, warum unsere individuellen Grenzen ebenso sehr von unserem Kopf und unserem Herzen wie von unseren Muskeln bestimmt werden können. Packend erzählt er vom Bestreben der Wissenschaft, das Phänomen der menschlichen Erschöpfung zu ergründen: von groben Experimenten mit Strom und Froschschenkeln bis hin zu feinentwickelten Neuroimaging-Technologien. Hutchinson zeigt auf, dass ein Schlüsselelement der Ausdauer darin besteht, wie das Gehirn auf Notsignale reagiert – sei es Hitze oder Kälte oder Muskeln, die vor Laktatsäure schreien. Und er liefert spannende Beispiele und schlagkräftige Belege, dass es möglich ist, diese Gehirnreaktion zu trainieren und auf diese Weise wahrgenommene Grenzen zu überwinden. Hutchinson, selbst ein erfolgreicher Mittel- und Langstreckenläufer, nimmt seine Leserinnen und Leser mit an die vorderste Front der modernen Sportpsychologie – Elektrodenstöße im Gehirn, computergestütztes Training, subliminale Reize – und präsentiert verblüffende neue Entdeckungen, mit denen sich die Leistungsfähigkeit von Athleten auf ein neues Level heben lässt. Und nicht zuletzt verrät er in »Endure« auch, wie jeder von uns diese Taktiken nutzen kann, um seine eigene Zeiten und Ergebnisse zu verbessern. Jetzt ist endlich ist dieser in zahlreiche Sprachen übersetzte internationale Bestseller erstmals auch in einer deutschsprachigen Ausgabe erhältlich. Pflichtlektüre für alle Leistungs- und Hobbysportler, die das meiste aus ihrem Potenzial machen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alex Hutchinson
ENDURE
Alex Hutchinson
ENDURE
Körper, Geist und die erstaunlich dehnbaren Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit
Aus dem Amerikanischen von Olaf Bentkämper
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel »Endure. Mind, Body and the Curiously Elastic Limits of Human Performance«bei HarperCollins Publishers, New York/USA.
Diese Ausgabe erscheint auf Grundlage einer Vereinbarung mit Mariner Books, einem Imprint von HarperCollins Publishers.
© Alex Hutchinson 2018 und 2021 (Nachwort)
Alex Hutchinson:
Endure. Körper, Geist und die erstaunlich dehnbaren Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit
Mit einem Vorwort von Malcolm Gladwell.
Aus dem Amerikanischen von Olaf Bentkämper.
deutsche Erstausgabe: Covadonga Verlag, 2024
Covadonga Verlag, Spindelstr. 58, D-33604 Bielefeld
ISBN (Print): 978-3-95726-089-5
ISBN (E-Book): 978-3-95726-094-5
Coverfoto: Gruber Images / Illustration Coverrückseite: Dima Kostrov, Shutterstock Druck und Bindung: Westermann Druck Zwickau GmbH – 1. Auflage, 2024
Dieses Buch ist nur zu Informationszwecken gedacht. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm aufnehmen. Eine Haftung des Autors bzw. der Verlage für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Covadonga ist der Verlag für Radsportliteratur.
Besuchen Sie uns im Internet: www.covadonga.de
Für meine Eltern, Moira und Roger, deren Neugier, Strenge, Respekt für unterschiedliche Sichtweisen und Talent für Klarheit weiterhin das Vorbild bleiben, nach dem ich bei allem, was ich schreibe, strebe.
Inhalt
Vorwort von Malcolm Gladwell
Zwei Stunden: 6. Mai 2017
TEIL I: GEIST UND MUSKELN
Kapitel 1: Die unerbittliche Minute
Kapitel 2: : Die menschliche Maschine
Kapitel 3: Der zentrale Regler
Kapitel 4: »Ich hör dann mal auf«
Zwei Stunden: 30. November 2016
TEIL II: GRENZEN
Kapitel 5: Schmerz
Kapitel 6: Muskeln
Kapitel 7: Sauerstoff
Kapitel 8: Hitze
Kapitel 9: Durst
Kapitel 10: Brennstoff
Zwei Stunden: 6. März 2017
TEIL III: DIE GRENZEN DURCHBRECHEN
Kapitel 11: Das Gehirn trainieren
Kapitel 12: Das Gehirn kitzeln
Kapitel 13: Glaube
Zwei Stunden: 6. Mai 2017
Nachwort: Das Unbekannte wagen
Danksagung
Anmerkungen
Der Autor
Namensregister
Vorwort
von Malcolm Gladwell
Alle Langstreckenläufer haben Rennen erlebt, die rückblickend keinen Sinn ergeben. Bei mir sind es zwei. Das erste fand statt, als ich 13 Jahre alt war, in meinem ersten Jahr an der High School. Mit nicht mehr als einem Monat Training in den Beinen nahm ich an einem Crosslauf in Cambridge in Ontario teil, gegen Jungen, die zwei Jahre älter waren als ich. Einer von ihnen gehörte zu den besten Langstreckenläufern seiner Altersklasse in der Provinz. Noch heute, 40 Jahre später, kann ich mich an dieses Rennen erinnern. Ich habe mich am Anfang einfach an die Führenden gehängt und mich festgebissen, bin bis zur völligen Erschöpfung gelaufen und wurde am Ende ganz knapp und völlig unerklärlich Zweiter. Ich sage unerklärlich, denn obwohl ich später eine beachtliche Karriere als Mittelstreckenläufer an der High School hatte, bleibt dieser Lauf die einzige wirklich herausragende Leistung, die ich je auf einer Langstrecke gezeigt habe. Für den Rest meines Läuferlebens bin ich bei allen Wettkämpfen über Distanzen von mehr als 1.500 Metern hinter den Erwartungen geblieben.
Das heißt, mit einer Ausnahme: Vor zwei Jahren, im Alter von 51 Jahren, lieferte ich bei einem kleinen Stadtlauf in New Jersey einen magischen Wettkampf über 5.000 Meter ab, bei dem ich eine volle Minute schneller war als bei jedem Fünf-Kilometer-Lauf, an dem ich teilgenommen hatte, seit ich als Altersklassen-Athlet zum ernsthaften Laufen zurückgekehrt war. An diesem Sommertag in New Jersey war ich plötzlich wieder der 13-jährige Junge von vor 40 Jahren in Cambridge. Ich fing an zu träumen. Ich staunte über meine Laufkünste. Und dann? Wieder zurück in die Mittelmäßigkeit.
Als der besessene Mensch – und vor allem der besessene Läufer –, der ich bin, habe ich endlos über diese beiden anomalen Rennen gegrübelt. Ich besitze Laufprotokolle aus meiner Teenagerzeit, die ich auf der Suche nach Hinweisen immer wieder durchgesehen habe. Gab es in meinem frühesten Training Anzeichen für diese Art von Leistung? Hatte ich irgendetwas Besonderes gemacht?
Was meinen jüngeren Fünf-Kilometer-Wunderlauf in New Jersey betrifft, liegen mir natürlich unendlich viel mehr Informationen vor. Monate an Garmin-Daten zu jeder Trainingseinheit vor dem Wettkampf und dann noch mehr vom Tag des Rennens selbst: Pace, Schrittfrequenz, Zwischenzeiten. Mehr als einmal habe ich im Vorfeld eines Rennens versucht, genau die Vorbereitung zu wiederholen, die ich vor meiner persönlichen Bestleistung absolviert hatte. Ich wollte, dass der Blitz ein zweites Mal einschlägt. Das ist nicht geschehen, und ich vermute, der Grund dafür ist, dass ich nicht richtig verstehe, was es bedeutet, eine außergewöhnliche Ausdauerleistung zu vollbringen. Ich glaube, Sie können sich denken, worauf ich hinauswill: Ich bin das perfekte Publikum für Alex Hutchinsons Endure.
Ein paar Worte zu Alex Hutchinson. Wir sind beide Kanadier und beide Läufer, wobei er sowohl ein besserer Kanadier (er lebt immer noch dort, ich nicht) als auch ein viel besserer Läufer ist, als ich es je war. Er hat mich einmal zu dem Tempolauf eingeladen, den er jeden Samstagvormittag mit Freunden auf einem Friedhof im Norden von Toronto absolviert. Wenn ich mich recht entsinne, wurde ich Letzter – oder vielleicht Vorletzter, denn einer aus seiner Truppe ließ sich freundlicherweise dazu herab, meine Pace zu laufen. Alex verlor ich schon nach der ersten Kurve aus den Augen. Wie Sie beim Lesen der folgenden Seiten und Kapitel feststellen werden, schreibt Alex über die Geheimnisse der Ausdauer als studierter Wissenschaftler, als Sportfan und als scharfer Beobachter menschlicher Leistungen – aber auch als Aktiver. Er hat seine eigenen anomalen Rennen, die er erklären kann.
Es sollte jedoch ausdrücklich betont werden, dass es sich hier nicht um ein Laufbuch handelt. Es gibt viele Bücher über den Laufsport, und als Läufer habe ich viele davon gelesen. Aber es sind Insiderberichte, die für andere Insider geschrieben wurden: Ob man beim Laufen mit dem Vorfuß oder mit der Ferse aufsetzt oder eine Schrittfrequenz von 180 Schritten pro Minute anstrebt, ist nur für Läufer von Bedeutung, die sich selbst mit Haut und Haaren ihrem Sport verschrieben haben. Aber eines der vielen Dinge, die Endure zu einer so tollen Lektüre machen, ist, wie überzeugend Alex Hutchinson die Perspektive erweitert. In einer meiner Lieblingspassagen aus dem Kapitel über Schmerz schreibt er über den Versuch des Radrennfahrers Jens Voigt, den Stundenweltrekord zu brechen. Voigt war berühmt dafür, dass er keine Angst vor Schmerzen hatte. Doch als er nach dem Rekordversuch vom Rad stieg, litt er laut Hutchinson Höllenqualen: »Der Schmerz, den er an den Rand seines Bewusstseins gedrängt hatte, brach über ihn herein.« Das ist eine Radsport-Geschichte. Aber in Hutchinsons Händen wird sie auch zu einer Möglichkeit, eine viel tiefere und folgenreichere Frage darüber zu stellen, wie unsere Physiologie mit unserer Psychologie interagiert.
Bei einer Vielzahl menschlicher Aktivitäten ist Leistung ohne Unbehagen nicht möglich. Wie ist also unser Verhältnis zu diesem Schmerz? Wie interagieren die Protestsignale unseres Gehirns mit dem körperlichen Willen, weiterzumachen? Man muss kein besessener Radsportler sein, um diese Diskussion zu verstehen. Wenn überhaupt, dann wird diese Diskussion Sie wahrscheinlich davon abhalten, jemals ein besessener Radsportler zu werden. »Alles tat weh«, sagte Voigt. »Mein Nacken tat weh, weil ich meinen Kopf so weit unten in dieser aerodynamischen Position halten musste. Meine Ellbogen schmerzten davon, meinen Oberkörper in dieser Position zu halten. Meine Lungen taten weh, nachdem sie so lange gebrannt und nach Sauerstoff geschrien hatten. Mein Herz tat weh vom ständigen Pochen. Mein Rücken brannte, und dann war da noch mein Hintern! Ich war wirklich und wahrhaftig in einer Welt der Schmerzen gefangen.« Oh Mann. Es tat schon weh, diese Passage zu lesen.
Gelingt es Endure, das Rätsel des anomalen Rennens aufzulösen? In gewisser Weise ja. Mein Problem ist, wie mir nun klar wird, dass ich immer versucht hatte, diese unerklärlichen Leistungen mit einem absurd einfachen Modell der Ausdauer erklärbar zu machen. Die Zeit, die ich gelaufen bin, war mein Output. Und so bin ich rückwärts vorgegangen und habe versucht, die entsprechenden Inputs zu identifizieren, die diese Leistung möglich gemacht hatten. Hatte ich vorher einen oder zwei Ruhetage eingelegt? Wie schnell hatte ich die Berganläufe in der Woche zuvor absolviert? Ließ sich etwas aus dem letzten Intervalltraining lernen, das ich vor dem Wettkampf unternommen hatte? Die Daten, die wir von unseren GPS-Sportuhren sammeln, machen diese Art des Denkens noch verführerischer: Sie ermutigen uns, ein einfaches Bild davon zu zeichnen, wie und warum sich unser Körper durch die Welt bewegt. Ich verspreche Ihnen, dass Sie sich nach der Lektüre von Endure nie wieder mit diesem einfachen Bild zufriedengeben werden. Es gibt viele Dinge, die Ihnen Ihr Garmin nicht sagen kann. Und zum Glück haben wir für diese vielen Dinge Alex Hutchinson.
Zwei Stunden 6. Mai 2017
Die Kommentatorenkabine am Autodromo Nazionale Monza, einer historischen Formel-1-Rennstrecke in den Wäldern eines ehemaligen königlichen Parks nordöstlich von Mailand, ist eine kleine Betoninsel, die praktisch über der Fahrbahn in der Luft schwebt. Von diesem exklusiven Aussichtspunkt aus versuche ich, einem Live-Streaming-Publikum von schätzungsweise 13 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, von denen sich viele mitten in der Nacht aus dem Bett gequält haben, um dieses Ereignis zu verfolgen, einen fundierten Gastkommentar zu liefern. Aber ich werde allmählich nervös.
Das Rennen unter mir steuert auf einen Ausgang zu, den nach monatelangen Spekulationen und heftigen Debatten kaum jemand für möglich gehalten hätte. Eliud Kipchoge, der amtierende Olympiasieger im Marathonlauf, umrundet die Rennstrecke seit einer Stunde und 40 Minuten hinter einer auserlesen choreografierten Formation von Läufern, die ihn aus dem Wind nimmt – und bemerkenswerterweise ist er weiterhin auf dem besten Weg, die 42,195 Kilometer in unter zwei Stunden zu laufen. Wenn man bedenkt, dass der Marathon-Weltrekord zu diesem Zeitpunkt bei 2:02:57 Stunden steht und jede neue Bestmarke in der Regel eine Sache von wenigen hart umkämpften Sekunden ist, bringt mich Kipchoge mit seiner Leistung schon jetzt an die Grenzen meiner Fähigkeit, Erstaunen und Ehrfurcht zu vermitteln. Auf riesigen Bildschirmen vor mir werden detaillierte Statistiken über Kipchoges Lauf angezeigt, aber ich bin mit den Gedanken woanders. Ich möchte aus der Kabine eilen und mich wieder direkt an den Streckenrand stellen, um die knisternde Spannung in der versammelten Menge zu spüren, das Röcheln von Kipchoges Atem zu hören, wenn er vorbeiläuft, und ihm in die Augen zu sehen, wenn er tiefer ins Unbekannte vordringt.
1991 schlug Michael Joyner, ein ehemaliger Collegeläufer von der Universität von Arizona, der gerade seine Facharztausbildung an der Mayo Clinic in Minnesota absolvierte, ein provokantes Gedankenexperiment vor. Die Grenzen des Ausdauerlaufs lassen sich laut Sportphysiologie mit drei Parametern quantifizieren: mit der aeroben Kapazität, auch VO2max genannt, die mit der Größe des Motors eines Autos vergleichbar ist, mit der Laufökonomie, einem Effizienzmaß wie dem Benzinverbrauch, und mit der Laktatschwelle, die bestimmt, wie viel der Motorenleistung man über längere Zeit aufrechterhalten kann. Wissenschaftler hatten diese Größen bei vielen Spitzenläufern gemessen, die in der Regel sehr gute Werte bei allen drei Parametern und außergewöhnliche Werte bei mindestens einem davon aufwiesen. Was würde passieren, fragte sich Joyner, wenn ein einzelner Läufer bei allen drei Parametern außergewöhnliche – aber menschenmögliche – Werte erzielte? Seine Berechnungen ergaben, dass dieser Läufer in der Lage wäre, einen Marathon in 1:57:58 Stunde zu absolvieren.
Die Reaktionen auf seine Arbeit, die im Journal of Applied Physiology veröffentlicht wurde, brachten größtenteils Verwunderung zum Ausdruck. »Viele Leute kratzten sich am Kopf«, erinnert sich Joyner. Schließlich lag der damalige Weltrekord bei 2:06:50 Stunden, aufgestellt im Jahr 1988 vom Äthiopier Belayneh Densimo. Einen Marathon unter zwei Stunden hatte niemand auf dem Radar: Als Joyner seine Ideen Mitte der 1980er Jahre erstmals präsentierte, galt die Vorstellung tatsächlich noch als so abwegig, dass seine Arbeit zunächst nicht veröffentlicht wurde. Aber die scheinbar ungeheuerliche Zeit war keine Vorhersage, unterstrich Joyner – sie war vielmehr eine Herausforderung für seine wissenschaftlichen Kollegen. In gewisser Weise war seine Berechnung die Apotheose eines Jahrhunderts von Versuchen, die äußersten Grenzen der menschlichen Ausdauer zu quantifizieren. So schnell kann ein Mensch theoretisch laufen, besagte die Mathematik. Doch wie erklärte sich die Kluft zwischen Theorie und Realität? War es nur eine Frage der Zeit, bis der perfekte Läufer geboren oder der perfekte Lauf absolviert wurde? Oder war unser Verständnis von Ausdauer einfach unvollständig?
Die Jahre vergingen. 1999 gelang es dem Marokkaner Khalid Khannouchi als erstem Menschen, unter 2:06 Stunden zu laufen. Vier Jahre später durchbrach Paul Tergat aus Kenia die Marke von 2:05 Stunden, und fünf Jahre später unterbot Haile Gebrselassie aus Äthiopien dann 2:04 Stunden. Als Joyner und zwei Kollegen im Jahr 2011 im Journal of Applied Physiologyeinen aktualisierten Artikel mit dem Titel »The Two-Hour Marathon: Who and When?« (»Der Zwei-Stunden-Marathon: Wer und wann?«) veröffentlichten, erschien die Vorstellung nicht mehr lächerlich. Tatsächlich erhielt die Zeitschrift erstaunliche 38 Antworten von anderen Forschern, die über die verschiedenen Faktoren spekulierten, die uns der magischen Grenze näher bringen könnten. Ende 2014, kurz nachdem der Kenianer Dennis Kimetto als erster Marathonläufer unter 2:03 Stunden geblieben war, kündigte ein Konsortium unter der Leitung des britischen Sportwissenschaftlers Yannis Pitsiladis an, die Zwei-Stunden-Marke innerhalb von fünf Jahren knacken zu wollen.
Dennoch blieben zwei Minuten und 57 Sekunden eine beträchtliche Kluft, die es noch zu überwinden galt. Ebenfalls 2014 beauftragte mich das Magazin Runner’s World mit einer umfassenden Analyse der physiologischen, psychologischen und umweltbedingten Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit jemand einen Zwei-Stunden-Marathon laufen kann. Nachdem ich Berge von Daten gesichtet und Experten auf der ganzen Welt konsultiert hatte, darunter auch Joyner, präsentierte ich zehn Seiten mit Diagrammen, Schaubildern, Karten und Argumenten und schloss mit meiner eigenen Prognose: Die Schallmauer würde im Jahr 2075 durchbrochen werden, schrieb ich.
Diese Vorhersage kam mir im Oktober 2016 sofort in den Sinn, als ich einen unerwarteten Anruf von David Willey, dem damaligen Chefredakteur von Runner’s World, erhielt. Nike, die größte Sportmarke der Welt, bereitete sich darauf vor, ein »streng geheimes« Projekt zu enthüllen, das darauf abzielte, in nur sechs Monaten einen Marathon in unter zwei Stunden zu liefern. Wir erhielten die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und über das Vorhaben zu berichten, das »Breaking2« getauft wurde. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder die Augen verdrehen sollte, aber ich konnte nicht nein sagen. Ich erklärte mich bereit, ein paar Wochen später zum Hauptsitz von Nike in Beaverton zu reisen, einem Vorort von Portland, Oregon, um mir vor Ort ein Bild von dem Projekt zu machen. Wenn es nur darum ging, eine überzogene Marketingkampagne zu entlarven, war ich nach den Recherchen für meinen früheren Beitrag in Runner’s World jedenfalls so gut gerüstet wie kaum ein anderer.
Mein Auftritt als Gastkommentator während der Live-Übertragung endet, als Kipchoge gerade die 37-Kilometer-Marke erreicht. Es ist der 6. Mai 2017, auf den Tag genau 63 Jahre nach dem Tag, an dem Roger Bannister als erster Mensch der Welt die Meile in unter vier Minuten lief. Ich kann es kaum erwarten, an die Strecke zu kommen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich von diesem Hochsitz von Sendekabine herunterkomme. Als ich über den Rand spähe, überlege ich kurz, mich einfach über das Geländer zu schwingen und den Sprung in die Tiefe zu riskieren. Aber der strenge Blick eines Sicherheitsbeamten in der Nähe hält mich davon ab. Stattdessen gehe ich zurück über den Steg, der die Sendekabine mit dem mehrstöckigen Labyrinth aus Sackgassen und unbeschrifteten Türen des Hauptgebäudes verbindet. Ich habe keine Zeit, auf einen Guide zu warten. Ich fange an zu rennen.
TEIL I GEIST UND MUSKELN
KAPITEL 1 Die unerbittliche Minute
Füllst jede unerbittliche Minute
Mit sechzig sinnvollen Sekunden an:
Dein ist die Erde dann mit allem Gute …
– RUDYARD KIPLING
An einem kalten Samstagabend im Februar 1996 in der Universitätsstadt Sherbrooke, Quebec, grübelte ich – wieder einmal – über eines der großen Rätsel der Ausdauer: John Landy. Der stämmige Australier ist einer der berühmtesten ewigen Zweiten im Sport und der zweite Mann in der Geschichte, der die Meile in unter vier Minuten lief. Im Frühjahr 1954, nach vielen Jahren konzertierter Anstrengungen, nach Jahrhunderten gestoppter Läufe und nach Jahrtausenden der Evolution, kam ihm Roger Bannister um läppische 46 Tage zuvor. Das bleibende Bild von Landy, das auf zahllosen Plakaten und einer überlebensgroßen Bronzestatue in Vancouver, British Columbia, verewigt wurde, entstand im Sommer des gleichen Jahres bei den Empire Games, als die seinerzeit einzigen Vier-Minuten-Meilenläufer der Welt sich zum ersten und einzigen Mal im direkten Duell gegenüberstanden. Nachdem er das gesamte Rennen über in Führung gelegen hatte, blickte sich Landy auf der Zielgeraden über die linke Schulter um, während Bannister auf der rechten Seite an ihm vorbeizog. Dieser Sekundenbruchteil der Niederlage machte ihn in den Worten einer britischen Zeitungsschlagzeile zum Inbegriff des »Nearly Man«, des knapp Gescheiterten.
Das Rätsel an Landy ist jedoch nicht, dass er nicht gut genug gewesen wäre, sondern vielmehr, dass er es zweifellos war. Auf der Jagd nach dem Vier-Minuten-Rekord war er bei sechs verschiedenen Gelegenheiten 4:02 Minuten gelaufen und erklärte schließlich: »Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Vier-Minuten-Meile jenseits meiner Möglichkeiten liegt. Zwei Sekunden mögen nicht nach viel klingen, aber für mich ist es so, als würde ich versuchen, eine Wand zu durchbrechen.« Weniger als zwei Monate nachdem Bannister es geschafft hatte, lief Landy 3:57,9 Minuten (seine offizielle Marke in den Rekordbüchern lautet 3:58,0 Minuten, da die Zeiten damals auf die nächste halbe Sekunde aufgerundet wurden). Damit verbesserte er seine bisherige Bestzeit um fast vier Sekunden und erreichte das Ziel mit 13,4 Metern Vorsprung gegenüber der Pace, die für die Vier-Minuten-Meile erforderlich gewesen wäre – eine rätselhaft jähe und bittersüße Transformation.
So wie viele andere Läufer vor und nach mir war ich ein bekennender Bannister-Jünger, mit einem zerknitterten und fast auswendig gelernten Exemplar seiner Autobiografie auf dem Nachttisch. Aber in jenem Winter 1996 glaubte ich mehr und mehr Landy zu sehen, wenn ich in den Spiegel schaute. Seit meinem 15. Lebensjahr jagte ich meiner eigenen, bescheideneren Vier-Minuten-Marke nach, jener über 1.500 Meter, ein Rennen, das 109 Meter und somit auf diesem Niveau knapp 17 Sekunden kürzer ist als die Meile. In der High School lief ich in einem 1.500-Meter-Wettkampf eine Zeit von 4:02 Minuten, und dann stieß ich wie Landy gegen eine Wand und lief in den nächsten vier Jahren immer wieder ähnliche Zeiten. Nun, als 20-jähriger Student an der McGill University, fragte ich mich, ob ich bereits jede Sekunde aus meinem Körper herausgequetscht hatte. Während der langen Busfahrt von Montreal nach Sherbrooke, wohin meine Teamkameraden und ich zu einem bedeutungslosen Frühsaison-Rennen fuhren, das auf einer der langsamsten Laufbahnen in ganz Kanada stattfinden würde, starrte ich aus dem Fenster in den wirbelnden Schnee und fragte mich, ob mein langersehnter Moment der landyesken Transformation wohl jemals kommen würde.
Die Geschichte, die man uns im Vorfeld erzählt hatte, möglicherweise nur eine Legende, besagte, dass man die Technikabteilung der Universität Sherbrooke mit der Planung der Indoor-Laufbahn als Studienprojekt beauftragt hatte. Sie hatten die Aufgabe, die optimalen Winkel für eine 200-Meter-Bahn zu berechnen, und orientierten sich an den Zahlen, die der Zentripetalbeschleunigung von 200-Meter-Sprintern der Weltspitze entsprachen – und übersahen dabei die wichtige Tatsache, dass manche Leute auf so einer Bahn nicht nur eine Runde, sondern mehrere Runden hintereinander laufen wollen. Das Resultat glich eher einem Velodrom als einer Laufbahn, mit so steilen Überhöhungen, dass selbst die meisten Sprinter nicht auf den äußeren Bahnen laufen konnten, ohne nach innen abzurutschen. Mittelstreckenläufer wie ich drohten sich sogar auf der Innenbahn noch die Knöchel zu brechen; Rennen, die länger als eine Meile waren, mussten auf dem Aufwärmring im Inneren der Bahn ausgetragen werden.
Um unter vier Minuten zu bleiben, musste ich einen perfekt kalibrierten Lauf absolvieren und in jeder Runde rund zwei Zehntelsekunden schneller sein als bei meiner Bestzeit von 4:01,7 Minuten. Sherbrooke mit seiner Kirmesbahn, wo es noch dazu an adäquater Konkurrenz fehlte, war nicht der richtige Ort für diese Höchstleistung, entschied ich. Stattdessen wollte ich so locker wie möglich laufen und meine Kräfte für den Wettkampf in der Woche darauf sparen. Dann sah ich im Rennen vor meinem eigenen, wie meine Teamkollegin Tambra Dunn im 1.500-Meter-Lauf der Frauen gleich zu Beginn furchtlos an die Spitze sprintete, eine Runde nach der anderen im Alleingang abspulte und mit einer sensationellen persönlichen Bestzeit ins Ziel kam, mit der sie sich für die nationalen High-School-Meisterschaften qualifizierte. Plötzlich erschienen mir meine obsessiven Berechnungen und endlosen strategischen Grübeleien albern und überzogen. Ich war hier, um ein Rennen zu laufen; warum sollte ich nicht einfach so schnell laufen, wie ich konnte?
Die »Grenzen der Ausdauer« zu erreichen, ist ein Konzept, das sonnenklar erscheint, bis man versucht, es tatsächlich zu erklären. Hätten Sie mich 1996 gefragt, was mich von einer Zeit unter vier Minuten abhielt, hätte ich etwas von maximaler Herzfrequenz, Lungenkapazität, langsam kontrahierenden und ermüdenden Muskelfasern, Laktat-Akkumulation und verschiedenen anderen Schlagwörtern erzählt, die ich aus den Laufzeitschriften aufgeschnappt hatte, die ich damals verschlang. Bei näherer Betrachtung ist jedoch keine dieser Erklärungen stichhaltig. Man kann auch mit einer Herzfrequenz weit unter der Maximalleistung, mäßigen Laktatwerten und weiterhin mustergültig kontrahierenden Muskelfasern gegen die Wand laufen. Zu ihrer Enttäuschung haben Physiologen herausgefunden, dass der Wille zum Durchhalten nicht zuverlässig mit einer einzelnen physiologischen Variable verknüpft werden kann.
Ein Teil der Herausforderung besteht darin, dass Ausdauer konzeptionell wie ein Schweizer Taschenmesser ist. Sie ist das, was man braucht, um einen Marathon zu absolvieren; sie ist auch das, was es einem ermöglicht, auf einem Langstreckenflug mit einer Horde kleiner Kinder an Bord nicht den Verstand zu verlieren. Die Verwendung des Wortes Ausdauer im letzteren Fall mag metaphorisch erscheinen, aber die Unterscheidung zwischen physischer und psychischer Ausdauer ist tatsächlich weniger eindeutig, als es scheint. Denken Sie an Ernest Shackletons unglückselige Antarktis-Expedition und den zweijährigen Überlebenskampf der Besatzung, nachdem ihr Schiff, die Endurance, 1915 im Eis zerschellt war. War es die Art von Ausdauer, mit der man Kleinkinder im Flieger aushält, die sie zum Durchhalten befähigte, oder bloße körperliche Stärke? Kann man das eine ohne das andere haben?
Eine passende und vielseitige Definition, die mir gefällt, stammt von dem italienischen Wissenschaftler Samuele Marcora und besagt, Ausdauer sei »der Kampf weiterzumachen gegen den wachsenden Wunsch aufzuhören«. Eigentlich bezieht sich Marcora damit auf Anstrengung – effort – und nicht auf Ausdauer – endurance – (eine Unterscheidung, die wir in Kapitel 4 näher untersuchen werden), aber sie erfasst sowohl die körperlichen als auch die mentalen Aspekte der Ausdauer. Entscheidend ist, dass man sich über seine Instinkte hinwegsetzen muss bzw. über das, was sie einem einreden (langsamer werden, sich zurücknehmen, aufgeben), und zugleich auch das Gefühl für die verstrichene Zeit ausblenden muss. Einen Schlag einzustecken, ohne umzukippen, erfordert Selbstbeherrschung, aber Ausdauer impliziert etwas Dauerhafteres: den Finger lange genug in die Flamme zu halten, um die Hitze zu spüren; die unerbittliche Minute mit 60 Sekunden zu füllen, die es wert sind, gelaufen zu werden.
Die Zeit, die dabei vergeht, kann Sekunden oder Jahre betragen. In den NBA-Playoffs 2015 war LeBron James’ größter Feind – bei allem Respekt für seinen BewacherAndre Iguodala von den Golden State Warriors – die Ermüdung. In den vorangegangenen fünf Spielzeiten hatte James 17.860 Minuten auf dem Feld gestanden, über 2.000 Minuten mehr als jeder andere Spieler in der Liga. In einer der Halbfinal-Partien bat er in einer spannenden Verlängerung überraschend darum, aus dem Spiel genommen zu werden, änderte dann seine Meinung, warf einen Dreier, gefolgt von einem Sprungwurf aus vollem Lauf, mit dem er mit noch 12,8 Sekunden auf der Uhr den Sieg besiegelte, und brach dann nach dem Schlusspfiff völlig fertig auf dem Hallenboden zusammen. Im vierten Spiel der Finals konnte er sich kaum noch bewegen: »Ich hatte keine Luft mehr«, gab er zu, nachdem er im letzten Viertel keine Punkte mehr erzielt hatte. Es war nicht so, dass er akut außer Atem war. Vielmehr war es die über Tage, Wochen und Monate akkumulierte Erschöpfung, die LeBron James an die Grenzen seiner Ausdauer gebracht hatte.
Am anderen Ende des Spektrums kämpfen selbst die besten Sprinter der Welt gegen das, was John Smith, der Trainer des ehemaligen 100-Meter-Weltrekordlers Maurice Greene, euphemistisch als »negative Beschleunigungsphase« bezeichnet. Ihr Wettkampf mag in zehn Sekunden vorbei sein, aber die meisten Sprinter erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit nach 50 bis 60 Metern, halten sie kurz aufrecht und beginnen dann nachzulassen. Die Fähigkeit von Usain Bolt, sich am Ende eines Rennens wie von Zauberhand von seinen Konkurrenten abzusetzen? Ein Beweis für seine Ausdauer: Er wird ein bisschen weniger (oder ein bisschen später) langsamer als alle anderen. Bei seinem 9,58-Sekunden-Weltrekord im Rahmen der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin war Bolt auf den letzten 20 Metern fünf Hundertstelsekunden langsamer als auf den vorherigen 20 Metern, baute seinen Vorsprung auf den Rest des Feldes aber trotzdem aus.
Bei denselben Weltmeisterschaften stellte Bolt mit 19,19 Sekunden auch den Weltrekord über 200 Meter auf. Ein entscheidendes Detail: Er lief die erste Hälfte des Rennens in 9,92 Sekunden – eine erstaunliche Zeit, wenn man bedenkt, dass die 200 Meter in einer Kurve beginnen, aber immer noch langsamer als bei seinem 100-Meter-Rekord. Es ist kaum wahrnehmbar, aber er teilte sich sein Tempo und seine Kräfte bewusst ein, um seine Leistung über die gesamte Distanz zu maximieren. Aus genau diesem Grund sind die Psychologie und die Physiologie der Ausdauer untrennbar miteinander verbunden: Jede Aufgabe, die länger als ein Dutzend Sekunden dauert, erfordert bewusste oder unbewusste Entscheidungen darüber, wie sehr man ans Limit geht und wann. Sogar für wiederholte All-out-Anstrengungen beim Gewichtheben – kurze fünfsekündige Zugübungen, von denen man annehmen könnte, dass sie ein reines Maß für die Muskelkraft sind – haben Studien ergeben, dass wir nicht umhin können, uns selbst zu pacen: Die »maximale« Kraft hängt davon ab, wie viele Wiederholungen man glaubt, noch in sich zu haben.
Die zwangsläufige Bedeutung des Pacings ist der Grund, warum Ausdauersportler von ihren Zwischen- und Teilzeiten so besessen sind. Wie John L. Parker Jr. in seinem legendären Laufbuch-Klassiker Once a Runner schrieb: »Ein Läufer ist ein Geizhals, der die Groschen seiner Energie mit großer Knauserigkeit ausgibt und ständig wissen will, wie viel er schon ausgegeben hat und wie viel er noch bezahlen muss. Er will genau in dem Moment bankrott sein, in dem er sein Geld nicht mehr braucht.« Bei meinem Rennen in Sherbrooke wusste ich, dass ich jede 200-Meter-Runde in knapp 32 Sekunden laufen musste, um die Vier-Minuten-Marke zu knacken, und ich hatte unzählige Trainingsstunden damit verbracht, das Gefühl für genau dieses Tempo zu verinnerlichen. Es war daher ein ziemlicher Schock, als ich den Zeitnehmer nach meiner ersten Runde auf der Bahn »27!« rufen hörte.
Die Wissenschaft darüber, wie wir unser Tempo bzw. unsere Pace bestimmen, erweist sich als überraschend komplex (wie wir in späteren Kapiteln sehen werden). Man trifft sein Urteil darüber, was man durchhalten kann, nicht nur danach, wie man sich fühlt, sondern auch danach, wie sich dieses Gefühl dazu verhält, wie sich zu fühlen man zu diesem Zeitpunkt des Rennens erwartet hatte. Als ich in die zweite Runde ging, musste ich zwei widersprüchliche Informationen miteinander in Einklang bringen: die intellektuelle Erkenntnis, dass ich ein waghalsig schnelles Tempo angeschlagen hatte, und das subjektive Gefühl, dass ich mich überraschend und berauschend gut fühlte. Ich kämpfte gegen den panischen Drang an, langsamer zu laufen, und vollendete die zweite Runde nach 57 Sekunden – und fühlte mich immer noch gut. Jetzt wusste ich mit Sicherheit, dass etwas Besonderes im Gange war.
Im weiteren Verlauf des Rennens hörte ich auf, auf die Zwischenzeiten zu achten. Sie lagen so weit vor dem 4:00-Minuten-Zeitplan, den ich mir eingeprägt hatte, dass sie keine nützlichen Informationen mehr lieferten. Ich lief einfach und hoffte, das Ziel zu erreichen, bevor mich die Realität wieder auf den Boden der Tatsachen holte. Ich überquerte die Ziellinie in einer Zeit von 3:52,4 Minuten und verbesserte meine persönliche Bestleistung um sage und schreibe neun Sekunden. In diesem einen Rennen hatte ich mich mehr verbessert als in der gesamten Zeit seit meiner ersten Wettkampfsaison fünf Jahre zuvor. Als ich meine Trainingstagebücher durchforstete – wie ich es an jenem Abend tat und seither noch viele, viele Male getan habe –, entdeckte ich keinerlei Hinweise darauf, dass ein solcher Leistungssprung bevorgestanden hätte. Meine Trainingseinheiten deuteten höchstens auf schrittweise Verbesserungen im Vergleich zu den Vorjahren hin.
Nach dem Rennen besprach ich mich mit einem Teamkollegen, der meine Rundenzeiten für mich gemessen hatte. Seine Uhr erzählte eine ganz andere Geschichte des Rennens. Meine erste Runde hatte 30 Sekunden gedauert, nicht 27; meine Durchgangszeit nach zwei Runden waren 60 Sekunden, nicht 57. Vielleicht hatte der Rundenzähler, der im Ziel die Zwischenzeiten anzeigte, seine Uhr drei Sekunden zu spät gestartet, oder seine Bemühungen, für mich simultan vom Französischen ins Englische zu übersetzen, hatten zu einer Verzögerung von ein paar Sekunden geführt. In jedem Fall hatte er mir vorgegaukelt, dass ich schneller lief, als ich wirklich war, und mich dabei unerklärlich gut fühlte. Das Ergebnis war, dass ich mich von meinen Erwartungen vor dem Rennen gelöst hatte und ein Rennen lief, das niemand hätte vorhersagen können.
Nach Roger Bannister brachen sämtliche Dämme – zumindest wird die Geschichte oft so erzählt. Typisch für das Genre ist The Winning Mind Set, ein Selbsthilfebuch von Jim Brault und Kevin Seaman aus dem Jahr 2006, das Bannisters Vier-Minuten-Meile als Parabel über die Bedeutung des Selbstvertrauens verwendet. »Innerhalb eines Jahres taten es ihm 37 andere Läufer nach«, schreiben sie. »Im darauffolgenden Jahr liefen mehr als 300 Läufer die Meile in weniger als vier Minuten.« Ähnliche überlebensgroße (d. h. völlig frei erfundene) Behauptungen sind in Motivationsseminaren und im Internet weit verbreitet: Sobald Bannister den Weg geebnet hatte, so das Credo, überwanden auch andere plötzlich ihre mentalen Barrieren und setzten ihr wahres Potenzial frei.
Als das Interesse an einem möglichen Marathonlauf unter zwei Stunden zunahm, wurde dieses Narrativ häufig als Beweis dafür angeführt, dass auch diese neue Herausforderung in erster Linie psychologischer Natur sei. Skeptiker hingegen behaupteten, dass der Glaube nichts damit zu tun habe – vielmehr sei der Mensch in seiner jetzigen Form einfach nicht in der Lage, so lange so schnell zu laufen. Diese Debatte bot, wie schon ihre Vorläuferin vor sechs Jahrzehnten, eine verlockende Testumgebung, um die verschiedenen Theorien über Ausdauer und menschliche Grenzen, die von der Wissenschaft derzeit untersucht werden, anhand der Realität zu überprüfen. Um jedoch aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen zu können, ist es wichtig, dass die Fakten stimmen. Zum einen war Landy der einzige andere Mittelstreckler, der innerhalb eines Jahres nach Bannister unter vier Minuten blieb, und im Jahr darauf folgten nur vier weitere. Erst 1979, mehr als 20 Jahre später, war der spanische Mittelstrecken-Star José Luis González der dreihundertste Mensch, der diese Grenze durchbrach.
Und hinter Landys plötzlichem Durchbruch, nachdem er so lange stagniert hatte, steckt mehr als nur die Überlegenheit des Geistes über die Muskeln. Die sechs Läufe, in denen er nahe herankam, die Vier-Minuten-Marke zu unterbieten, absolvierte er alle in unbedeutenden Wettkämpfen in Australien, wo die Konkurrenz spärlich war und die Wetterbedingungen oft ungünstig ausfielen. Schließlich machte er sich im Frühjahr 1954 auf die lange Reise nach Europa, wo die Stadionlaufbahnen schnell und die Konkurrenz groß waren – nur um drei Tage nach seiner Ankunft festzustellen, dass Bannister ihm bereits zuvorgekommen war. In Turku hatte er zum ersten Mal einen Pacemaker, einen einheimischen Läufer, der die ersten anderthalb Runden in zügigem Tempo von vorne lief. Und was noch wichtiger war, er hatte echte Konkurrenz: Chris Chataway, einer der beiden Männer, die für Bannister bei seinem Rekord die Pace gemacht hatten, war Landy bis zur Hälfte der letzten Runde dicht auf den Fersen. Es ist nicht weit hergeholt, anzunehmen, dass Landy an diesem Tag die Vier-Minuten-Marke geknackt hätte, selbst wenn Roger Bannister nie existiert hätte.
Dennoch kann ich die Rolle des Geistes nicht ganz von der Hand weisen – nicht zuletzt aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Bei meinem nächsten Versuch, nach Sherbrooke eine Topzeit zu erzielen, lief ich 3:49 Minuten. Im darauffolgenden Rennen überquerte ich die Ziellinie ebenso perplex wie begeistert in 3:44 Minuten, womit ich mich für die Trials für die Olympischen Spiele in jenem Sommer qualifizierte. Innerhalb von drei Rennen hatte ich mich irgendwie transformiert. Die TV-Übertragung der Trials von 1996 ist noch auf YouTube zu finden, und als die Kamera vor dem Start des 1.500-Meter-Finals auf mir verweilt (ich stehe neben Graham Hood, dem damaligen kanadischen Rekordhalter), kann man erkennen, dass ich immer noch nicht so recht weiß, wie ich dorthin gekommen bin. Meine Augen huschen immer wieder panisch umher – so als würde ich erwarten, feststellen zu müssen, dass ich noch meinen Schlafanzug trage, sobald ich es wagte, nach unten zu schauen.
In den folgenden zehn Jahren verbrachte ich viel Zeit damit, weiteren Durchbrüchen nachzujagen, mit ausgesprochen gemischten Resultaten. Das Wissen (oder der Glaube), dass man sich seine ultimativen Grenzen nur einbildet, macht sie in der Hitze eines Rennens nicht weniger real. Und es bedeutet auch nicht, dass man einfach beschließen kann, sie zu ändern. Wenn überhaupt, dann hat mich mein Kopf in jenen Jahren ebenso oft ausgebremst wie vorangebracht, zu meiner eigenen Frustration und Verwirrung. »Es sollte reine Mathematik sein«, beschrieb der US-amerikanische Olympiateilnehmer Ian Dobson, auch er ein Mittelstreckenläufer, den Kampf um das Verständnis für die Höhen und Tiefen seiner eigenen Leistungen, »aber das ist es nicht.« Auch ich suchte immer wieder nach der Formel, die es mir ermöglichen würde, ein für alle Mal meine Grenzen zu berechnen. Wenn ich wüsste, dass ich so schnell gelaufen war, wie mein Körper es zuließ, so schlussfolgerte ich, könnte ich meine Laufkarriere beenden, ohne irgendetwas bedauern zu müssen.
Im Alter von 28 Jahren, nach einem unglücklich verlaufenen Kreuzbeinbruch drei Monate vor den Olympischen Spielen 2004, beschloss ich schließlich, meine Leistungssportkarriere zu beenden. Ich machte einen Studienabschluss in Journalismus und heuerte dann als Reporter bei einer Zeitung in Ottawa an. Aber eine Frage ließ mich nicht los: Warum war es nicht reine Mathematik? Was hatte mich so lange davon abgehalten, die vier Minuten zu unterbieten, und was hatte sich geändert, als ich es schaffte? Ich verließ die Zeitung und begann, als freiberuflicher Journalist über Ausdauersport zu schreiben, wobei mich weniger interessierte, wer gewonnen und wer verloren hatte, sondern vor allem warum. Ich vertiefte mich in die wissenschaftliche Literatur und entdeckte, dass es eine heftige (und manchmal erbitterte) Debatte über genau diese Fragen gab.
Die Physiologen verbrachten den größten Teil des 20. Jahrhunderts mit der epischen Suche nach dem Verständnis der Ermüdung des menschlichen Körpers. Sie schnitten Fröschen die Hinterbeine ab und jagten elektrischem Strom in die abgetrennten Muskeln, bis sie irgendwann aufhörten zu zucken; sie schleppten sperrige Laborgeräte auf Expeditionen zu entlegenen Andengipfeln und trieben Tausende von freiwilligen Probanden auf Laufbändern, in Wärmekammern und mit allen erdenklichen Medikamenten bis zur Erschöpfung. Was dabei herauskam, war eine mechanistische – fast mathematische – Sichtweise der menschlichen Grenzen: Wie ein Auto mit einem Stein auf dem Gaspedal fährt man weiter, bis der Tank leer ist oder der Kühler kocht, dann bleibt man stehen.
Aber das ist nicht das ganze Bild. Mit dem Aufkommen hochentwickelter Techniken zur Messung und Manipulation des Gehirns erhalten Forscher nun endlich auch einen Einblick in die Vorgänge in unseren Neuronen und Synapsen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Wie sich herausstellt, kommt es in vielen Fällen darauf an, wie das Gehirn diese Notsignale interpretiert, ganz gleich, ob es sich um Hitze oder Kälte, Hunger oder Durst oder um Muskeln handelt, die vor dem vermeintlichen Gift der »Milchsäure« schreien. Mit dem neuen Verständnis für die Rolle des Gehirns ergeben sich neue – und manchmal beunruhigende – Möglichkeiten. In seiner US-Zentrale im kalifornischen Santa Monica hat der Energydrink-Hersteller Red Bull auf der Fahndung nach Wettbewerbsvorteilen zum Beispiel bereits mit transkranieller Gleichstromstimulation experimentiert, bei der das Gehirn von Elite-Triathleten und -Radsportlern durch Elektroden mit einem Stromstoß stimuliert wurde. Das britische Militär hat Studien zu computergestützten Gehirntrainingsprotokollen finanziert, um die Ausdauer seiner Soldaten zu verbessern – mit verblüffenden Ergebnissen. Und sogar unterbewusste Botschaften können die Ausdauer verbessern oder verschlechtern: Das Bild eines lächelnden Gesichts, das wiederholt blitzartig für 16 Millisekunden eingeblendet wird, steigert die Leistung beim Radfahren um zwölf Prozent im Vergleich zu einem stirnrunzelnden Gesicht.
In den vergangenen zehn Jahren bin ich zu Forschungslaboren in Europa, Südafrika, Australien und Nordamerika gereist und habe mit Hunderten von Wissenschaftlern, Trainern und Sportlern gesprochen, die wie ich davon besessen sind, die Geheimnisse der Ausdauer zu entschlüsseln. Zu Beginn hatte ich die Vermutung, dass das Gehirn eine größere Rolle spielt, als allgemein anerkannt wird. Das hat sich bewahrheitet, aber nicht in der simplen »Alles Kopfsache«-Manier, den die Selbsthilfe-Bücher propagieren. Stattdessen sind Geist und Körper grundlegend miteinander verflochten, und um zu verstehen, was die eigenen Grenzen unter bestimmten gegebenen Rahmenbedingungen definiert, muss man beide zusammen betrachten. Genau das haben die auf den folgenden Seiten vorgestellten Wissenschaftler getan, und die überraschenden Ergebnisse ihrer Forschung lassen mich vermuten, dass wir, wenn es darum geht, unsere Grenzen auszureizen, erst am Anfang stehen.
KAPITEL 2 Die menschliche Maschine
Nach 56 anstrengenden Tagen auf Skiern blickte Henry Worsley auf die Digitalanzeige seines GPS-Geräts und hielt inne. »Das war’s«, verkündete er mit einem Grinsen und trieb einen Skistock in den windgepeitschten Schnee. »Wir haben es geschafft!« Es war der frühe Abend des 9. Januar 2009, auf den Tag genau 100 Jahre, nachdem der britische Entdecker Ernest Shackleton im Namen von König Edward VII. an genau dieser Stelle auf dem antarktischen Plateau den Union Jack aufgestellt hatte: 88 Grad und 23 Minuten südlicher Breite, 162 Grad östlicher Länge. Im Jahr 1909 war dies der am weitesten südlich gelegene Ort, den je ein Mensch erreicht hatte, nur 180 Kilometer vom Südpol entfernt. Worsley, ein schroff wirkender Veteran des britischen Special Air Service, der Shackleton seit langem verehrt hatte, weinte hinter seiner Brille »kleine Tränen der Erleichterung und Freude« – die ersten, seit er zehn Jahre alt gewesen war. (»Mein schlechter körperlicher Zustand verstärkte meine Verletzlichkeit«, erklärte er später.) Dann bauten er und seine beiden Begleiter, Will Gow und Henry Adams, ihr Zelt auf und fachten den Kessel an. Die Temperatur betrug –35 Grad Celsius.
Für Shackleton waren 88 Grad und 23 Minuten südlicher Breite eine herbe Enttäuschung. Sechs Jahre zuvor hatte er als Mitglied der Discovery-Expedition von Robert Falcon Scott zu einem dreiköpfigen Team gehört, das mit 82 Grad und 17 Minuten den Rekord für den weitesten Vorstoß nach Süden aufgestellt hatte. Aber er war in Schande nach Hause geschickt worden, nachdem Scott behauptet hatte, dass seine körperliche Schwäche die anderen aufgehalten habe. Shackleton kehrte mit der Expedition von 1908/09 zurück und wollte sich rehabilitieren, indem er seinen ehemaligen Mentor im Wettlauf um den Pol besiegte, aber sein eigener Vorstoß mit vier Männern ins Innere der Antarktis war von Anfang an ein einziger Kampf. Als Socks, das letzte ihnen noch verbliebene der ursprünglich vier mandschurischen Ponys, sechs Wochen nach Beginn des Marsches in einer Spalte des Beardmore-Gletschers verschwand, hatten sie ihre Verpflegungsrationen bereits reduziert und es wurde immer unwahrscheinlicher, dass sie ihr Ziel erreichen würden. Dennoch beschloss Shackleton, so weit wie möglich voranzukommen. Am 9. Januar fügte er sich schließlich in das Unvermeidliche: »Wir haben unser Pulver verschossen«, schrieb er in sein Tagebuch. »Und nun heimwärts. Mag uns dies auch bedauern, doch wir haben unser Bestes versucht.«
Für Worsley, der ein Jahrhundert später den Ort des Geschehens aufsuchte, war dieser Moment der Inbegriff von Shackletons Bedeutung als Führungspersönlichkeit: »Die Entscheidung umzukehren«, so argumentierte er, »war wohl eine der größten Entscheidungen in der Geschichte der Entdeckungsreisen.« Worsley war ein Nachfahre des Kapitäns von Shackletons Schiff auf der Endurance-Expedition; Gow war Shackletons angeheirateter Großneffe; und Henry Adams war der Urenkel von Shackletons zweitem Befehlshaber bei der Expedition von 1909. Die drei hatten beschlossen, ihre Vorfahren zu ehren und die 1.320 Kilometer lange Strecke ohne fremde Hilfe zurückzulegen. Anschließend würden sie sich um die unerledigten Geschäfte der Vorfahren kümmern und auch die letzten 180 Kilometer bis zum Südpol zurücklegen, wo sie dann von einer Turboprop-Maschine vom Typ Twin Otter abgeholt werden und nach Hause fliegen würden. Shackleton hingegen musste umkehren und die 1.320 Kilometer zu seinem Basislager zu Fuß zurücklaufen – ein Rückweg, der, wie die meisten im großen Zeitalter der Entdeckungen, zu einem verzweifelten Wettlauf mit dem Tod wurde.
Was waren die Grenzen, die Shackleton seinerzeit beschäftigten und peinigten? Es war nicht nur bitterkalt, er und seine Männer bewegten sich auch in einer Höhe von mehr als drei Kilometern über dem Meeresspiegel, was bedeutete, dass jeder eisige Atemzug nur zwei Drittel so viel Sauerstoff lieferte, wie ihr Körper erwartete. Da ihre Ponys schon früh ausfielen, mussten sie eigenhändig Schlitten ziehen, die anfangs bis zu 220 Kilogramm wogen, was eine ständige Belastung für ihre Muskeln bedeutete. Studien über moderne Polarreisende legen nahe, dass sie zwischen 6.000 und 10.000 Kalorien pro Tag verbrannten – und das bei halben Verpflegungsrationen. Am Ende ihrer Reise dürften sie im Laufe von vier unermüdlichen Monaten fast eine Million Kalorien verbrannt haben, ähnlich viel wie die nachfolgende Scott-Expedition von 1911/12. Nach Ansicht des südafrikanischen Wissenschaftlers Tim Noakes waren diese beiden Expeditionen »die größten menschlichen Leistungen anhaltender körperlicher Ausdauer aller Zeiten«.
Shackletons eigenes Verständnis dieser verschiedenen Faktoren war begrenzt. Er wusste natürlich, dass er und seine Männer etwas zu essen brauchten, aber darüber hinaus war noch wenig bekannt über die Funktionsweise des menschlichen Körpers. Das sollte sich jedoch ändern. Wenige Monate bevor Shackletons Schiff, die Nimrod, im August 1907 von der Isle of Wight aus in Richtung Antarktis segelte, veröffentlichten Wissenschaftler der Universität Cambridgeeinen Bericht über ihre Forschungen zur Milchsäure, einem offensichtlichen Feind der muskulären Ausdauer, der Generationen von Sportlern sehr vertraut werden sollte. Obwohl sich die moderne Sichtweise der Milchsäure in den vergangenen hundert Jahren dramatisch verändert hat (zunächst einmal handelt es sich bei dem, was man im Körper findet, nicht um Milchsäure, sondern um Laktat, ein negativ geladenes Ion), markierte die Veröffentlichung den Beginn einer neuen Ära der Erforschung der menschlichen Ausdauer – denn wenn man versteht, wie eine Maschine funktioniert, kann man ihre ultimativen Grenzen berechnen.
Jöns Jacob Berzelius, ein schwedischer Chemiker aus dem 19. Jahrhundert, ist heute vor allem dafür bekannt, das moderne System der chemischen Notation – H2O und CO2 usw. – entwickelt zu haben, aber er war auch der Erste, der 1807 den Zusammenhang zwischen Muskelermüdung und einer kurz zuvor entdeckten Substanz herstellte, die man in saurer Milch findet. Berzelius stellte fest, dass die Muskeln erlegter Hirsche ein hohes Maß dieser »Milchsäure« zu enthalten schienen, und dass die Menge dieser Säure davon abhing, wie sehr sich das Tier kurz vor seinem Tod verausgabt hatte. (Zu Berzelius’ Ehrenrettung sei gesagt, dass die Chemiker noch fast ein Jahrhundert davon entfernt waren, herauszufinden, was »Säuren« eigentlich sind. Heute wissen wir, dass sich das Laktat aus Muskeln und Blut, sobald es dem Körper entzogen wurde, mit Protonen verbindet und Milchsäure bildet. Das ist es, was Berzelius und seine Nachfolger gemessen haben, weshalb sie glaubten, dass es Milchsäure war und nicht Laktat, was bei der Ermüdung eine Rolle spielt. Für den Rest des Buches wird folglich, außer in historischen Zusammenhängen, von Laktat die Rede sein.)
Was das Vorhandensein von Milchsäure in den Muskeln der Hirsche zu bedeuten hatte, war unklar, da man nur wenig darüber wusste, wie Muskeln funktionierten. Berzelius selbst vertrat damals die Idee einer »Lebenskraft«, die alle Lebewesen antreibt und außerhalb des Bereichs der gewöhnlichen Chemie existiert. Doch der Vitalismus wurde allmählich durch den »Mechanismus« verdrängt, also die Vorstellung, dass der menschliche Körper im Grunde eine – wenn auch hochkomplexe – Maschine ist, die denselben grundlegenden Gesetzen gehorcht wie Pendel und Dampfmaschinen. Eine Reihe von Experimenten im 19. Jahrhundert, die oft grob und manchmal geradezu komisch waren, gaben erste Hinweise darauf, was diese Maschine antreiben könnte. So sammelten 1865 zwei deutsche Wissenschaftler bei einer Besteigung des Faulhorn, eines 2.681 Meter hohen Gipfels in den Berner Alpen, ihren eigenen Urin und maßen anschließend dessen Stickstoffgehalt, um festzustellen, dass Eiweiß allein nicht die gesamte Energie liefern konnte, die für eine längere Anstrengung benötigt wurde. Als sich solche und ähnliche Erkenntnisse häuften, untermauerte dies die einst ketzerische Ansicht, dass menschliche Grenzen letztlich eine einfache Frage von Chemie und Mathematik seien.
Heutzutage können Sportler ihren Laktatspiegel während des Trainings mit einem kleinen Piekser messen (einige Unternehmen behaupten sogar, Laktat in Echtzeit mit schweißanalysierenden Klebepflastern messen zu können). Aber allein der Nachweis von Milchsäure bedeutete für die frühen Forscher noch eine große Herausforderung; Berzelius widmet in seinem 1808 erschienenen Buch Föreläsningar i Djurkemien (»Vorlesungen über Tierchemie«) sechs dicht bedruckte Seiten seinem Rezept für das Zerkleinern von frischem Fleisch, das Auspressen in einem dicken Leinensack, das Kochen der ausgepressten Flüssigkeit, das Verdampfen und das Durchlaufen verschiedener chemischer Reaktionen, bis nach dem Ausfällen des gelösten Bleis und der Alkohole ein »dicker brauner Sirup und schließlich ein Lack übrig bleibt, der ganz den Charakter von Milchsäure aufweist«.
Es ist nicht verwunderlich, dass spätere Versuche, diese Art von Verfahren anzuwenden, zu einem Wust von zweideutigen Ergebnissen führten, die für allgemeine Verwirrung sorgten. Das war auch 1907 noch der Fall, als sich die Cambridge-Physiologen Frederick Hopkins und Walter Fletcher des Problems annahmen. »Es ist bekannt«, schrieben sie in der Einleitung ihrer Arbeit, »dass es kaum eine wichtige Tatsache bezüglich der Milchsäurebildung im Muskel gibt, die nicht von einem Beobachter behauptet und von einem anderen widerlegt wurde.« Hopkins war ein akribischer Experimentalphysiker, der später als Mitentdecker von Vitaminen bekannt wurde und dafür den Nobelpreis erhielt; Fletcher war ein versierter Läufer, der als Student in den 1890er Jahren zu den Ersten gehörte, die den 320-Meter-Rundkurs um den Innenhof des Trinity College in Cambridge in der Zeit zurücklegten, die die historische College-Uhr braucht, um zwölf Uhr zu schlagen – eine Herausforderung, die auch in dem Kinofilm Die Stunde des Siegers von 1981 verewigt wurde. (Obschon hinzugesagt werden muss, dass Fletcher den Berichten zufolge die Kurven schnitt.)
Hopkins und Fletcher tauchten die Muskeln, die sie untersuchen wollten, unmittelbar nach Beendigung der Tests in kalten Alkohol. Dieser entscheidende Fortschritt sorgte dafür, dass der Milchsäuregehalt während der nachfolgenden Verarbeitungsschritte, bei denen die Muskeln noch mit Mörser und Stößel zerkleinert und anschließend der Säuregehalt gemessen wurde, mehr oder weniger konstant blieb. Mit dieser neuen, präzisen Technik untersuchten die beiden Forscher die Muskelermüdung, indem sie mit Froschschenkeln experimentierten, die in langen Ketten von zehn bis 50 Paaren aufgehängt und mit Zinkhaken verbunden waren. Indem die Wissenschaftler an einem Ende der Kette elektrischen Strom anlegten, konnten sie alle Beine auf einmal kontrahieren lassen; nach zwei Stunden intermittierender Kontraktionen waren die Muskeln völlig erschöpft und nicht mehr in der Lage, auch nur ein schwaches Zucken zu erzeugen.
Die Ergebnisse waren eindeutig: Erschöpfte Muskeln enthielten dreimal so viel Milchsäure wie ausgeruhte, was Berzelius’ Vermutung zu bestätigen schien, dass sie ein Nebenprodukt – oder vielleicht sogar eine Ursache – der Ermüdung war. Und es gab noch eine zusätzliche Wendung: Die Menge an Milchsäure nahm ab, wenn die ermüdeten Froschmuskeln mit Sauerstoff versorgt wurden, stieg aber an, wenn ihnen Sauerstoff entzogen wurde. Endlich rückte eine erkennbar moderne Vorstellung davon, wie Muskel ermüden, in den Fokus – und von nun an häuften sich neue Erkenntnisse mit rasanter Geschwindigkeit.
Die Bedeutung von Sauerstoff wurde im folgenden Jahr von Leonard Hill, einem Physiologen am London Hospital Medical College, im British Medical Journal bestätigt. Er verabreichte Läufern, Schwimmern, Arbeitern und Pferden reinen Sauerstoff – mit offenbar verblüffenden Ergebnissen. Ein Marathonläufer verbesserte seine Bestzeit über eine Versuchsstrecke von 1.200 Metern um 38 Sekunden. Ein Straßenbahnpferd war in der Lage, einen steilen Anstieg in zwei Minuten und acht Sekunden statt in dreieinhalb Minuten zu erklimmen, und atmete oben angekommen nicht einmal schwer.
Einer von Hills Kollegen begleitete sogar einen Langstreckenschwimmer namens Jabez Wolffe bei seinem Versuch, als zweiter Mensch der Welt den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Nach mehr als 13 Stunden im Wasser, als er schon aufgeben wollte, atmete Wolffe über einen langen Gummischlauch Sauerstoff ein und fühlte sich sofort wie neu geboren. »Die Ruder mussten wieder herausgeholt und eingesetzt werden, um dem Schwimmer folgen zu können«, notierte Hill, »zuvor waren er und das Boot mit der Strömung getrieben.« (Wolffe musste schließlich, obwohl er am ganzen Körper mit Whiskey und Terpentin eingeschmiert und sein Kopf mit Olivenöl eingerieben war, eine quälende Viertelmeile – 400 Meter – vom französischen Ufer entfernt aufgrund der Kälte aus dem Wasser gezogen werden. Letztendlich unternahm er 22 Versuche, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, die alle fehlschlugen.)
Als die Geheimnisse der Muskelkontraktion allmählich gelüftet wurden, stellte sich die Frage: Wo liegen die Grenzen? Die Denker des 19. Jahrhunderts hatten die Idee diskutiert, dass ein »Naturgesetz« die größten potenziellen körperlichen Fähigkeiten eines Menschen vorgibt. »Jedes Lebewesen hat von Geburt an eine Grenze des Wachstums und der Entwicklung in allen Richtungen, über die es unmöglich durch irgendeine Kraftanstrengung hinausgehen kann«, argumentierte der schottische Arzt Thomas Clouston 1883. »Der Arm des Schmieds kann nicht über eine bestimmte Grenze hinaus anwachsen. Die Schnelligkeit eines Cricketspielers kann nicht über diesen unausweichlichen Punkt hinaus gesteigert werden.« Aber was war dieser Punkt? Es war ein Cambridge-Schüler von Fletcher, Archibald Vivian Hill (er hasste seinen Namen und war allgemein nur als A. V. bekannt), der in den 1920er Jahren die ersten glaubwürdigen Messungen der maximalen Ausdauer vornahm.
Man könnte meinen, der beste Test für die maximale Ausdauer sei ziemlich offensichtlich: ein Rennen. Aber die Leistung bei einem Rennen hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren wie zum Beispiel dem Pacing ab. Sie können die beste Ausdauer der Welt haben, aber wenn Sie ein unverbesserlicher Optimist sind, der nicht widerstehen kann, mit einem Sprint loszulegen (oder ein Feigling, der immer im Joggingtempo losläuft), werden Ihre Wettkampfzeiten niemals genau das widerspiegeln, wozu Sie körperlich in der Lage sind.
Man kann einen Teil dieser Variabilität ausschalten, indem man stattdessen einen Test zur Messung der Zeit bis zur Erschöpfung unternimmt: Wie lange kann jemand auf dem Laufband mit einer bestimmten Geschwindigkeit laufen? Oder wie lange kann jemand eine bestimmte Leistung auf einem Radergometer erbringen? Auf diese Weise werden heute viele Forschungsstudien zur Ausdauer durchgeführt. Aber auch dieser Ansatz hat Schwächen. Das wichtigste Manko ist, dass das Ergebnis davon abhängt, wie motiviert man ist, an seine Grenzen zu gehen. Es hängt außerdem davon ab, wie gut man in der letzten Nacht geschlafen hat, was man vor dem Test gegessen hat, wie bequem die Schuhe sind, und auch eine Reihe anderer möglicher Ablenkungen und Anreize nehmen Einfluss. Mit anderen Worten: Es ist ein Test der Leistungsfähigkeit an diesem speziellen Tag, die ultimative Leistungsfähigkeit der betreffenden Person kann man auf diese Weise nicht messen.
Im Jahr 1923 veröffentlichtenA. V. Hill und sein Kollege Hartley Lupton, damals an der Universität Manchester tätig, die erste einer Reihe von Studien, in denen sie untersuchten, was sie anfangs als »maximal oxygen intake« bezeichneten, also als »maximale Sauerstoffeinatmung« – eine Größe, die heute besser unter ihrer wissenschaftlichen Kurzbezeichnung VO2max bekannt ist. (Moderne Wissenschaftler verwenden den Begriff »maximal oxygen ontake«, also »maximale Sauerstoffaufnahme«, da es ein Maß dafür ist, wie viel Sauerstoff die Muskeln tatsächlich verbrauchen, und nicht, wie viel man einatmet.) Hill hatte bereits im Jahr zuvor den Nobelpreis für muskelphysiologische Studien erhalten, bei denen die durch Muskelkontraktionen erzeugte Wärme sorgfältig gemessen wurde. Er war ein begeisterter Läufer – eine Angewohnheit, die viele der Physiologen, die wir in den folgenden Kapiteln kennenlernen werden, teilen. Für die Experimente zum Sauerstoffverbrauch war er sogar sein bester eigener Proband, denn er berichtete in der Arbeit von 1923, dass er mit 35 Jahren »dank eines täglichen langsamen Laufs von etwa einer Meile vor dem Frühstück in einem recht guten allgemeinen Trainingszustand« gewesen sei. Er war außerdem ein begeisterter Teilnehmer an Bahn- und Crosslauf-Wettkämpfen: »Um die Wahrheit zu sagen, waren es wohl meine Mühen und Misserfolge in der Leichtathletik sowie die mich bisweilen überkommende Steifheit und Erschöpfung, die mich dazu bewegt haben, viele der Fragen zu stellen, die ich hier zu beantworten versucht habe.«
Hill und seine Kollegen ließen bei ihren Experimenten die Versuchspersonen in engen Kreisen um eine 85 Meter lange Schleife in Hills Garten laufen (eine normale Stadionlaufbahn ist im Vergleich dazu 400 Meter lang), wobei ihnen ein Luftsack auf den Rücken geschnallt wurde, der mit einem Atemgerät verbunden war, um ihren Sauerstoffverbrauch zu messen. Je schneller sie liefen, desto mehr Sauerstoff verbrauchten sie – bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann, so berichteten Hill und Kollegen, erreicht die Sauerstoffaufnahme »ein Maximum, über das hinaus keine Anstrengung mehr möglich ist«. Entscheidend war, dass die Probanden immer noch beschleunigen konnten, ihre Sauerstoffaufnahme jedoch stagnierte. Bei diesem Plateau handelt es sich um die VO2max, ein reines und objektives Maß für die Ausdauerleistungsfähigkeit, das theoretisch unabhängig von Motivation, Wetter, Mondphase oder anderen möglichen Ausreden ist. Hill vermutete, dass die VO2max die ultimativen Grenzen des Herz- und Kreislaufsystems widerspiegelt – eine messbare Konstante, die die Größe des »Motors« zu verraten schien, mit dem ein Sportler gesegnet war.
Dank dieses Fortschritts verfügte Hill nun über die Mittel, um die theoretische Höchstleistung eines jeden Läufers über eine beliebige Distanz zu berechnen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten erfolgt die Anstrengung in erster Linie aerob (d. h. »mit Sauerstoff«), da Sauerstoff für die effizienteste Umwandlung der gespeicherten Energie in eine für die Muskeln verwertbare Form benötigt wird. Die VO2max eines Athleten spiegelt seine aeroben Grenzen wider. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Energiebedarf der Beine jedoch so hoch, dass die aeroben Prozesse nicht mithalten können, so dass man auf schnell verbrennende anaerobe (»ohne Sauerstoff«) Energiequellen zurückgreifen muss. Wie Hopkins und Fletcher 1907 gezeigt hatten, besteht das Problem darin, dass Muskeln, die ohne Sauerstoff arbeiten, Milchsäure erzeugen. Hill schlossfolgerte, dass die Fähigkeit der Muskeln, hohe Mengen an Milchsäure zu tolerieren – das, was wir heute als anaerobe Kapazität bezeichnen würden –, der andere entscheidende Faktor für die Ausdauer sein musste, insbesondere bei Wettkämpfen, die weniger als zehn Minuten dauern.
In seinen Zwanzigern, so berichtete A. V. Hill, sei er Bestzeiten von 53 Sekunden über die Viertelmeile, 2:03 Minuten über die halbe Meile, 4:45 Minuten über die Meile und 10:30 Minuten über zwei Meilen gelaufen – beachtlich für die damalige Zeit, wenn auch, wie er bescheiden betonte, nicht »erstklassig«. (Wobei diese Leistungen gemäß der damaligen wissenschaftlichen Praxis einem anonymen Probanden namens »H.« zugeschrieben waren, der zufällig das gleiche Alter und das gleiche Tempo hatte wie Hill.) Die erschöpfenden Tests in seinem Garten zeigten, dass Hills VO2max bei 4,0 Litern Sauerstoff pro Minute lag und seine Laktattoleranz es ihm erlaubte, eine weitere »Sauerstoffschuld« von etwa zehn Litern zu akkumulieren. Anhand dieser Zahlen und der Messungen seiner Laufeffizienz konnte er ein Diagramm erstellen, das seine besten Laufzeiten mit erstaunlicher Genauigkeit vorhersagte.
Hill teilte diese Erkenntnisse enthusiastisch mit der Fachöffentlichkeit. »Unsere Körper sind Maschinen, deren Energieverbrauch genau gemessen werden kann«, erklärte er 1926 in einem Aufsatz im Scientific American mit dem Titel »The Scientific Study of Athletics«. Er veröffentlichte eine Analyse der Weltrekorde im Laufen, Schwimmen, Radfahren, Rudern und Eisschnelllaufen über Distanzen von 100 Yards bis 100 Meilen. Bei den kürzesten Sprints wurde die Form der Weltrekordkurve offenbar von der »Muskelviskosität« diktiert, die Hill während seiner Zeit an der Cornell University untersuchte, indem er einem Sprinter ein stumpfes, magnetisiertes Sägeblatt um die Brust schnallte und ihn dann an einer Reihe von Elektromagneten mit gewickeltem Draht vorbeilaufen ließ – ein bemerkenswertes frühes System zur präzisen elektrischen Zeitmessung. Bei längeren Distanzen krümmten der Einfluss der Milchsäure und der VO2max die Weltrekordkurve dann genau wie vorhergesagt.
Doch bei den längsten Distanzen gab es ein Rätsel. Hills Berechnungen legten nahe, dass Herz und Lunge bei einem ausreichend langsamen Tempo in der Lage sein müssten, die Muskeln mit genügend Sauerstoff zu versorgen, um sie vollständig aerob auf Betrieb zu halten. Mit anderen Worten, es sollte ein Tempo geben, das man so gut wie unbegrenzt durchhalten kann. Stattdessen zeigten die Daten aber ein stetiges Nachlassen: Der 100-Meilen-Rekord war wesentlich langsamer als der 50-Meilen-Rekord, der wiederum langsamer war als der 25-Meilen-Rekord. »Die alleinige Betrachtung von Sauerstoffaufnahme und Sauerstoffschuld reicht nicht aus, um das kontinuierliche Absinken der Kurve zu erklären«, räumte Hill ein. Er zeichnete eine gestrichelte, fast horizontale Linie ein, die zeigte, wo seiner Meinung nach die Ultradistanz-Rekorde liegen sollten, und kam zu dem Schluss, dass die Rekorde über längere Distanzen vor allem deshalb schwächer waren, weil »die größten Athleten sich auf Distanzen von nicht mehr als zehn Meilen beschränkt haben«.
Als Henry Worsley und seine Begleiter 2009 schließlich den Südpol erreichten, hatten sie fast 1.500 Kilometer auf Skiern zurückgelegt und dabei Schlitten gezogen, die ursprünglich mehr als 130 Kilogramm wogen. Zu Beginn der letzten Woche wusste Worsley, dass sich sein Spielraum für Fehler in Luft aufgelöst hatte. Mit 48 Jahren war er knapp zehn Jahre älter als seine beiden Begleiter Henry Adams und Gow, und am Ende eines jeden Tages hatte er Mühe, mit ihnen mitzuhalten. Am Neujahrstag, als noch rund 200 Kilometer vor ihnen lagen, lehnte er Henry Adams’ Angebot ab, ihm einen Teil seiner Schlittenladung abzunehmen. Stattdessen vergrub er seine Notrationen im Schnee – ein kalkuliertes Risiko, mit dem er neun Kilogramm einsparen konnte. »Bald empfand ich jede Stunde als einen beunruhigenden Kampf und ich wurde mir meines schwächer werdenden Zustands sehr bewusst«, erinnerte er sich. Er begann, den Anschluss zu verlieren, und kam zehn bis 15 Minuten nach den anderen im Lager an.
Am Vorabend ihres finalen Angriffs auf den Pol machte Worsley einen einsamen Spaziergang außerhalb des Zeltes, wie er es während der gesamten Reise jeden Abend getan hatte, bevor er in seinen Schlafsack kroch. Im Laufe der Expedition hatte er diese ruhigen Momente bisweilen damit verbracht, über die zerklüfteten Gletscher, die sie gerade überquert hatten, und die fernen Berge, die noch vor ihnen lagen, nachzudenken; manchmal war die Aussicht einfach »eine nicht enden wollende Weite aus Nichts«. An diesem letzten Abend wurde er in der polaren Dämmerung mit einem spektakulären Schauspiel belohnt: Die Sonne war wie ein Diamant geformt, umgeben von einem glühenden Kreis aus weißem, grellem Licht und auf beiden Seiten von Nebensonnen, so genannten Parhelia, ein Effekt, der entsteht, wenn die Sonnenstrahlen durch einen Schleier aus prismenförmigen Eiskristallen gebrochen werden. Es war das erste Mal während der gesamten Expedition, dass die Nebensonnen deutlich zu sehen waren. Gewiss, so sagte sich Worsley, war dies ein gutes Omen – ein Zeichen der Antarktis, dass sie ihren Griff nun endlich lockern und ihren Frieden mit ihm schließen würde.
Der nächste Tag war antiklimaktisch, eine gemütliche Fünf-Meilen-Wanderung als Schlusspunkt ihrer epischen Reise, bevor sie den warmen Unterschlupf der Amundsen-Scott-Südpolstation erreichten. Sie hatten es geschafft, und Worsley war von einem Gefühl der Erleichterung und Erfüllung überwältigt. Aber die Antarktis war doch noch nicht fertig mit ihm. Worsley hatte in seinem Leben einiges erlebt, er hatte drei Jahrzehnte in der britischen Armee gedient, darunter auch Einsätze auf dem Balkan und in Afghanistan mit der Eliteeinheit Special Air Service (SAS), er fuhr eine Harley, er hatte Gefängnisinsassen das Sticken beigebracht und sich in Bosnien einem Steine werfenden Mob gestellt, aber die Polar-Expedition zog ihn in ihren Bann: Diese Reise verlangte ihm alles ab und erweiterte damit seine Vorstellung davon, wozu er fähig war. Indem er die Grenzen seiner eigenen Ausdauer herausforderte, hatte er endlich einen würdigen Gegner gefunden. Worsley war angefixt.
Drei Jahre später, Ende 2011, kehrte er in die Antarktis zurück, um am Reenactment zum 100-jährigen Jubiläum des Wettlaufs von Robert FalconScott und Roald Amundsen zum Südpol teilzunehmen. Amundsens Team erreichte den Pol berühmterweise am 14. Dezember 1911 auf Skiern über eine östliche Route, mit Hilfe von 52 Hunden, die erst Schlitten zogen und schließlich als Nahrung dienten. Scotts Team, das sich auf der längeren Route, die Shackleton eingeschlagen hatte, mit schlecht funktionierenden mechanischen Schlitten und mandschurischen Ponys abmühte, die dem Eis und der Kälte nicht gewachsen waren, erreichte den Pol erst 34 Tage später und fand dort Amundsens Zelt sowie eine höfliche Notiz vor: »Da Sie wahrscheinlich der Erste sind, der dieses Gebiet nach uns erreicht, möchte ich Sie bitten, diesen Brief an König Haakon VII. weiterzuleiten. Wenn Sie etwas von den im Zelt zurückgelassenen Gegenständen gebrauchen können, zögern Sie nicht, sich zu bedienen. Auch der Schlitten, der draußen steht, könnte Ihnen von Nutzen sein. Mit freundlichen Grüßen wünsche ich Ihnen eine sichere Rückkehr …« Während Amundsens Rückreise ohne Zwischenfälle verlief, zeigte Scotts erschütternde Tortur, was auf dem Spiel stand. Eine Kombination aus schlechtem Wetter, Pech und mangelhafter Ausrüstung in Verbindung mit einer stümperhaften »wissenschaftlichen« Berechnung ihres Kalorienbedarfs führte dazu, dass Scott und seine Männer zu schwach waren, um den Rückweg anzutreten. Hungernd und frierend lagen sie zehn verschneite Tage lang in ihrem Zelt, unfähig, die letzten knapp 18 Kilometer zu ihrem Lebensmitteldepot zurückzulegen, bevor sie starben.
Ein Jahrhundert später führte Worsley ein Team





























