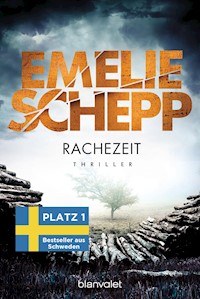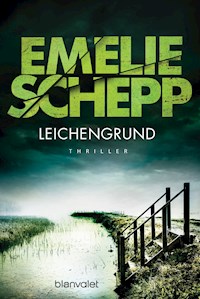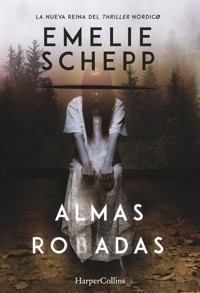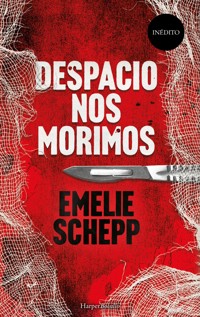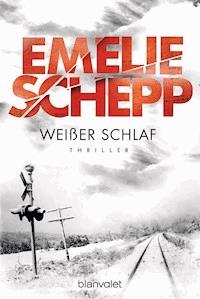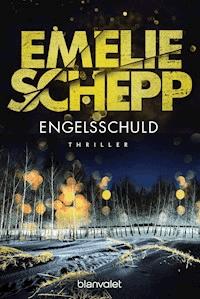
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jana Berzelius
- Sprache: Deutsch
Ein Fehler, den du nicht wiedergutmachen kannst. Und ein Mörder, der nie vergessen hat ...
Grausame Morde erschüttern die schwedische Stadt Norrköping. Dreimal wird der Sanitäter Philip Engström zu den Tatorten gerufen, dreimal kann er nichts mehr für die entsetzlich entstellten Opfer tun. Er erkennt, dass er den Ermordeten schon einmal begegnet ist — und er selbst das nächste Opfer sein könnte. Doch eine schwere Schuld in seiner Vergangenheit lässt ihn schweigen. Staatsanwältin Jana Berzelius nimmt sich des Falls an. Erst spät merkt sie, dass Privates und Berufliches in dieser Mordserie eng miteinander verknüpft sind. Denn Jana hat ihre ganz eigene Rechnung mit dem Mörder offen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Grausame Morde erschüttern die schwedische Stadt Norrköping. Dreimal wird der Sanitäter Philip Engström zu den Tatorten gerufen, dreimal kann er nichts mehr für die entsetzlich entstellten Opfer tun. Er erkennt, dass er den Ermordeten schon einmal begegnet ist – und er selbst das nächste Opfer sein könnte. Doch eine schwere Schuld in seiner Vergangenheit lässt ihn schweigen. Staatsanwältin Jana Berzelius nimmt sich des Falles an. Erst spät merkt sie, dass Privates und Berufliches in dieser Mordserie eng miteinander verknüpft sind. Denn Jana hat ihre ganz eigene Rechnung mit dem Mörder offen.
Autorin
Emelie Schepp, geboren 1979, wuchs im schwedischen Motala auf. Sie arbeitete als Projektleiterin in der Werbung, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Nach einem preisgekrönten Theaterstück und zwei Drehbüchern verfasste sie ihren ersten Roman: Der zuerst nur im Selbstverlag erschienene Thriller »Nebelkind« wurde in Schweden ein Bestsellerphänomen und als Übersetzung in zahlreiche Länder verkauft. 2016 wurde Schepp mit dem Crimetime Specsavers Award ausgezeichnet und damit zur besten Spannungsautorin Schwedens gekürt.
Von Emelie Schepp bereits erschienenNebelkind · Weißer Schlaf · Engelsschuld
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Emelie Schepp
Engelsschuld
Thriller
Deutsch von Annika Krummacher
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Prio Ett« bei Wahlström & Widstrand, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Emelie Schepp by Agreement with Grand Agency
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friederike Arnold
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildungen: Getty Images/Jeff Canon; Getty Images/WIN-Initiative/Neleman
BL · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-20697-0V005www.blanvalet.de
Für Papa
Die Frau schlug die Augen wieder auf und sah mich an. Verzweifelt fuchtelte sie mit den Händen, als wäre ihr erst in diesem Moment aufgegangen, was gleich passieren würde.
Ich sah ihr Erstaunen, ihre Verwunderung, und flüsterte ihr zu, dass es keinen anderen Ausweg gebe, dass sie schon zu viel gesehen habe.
Sie hätte weiter die Augen geschlossen halten sollen, hätte nicht mit neugierigem Blick den Ring betrachten dürfen.
»Es tut mir leid«, sagte ich, während ich meine Hände auf ihre Nase und ihren Mund presste. »Aber was hätten Sie an meiner Stelle getan?«
Sie antwortete nicht. Natürlich nicht.
Einen einzigen Versuch unternahm sie noch, sich zu befreien, einen letzten verzweifelten Versuch. Ihr magerer Körper auf der Pritsche bäumte sich auf. Sie wollte meine Hände packen, dann fuhr sie mit den Fingern über meinen Arm und kratzte mich. Aber ich wehrte mich. Drückte immer fester zu.
Sie versuchte zu schreien, ich hörte einen gurgelnden Laut, aber ihre Kräfte ließen nach, und sie blinzelte hektisch, ohne dass Tränen kamen.
Und dann, endlich, kam die Einsicht, dass dies das Ende darstellte. Ihr Gehirn machte sich frei von allen anderen Gedanken, alles wurde rein und furchtbar.
Es war kein Geräusch zu hören, nur ein leiser Seufzer, als sie aufgab. Als der Körper sich schließlich entspannte und still wurde.
Ich nahm die Hand von ihrem Mund, lauschte der Stille. Und lächelte. Denn es fühlte sich so einfach an, so perfekt, so selbstverständlich.
Dies war eine Ausnahme gewesen, aber auch ein Beginn. Und ich freute mich auf die Fortsetzung.
Wie ein Kind.
Mittwoch
1
Philip Engström stand im Pausenraum der Rettungswache in Norrköping. Kühle Frühlingsluft wehte durchs offene Fenster herein. Er nahm den Kaffeebecher aus dem Automaten, schloss die Hände darum und genoss die Wärme. Dann ging er durchs Zimmer und ließ sich auf eines der Sofas sinken.
Erst in einer Stunde war seine Schicht vorbei, aber schon jetzt spürte er eine starke Sehnsucht, die Augen schließen zu dürfen, nur ganz kurz zu schlafen.
Er wusste, dass er diesen Gedanken besser verbannen sollte, aber nach den stressigen Ereignissen der vergangenen Nacht brauchte er Erholung. Plötzlich war er eingenickt. Der Schlaf hatte ihn überwältigt, und er träumte von einem wirbelnden, tosenden Wasserfall.
Da hörte er plötzlich in weiter Ferne jemanden seinen Namen rufen. Er zuckte zusammen, tastete über den Tisch und stieß versehentlich den Kaffeebecher um.
»Mensch, Philip!«
»Hallo, Sandra«, sagte er verschlafen.
Sandra Gustafsson stand zwei Meter von ihm entfernt und hatte die Hand in die Hüfte gestemmt. Ihre Haare waren blond, und ihre Augen waren so grün wie ihre Arbeitskleidung. Sandra war Rettungssanitäterin und der jüngste Zuwachs in der Wache. Sie war kompetent und arbeitete hart, machte sich aber auch viele Gedanken um ihre Kollegen.
»Noch immer müde?«, fragte sie.
»Kein bisschen«, antwortete Philip. Er stand auf und wischte den Kaffee mit unnötig viel Küchenkrepp vom Tisch, ehe er sich wieder setzte.
Sie sah ihn an, während er ein Gähnen unterdrückte. Dann ging sie zum Automaten und füllte zwei Becher mit Kaffee. Er konnte sein Lächeln nicht verbergen, als sie ihm den einen reichte. Er nahm einen raschen Schluck und sah verstohlen auf die Uhr.
»Bald ist Feierabend«, sagte sie.
»Genau.«
»Und du willst nicht mit mir sprechen, bevor du gehst?«
Sie setzte sich in den Sessel ihm gegenüber. Ihr Körper war kräftig und durchtrainiert.
»Worüber?«
»Über die Patientin, die gestorben ist.«
»Warum sollte ich mit dir darüber reden wollen?«, fragte er und nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee. Er fühlte sich noch immer schläfrig. Ich muss besser auf meine Gesundheit achten, dachte er. Wegen der Schichtarbeit schlief er zu wenig und zu unregelmäßig. Es reichte einfach nicht, sich hier und da eine Stunde auszuruhen.
»Irgendwie war das eine seltsame Situation«, sagte sie.
»Es war ein ganz normaler Herzinfarkt, was gibt es denn da zu besprechen?«
»Die Patientin hätte überleben können.«
»Aber sie ist gestorben, okay?«
Philip lauschte auf das Summen des Kaffeeautomaten. Er dachte an die Patientin und spürte, dass seine Hände zitterten.
»Ich frage mich nur, wie es dir damit geht«, sagte sie.
»Sandra.« Er stellte den Kaffeebecher auf den Tisch. »Ich weiß, dass du diese Peer-Ausbildung gemacht hast und uns Kollegen super zuhören kannst, aber dieser Psychoscheiß funktioniert nicht bei mir.«
»Du willst also nicht reden?«
»Nein, hab ich gesagt.«
»Ich habe nur gedacht …«
»Was hast du gedacht? Dass wir uns im Kreis hinsetzen und uns umarmen? Willst du, dass wir uns dabei auch noch einen Kuschel-Schlafanzug anziehen, oder was?«
»Na ja, die Abläufe sehen normalerweise vor …«
»Hör auf. Ich arbeite seit fünf Jahren als Notfallsanitäter, ich weiß ganz genau, wie die Abläufe aussehen.«
»Dann weißt du auch, dass es nicht in Ordnung ist, bei einem Einsatz einzuschlafen.«
Es wurde für einen Moment still im Raum.
»Und was ist, wenn jemand davon erfährt?«, flüsterte sie dann.
»Keiner wird davon erfahren«, sagte er. »Schließlich gibt es so was wie Schweigepflicht.«
»Wie?«
Er sah sich um und vergewisserte sich, dass niemand in Hörweite war.
»Du hast gehört, was ich gesagt habe.«
»Das können wir doch nicht machen, verdammt«, sagte sie.
Philip fing ihren Blick auf. »Warum nicht?«
»Du hast sie ja nicht mehr alle«, sagte sie. »Du bist total …«
»Ich weiß, dass das komisch klingt.«
»Komisch? Das klingt total verrückt.«
Er sah in Richtung Tür und hätte am liebsten das Zimmer verlassen, jetzt, sofort. Er wollte die Ruhe spüren, die Stille hören, und vor allem wollte er Sandra loswerden.
»Tut mir leid, Philip, das kann ich nicht. Du hast das vermurkst, nicht ich.«
»Ich vermurkse gar nichts, nur damit du es weißt. Und das war auch gar nicht der Grund, dass sie gestorben ist.«
»Glaubst du das wirklich?«
Philip starrte sie an, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und atmete tief durch.
»Na gut«, sagte er nach einer Weile. »Wir machen es so: Wenn jemand wider Erwarten herausfinden sollte, dass ich während des Einsatzes eingenickt bin, verspreche ich, mich selbst anzuzeigen.«
»Und was ist mit mir?«
»Du schiebst alles auf mich und sagst, dass du Angst hattest, was zu sagen, weil du gerade erst hier angefangen hast, und so weiter. Du kannst dabei richtig auf die Tränendrüse drücken.«
Sie sah ihn schweigend an.
»Sind wir uns einig?«, fragte er.
»Ja«, sagte sie leise. »Aber du müsstest mal was unternehmen. Noch so ein Vorfall, und ich zeige dich an.«
»Danke«, entgegnete er und legte die Hand auf ihre Schulter.
»Ich meine es ernst.«
»Ich weiß«, sagte er und stand auf.
Staatsanwältin Jana Berzelius saß vor dem Aufnahmestudio und wartete. Gleich durfte sie sich neben Richard Hansen setzen, der das Frühstücksradio des Senders P4 Östergötland moderierte. Auf ein Handzeichen des Moderators hin schlich sie sich ins Studio und setzte sich auf den vorgesehenen Platz. Über die Kopfhörer verfolgte sie mit, wie er das neue Diskussionsthema ankündigte:
»Erpressung, Raub und Überfälle mit Hammer, Messer und Schnellfeuerwaffen – die Bandenkriminalität in Norrköping nimmt stetig zu. Jana Berzelius, Sie sind seit mehreren Jahren als ermittelnde Staatsanwältin in Fällen von organisierter Kriminalität tätig. Haben Sie eine Erklärung für diese Zunahme von Gewalttaten?«
Jana räusperte sich.
»Zunächst einmal sollten wir berücksichtigen, dass wir hier von der Zahl der angezeigten Verbrechen sprechen. Dass die Statistik einen Zuwachs verzeichnet, heißt nicht unbedingt, dass die tatsächliche Kriminalität zunimmt, sondern …«
»Sie meinen also, die Statistik lügt?«
»Wir beobachten, dass die Bandenkriminalität in ganz Schweden zunimmt, während die Gewalt in der Gesellschaft insgesamt sinkt.«
»Und was ist der Grund für die steigende Bandenkriminalität?«
»Da gibt es viele Erklärungen.«
»Zum Beispiel?«
Sie beugte sich vor. »Im Prinzip haben Sie in Ihrer Ankündigung die wichtigsten Gründe genannt. Ich kann Ihnen nur zustimmen, dass der wachsende Bestand an Schusswaffen in Kombination mit einer sozialen und wirtschaftlichen Segregation wichtige Faktoren darstellen.«
»Wie Sie wissen, hat unsere Redaktion die kriminellen Banden hier in Norrköping näher untersucht«, fuhr Hansen fort, während er in seine Unterlagen sah. »Unsere Reportagen über die Aktivitäten dieser Banden in Sachen Waffen-, Drogen- und Menschenhandel haben viel Aufsehen erregt. Jetzt ist seit den ersten Berichten ein Jahr vergangen, und es ist kaum eine Verbesserung zu beobachten. Es wird nur selten ein Urteil gesprochen, wenige Fälle kommen überhaupt vor Gericht, und viele Menschen behaupten, dass das Rechtssystem in Schweden nicht richtig funktioniert. Müssen wir uns Sorgen machen?«
»Im Rechtswesen besteht immer das Risiko von Fehlern, die dann in vereinzelten Fällen zu falschen Gerichtsurteilen führen können oder dazu, dass es gar nicht erst zu einem Prozess kommt.«
»Könnte ein befangener Staatsanwalt ein solches Risiko darstellen?«
»Natürlich – genau wie manipulierte polizeiliche Ermittlungen, irreführende Expertengutachten oder Falschaussagen. Dass diese Risiken manchmal in falschen Gerichtsurteilen resultieren, kann niemand leugnen, nicht einmal ich als Staatsanwältin.«
»Und was halten Sie von den immer lauter werdenden Stimmen, die eine Erhöhung des Strafmaßes für Gewaltverbrechen fordern?«
»Wir haben keine Beweise dafür, dass strengere Strafen zu weniger Verbrechen führen würden, dagegen …«
»In den USA hat die Entscheidung für härtere Strafen dazu geführt, dass …«
»Aber wir sprechen jetzt von Schweden beziehungsweise von Norrköping«, präzisierte Jana.
Hansen blickte wieder in seine Unterlagen.
»Die Opposition hält härtere Strafen für ein wichtiges Ziel in der Rechtspolitik. Möchten Sie das kommentieren?«
»Die wichtigste Aufgabe der Rechtspolitik sollte die Prävention von Verbrechen sein.«
Hansen sah zu ihr auf. »In der sogenannten Polizeiaffäre wurden leitende Polizeichefs und Geschäftsleute wegen Korruption und Drogenschmuggel angeklagt und werden, so dürfen wir vermuten, zu langen Gefängnisstrafen verurteilt werden.«
»Das stimmt, ja.«
»Wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Gerichtsverfahren besonders kompliziert. Mal ganz abgesehen von der besonderen Rücksichtslosigkeit der Gewalttaten, geht es offenbar um einen Beamten, der seine Machtposition missbraucht hat, und zwar in erheblichem Umfang.«
»Sie sprechen vom Reichspolizeichef Anders Wester«, entgegnete Jana. »Wir haben noch gar kein klares Bild, was tatsächlich vorgefallen ist, nicht alle Tatverdächtigen sind angehört worden …«
»Das ist richtig, aber wäre in einem solchen einzigartigen Fall nicht eine härtere Strafe denkbar, um zu demonstrieren, dass unsere Gesellschaft diese Art von Verbrechen verurteilt?«
»Das kann ich nicht kommentieren, und ich bin auch nicht für diesen Fall zuständig.«
»Aber sind Sie denn nicht der Meinung, dass die Gesellschaft durch ihr Strafsystem deutlich macht, wie sie die unterschiedlichen Verbrechen bewertet?«
»Doch, aber es gibt wie gesagt keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen härteren Strafen und einem Rückgang der Kriminalität.«
»Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie also der Meinung, dass wir stattdessen mehr in Präventionsmaßnahmen investieren sollten, weil Sie das für den einzigen Weg halten, um die Kriminalität zu senken?«
»Ja, natürlich.«
»Und worauf basieren Ihre Schlussfolgerungen?«
Jana sah ihm direkt in die Augen.
»Auf meiner Erfahrung.«
Der Krankenpfleger Mattias Bohed ging zusammen mit seiner Kollegin Sofia Olsson durch die Station 11 des Vrinnevi-Krankenhauses. Vor Zimmer 38 saß der Wachmann Andreas Hedberg. Er lächelte Sofia schüchtern an, erhob sich und schloss die Tür auf. Sobald die beiden Pfleger den Raum betreten hatten, sperrte Hedberg wieder zu.
In dem streng bewachten Zimmer wurde seit drei Monaten der Mordverdächtige Danilo Peña versorgt. Mattias wusste kaum mehr über den Patienten als das, was im Internet zu lesen war – dass er in die sogenannte Polizeiaffäre verwickelt war und unter Verdacht stand, mehrere Menschen ermordet zu haben, darunter einige junge Mädchen aus Thailand. Die Kollegen, die für seine Pflege ausgewählt worden waren, mussten sich an strikte Verhaltensregeln halten, unter anderem durften sie nie allein mit ihm im Zimmer sein.
»Hast du vergessen, die Lampe auszuschalten?«, fragte Sofia, als sie sah, dass drüben am Bett Licht brannte.
»Nein«, sagte Mattias. »Ich glaube nicht.«
»Du musst unbedingt daran denken, die Lampen nicht eingeschaltet zu lassen. Es muss dunkel im Raum sein, wenn wir nicht hier sind.«
»Entschuldigung«, sagte er, obwohl er davon überzeugt war, keinen Fehler gemacht zu haben.
Der Raum war klein und enthielt außer der medizintechnischen Ausrüstung ein Bett, einen Nachttisch und einen Stuhl.
Sofia nahm eine kleine Glasflasche in die Hand und schüttelte sie vorsichtig, ehe sie die Flüssigkeit in eine Spritze zog.
»Hast du schon gehört, dass er gestern kurz aufgewacht ist?«, sagte sie.
»Soll das ein Witz sein?«
»Ja«, sagte sie und lächelte.
»Willst du mir einen Schrecken einjagen, oder was?«
»Nein, aber ich will, dass du ganz besonders sorgfältig bist. Die Lampe darf auf keinen Fall anbleiben, wenn wir nachher das Zimmer verlassen.«
Der Patient lag ruhig auf dem Rücken, nur seine Atmung war zu erahnen. Er hatte die Augen geschlossen und die Arme unter der Decke.
Mattias hielt Abstand, obwohl er wusste, dass der Patient tief schlief.
»Was ist los mit dir? Das war doch nur ein Witz«, sagte Sofia, die seine Nervosität bemerkt hatte. »Es gab doch noch nie irgendwelche Anzeichen, dass er gleich aufwachen könnte. Er hat sich kaum bewegt und liegt immer so da, wenn wir reinkommen.«
»Aber eines Tages wird er aufwachen, oder etwa nicht?«
»Entspann dich«, sagte sie und seufzte.
»Aber ehrlich jetzt, was passiert, wenn er aufwacht?«
»Er wird nicht aufwachen.«
Sie ging zum Bett und sagte leise zum Patienten, dass es Zeit für die Spritze sei.
»Warum redest du mit ihm, wenn er dich doch sowieso nicht hört?«, wollte Mattias wissen.
»Keine Ahnung, aus alter Gewohnheit vielleicht?«
Sie hielt die Spritze in der linken Hand und schlug mit der Rechten die Decke zurück.
»Hilfst du mir, bitte?«
Mattias stellte sich neben sie und rieb einen Wattebausch mit Desinfektionsmittel über die schlaffe Haut des Oberarms. Danilo Peña sah mager aus. Vermutlich hatte er während seines Krankenhausaufenthalts eine ganze Menge Muskelmasse verloren.
Mattias umrundete das Bett, warf den Wattebausch in den Papierkorb und beobachtete Sofia, die im Begriff war, Danilo Peña die Spritze in den Unterarm zu geben.
»Träum was Schönes«, sagte sie leise.
In diesem Moment zuckte Peñas Hand. Sofia trat sofort einen Schritt zurück. Die Spritze fiel ihr aus der Hand und rollte unter das Bett.
»Ist er aufgewacht?«, fragte Mattias erschrocken.
»Nein. Seine Augen sind ganz trüb, und der Blick ist total unfokussiert. Er schläft noch immer. Ehrlich gesagt war ich gar nicht darauf vorbereitet, dass er … Ich meine, ich war echt überrascht.«
Sie bückte sich, um die Spritze unter dem Bett hervorzuholen, bekam sie aber nicht zu fassen.
»Sie liegt eher auf deiner Seite«, sagte sie. »Kannst du sie eben aufheben, während ich eine neue vorbereite?«
Mattias fixierte den Patienten mit dem Blick, während er sich hinkniete. Er sah Sofias Füße, als er unter das Bett sah.
Die Spritze lag ziemlich weit hinten an der Wand. Das Namensschild und die Kulis in der Brusttasche drückten, als er unter das Bett robbte, um sie hervorzuholen.
In diesem Moment ertönte ein dumpfer Laut über ihm. Er blickte sich um, konnte Sofias Füße aber nicht mehr sehen.
»Sofia?«, fragte er und erhob sich, während er die Spritze krampfhaft umklammert hielt.
Ein Adrenalinstoß durchfuhr ihn, als er sah, dass die Decke beiseitegeschoben und das Bett leer war.
Auf dem Stuhl daneben saß Sofia. Ihre Arme hingen schlaff herunter, und ihre Augen waren geschlossen.
Er starrte sie an, und sein Herz pochte so heftig, dass es in seinen Ohren dröhnte. Erst jetzt fiel ihm ein, dass er den Notrufschalter betätigen oder den Wachmann rufen sollte, aber der Körper gehorchte ihm nicht.
Dann machte er einen Schritt rückwärts. Als er sich umdrehte, entdeckte er den Patienten, der still hinter ihm stand, nur zwei Schritte entfernt, mit geballten Fäusten und finsterem Blick.
Mattias umklammerte die Spritze noch fester und hob sie langsam, als wollte er sich damit verteidigen.
»Wag nicht mal, diesen Gedanken zu denken«, sagte Danilo Peña mit dumpfer Stimme und machte zwei Schritte auf ihn zu.
Mattias wich zurück, aber seine Bewegung war viel zu vorhersehbar und langsam. Danilo Peña packte seinen Arm und verdrehte ihn. Es tat fürchterlich weh.
»Was wollen Sie?«, keuchte Mattias. »Sagen Sie einfach, was Sie wollen, dann helfe ich Ihnen …«
Der Schmerz im Arm ließ ihn verstummen. Er konnte nicht mehr dagegenhalten, die Spritze glitt aus seiner Hand und auf den Fußboden.
»Zieh dich aus.«
»Was?«
»Zieh dich aus.«
»Okay, okay«, sagte Mattias. Doch er konnte sich nicht bewegen, denn sein Körper war wie gelähmt.
Erst als Danilo Peña seine Worte wiederholte, verstand er und zog sich den weißen Kasack über den Kopf. Ein Stift fiel auf den Boden.
»Die Hose auch.«
Mattias wandte den Blick zur Tür.
»Bist du schwer von Begriff? Es ist eilig.«
Der Schlag kam so schnell, dass er nicht mehr reagieren konnte. Er tastete nach seinem Mund und spürte warmes Blut zwischen den Fingern.
Danilo Peña bückte sich und hob die Spritze auf.
»Bitte«, sagte Mattias. »Ich tue alles, was Sie wollen …«
»Die Hose.«
Mattias knöpfte schnell die weiße Hose auf und schob sie sich bis zu den Knien hinunter. Er versuchte, sein Bein herauszuziehen, blieb aber mit dem Turnschuh hängen. Mattias verlor das Gleichgewicht und fiel zur Seite. Er spürte den Schmerz in der Hüfte, als er auf dem Fußboden landete, zerrte aber weiter am Hosenbein.
Schließlich hatte er Schuhe und Hose ausgezogen. Er hatte eine Gänsehaut an den Beinen und dachte an seinen Sohn Vincent, der fürs Ausziehen immer so ewig brauchte. Ständig musste er ihn ermahnen, wenn er baden sollte oder ins Bett musste. Jetzt schwor er sich, ihn nie wieder deswegen zu ermahnen. Nie wieder, dachte er und spürte einen Kloß im Hals, als müsste er gleich weinen.
»Du hast die Strümpfe vergessen. Los, mach schon!«
Mattias schluckte, zog die Strümpfe aus und sah Danilo Peña an.
»Ich habe eine Familie, einen Sohn …«
»Steh auf«, sagte Peña. »Geh zum Bett.«
Mattias stolperte vorwärts, ohne seinen Körper wirklich im Griff zu haben, hielt sich aber auf den Beinen, keuchend und zitternd.
»Und jetzt?«
»Leg dich hin«, zischte Peña.
»Ins Bett?«
»Ins Bett.«
Die Laken waren noch immer warm, als er sich mit dem Kopf aufs Kissen legte. Es war unbequem, doch er wagte nicht, sich zu bewegen.
Danilo Peña bückte sich, hob den Kasack vom Boden auf und schlüpfte rasch hinein. Die Hose saß locker an seiner Taille. Dann drehte er sich zu Mattias um, schlug die Decke zurück und hielt die Spritze über die nackte Brust des Krankenpflegers, einen Zentimeter über dem Herzen.
»Zeit für deine Spritze«, sagte er und lächelte.
Mattias sah die spitze Nadel. Dann ging alles ganz schnell. Er empfand einen Stich in der Brust, als hätte ein Insekt ihn gebissen. Es fühlte sich an, als würde sich eiskaltes Wasser in seinem Blutkreislauf verteilen.
Von der Einstichstelle ausgehend, breitete sich ein roter Fleck auf dem weißen Laken aus.
Eigentlich hätte er Angst empfinden müssen, aber er spürte gar nichts, alles, was er tun konnte, war, seine Umgebung zu beobachten.
Danilo Peña sagte irgendetwas, aber die Worte hallten wie in einem Tunnel. Mattias sah, wie er den weißen Kasack zurechtzog, den Stift vom Boden aufhob und in die Brusttasche steckte. Peña betrachtete sich im Spiegel und fuhr sich durchs schwarze Haar, bevor er sich wieder zu Mattias umdrehte.
»Träum was Schönes«, sagte er.
Dann ging er zur Tür. Mattias hörte, wie sie aufgeschlossen, geöffnet und wieder geschlossen wurde.
Das kann alles nicht wahr sein, war sein letzter Gedanke.
Dann spürte er, wie sie näher kam. Die Stille.
Dann die Kälte. Sie begann in den Füßen und Händen. Breitete sich langsam aus, von den Beinen, den Armen und dem Kopf bis zum Herzen.
Und als Letztes kam die Finsternis.
2
Private Nummer.
Seufzend drückte Jana Berzelius das Gespräch weg und legte ihr Handy mit der Vorderseite nach unten auf den Schreibtisch. Sie ging nur selten ran oder besser gesagt fast nie, wenn die Nummer unterdrückt war, und momentan wollte sie nicht gestört werden.
Jana hatte den Radiosender zu Fuß verlassen und zu Hause ihre Aktentasche geholt. Anschließend war sie mit dem Auto zur Staatsanwaltschaft gefahren.
Sie warf einen Blick auf den Bildschirm und begann eifrig zu schreiben.
Das Handy klingelte erneut.
Sie nahm es hoch. Schon wieder eine unterdrückte Rufnummer.
Mit einem Mal klopfte es an der Tür. Sie hob den Blick und sah durch die Glasscheibe ihren Kollegen Per Åström, der ihr lächelnd zuwinkte.
Sie schätzte seine Gesellschaft durchaus. Manchmal gingen sie sogar miteinander essen. Per war im Grunde der einzige soziale Umgang, den sie sich erlaubte. Sie mochte keine Gesellschaft und hatte auch kein Bedürfnis, sich ohne besonderen Grund mit jemandem zu treffen. Für sie hatte Kommunikation eigentlich nur eine berufliche Funktion. Im Gerichtssaal hatte sie keinerlei Probleme damit, lange Reden zu halten, um Fakten darzulegen, aber private Gespräche waren eine Herausforderung für sie. Eine Herausforderung, die sie nicht weiter interessierte. Ihr Privatleben wollte sie für sich behalten.
Per klopfte wieder und formte mit den Lippen die Frage: Darf ich reinkommen?
Sie warf einen Blick auf ihr klingelndes Handy und dann wieder auf Per, der vor der Tür stand. Wenn sie ihn hereinließ, würden viele Minuten wertvoller Arbeitszeit verloren gehen – sie hatte ja schon den ganzen Morgen im Radiosender verbracht. Per begnügte sich nur selten mit der kurzen Version, und auch wenn sie auf die Uhr sah, würde er nicht begreifen, dass sie anderes zu tun hatte, als ihm zuzuhören.
Daher war die Entscheidung einfach.
Sie schüttelte den Kopf. Per schien erstaunt zu sein. Dann drehte sie sich in ihrem Schreibtischstuhl halb von ihm weg und nahm den Anruf entgegen.
»Hallo, hier ist Oberarzt Alexander Eliasson.« Seine Stimme war seltsam ruhig. »Störe ich?«
Sie runzelte die Stirn.
»Worum geht es?«, fragte sie.
»Es tut mir leid, dass ich Sie anrufen muss, aber … Ich möchte Sie bitten, ins Krankenhaus zu kommen.«
»Warum?«
»Heute Nacht wurde ein Rettungswagen nach Lindö ins Haus Ihrer Eltern gerufen und …«
»Wie geht es ihm?«
»Ich fürchte …«
»Mein Vater, wie geht es ihm?«
»Es geht nicht um Ihren Vater.«
»Tut mir leid, ich dachte …« Sie atmete tief durch.
»Ich habe heute Morgen schon versucht, ihn zu erreichen«, sagte der Oberarzt. »Wir sind seit Langem befreundet, wissen Sie.«
»Vater fällt es momentan sehr schwer, zu kommunizieren«, erklärte Jana.
»Das weiß ich, und was ihm widerfahren ist, tut mir aufrichtig leid.«
»Die Sache war selbst verschuldet.«
Sie sah aus dem Fenster und beobachtete die Vögel, die sich hoch über die Dächer erhoben.
»Und was ist der Grund Ihres Anrufs?«
»Ich fürchte, der Rettungswagen ist nicht rechtzeitig eingetroffen.«
Es vergingen ein paar Sekunden, in denen sie versuchte, ihre Gedanken zu strukturieren.
»Sie sprechen von meiner Mutter«, sagte sie leise.
»Ja«, erwiderte der Oberarzt. »Ich bedaure es wirklich sehr, aber … Ihre Mutter ist verstorben.«
Die Sonne war durch die dicke Wolkendecke gedrungen, und die nackten Bäume warfen schmale Schatten auf den Asphalt. Kriminalkommissar Henrik Levin fuhr in eine Parkbucht und blieb mit der Hand auf dem Lenkrad sitzen. Er entdeckte die Streifenwagen, auch die Kriminaltechniker waren vor Ort.
Die Polizei hatte das gesamte Gebiet durchsucht und alle Aufnahmen aus den nahegelegenen Verkehrsüberwachungskameras beschlagnahmt. Die Fahndung nach Danilo Peña lief auf Hochtouren.
»Hallo! Willst du den ganzen Tag im Auto sitzen bleiben, oder was?«
Mia Bolander hatte die Beifahrertür geöffnet und sah ihn müde an. Henrik stieg aus dem Wagen, schloss ab und ging mit Mia zum Haupteingang des Krankenhauses.
Währenddessen schaute er sich um und sortierte diejenigen aus, die sie mit neugierigen Blicken beobachteten. Er ignorierte das grelle, rotierende Blaulicht und die uniformierten Kollegen, die breitbeinig rechts und links von der Drehtür standen, und ließ den Blick über den großen Parkplatz schweifen, hinüber zu dem kleinen Waldstück, zu den Bäumen und Steinen, als hielte er zwischen den Gebäuden des Krankenhauses nach einer Bewegung Ausschau.
»Er ist sicher schon über alle Berge«, sagte Mia, die seinen suchenden Blick registriert hatte. »Aber das ist echt krass, einfach so durch den Haupteingang rauszuspazieren.«
»Wenn er das überhaupt getan hat«, meinte Henrik. »Zwei Busse haben das Gelände verlassen, vier Taxis, etwa zwanzig Privatautos und ein Rettungswagen, aber niemand hat ihn gesehen.«
»Haben wir die Ausfahrten sperren lassen?«, fragte sie.
»Dafür war es zu spät.«
»Und die Busse?«
»Die haben wir ausfindig gemacht, aber ohne Ergebnis.«
»Fahrdienste?«
»Auch nichts.«
»Und Taxiunternehmen?«
»Sind alle befragt worden, Taxi Kurir, Taxi Norrköping, Vikbolands Taxi … aber nichts … nein.«
»Und wie kriegen wir ihn?«, fragte sie lächelnd.
»Die Suchmeldung ist schon raus, es wird überregional nach ihm gefahndet. Aber er könnte natürlich auch noch auf dem Krankenhausgelände sein.«
»Das ist doch eher unwahrscheinlich«, sagte Mia und rümpfte die Nase. »Und was ist mit dem Wachmann?«
»Wird immer noch vermisst. Vermutlich hat Danilo Peña ihn entführt.«
Routiniert hob Henrik das Absperrband über seinen Kopf und hielt es hoch, damit Mia durchschlüpfen konnte. Mit schweren Schritten ging er zur Station 11.
Er blinzelte in das helle Scheinwerferlicht, das durch die Türöffnung des Zimmers 38 fiel, und sah die Kriminaltechnikerin Anneli Lindgren auf dem Boden hocken. Ihr weißer Schutzanzug raschelte, als sie sich erhob. Sie nahm den Mundschutz ab und nickte ihm und Mia zu.
Die beiden traten ein und schauten sich um. Hier drinnen herrschte eine ziemliche Hitze, und auf dem Boden war ein knallroter Handabdruck zu sehen.
»Wir haben Spuren von Danilo Peñas Füßen sichern können. Das heißt, er steigt hier aus dem Bett.« Anneli zeigte auf die rechte Seite des Betts. »Dann überfällt er die Krankenschwester und schlägt sie bewusstlos. Sie sackt auf dem Stuhl zusammen. So ist sie auch aufgefunden worden.«
»Und Mattias Bohed, der Krankenpfleger?«, fragte Mia.
»Er lag im Bett.«
»Im Bett?«
Anneli nickte. »Er war nackt«, fügte sie hinzu.
Henrik schob die Hände in die Taschen und wandte den Blick zur Tür.
»Danilo Peña zwingt also den Krankenpfleger, sich auszuziehen und sich ins Bett zu legen, zieht dann Boheds Arbeitskleidung an und verlässt das Zimmer.«
Henrik ging zur Tür und schaute hinaus. Hinter den Glastüren hasteten Krankenhausmitarbeiter entlang und warfen ihm fragende Blicke zu.
Es kam durchaus vor, dass eine Klinik abgesperrt wurde. Im Vrinnevi-Krankenhaus zuletzt vor acht Monaten, als ein Mann in der Innenstadt mit zwei Schüssen ins Bein getroffen worden war. Die Polizei hatte sofort die Notaufnahme sperren lassen, damit das medizinische Fachpersonal in Ruhe arbeiten konnte. Zwei Polizeifahrzeuge mit acht Polizisten hatten die Klinik überwacht, was bei solchen Ereignissen der Standard war.
Aber eine ganze Station abzusperren war ungewöhnlich.
»Peña verlässt also das Zimmer«, sagte Henrik und trat auf den Flur hinaus. »Dann überfällt er den Wachmann und nimmt ihn mit.«
»Vermutlich als Geisel«, sagte Anneli. »Niemand hat die beiden bislang gesehen.«
Henrik sah an die Decke und strich sich übers Kinn.
»Mit Hilfe seiner Geisel schafft er es aus der Station, aber wohl nicht bis zum Haupteingang …«
»Wahrscheinlich ist er über die Feuertreppe geflüchtet, dort drüben.« Anneli zeigte ans Ende des Korridors.
»Zeig sie mir, bitte.«
Sie gingen durch die Station, kamen an mehreren Zimmern vorbei und blieben vor einer Tür stehen.
»Wir haben uns die Fahrstühle noch nicht genauer vornehmen können«, sagte Anneli. »Aber schau mal hier.«
Sie deutete auf den Türrahmen, der blutige Fingerabdrücke aufwies.
»Ich muss wieder zurück«, erklärte sie.
»Alles klar«, sagte Henrik. Er hörte, wie ihre Schritte sich entfernten, während er die Fingerabdrücke betrachtete.
Vorsichtig schob er die Tür auf, ging ein Stockwerk tiefer und blieb vor einer Tür stehen, die er ebenso genau in Augenschein nahm.
Gerade als er sie aufdrücken wollte, entdeckte Henrik einen weiteren blutigen Fingerabdruck.
Sachte schob er die Tür zu Station 9 auf.
Weiter unten im Flur schaute jemand eine Heimwerkersendung im Fernsehen. Musik war zu hören, und ein Moderator, der gerade eine Leiter zu bauen schien. Als Henrik vorbeikam, sah er eine ältere Frau auf einem Sofa sitzen. Sie trug eine geblümte Hose und starrte auf den Fernsehbildschirm.
Er ging an mehreren verschlossenen Zimmern vorbei und stellte fest, dass die Tür zum Lagerraum ganz hinten im Flur einen Spaltbreit offen stand.
Im Hintergrund ertönten Hammerschläge aus dem Fernseher, und er überlegte gerade, wie viele Leute sich außer der Frau in der geblümten Hose wohl in der Nähe befanden, als ein Stöhnen aus dem Lagerraum drang.
Henrik zog seine Waffe und hielt kurz die Luft an. Dann machte er mit der Linken die Tür auf und richtete die Pistole in die Dunkelheit.
»Polizei!«, rief er.
Im nächsten Moment senkte er die Waffe.
Vor ihm im Lagerraum befand sich nicht Danilo Peña, sondern der Wachmann.
Jana Berzelius ignorierte die rote Ampel und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gamla Övägen.
Die ganze Zeit dachte sie an das Gespräch mit Oberarzt Alexander Eliasson und daran, dass Mutter tot war.
Ein unwirkliches Gefühl breitete sich in ihr aus, und sie wunderte sich immer mehr über ihre Reaktion. Mutter war einer der wenigen Menschen gewesen, mit denen sie etwas wie eine Beziehung verband.
Aber hatte sie sie geliebt?
Das vielleicht nicht.
Doch nachdem sie die Nachricht von ihrem Tod erhalten hatte, hätte sie sich am liebsten abreagiert, hätte laut geschrien oder etwas zerstört. Stattdessen war sie in ihrem Büro stehen geblieben, ganz ruhig, als wollte sie dem Schmerz keinen Platz in ihrem Inneren einräumen. Ohne mit jemandem über den Anruf zu sprechen, war sie hinausgegangen, hatte die Frühlingsluft tief eingeatmet und sich ins Auto gesetzt.
Am Vrinnevi-Krankenhaus registrierte sie das große Polizeiaufgebot am Haupteingang, dachte aber nicht weiter darüber nach, als sie die Notaufnahme betrat.
Ein Mann mit Geheimratsecken und hellgrauem Bart streckte seine Hand aus und begrüßte sie freundlich.
»Hallo, ich bin Alexander Eliasson. Wir haben vorhin telefoniert.«
Sie stellte sich vor.
»Was war die Todesursache?«, fragte sie.
»Ihre Mutter ist an einem Herzinfarkt verstorben. Obwohl der Rettungswagen schnell vor Ort war, konnte sie nicht gerettet werden. Wie Sie sicher wissen, ist Herzinfarkt die häufigste Todesursache in Schweden.«
Jana nickte.
»Was meinen Sie, sollen wir … zu ihr gehen?«
Jana nickte erneut.
Sie gingen durch einen langen Korridor. Jana wollte diesen Augenblick so lange wie möglich hinauszögern, aber zugleich das Ganze hinter sich bringen. Sie blieb mehrere Schritte hinter dem Oberarzt, der sich immer wieder zu ihr umdrehte und sie anlächelte. Doch sie wich seinem Blick aus.
»Ich weiß, dieser Moment ist schwierig«, sagte er. »Aber er ist ein wichtiger Teil der Trauerarbeit. Ich habe viele Menschen sagen hören, dass die Begegnung mit dem Verstorbenen eine Art Befreiung bedeutet, eine Erleichterung.«
Sie schwieg.
»In Anbetracht des Todes fühlen, denken und reagieren wir alle verschieden. Insbesondere wenn es um einen nahen Angehörigen geht. Standen Sie sich nahe, Sie und Ihre Mutter?«
Nach diesem erneuten Versuch gab er auf, weil er merkte, dass sie kein Interesse zeigte.
Jana konzentrierte sich auf ihre Schritte, betrachtete die Staubkörner, die durch die Luft wirbelten, und dachte, dass jeder Schritt kleine, kaum spürbare Wellen durch den Körper sandte.
»Haben Sie schon mal einen Toten gesehen?«, fragte der Oberarzt, als sie angekommen waren.
Sie schwieg weiterhin, und er murmelte etwas Unverständliches vor sich hin, während er die Tür zu dem kleinen Raum öffnete. Er ließ sie vorgehen, und sie spürte seinen forschenden Blick. Was erwartete er? Tränen, Betrübnis? Oder wartete er darauf, dass sie panisch wurde, verzweifelte, betete?
Sie sah ihn nicht an, sondern stellte sich mitten ins Zimmer, ohne eine Miene zu verziehen.
Das ganze Zimmer war gelb. PVC-Boden, Wände, Lüftungsanlage. Außerdem ein Tisch und zwei Stühle, ein Bild an der Wand mit einem blauen Himmel über einem Tal. Völlig unpersönlich.
Ein Raum für den Tod.
Margaretha Berzelius lag auf einer Pritsche, man hatte sie mit einem weißen Laken zugedeckt. Neben der Hüfte war eine kleine bleiche Hand zu sehen. Unter der Haut zeichneten sich die Sehnen ab. Die Augen waren geschlossen, das Kinn hing herab.
»Es tut mir aufrichtig leid«, sagte der Oberarzt und zog einen Stuhl heran, aber Jana schüttelte nur den Kopf.
»Sind wir fertig?«, fragte sie.
»Wir haben es nicht eilig«, sagte er. »Lassen Sie sich ruhig Zeit.«
Jana spürte, wie sich ihre Kiefermuskulatur anspannte.
»Danke«, sagte sie. »Aber ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Ich will jetzt gehen.«
Philip Engström schloss die Tür seines Häuschens in Skarphagen auf und trat ein. Er schaltete das Licht an und hielt inne, während die Tür mit einem Knall hinter ihm zuschlug.
Es war still, Lina war also nicht zu Hause. Hatte sie gerade eine Vorlesung? Oder saß sie in der Bibliothek und schrieb an ihrer Abschlussarbeit? Er wusste es nicht mehr.
Langsam atmete er ein, nahm den wohlbekannten Geruch wahr und ließ seine Tasche auf den Boden fallen. Er war nach der Arbeit ins Fitnessstudio zum Gewichtheben gegangen und hatte ein paar Kilometer auf dem Laufband zurückgelegt. Aber es hatte nichts genützt, er fühlte sich kraftlos und war schließlich vom Band gestiegen und nach Hause gefahren.
Er gähnte herzhaft, während er die Schuhe und die Jacke auszog. Dann ging er ins Bad, drückte eine Oxazepam aus dem Blister und schluckte sie mit etwas Wasser. Dann nahm er eine Zopiclon aus der Packung, legte sie weit hinten auf die Zunge, um den bitteren Geschmack nicht zu spüren, und schluckte sie ebenfalls.
Inzwischen hatte er schon seit über zehn Jahren Probleme mit dem Schlafen, aber sein Leben funktionierte, solange er Tabletten nahm. Es war zwar ein chemischer Schlaf, der nicht zu einer tiefen und echten Erholung führte. Aber immerhin konnte er schlafen.
Als er die Hände abtrocknete, fiel ihm auf, dass sich der Ringfinger nackt anfühlte. Er hielt die Hand hoch und stellte fest, dass der Ehering fehlte. Wann hatte er ihn zuletzt gehabt? Im Ruheraum? Im Rettungswagen? In der Umkleide? Auch daran konnte er sich nicht erinnern.
Verdammt!
Er ging ins Schlafzimmer, kroch unter die Decke und schloss die Augen.
Drei Versuche, sich zu entspannen.
Vier, fünf, sechs.
Aber es ging nicht. Er drehte und wendete sich im Bett, strampelte die Decke weg, zog sie schnell wieder hoch und kuschelte sich hinein.
Scheiße!
Das Gespräch mit Sandra hatte nicht gerade zur Entspannung beigetragen. Sie meinte es gut, das wusste er, aber wäre sie nicht mit seiner Frau befreundet, hätte er ihr ewiges Rumgenerve nicht ausgehalten.
Natürlich gab es Dinge, die man mit anderen Menschen diskutieren konnte. Aber in diesem Fall – was gab es da eigentlich zu besprechen? Nichts. Überhaupt nichts.
Weder mit Sandra noch mit Lina.
Ehrlich gesagt gab es nur einen Menschen, mit dem er wirklich reden konnte. Zwar nicht über Gefühle, aber über alles andere. Katarina Vinston, seine Kollegin, die nicht nur ungewöhnlich nett war, sondern auch noch eine geschickte Rettungssanitäterin.
Er und Katarina hatten viel Zeit miteinander verbracht, sie hatten lange Gespräche im Auto geführt, hatten zwischen den Einsätzen miteinander gegessen und trainiert. Und aus ihrer beruflichen Beziehung war eine Art Freundschaft geworden.
Philip langte nach der Hose, die auf dem Boden lag, und obwohl die Tabletten wahrscheinlich jeden Moment wirkten, zog er sein Handy aus der Tasche und rief Katarina über Facetime an. Als sie ranging, bekam er eine Sorgenfalte zwischen den Augen. Die frühere dunkelhaarige Schönheit war verschwunden, geblieben war eine Frau mit blassem Gesicht und eingefallenen Wangen.
»Lange nichts gehört«, sagte er.
»Eine Woche«, erwiderte sie sanft. »Das ist nicht so lange.«
»Du bist hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte, aber ich freu mich trotzdem, dich zu sehen.«
Sie lachte laut.
»Ich nehme an, ich sollte dich fragen, wie es dir geht«, fuhr er fort.
»Besser«, sagte sie.
»Besser oder gesund?«
»Ich komme morgen zu unserer gemeinsamen Frühschicht.«
»Glück für dich.«
Sie lachte wieder, noch lauter diesmal, und Philip sah ein Glitzern in ihren Augen.
»Aber ich wäre gerne noch eine Weile zu Hause geblieben«, fuhr sie fort.
»Warum sagst du das?«
»Das weißt du doch. Ich habe die Arbeit satt. Du etwa nicht?«
»Nein, ich kann ohne Ende arbeiten, solange der Job interessant ist.«
»Und du findest deinen Job so interessant?«
»Ja. Ich kenne die Kollegen, und sie kennen mich. Ich komme gut mit ihnen aus, und sie … na ja …«
»Sie kommen gut mit dir aus?«
»Ja.«
»Und das ist dir wichtig?«
»Was soll ich dazu sagen? Sie brauchen mich eben. Ohne mich würde der ganze Betrieb nicht funktionieren.«
»Und Richard Nilsson?«
»Was ist mit ihm?«
»Ich wurde gefragt, ob ich seine Schicht übernehme, aber ich habe abgelehnt. Ist er auch krank?«
»Keine Ahnung. Vermutlich ist er erkältet, oder er sitzt mit seiner Alten und seinen Kids vor der Glotze. Was weiß ich.«
»Das heißt, du hast seine Schicht übernommen?«, fragte sie.
»Ja, ich steige heute Abend um acht wieder ein.«
»Dann hast du eine Vierundzwanzig-Stunden-Schicht vor dir?«
»Das ist doch nicht verboten.«
Sie sah ihn mit ihren hellblauen Augen lange an, ehe sie sagte: »Ich verstehe nicht, wie du das schaffst.«
»Das ist gar kein Problem für mich«, sagte er, und nun war es an ihm, zu lächeln. Aber offenbar war sein breites Lächeln nicht überzeugend, denn sie schüttelte den Kopf.
»Das ist nie ein Problem für dich, oder?«
»Nein.«
»Aber ich krieg ein Problem mit dir, wenn du jetzt nicht schläfst.«
»Was meinst du damit?«
»Ich meine, dass ich morgen früh um acht mit einem ausgeschlafenen Kollegen zusammenarbeiten will. Insbesondere wenn du heute Abend schon die Nachtschicht machst. Schlaf jetzt.«
»Mir fällt es so schwer einzuschlafen, wenn es draußen hell ist.«
»Versuch es wenigstens.«
»Ja, ja«, sagte er. »Wir sehen uns morgen.«
Und dann war sie weg. Philip legte sich das Handy auf den Bauch. Sein Körper fühlte sich taub an. Er betrachtete die Topfpflanze auf dem Fensterbrett und sah, dass sich die Blätter vor und zurück bewegten. Die Tabletten begannen zu wirken.
Jana Berzelius war dem Tod schon oft begegnet. Aber Mutters bleichen Körper auf der Pritsche im Krankenhaus zu sehen war etwas anderes. Es ging ihr viel zu nah, und darauf war sie nicht vorbereitet gewesen.
Dass Herzinfarkt die häufigste Todesursache in Schweden war, kümmerte sie nicht. Sie dachte nur an die Trauer, die sie empfand, weil Mutter nie mehr zurückkehren würde. Und diese Trauer überraschte sie.
Aber es hatte keinen Sinn, genauer nachzuspüren. Mutter war tot, und es war am besten, ihm gleich Bescheid zu geben. Vater musste es erfahren.
Sie überholte einen kleinen Lastwagen und gleich noch einen Linienbus, der gerade von der Haltebucht auf die Straße fahren wollte. Der Fahrer hupte mehrmals laut.
Als sie vor dem großen weißen Haus in Lindö hielt, waren ihre Hände verschwitzt. Die Schlüssel rasselten, als sie die Haustür öffnete.
Im Flur wurde sie von einem muffigen Geruch empfangen. Sie spürte für einen Moment die Panik in ihrer Brust aufflackern, sie wollte nicht hier sein, der faulige, süßliche Gestank war unerträglich.
Aber sie hatte keine Wahl.
Sie musste es ihm erzählen.
Ihre Handflächen waren noch immer verschwitzt, als sie ihren Mantel aufknöpfte und an den Messinghaken hängte.
Sie sah sich verstohlen um und ging dann zur Küche. Das Haus war dunkel, aber das Sonnenlicht drang durch die Gardinen und wurde an der Decke reflektiert.
Ein seltsames Knacken ertönte von irgendwo dort drinnen.
Sie blieb stehen, lauschte.
Wieder war etwas zu hören. Ein schleifendes dumpfes Geräusch, wie von einem Menschen, der seine Füße über den Boden zog.
Sie betrat die Küche, verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete den Rollstuhl.
Dort saß er.
Elend, grau und alt.
»Hallo, Vater«, sagte sie.
Ermittlungsleiter Gunnar Öhrn öffnete eine Dose Cola und trank so eilig, als hätte er Sorge, dass die Kohlensäure sich verflüchtigen könnte. Henrik und Mia hatten neben ihm an der Fensterwand Platz genommen. Es war Nachmittag geworden und die Kantine ansonsten leer.
»Echt krass, dass wir schon wieder diesen Danilo Peña jagen«, sagte Mia und schlürfte ihren Kaffee.
»Was ist mit diesem Bootshaus, wo du ihn geschnappt hast? Könnte es sein, dass er sich dort versteckt?«, fragte Henrik.
»Eher nicht«, antwortete Mia. »Er ist zwar echt gestört, aber so blöd ist er auch wieder nicht. Arkösund ist wohl der allerletzte Ort, wo er jetzt hinfahren würde.«
Gunnar seufzte. »Aber wie konnte er drei Monate lang im künstlichen Koma liegen und dann plötzlich aufstehen? Offenbar hatte die Klinik keine Ahnung, wie sein Gesundheitszustand war. Warum lag er denn so lange im Koma?«
»Ich habe mit einem der Ärzte gesprochen«, sagte Henrik. »Es gab nach seiner Operation Komplikationen, offenbar ein Anastomosenleck.«
»Was für ein Leck?«, fragte Gunnar.
»Irgendwie war wohl die Stelle undicht, wo sie den Darm zusammengenäht hatten, wenn ich den Arzt richtig verstanden habe«, sagte Henrik. »Man hat Danilo Peña unter anderem Stesolid verabreicht, ein muskelentspannendes und beruhigendes Medikament …«
»Mit dessen Hilfe Mattias Bohed wunderbar eingeschlafen ist«, ergänzte Mia.
»Ja, Stesolid führt zu Schläfrigkeit. Und wenn man eine Spritze in den Brustkorb gibt, riskiert man einen Stich ins Herz oder in die Lungen. Davon kann man sterben, wenn man nicht sofort behandelt wird.«
»Wir können also festhalten, dass Mattias Bohed großes Glück gehabt hat«, sagte Gunnar. »Was hat der Wachmann gesagt?«
»Nichts von Wert«, meinte Henrik.
Anneli Lindgren betrat die Kantine und nickte ihnen mit gehobenen Augenbrauen zu. »Habt ihr eure Sitzung heute in der Kantine?«
»Unser Treffen ist eher informeller Art«, erklärte Henrik.
Sie nahm sich eine Tasse und goss heißes Wasser hinein. Gunnar versuchte, sie zu ignorieren und so zu tun, als hätte nicht eben seine ehemalige Lebensgefährtin den Raum betreten.
»Wie hieß der Wachmann noch mal? Anders Hedberg?«, fragte er.
»Andreas«, korrigierte ihn Henrik.
»Sorry, ich …«
Gunnar nahm drei große Schlucke aus seiner Coladose und wartete, bis Anneli mit ihrer Teetasse wieder die Kantine verlassen hatte.
»So, wo waren wir stehen geblieben?«, fragte er, als ihre Schritte auf dem Flur verklungen waren.
»Der Wachmann heißt Andreas Hedberg und ist vierundvierzig Jahre alt«, berichtete Henrik. »Ziemlich unerfahren, arbeitet erst seit ungefähr einem Jahr als Wachmann.«
»Nach diesem Ereignis wird er vermutlich den Job wechseln«, bemerkte Mia.
»Warum hat man denn einen Grünschnabel wie ihn vor Peñas Tür gesetzt?«, fragte Gunnar. »Hat man ihn überprüft? Er kann nicht mit Peña kooperiert haben, oder?«
»Und zum Dank niedergeschlagen worden sein, meinst du?«, erwiderte Mia.
»Vermutlich nicht«, sagte Henrik. »Aber wir befragen ihn heute Nachmittag.«
»Sollten wir den Namen des Flüchtigen veröffentlichen?«, fragte Gunnar. »Ich nehme an, die Medien haben die Nachricht ohnehin schon aufgeschnappt. Der Haupteingang des Vrinnevi-Krankenhauses lässt sich ja nicht völlig unbemerkt absperren.«
Henrik zog die Augenbrauen zusammen. »Was meinst du?«
»Dass Danilo Peña als gefährlich eingestuft werden muss …«
»Aber wir haben doch schon mal nach ihm gefahndet, im Rahmen der Polizeiaffäre«, sagte Henrik verbissen. »Machen wir uns nicht total lächerlich, wenn wir schon wieder Namen und Bild veröffentlichen?«
»Ja, aber haben wir eine Alternative?«, gab Mia zu bedenken. »Wie lange können wir die Identität von Danilo Peña geheim halten? Wenn während seines sogenannten Freigangs irgendwas passiert, führt das bloß dazu, dass wir jede Menge Ärger kriegen. Haben wir nicht schon genug Stress?«
»Da hast du recht, Mia«, sagte Gunnar und stellte die leere Coladose auf den Tisch. »Aber ich glaube genau wie Henrik, dass wir besser noch eine Weile unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermitteln.«
»Gut«, sagte Henrik. »Wir sollten uns darauf konzentrieren, ihn zu finden, bevor die Medien überhaupt begriffen haben, dass er flüchtig ist. Damit werden wir demonstrieren, dass unsere neue Organisation tatsächlich funktioniert.«
Gunnar grinste. »Na, dann sucht als Erstes heraus, was wir bisher schon alles an Informationen über Danilo Peña haben.«
3
Philip Engström starrte an die Decke und dachte an den seltsamen Traum, den er eben gehabt hatte. Er war in einem Museum gewesen und hatte einen weiß gekleideten Mann angestarrt, der vollkommen reglos in einem Glaskäfig gestanden hatte. Das Unbehagliche daran war, dass der Mann ihm aufs Haar geglichen hatte.
Er blinzelte und betrachtete die Lampe an der Zimmerdecke. Dann streckte er sich und griff nach dem Handy auf dem Nachttisch. Es war fünf Uhr nachmittags. Er hatte eine SMS von Lina bekommen, überflog sie und stand auf.
Langsam zog er einen Pullover an, während er aus dem Schlafzimmer in die Küche ging. Wie immer protestierte die Kühlschranktür, und er musste sie mit beiden Händen öffnen. Sein Blick glitt über die Butter, die Ketchupflasche, das Glas mit den sauren Gurken.
Gerade als er das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Milchpackung las, hörte er Linas Stimme.
»Hallo Liebling, bist du zu Hause?«
Philip brachte es nicht über sich, zu antworten. Er hörte, wie die Haustür geschlossen wurde, trank drei Schlucke Milch und stellte die Packung wieder zurück in den Kühlschrank. Als sie in die Küche kam, stand er reglos und schweigend am Küchentisch.
»Schön, dass du schon wach bist«, sagte sie. »Hast du gut geschlafen?«
»Ja«, murmelte er.
Sie streichelte seinen Arm, gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange und stellte eine weiße Plastiktüte auf den Tisch.
»Ich habe was zu essen mitgebracht. Vom Thailänder.«
»Aha.«
»Rotes Curry.«
»Haben wir was zu feiern, oder wie?«, fragte er müde.
»Nein, ich wollte nur keine Zeit fürs Kochen verschwenden. Ich dachte, wir könnten die Zeit für was anderes nutzen.«
Philip spürte ihre Hand an seinem Arm und sah sie an. Ihre SMS hatte nur aus zwei Worten bestanden: Heute Kuschelabend. Das bedeutete, dass sie im Verlauf des Abends miteinander schlafen würden, ein oder zwei Mal. Nach ihrer Heirat vor drei Jahren hatten sie sich einer langen und gründlichen Kinderwunschdiagnostik unterzogen. Das Ergebnis lautete, dass es keinerlei medizinische Gründe für ihre Kinderlosigkeit gab. Sie bräuchten wohl nur Ruhe und Entspannung.
Noch hatten ihre Bemühungen keine Resultate gezeigt, aber Lina hatte eine Art Stundenplan ausgearbeitet, der auf ihren fruchtbaren Tagen basierte. Drei Tage vor dem Eisprung bis ein oder zwei Tage danach waren die Chancen am größten, schwanger zu werden.
Heute waren es drei Tage bis zum Eisprung, also würden sie Sex nach Plan haben. Und nicht, weil sie Lust hatten. So sah ihr Leben gerade aus.
»Wir müssen«, sagte sie.
»Das weiß ich doch.«
Dabei wollte er nicht an Abläufe und Stundenpläne denken, insbesondere nicht jetzt. Er hoffte, dass ihn das steife Lächeln auf seinen Lippen nicht verraten würde, aber vergeblich.
»Willst du nicht?«, fragte Lina.
»Doch.«
»Sicher?«
»Ja!«, sagte er, viel lauter als beabsichtigt.
Sie zuckte zusammen, sah ihn aber nicht an, sondern starrte in die Plastiktüte, auf die Aluboxen mit dem dampfenden Essen.
»Du …«, sagte er. »Tut mir leid.«
»Schon gut.« Sie zuckte enttäuscht mit den Achseln und nahm eine Alubox heraus.
Er verfolgte ihre Bewegungen. Plötzlich wurde ihm schwindlig, und er schloss für einen Moment die Augen, als er ihre Hände doppelt sah. Sobald er die Augen wieder aufschlug, bemerkte er ihren besorgten Blick.
»Vielleicht ist es am besten, wenn wir erst mal was essen«, sagte sie knapp und holte die andere Box aus der Tüte.
»Aber du …«, begann er.
Lina schüttelte den Kopf so heftig, dass ihr das hellbraune Haar ins Gesicht fiel. Er ging zu ihr, hob ihr Kinn und küsste sie auf den Mund, nur kurz. Dann ließ er seine Hand über ihre Wange und in ihren Nacken gleiten. Er sah sie mit einem Lächeln in den Augen an und wusste, dass es nur einen Weg gab, sie zufriedenzustellen.
Er presste seine Lippen auf ihre, und diesmal erwiderte sie den Kuss. Seine Hände glitten unter ihren Pullover, über ihre weichen Brüste, zu ihrem Slip.
Sie konnten ebenso gut hier miteinander Sex haben, auf dem Tisch, an der Wand oder auf dem Küchenfußboden. Es war ihm egal, und er wusste, dass es auch ihr egal war. Hauptsache, sie taten es.
Jetzt spürte er ihre eifrigen Hände, die an seinem Pullover zogen. Ihre Atmung wurde schneller. Er drückte sie an die Wand, merkte, wie ihr Körper erbebte, und küsste sie erneut.
»Komm«, sagte er und reichte ihr die Hand.
»Wollen wir denn nicht essen?«, erwiderte sie und nahm seine Hand.
»Doch, aber wir fangen mit dem Dessert an.«
Jana Berzelius stand in der Villa in Lindö und beobachtete ihren Vater und seine Pflegerin in der Küche. Vater hielt unbeholfen eine Gabel und führte sie konzentriert zu seinem Mund. Doch die Hand schien ein Eigenleben zu führen, denn das Essen landete auf der Wange und am Kinn.
Mutter hatte zwar erzählt, dass die Mahlzeiten lange dauerten und dass Vater in letzter Zeit begonnen hatte, wieder selbst zu essen, aber Jana hätte sich niemals vorstellen können, dass er wie ein kleines Kind aß, mit einem Lätzchen und Speiseresten um den Mund.
Wieder fiel ihm etwas Essen herunter. Er senkte die Gabel, um sich etwas aufzuladen, aber die Pflegerin nahm ihm lächelnd das Besteck aus der Hand und tat eine kleine Portion Kartoffelpüree auf die Gabel.
»Öffnen Sie den Mund«, sagte sie sanft.
Doch er weigerte sich, wandte den Kopf ab und kniff die Lippen zusammen wie ein trotziges Kind. Die Pflegerin hielt die Gabel mit dem Kartoffelbrei an seinen Mund.
»So, jetzt öffnen Sie den Mund, bitte.«
Jana hatte keine Lust zuzuschauen, wie er mit dem Essen kämpfte. Lautlos verließ sie die Küche und ging die Treppe hinauf, durch den Flur und schob die Tür zum Arbeitszimmer ihres Vaters auf. Sie ließ ihren Blick über die Regale, den Schreibtisch und die Gemälde an der Wand schweifen.
In diesem Zimmer war es passiert.
Sie hatte versucht, es zu verhindern. Sie hatte versucht, ihn davon abzuhalten, sich mit einer Pistole zu erschießen. Die Kugel hatte die linke Gehirnhälfte geschädigt, sodass er nicht mehr gehen und sich auch ansonsten nicht richtig bewegen konnte.
Sie umrundete den Schreibtisch, betrachtete das Papierchaos und dachte, dass nichts mehr so war wie früher. Die strikte Ordnung, die in all den Jahren immer Vaters Kennzeichen gewesen war, gab es nicht mehr.
Sie blätterte die Rechnungen durch, Wasser, Strom, Müllabfuhr. Alles wild durcheinander.
Jana begann, die Unterlagen ordentlich aufzustapeln, als sie hinter sich ein Räuspern hörte. Sie blickte auf und sah die Pflegerin in der Türöffnung stehen.
»Ja?«, sagte Jana irritiert, weil die Frau sie neugierig musterte.
»Sie sind Jana Berzelius, die Tochter, nicht wahr?«, sagte sie. »Ich konnte mich in der Küche nicht richtig vorstellen. Mein Name ist Elin Ronander.«
»Ich wollte nicht beim Essen stören«, erklärte Jana.
»Und mir tut es leid, Sie jetzt stören zu müssen«, erwiderte Elin Ronander, »aber ich wollte nur fragen, wo Ihre Mutter ist.«
Jana seufzte.
»Tut mir leid, dass ich frage«, sagte die Pflegerin. »Aber sie hinterlässt sonst immer einen Zettel auf dem Küchentisch, wenn sie weggeht, und als wir am Vormittag zurückgekommen sind, lag dort kein Zettel. Ich habe sie angerufen, aber …«
»Wo sind Sie gewesen?«
»Wir waren in Örebro, im Rehazentrum. Ihr Vater ist ab und zu dort.«
Jana sah sie an. »Wie lange sind Sie schon hier tätig?«
»Seit Ihr Vater aus dem Krankenhaus zurück ist. Ihre Mutter hat mich angestellt.«
»Das heißt, Sie kennen ihn?«
»Ich pflege ihn«, sagte sie. »Aber ich kenne ihn nicht näher.«
»Gut, denn ich hätte gern ein objektives Urteil. Ich möchte ganz genau wissen, wie es ihm geht und was weiter mit ihm geschehen wird.«
Mehrere Falten bildeten sich auf Elin Ronanders Stirn, während sie die Brille abnahm und sie mit ihrem Strickpullover putzte.
»Er hat in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht«, sagte sie schließlich.
»Wie sieht seine Zukunft aus?«
»Diese Frage kann ich nicht beantworten.«
Jana ergriff den Papierstapel und schlug ihn zweimal gegen den Schreibtisch.
»Wird er gesundheitlich ganz wiederhergestellt sein?«
Elin Ronander seufzte und setzte die Brille wieder auf.
»Die Reha ist ein langer und mühseliger Prozess für ihn, aber ich bemerke deutliche Verbesserungen. Noch vor einer Woche konnte er sich nicht ohne Hilfe aus dem Rollstuhl erheben. Heute früh konnte er sogar einige Schritte ganz allein gehen.«
»Die Antwort lautet also Ja?«
»Wissen Sie, es ist wirklich schwer, darüber eine Aussage zu treffen, aber wenn alles nach Plan läuft, kann er bald Spaziergänge im Garten machen.«
»Und die Sprachfähigkeit?«
»Die muss natürlich regelmäßig trainiert werden. Jeden Tag.«
»Ich kann nicht so oft hierherkommen.«
Jana nahm den Papierstapel, ging um den Schreibtisch herum und an Elin Ronander vorbei.
»Aber die Stimulation ist wichtig, damit er wieder sprechen lernt«, sagte die Pflegerin. »Und es ist wichtig, dass die Angehörigen sich möglichst viel einbringen.«
»Ich habe wie gesagt nicht so viele Möglichkeiten«, erklärte Jana.
»Dann wird Ihre Mutter viel zu tun haben. Ich habe nur einen Vertrag für weitere zwei Monate.«
Jana blieb stehen, mit dem Rücken zu Elin Ronander.
»Ich sorge dafür, dass Ihr Vertrag verlängert wird, wenn Sie die volle Verantwortung für den Rehaprozess übernehmen. Klingt das gut?« Sie drehte sich zur Pflegerin um.
Elin Ronander nickte.
»Okay«, sagte Jana. »Und da ist noch was.«
»Ja?«
»Richten Sie meinem Vater bitte aus, dass seine Frau tot ist.«
Anneli Lindgren stand im Treppenhaus. Es fühlte sich seltsam an, wie eine Fremde an die eigene Wohnungstür zu klopfen. Sie öffnete ihre Jacke und strich mit der Hand über ihre Bluse, als wollte sie die Falten glätten, die sich im Lauf des Tages gebildet hatten.
Gunnar öffnete, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Wieder einmal.
»Die Sachen sind im Schlafzimmer«, sagte er und ging in die Küche zurück.
Sie nahm Bratgeruch wahr und sah eine leere Pfanne auf dem Herd stehen. Auf dem Küchentisch stand neben zwei Tellern mit Essensresten ein Glas Preiselbeeren.
»Schaltest du nicht die Dunstabzugshaube ein?«
»Es sind sechs Kisten«, sagte er und schraubte den Deckel aufs Preiselbeerglas. »Direkt neben der Tür.«
»Weiß Adam, dass ich hier bin?«
»Adam!«, rief Gunnar sehr laut.
»Jetzt weiß er es«, sagte Anneli und lächelte, um die angespannte Stimmung aufzulockern. Aber Gunnar schwieg, ohne eine Miene zu verziehen. Sie spürte, dass sie rote Wangen bekam.
»Dann trage ich mal die Kisten raus«, sagte sie.
»Tu das.«
Auf dem Weg zum Schlafzimmer fiel ihr auf, dass es in der Wohnung ziemlich unordentlich war. Im Bad tropfte der Wasserhahn. Im Wohnzimmer lag die Fernbedienung auf dem Boden, daneben die Batterien.
Die Kisten standen in zwei Stapeln neben dem Kleiderschrank. Die erste wog fast gar nichts. Vermutlich enthielt sie nur Kleidung. Die zweite war umso schwerer, und Anneli war ganz außer Atem, nachdem sie den Karton zum Auto geschleppt hatte.
Eigentlich interessierten sie die Kisten gar nicht. Der Inhalt war für sie fremd und bedeutungslos geworden.
Anneli hielt inne und holte tief Luft, ließ die Hand auf der kalten Autoscheibe ruhen, schloss die Augen und spürte, wie sich die Kälte in ihren Fingern ausbreitete.
Sie meinte eine innere Stimme zu hören, die rief: Es ist deine Schuld! Es ist alles nur deine Schuld!
Das stimmte ja auch.
Es war ihre eigene verdammte Schuld, dass sie aus der Wohnung ausziehen musste, die sie sich vor einem knappen halben Jahr zusammen gekauft hatten.
Sie hatte gedacht, es wäre einfach, eine neue Wohnung zu finden, aber der Immobilienmarkt hatte sich verändert. Es gab nur wenige Eigentumswohnungen, und bei den Mietwohnungen sah es nicht viel besser aus.
Sie hatte nicht gerade davon geträumt, ihre Mutter fragen zu müssen, ob sie vorübergehend bei ihr einziehen dürfe. Das hatte sie zwar schon ein paarmal getan, aber da war sie Anfang zwanzig gewesen.
Jetzt war sie vierundfünfzig.
Als sie die letzte Kiste ins Auto geladen hatte und ins Haus zurückging, wartete Adam im Wohnungsflur auf sie.
In seinem Gesicht blühte die Akne, und seine Haare waren so gescheitelt, dass sie sein rechtes Auge bedeckten. Die weißen Kopfhörer hingen ihm um den Hals, und in der Hand hielt er sein Smartphone.
»Bist du fertig?«, fragte Anneli.
»Yes«, sagte er müde und ging an ihr vorbei nach unten.
»Tschüs!«, rief sie in die Wohnung hinein, doch niemand antwortete.
Sie ging zwei Treppenstufen hinunter und blieb stehen. Vielleicht sollte sie Gunnar erklären, dass es nicht ganz fair sei, denn die Wohnung gehörte auch ihr, und sie hatte ebenso ein Recht darauf, dort zu wohnen. Am liebsten hätte sie noch einmal von vorn angefangen, den Seitensprung vergessen und weitergemacht wie vorher.
»Mama?«
Adams Worte hallten durchs Treppenhaus. Er stand ein paar Stufen unter ihr, hatte einen Kopfhörer aus dem Ohr genommen und sah sie fragend an.
»Kommst du?«
»Ich komme.«
Sie seufzte, warf einen letzten Blick auf das, was offenbar nicht mehr ihre Wohnungstür war, und ging die Treppe hinunter.
Jana Berzelius überquerte die Straße und lief durch die kleinen Gassen des Stadtteils Knäppingsborg. In den Schaufenstern lagen mit Zweigen und Blattranken dekorierte Handtücher, Kissen und Töpfe in verschiedenen blauen und grünen Farbtönen.
Als sie in ihre Wohnung kam, legte sie ihren Mantel ab, nahm ihr Handy und ging ins Schlafzimmer. Sie sah, dass Per Åström ihr auf die Mailbox gesprochen hatte, doch sie hörte seine Nachricht nicht ab. Er wollte bestimmt nur wissen, warum sie das Büro heute so überstürzt verlassen hatte. Sie hatte keine Lust, sich ihm gegenüber zu rechtfertigen, Mutters Tod war eine private Angelegenheit.
Sie warf das Handy aufs Bett, zog sich bis auf die Unterwäsche aus und schlüpfte in ihren Morgenmantel.