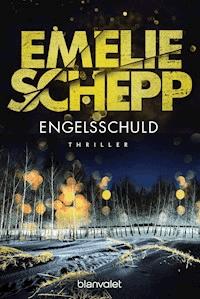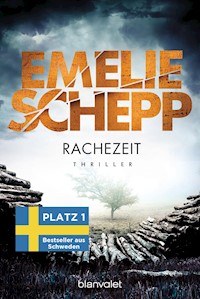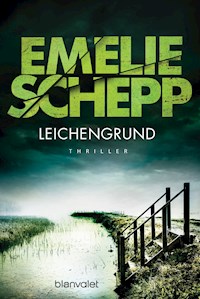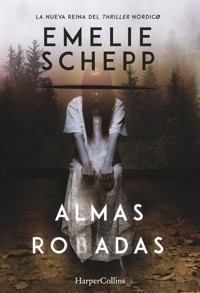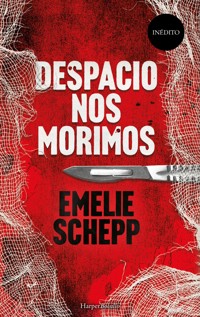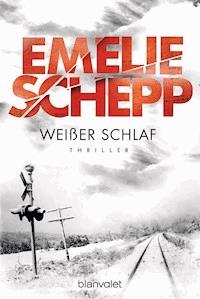
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jana Berzelius
- Sprache: Deutsch
Ich kenne deine Vergangenheit. Und ich kann dein Leben zerstören …
Eine eisige Winternacht am Bahnhof Norrköping in Schweden. In einem Zugabteil liegt eine junge Frau – sie ist tot, ihre Finger sind blutig, aus ihrem Mund tropft weißer Schaum. Sie war nicht alleine unterwegs, doch ihre Begleiterin ist verschwunden. Wer sind die Frauen, und warum musste eine von ihnen sterben? Staatsanwältin Jana Berzelius wird mit den Untersuchungen beauftragt. Doch der ohnehin komplizierte Fall erweist sich als persönlicher, als Jana lieb ist – denn er führt mitten in ihre grausame Vergangenheit zurück. Danilo, mit dem Jana ihr Schicksal teilt, ist einer der Mordverdächtigen – und er weiß viel über Jana. Zu viel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Eine eisige Winternacht am Bahnhof Norrköping in Schweden. In einem Zugabteil liegt eine junge Frau – sie ist tot, ihre Finger sind blutig, aus ihrem Mund tropft weißer Schaum. Sie war nicht allein unterwegs, doch ihre Begleiterin ist verschwunden. Wer sind die Frauen, und warum musste eine von ihnen sterben?
Staatsanwältin Jana Berzelius wird mit den Untersuchungen beauftragt. Doch der ohnehin komplizierte Fall erweist sich als persönlicher, als Jana lieb ist – denn er führt mitten in ihre grausame Vergangenheit zurück. Danilo, mit dem Jana ihr Schicksal teilt, ist einer der Mordverdächtigen – und er weiß viel über Jana. Zu viel …
Autor
Emelie Schepp, geboren 1979, wuchs im schwedischen Motala auf. Sie arbeitete als Projektleiterin in der Werbung, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Nach einem preisgekrönten Theaterstück und zwei Drehbüchern verfasste sie ihren ersten Roman: Der zuerst nur im Selbstverlag erschienene Thriller »Nebelkind« wurde in Schweden ein Bestsellerphänomen und als Übersetzung in zahlreiche Länder verkauft.
Von Emelie Schepp bei Blanvalet bereits erschienen:
Nebelkind
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Emelie Schepp
Weißer Schlaf
Roman
Aus dem Schwedischenvon Annika Krummacher
Für Mama
Schweigend saß das Mädchen mit ihren Eltern beim Frühstück und starrte in das Schälchen mit Joghurt und Erdbeerstückchen. Sie hörte, wie das Besteck gegen das Geschirr schlug.
»Iss jetzt.«
Mutter sah sie auffordernd an, aber das Mädchen rührte sich nicht.
»Hast du wieder schlecht geträumt?«
Das Mädchen schluckte, aber wagte nicht, den Blick vom Schälchen zu heben.
»Ja«, flüsterte sie kaum hörbar.
»Was hast du denn diesmal geträumt?«, fragte Mutter, während sie eine Scheibe Brot auseinanderschnitt und Marmelade darauf strich.
»Da war ein Container«, sagte sie. »Er war …«
»Nein!«, erklang die Stimme des Vaters vom anderen Ende des Tisches. Sie war hart und kalt wie Eis. Er hatte die Hand zur Faust geballt und sah das Mädchen mit einem Blick an, der genauso kalt und hart war wie seine Stimme.
»Jetzt reicht es!« Er erhob sich, zog sie vom Stuhl hoch und schob sie aus der Küche. »Wir wollen nichts mehr von deinen Fantasien hören.«
Das Mädchen stolperte vorwärts und bemühte sich, auf den Treppenstufen nach oben mit ihm Schritt zu halten. Ihr Arm und ihre Füße schmerzten. Als er ihren Nacken packte, versuchte sie sich aus seinem harten Griff zu winden.
Plötzlich ließ er sie los, als hätte ihn irgendetwas gestochen, und betrachtete sie angewidert.
»Du musst immer deinen Nacken bedecken, Kind. Immer!«
Er legte die Hände auf ihre Schultern und drehte sie um, sodass sie mit dem Rücken zu ihm stand.
»Wo ist das Pflaster geblieben?«
Sie spürte, wie er ihre Haare beiseiteschob und immer heftiger daran zerrte, um ihren Nacken zu entblößen. Sie hörte seine hastigen Atemzüge, als er die Hautritzung entdeckte. Er wich zurück und starrte sie entsetzt an.
Da begriff sie.
Er hatte die Hautritzung gesehen.
Das Pflaster im Nacken war abgegangen.
1
Da! Das Auto bog um die Ecke.
Nervös lächelte Pim ihre Freundin Noi an. Sie standen in einer Gasse, die im Schatten lag und vom Licht der Straßenlaternen nicht erreicht wurde. Es stank intensiv nach Urin, und das Bellen der Straßenhunde ging im Lärm von der Autobahn unter.
Pims Stirn war schweißnass – nicht wegen der Hitze, sondern weil sie so nervös war. Ihr dunkles Haar klebte im Nacken, und der dünne Stoff des T-Shirts schlug am Rücken Falten. Sie wusste nicht, was sie erwartete, und hatte auch wenig Zeit zum Nachdenken gehabt.
Alles war so schnell gegangen. Vor nur zwei Tagen hatte sie sich entschieden. Noi hatte gelacht und gesagt, der Job sei ganz einfach und gut bezahlt. In fünf Tagen seien sie wieder zu Hause.
Pim strich sich über die Stirn, wischte sich die feuchte Hand an der Jeans ab und beobachtete das Auto, das immer näher kam. Sie lächelte wieder, als wollte sie sich überzeugen, dass alles gut gehen würde.
Denn es wäre ja nur dies eine Mal.
Und dann nie wieder.
Sie umfasste den Griff ihres Koffers und hob ihn hoch. Ihr war gesagt worden, sie solle eine Tasche für fünf Tage packen, damit die erfundene Urlaubsreise glaubwürdiger erschien.
Sie warf Noi einen Blick zu, richtete sich auf und schob ihre Schultern nach hinten.
Das Auto bremste ab und hielt vor ihnen. Eine getönte Scheibe wurde heruntergefahren und gab den Blick auf einen Mann mit kurz geschorenem Haar frei.
»Steigt ein«, sagte er knapp, ohne die Augen von der Straße zu nehmen.
Pim umrundete den Wagen. Sie hielt inne, schloss einen Moment die Augen und atmete tief durch. Dann öffnete sie die Autotür und stieg ein.
Staatsanwältin Jana Berzelius trank einen Schluck Wasser, ehe sie sich dem Papierstapel zuwandte, der vor ihr auf dem Tisch lag. Es war zehn Uhr abends. Das Pub The Bishop Arms in Norrköping war gut gefüllt.
Noch vor einer halben Stunde war sie in Gesellschaft ihres Vorgesetzten gewesen, des leitenden Staatsanwalts Torsten Granath. Nach einem langen und erfolgreichen Arbeitstag vor Gericht hatte er die gute Idee gehabt, sie zum Abendessen ins Elite Grand Hotel einzuladen.
Zwei Stunden lang hatte er ihr ununterbrochen von seinem Hund erzählt, den er aufgrund von Magenproblemen hatte einschläfern lassen. Jana interessierte sich eigentlich nicht besonders für das Tier, aber sie hatte sich dennoch die Fotos auf Torstens Handy angesehen, die den mittlerweile verstorbenen Hund als Welpen zeigten. Dabei hatte sie genickt, den Kopf schief gelegt und sich um eine gewisse Anteilnahme bemüht.
Damit die Zeit schneller verging, hatte sie die anderen Gäste beobachtet. Vom Fenstertisch, an dem sie saßen, hatte sie den Eingangsbereich perfekt im Blick. Niemand hatte das Lokal betreten oder verlassen, ohne dass sie es mitbekam. Während Torstens Vortrag hatte sie zwölf Personen gezählt: drei ausländische Geschäftsleute, zwei Frauen mittleren Alters, die sich lautstark unterhielten, eine vierköpfige Familie, zwei ältere Herren und ein Teenager mit einem auffälligen Lockenkopf.
Nach dem Abendessen waren sie ins benachbarte The Bishop Arms weitergezogen. In dem Lokal mit seinem klassischen britischen Stil fühlte sich Torsten an seine Golfreisen in die Grafschaft Kent erinnert, und er bestand darauf, stets am selben Tisch zu sitzen. Jana fühlte sich in dem Lokal eher unwohl, und erleichtert hatte sie ihrem Chef die Hand geschüttelt, als er sich auf den Nachhauseweg machte.
Dennoch war sie sitzen geblieben.
Sie steckte die Unterlagen in ihre Aktentasche, trank das restliche Wasser aus und wollte gerade aufstehen, als ein Mann das Lokal betrat. Vielleicht war es sein nervöser Gang, der ihr auffiel. Sie folgte ihm mit dem Blick, während er zur Bar eilte. Er winkte den Barkeeper zu sich und bestellte sich etwas zu trinken. Dann setzte er sich an einen Tisch und stellte eine abgenutzte Sporttasche auf seine Knie.
Sein Gesicht war halb hinter einer Mütze versteckt, aber Jana schätzte ihn auf Mitte dreißig. Er trug eine Lederjacke, dunkle Jeans und schwarze Stiefel. Angespannt sah er durchs Fenster, dann zum Eingang und erneut aus dem Fenster.
Ohne den Kopf zu drehen, hob Jana ihren Blick und schaute ebenfalls aus dem Fenster. Draußen waren die Konturen der Saltängsbrücke zu sehen. In den kahlen Bäumen der Hamngatan hing die Weihnachtsbeleuchtung und schaukelte sanft im Wind. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses wünschte eine blinkende Werbung allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Sie schauderte beim Gedanken, dass es nur wenige Wochen bis Weihnachten waren, denn sie freute sich nicht darauf, wieder die Feiertage bei ihren Eltern zu verbringen. Zumal ihr Vater, der frühere Reichsstaatsanwalt Karl Berzelius, ihr aus unerklärlichen Gründen aus dem Weg ging, als wäre er an einem Kontakt mit seiner Tochter nicht mehr interessiert.
Sie hatten sich seit dem Frühjahr nicht mehr gesehen, und als Jana mit ihrer Mutter Margaretha über sein merkwürdiges Verhalten sprach, hatte diese keine konkrete Erklärung parat gehabt.
»Er hat sehr viel zu tun«, hatte sie nur gesagt.
Und da Jana nicht mehr Zeit als nötig auf diese Angelegenheit verschwenden wollte, hatte sie es einfach auf sich beruhen lassen. Im vergangenen halben Jahr hatte es daher keine Familienzusammenkünfte gegeben. Aber zu Weihnachten musste man sich einfach sehen, da war ein Zusammentreffen unumgänglich.
Sie seufzte schwer und richtete ihren Blick wieder auf den Mann, dem gerade ein hellgelber Drink an den Tisch gebracht wurde. Als er die Hand ausstreckte, um das Glas in Empfang zu nehmen, bemerkte sie einen großen, dunklen Leberfleck an seinem linken Handgelenk. Er hielt das Glas an seine Lippen und sah erneut aus dem Fenster.
Wahrscheinlich wartet er auf jemanden, dachte Jana und blickte auf ihre Armbanduhr. Es war Zeit, nach Hause zu gehen.
Sie erhob sich vom Tisch, knöpfte sich langsam die Winterjacke zu und wickelte sich ihren Seidenschal der Marke Louis Vuitton um den Hals. Dann setzte sie die dunkelrote Mütze auf und griff nach ihrer Aktentasche.
Auf dem Weg nach draußen sah sie den Mann telefonieren. Er murmelte etwas Unverständliches in sein Handy und leerte sein Getränk, bevor er sich rasch erhob und an ihr vorbei zum Ausgang ging.
Sie folgte ihm durch die Tür und trat auf die Straße, wo ihr kalte Winterluft entgegenschlug. Es war sternenklar und beinahe windstill. Der Mann war schnell außer Sichtweite. Jana zog ihre gefütterten Handschuhe an und machte sich auf zu ihrer Wohnung in Knäppingsborg.
Kurz bevor sie zu Hause war, entdeckte sie wieder den Mann aus dem Pub. Er stand in einer schmalen Gasse und drückte sich an die Wand. Dieses Mal war er nicht allein.
Vor ihm stand ein anderer Mann.
Mit Kapuze und den Händen in den Taschen.
Sie blieb abrupt stehen und versuchte, sich hinter einem Hausvorsprung unsichtbar zu machen. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, und sie redete sich ein, dass sie sich geirrt haben musste. Dass der Mann mit der Kapuze gar nicht der war, für den sie ihn gehalten hatte.
Als sie erneut sein Profil musterte, lief es ihr kalt den Rücken hinunter.
Sie wusste, wer er war.
Sie kannte seinen Namen.
Danilo!
Kriminalkommissar Henrik Levin schaltete den Fernseher aus und starrte an die Zimmerdecke. Es war kurz nach zehn und dunkel im Schlafzimmer.
Er horchte auf die Geräusche im Haus. Die Spülmaschine lief, von der Treppe war ein Knacken zu hören, und bisweilen erklang ein dumpfes Geräusch aus Felix’ Zimmer. Henrik wusste, dass sein Sohn sich häufig im Schlaf bewegte. Seine Tochter Vilma hingegen schlief wie immer mucksmäuschenstill im Nachbarzimmer.
Er legte sich auf die Seite, zog sich die Decke über den Kopf und schloss die Augen, doch schon bald war ihm klar, dass ihm das Einschlafen schwerfallen würde. Seine Gedanken fuhren mal wieder Karussell.
Schon bald würde er nachts nicht mehr viel schlafen. Stattdessen standen bis frühmorgens Füttern, Beruhigen und Baby-in-den-Schlaf-Wiegen auf dem Plan. Es waren noch etwa drei Wochen bis zum errechneten Entbindungstermin.
Er zog die Bettdecke wieder beiseite und betrachtete Emma, die neben ihm mit offenem Mund auf dem Rücken lag und schlief. Ihr Bauch war groß, aber er hatte keine Ahnung, ob er größer war als bei den früheren Schwangerschaften. Das Einzige, was er wusste, war, dass er Vater werden würde – zum dritten Mal.
Er drehte sich ebenfalls auf den Rücken, legte die Hände auf die Decke und schloss die Augen. Ihm war elend zumute, und er fragte sich, ob er sich wohl anders fühlen würde, wenn er das Kind erst einmal im Arm hielt. Er hoffte es, denn bisher hatte er von der Schwangerschaft kaum etwas mitbekommen. Er hatte keine Zeit gehabt, sondern war mit den Gedanken ganz woanders gewesen. Bei der Arbeit zum Beispiel.
Die Reichskripo hatte sich gemeldet.
Man wollte über die Ermittlungen vom vergangenen Frühjahr im Mordfall Hans Juhlén reden, einem Abteilungsleiter im Amt für Migration in Norrköping. Ein alter Fall, mit dem Henrik längst abgeschlossen hatte.
Anfangs ein Mord an einem hohen Bediensteten, hatte dieses Verbrechen im Verlauf immer weitere Kreise gezogen: Illegale Flüchtlingstransporte hatten das Ermittlerteam zu einem Drogensyndikat geführt, das unter anderem Kinder zu Soldaten ausbildete, zu kaltblütigen Mördern. Der Fall hatte die Nachrichten wochenlang dominiert.
Und morgen sollte alles noch einmal neu aufgerollt werden.
Die Reichskripo würde Fragen stellen – zu den Flüchtlingskindern, die in Containern per Schiff aus Südamerika eingeschleust worden waren. Und zum Chef des ganzen Unternehmens, Gavril Bolanaki, der bei der Auflösung des Falls ums Leben gekommen war.
Dabei war der Mordfall doch längst abgeschlossen.
Henrik öffnete die Augen und starrte seufzend in die Dunkelheit. Er blickte auf den Wecker, der Viertel nach zehn anzeigte, und wusste, dass die Spülmaschine gleich mit einem Piepston das Ende des Waschgangs verkünden würde.
Nach genau drei Minuten piepste sie.
Ihr Herz pochte laut, und das Blut pulsierte schneller.
Jana Berzelius bemühte sich, so leise wie möglich zu atmen.
Danilo.
Eine Welle widersprüchlicher Gefühle überrollte sie: Überraschung, Erstaunen und Irritation.
Es hatte eine Zeit gegeben, als Danilo und sie wie Geschwister gewesen waren und den Alltag geteilt hatten. Doch das lag weit zurück, in ihrer Kindheit. Nun teilten sie nur noch dieselbe blutige Vergangenheit, sonst nichts. Er trug eine Hautritzung im Nacken, und auch sie hatte eine, die sie ständig an ihre dunkle Kindheit erinnerte. Danilo war der Einzige, der wusste, woher Jana kam und warum sie so war, wie sie war.
Im Frühjahr hatte sie Danilo aufgesucht und ihn um Hilfe gebeten wegen der Container mit den Flüchtlingskindern vor Arkösund. Er hatte sich hilfsbereit gezeigt, war wohlwollend gewesen, aber letztlich hatte er sie verraten. Sein Versuch, sie zu töten, war misslungen, anschließend war er abgetaucht.
Seitdem hatte sie nach ihm gesucht, aber er war wie vom Erdboden verschluckt. Kein Lebenszeichen. Nichts. Ihr Frust und ihre Rachegefühle hatten sich verstärkt und waren schließlich so intensiv geworden, dass sie Tagträume hatte, in denen sie sich vorstellte, wie sie ihn am besten töten könnte.
Auf einem weißen Blatt Papier hatte sie eine Bleistiftskizze von seinem Gesicht angefertigt und zu Hause an die Pinnwand gehängt, als wollte sie sich stets an den Hass erinnern, den sie für ihn empfand. Dabei würde sie dieses Gefühl bestimmt nie vergessen.
Am Ende hatte sie ihre Suche aufgegeben und war in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie hatte geglaubt, dass sie ihn nie finden würde.
Dass er für immer verschwunden war.
Bis jetzt.
Nun stand er etwa zwanzig Meter von ihr entfernt.
Jana unterdrückte den Impuls, sich auf ihn zu stürzen, und bemühte sich, rational zu denken.
Sie hielt den Atem an, um die Stimmen der beiden Männer zu hören, doch sie waren zu weit weg.
Danilo zündete sich eine Zigarette an.
Die abgenutzte Sporttasche lag auf dem Boden, und der Mann mit dem Leberfleck hockte sich hin. Er öffnete den Reißverschluss und zeigte den Inhalt vor. Danilo nickte und machte eine Geste, woraufhin die beiden eilig weitergingen, hinunter in den Strömpark.
Jana biss die Zähne zusammen. Was sollte sie tun? Sollte sie sich einfach umdrehen und nach Hause gehen? So tun, als ob sie ihn nicht gesehen hätte? Ihn davonkommen lassen? Ihm erlauben, dass er wieder einmal aus ihrem Leben verschwand?
Sie zählte leise bis zehn, dann trat sie aus ihrem Versteck und folgte ihm.
Kriminalobermeisterin Mia Bolander schlug die Augen auf und legte sofort die Hand auf die Stirn. Noch immer drehte sich alles.
Sie stand auf, stellte sich nackt auf den Boden und betrachtete den Mann, dessen Namen sie vergessen hatte. Er lag auf dem Bauch und hatte die Hände unters Kopfkissen gesteckt.
Er war ziemlich seltsam gewesen. Zwanzig Minuten lang war er im Zimmer auf und ab gegangen und hatte behauptet, er sei ein fieser Kerl, der sie gar nicht verdiene. Sie hatte immer wieder geantwortet, dass er sie natürlich verdiene. Am Ende hatte sie versucht, ihn zu überreden, sich zu ihr ins Bett zu legen.
Als er dann schüchtern gefragt hatte, ob er ihre Füße massieren dürfe, war sie zu erschöpft gewesen, um abzulehnen. Doch in dem Moment, als er sich ihre große Zehe in den Mund gesteckt hatte, reichte es ihr, und sie hatte gefragt, ob sie nicht auch irgendwann mal vögeln sollten. Er hatte den Wink verstanden und sich ausgezogen.
Laut gestöhnt hatte er auch, sie am Hals geleckt und Knutschflecken hinterlassen.
Dieser Idiot.
Mia kratzte sich unter der rechten Brust und sah auf den Kleiderhaufen am Boden. Rasch zog sie sich an, ohne sich darum zu kümmern, dass sie Lärm machte. Sie wollte einfach nur nach Hause.
Der Kneipenbesuch am Vorabend hatte nicht gerade lang gedauert. Im Harrys hatte eine Karaokeveranstaltung zum Thema Weihnachten stattgefunden, und in dem Lokal drängten sich die Leute in glitzernden Anzügen und Kleidern. Manche trugen Wichtelmützen und hatten sich vermutlich schon vorher auf irgendeiner Weihnachtsfeier in Norrköping volllaufen lassen.
Der Mann, dessen Name ihr nicht mehr einfiel, hatte an der Bar gestanden, mit einem Bier in der Hand. Er war Anfang, Mitte Vierzig und hatte glattes blondes Haar, das er zu einem altmodischen Mittelscheitel gekämmt hatte. In seinen Nacken hatte er sich einen bunten Totenschädel tätowieren lassen. Ansonsten war er ordentlich gekleidet gewesen, mit Schlips und einem Sakko, das ein wenig übertriebene Schulterpolster aufwies.
Mia hatte ein paar Meter entfernt gesessen. Sie spielte an ihrem Glas herum und wollte seine Aufmerksamkeit erregen. Das war ihr schließlich gelungen, aber es dauerte eine Weile, bis er herüberkam und sich erkundigte, ob er sich zu ihr setzen dürfe. Sie antwortete mit einem Lächeln und fingerte wieder an ihrem Glas herum, und am Ende gab sie ihm zu verstehen, dass sie etwas zu trinken haben wolle. Letztlich wurden es drei große Bier und zwei weihnachtliche Drinks mit Safrangeschmack, ehe sie sich ein Taxi zu seiner Wohnung teilten.
Den Safrangeschmack hatte sie noch immer im Mund. Sie ging ins Bad, und als sie den Lichtschalter betätigte, wurde sie von der plötzlichen Beleuchtung geblendet. Sie schloss die Augen, während sie Wasser trank. Dann blinzelte sie in den Spiegel, schob sich die Haare hinter die Ohren und begutachtete ihren Hals. Rechts unter dem Kinn waren zwei große rote Knutschflecken zu sehen. Sie schüttelte den Kopf, schaltete das Licht aus und verließ das Badezimmer.
Im Flur griff sie nach seinem Sakko und durchsuchte die Taschen. Die Geldbörse lag in der Innentasche und enthielt nur Karten. Kein bisschen Bargeld. Nicht einmal ein Zehnkronenstück. Sie sah sich seinen Führerschein an und stellte fest, dass er Martin Strömberg hieß.
»Nur dass du es weißt, Martin«, sagte sie und zeigte mit dem Finger zum Schlafzimmer. »Du warst wirklich schlecht im Bett.«
Dann zog sie sich Stiefel und Jacke an und verließ die Wohnung.
Jana Berzelius stand am Museum der Arbeit und hielt Ausschau. Von hier oben hatte sie eine gute Sicht und beobachtete jede Straßenecke, doch sie entdeckte weder Danilo noch den Mann mit dem Leberfleck. Keine Menschenseele war zu sehen, und Jana staunte, wie verlassen dieses Stadtviertel an einem kühlen Mittwochabend im Dezember war.
So vergingen zehn Minuten. Schließlich musste sie sich eingestehen, dass die beiden Männer weg waren.
Sie hatte ihn verloren. Wut stieg in ihr auf, denn jetzt blieb ihr nichts anderes übrig, als mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, wieder einmal betrogen worden zu sein.
Doch was hatte sie eigentlich geglaubt? Sie hätte ihm nicht folgen, sondern ihn einfach gehen lassen sollen.
Das war die einzige Lösung: Sie musste ihn endlich gehen lassen.
Am Holmentorget ergriff sie ein seltsames Gefühl, als wäre jemand hinter ihr, aber als sie sich umdrehte, sah sie nur einen untersetzten Mann, der seinen Hund ausführte. Sie blickte zu den Wohnungen in der Kvarngatan hinauf, wo in mehreren Fenstern Adventsleuchter ein freundliches Licht verbreiteten. Der Himmel war schwarz und noch immer sternenklar.
Sie zog die Schultern hoch und fröstelte. Dann ging sie weiter über den Platz und betrat den Tunnel. Erneut überkam sie das Gefühl, verfolgt zu werden.
Abrupt drehte sie sich um, starrte in die Dunkelheit und lauschte.
Nichts.
Mit raschen Schritten ging sie über die Järnbrogatan und durch den rosa gestrichenen Torbogen, hinter dem das Stadtviertel Knäppingsborg begann.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch hinter sich.
Da stand er.
Zehn Meter von ihr entfernt.
Mit gesenktem Kopf und angespanntem Kiefer.
Sie begegnete seinem Blick, ließ die Aktentasche fallen.
Und machte sich bereit.
2
Du musst sie einfach nur schlucken!«
Pim zuckte zusammen und erwiderte den Blick des Mannes, der sich über den Tisch lehnte. Sein Gesicht war nur zehn Zentimeter von ihrem entfernt. Er trug ein schmutzig graues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln.
Sie betrachtete die Kapsel in seiner Hand. Sie war größer als eine Kirschtomate und länglicher, als sie gedacht hatte. Der Inhalt war in mehrere Lagen Gummi eingewickelt.
Noi saß daneben und sah Pim bittend an. Sie nickte kaum merkbar, als wollte sie sie ermutigen: Du schaffst es!
Sie befanden sich in einem Zimmer über einer Apotheke. Die Treppe, die dorthin führte, glich am ehesten einer Leiter. Obwohl in einer Ecke ein Standventilator summte, war es hier drinnen warm und stickig.
Es war kein Problem gewesen, die Tablette zu schlucken, die die Magensäure neutralisieren sollte. Sie war sofort die Speiseröhre hinuntergeglitten. Aber die Kapsel sah so groß aus, und sie drückte mit Zeigefinger und Daumen auf der Hülle herum.
Der Mann packte ihren Arm. Die Kapsel berührte ihre Lippen, und sie bekam einen trockenen Mund.
»Mach den Mund auf!«, sagte er zwischen zusammengebissenen Zähnen.
Pim sperrte den Mund auf und legte die Kapsel auf die Zunge.
»So, und jetzt Mund zu und schlucken.«
Sie sah an die Zimmerdecke und spürte die Kapsel ganz hinten auf der Zunge, versuchte zu schlucken, aber es ging nicht, die Kapsel wollte nicht hinuntergleiten. Sie hustete sie wieder hoch und bekam sie mit den Fingern zu fassen.
Der Mann schlug die Faust auf den Tisch.
»Wo hast du denn dieses Stück Dreck aufgelesen?«, sagte er zu Noi, die ganz blass wurde. »Ich kann mir so was nicht leisten, kapiert? Zeit ist Geld.«
Noi nickte und sah Pim an, die standhaft wegschaute.
»Komm schon«, flüsterte Noi. »Du schaffst es.«
Ängstlich schüttelte Pim den Kopf.
»Du musst aber!«, sagte Noi.
Pims Unterlippe zitterte, und ihr liefen die Tränen über die Wangen. Sie wusste, dass sie Glück hatte und sich über diese Chance freuen sollte. Sonst hatte sie immer nur Pech, und als Noi ihr von dieser Möglichkeit erzählt hatte, Geld zu verdienen, und noch dazu so einfach und so schnell, hatte ihr Herz gleich schneller geschlagen.
»Okay, jetzt reicht es! Hau ab!« Der Mann packte Pim am Arm und zog sie vom Stuhl hoch. »Ich habe genug andere, die Geld verdienen wollen.«
»Nein! Warte! Ich will!«, schrie Pim und wehrte sich. »Bitte, ich will. Lass es mich noch einmal probieren. Ich kann das.«
Der Mann zog sie näher zu sich. Er betrachtete sie, ihre schmalen, rot geweinten Augen, ihre glühenden Wangen und die zusammengepressten Lippen.
»Dann zeig es mir!«, sagte er, packte ihren Unterkiefer, zwang sie, den Mund zu öffnen, und spritzte ihr dreimal Gleitmittel in den Mund. Dann hielt er die Kapsel hoch.
»Hier«, sagte er.
Pim nahm die Kapsel und steckte sie sich in den Mund. Sie versuchte zu schlucken, half mit dem Finger nach, damit sie weiter hinten im Hals landete, doch sie musste würgen.
Ihre Panik wuchs.
Runter mit der Kapsel und Mund zu. Doch wieder überkam sie der Würgereiz.
Ihre Hände waren schweißnass. Sie kniff die Augen zusammen, öffnete den Mund, schob die Kapsel so tief in den Hals, wie sie nur konnte.
Und schluckte.
Schluckte, schluckte, schluckte.
Langsam glitt die Kapsel hinunter in Richtung Magen.
Der Mann klatschte in die Hände und lächelte.
»Genau so«, sagte er. »Nur noch neunundvierzig Stück.«
Der erste Schlag richtete sich gegen ihren Kopf, der zweite gegen den Hals.
Jana Berzelius parierte Danilos Fäuste mit den Unterarmen.
Er war außer sich und versuchte, von allen Seiten Treffer zu landen. Aber sie hielt dagegen, hob die rechte Faust, duckte sich, hob die linke, dann probierte sie einen Tritt. Zwar traf sie nicht, doch sie wiederholte die Bewegungen, diesmal schneller. Der Tritt traf Danilos Knie. Er krümmte sich vor Schmerzen, ging aber nicht zu Boden. Sie musste ihn aus dem Gleichgewicht bringen und trat noch einmal zu. Diesmal zielte sie auf seinen Kopf. Doch er bekam ihren Fuß zu fassen und drehte ihn nach links, und sie landete hart mit dem Rücken auf der kalten Erde. Mit den Händen schützte sie den Kopf, rollte zur Seite und rappelte sich auf.
Nun stand Danilo ganz ruhig vor ihr und schien abzuwarten. Er atmete schwer.
Dann nahm er Anlauf und warf sich vorwärts. Im selben Moment beugte sie den Kopf und hielt sich die Fäuste vors Gesicht, verwendete alle Kraft darauf, den Fuß zu heben.
Der Tritt traf perfekt.
Danilo brach zusammen, doch als sie das Knie auf seinen Brustkorb setzen wollte, warf er sich brüllend herum und packte sie. Er setzte sich rittlings auf sie und schlug mit voller Kraft gegen ihre Rippen. Dann ergriff er ihre Haare und zog ihren Kopf nach vorn. Sie versuchte, der Bewegung zu folgen, um die Schmerzen in der Kopfhaut zu verringern, aber Danilos Gewicht auf ihrer Brust hinderte sie daran.
»Warum verfolgst du mich?«, zischte er ihr ins Gesicht.
Sie antwortete nicht, sondern dachte fieberhaft nach. Auf gar keinen Fall durfte sie zulassen, dass er sie besiegte. Ihr war durchaus bewusst, wozu er fähig war, aber ihre Arme waren unter seinen Beinen eingeklemmt. Sie streckte die Finger auf dem Boden aus, in der Hoffnung, irgendetwas zu fassen zu bekommen, womit sie sich verteidigen könnte, aber sie spürte nichts als Eis und Schnee.
Ein unangenehmes Gefühl überkam sie. Sie hatte nicht damit gerechnet, die Schwächere zu sein. Sie hätte ihn überraschen müssen. Immerhin hatte sie am Anfang die Oberhand gehabt.
Sie ballte die Hände zu Fäusten, spannte ihre Muskeln an und sammelte Kraft. Dann rammte sie ihm das Knie in den Rücken. Danilo krümmte sich und ließ ihre Haare los. Sie stieß ihm wieder das Knie in den Rücken, immer und immer wieder. Dann wollte sie das Bein um seinen Hals schlingen, aber vergeblich. Er blieb sitzen.
Wieder griff er nach ihren Haaren.
»Das hättest du nicht tun sollen«, fauchte er, packte ihren Hinterkopf und schlug ihn auf den Boden.
Sie verspürte einen rasenden Schmerz, und ihr wurde schwarz vor Augen.
Als er abermals ihren Kopf auf die Erde schlug, merkte sie, dass ihr die Kraft ausging.
»Halt dich von mir fern, Jana«, sagte er.
Sie hörte seine Stimme wie durch Nebel, weit entfernt.
Und spürte keinen Schmerz mehr.
Eine warme Welle spülte über sie hinweg, und sie begriff, dass sie kurz davor stand, das Bewusstsein zu verlieren.
Er hob die geballte Faust und hielt sie ihr vors Gesicht, ohne zuzuschlagen. Hielt ihr einfach nur die Faust hin, als würde er zögern. Er begegnete ihrem Blick, atmete rasch und sagte irgendetwas, doch seine Worte hallten wie in einem Tunnel.
Dann hörte sie ein entferntes Rufen.
»Hallo!«
Eine andere, fremde Stimme, die sie nicht zuordnen konnte.
Sie wollte sich bewegen, aber der Druck auf der Brust machte es unmöglich. Sie bemühte sich, bei Bewusstsein zu bleiben, und blickte Danilo direkt in die dunklen Augen. Er hatte ihr Gesicht umfasst und zischte:
»Ich warne dich. Wenn du mir noch einmal folgst, werde ich beenden, was ich hier begonnen habe.«
Er hielt ihr Gesicht einen Zentimeter von seinem entfernt.
»Noch ein einziges Mal, und du wirst es für immer bereuen. Kapiert?«
Sie hörte ihn, war aber nicht dazu in der Lage zu antworten. Plötzlich spürte sie, wie der Druck auf ihrer Brust nachließ. Die Stille um sie herum verriet, dass Danilo weg war.
Sie hustete heftig, legte sich auf die Seite und schloss die Augen.
Dann hörte sie wieder die fremde Stimme.
Anneli Lindgren stellte einen Teller mit zwei Knäckebroten auf den Tisch und setzte sich neben ihren Lebensgefährten Gunnar Öhrn. Beide arbeiteten bei der Kriminalpolizei, sie als Kriminaltechnikerin, er als Kriminalhauptkommissar.
Das Wasser dampfte in den Teetassen.
»Willst du lieber Earl Grey oder den grünen Tee haben?«, fragte sie.
»Welchen nimmst du?«
»Den grünen.«
»Dann nehme ich den auch.«
»Aber du magst ihn doch gar nicht.«
»Nein, aber du sagst doch immer, dass ich ihn trinken sollte.«
Sie lächelte ihn an und öffnete die Teepackung. Aus Adams Zimmer drang Musik. Sie hörte den Sohn mitsingen.
»Er scheint sich hier wohlzufühlen«, sagte sie.
»Du denn nicht?«
»Doch.«
Sie hörte Gunnars Besorgnis aus der Frage heraus und antwortete knapp und ohne zu zögern. Das war die einzige Art, weitere Fragen zu vermeiden. Er machte sich um alles Sorgen, dachte viel zu viel nach, analysierte und grübelte über Sachen nach, die er längst hätte loslassen sollen.
»Bist du dir sicher? Fühlst du dich jetzt wohl hier?«
»Ja.«
Anneli versenkte den Teebeutel in der Tasse und ließ ihn in dem heißen Wasser ertrinken. Sie hörte die Stimme, die Musik und den Text, den Adam auswendig gelernt hatte, und beobachtete das Wasser, das immer brauner wurde. Dabei überschlug sie, wie viele Male sie und Gunnar auseinander- und wieder zusammengezogen waren. Womöglich probierten sie es jetzt schon zum zehnten Mal. Vielleicht auch zum zwölften. Sicher war nur, dass sie seit zwanzig Jahren zusammenlebten, allerdings mit Unterbrechungen.
Diesmal fühlte es sich aber anders an, redete sie sich ein. Angenehmer, entspannter. Gunnar war ein guter Mann. Er war nett und strahlte Geborgenheit aus. Wenn er nur damit aufhören könnte, Dinge ständig wiederzukäuen.
Er legte die Hand auf ihre.
»Wir könnten uns ja eine neue Wohnung suchen. Oder ein Reihenhaus? Das haben wir noch nie probiert.«
Sie zog die Hand weg, sah ihn an und verzichtete auf eine Antwort, denn ihr Blick sprach Bände.
»Okay«, sagte er. »Ich verstehe. Es geht dir gut.«
»Genau. Also hör auf herumzunerven.«
Sie nippte an der Tasse. Das Stück, das Adam sich anhörte, würde noch ungefähr anderthalb Minuten dauern. Ein Gitarrensolo und danach der Refrain, dreimal.
»Was hältst du von dem Treffen mit der Reichskripo morgen?«, fragte er.
»Was weiß ich. Sollen die doch rausfinden, was sie wollen. Wir haben einen guten Job gemacht.«
»Ich verstehe gar nicht, warum Anders Wester überhaupt herkommen muss. Ich habe ihm nichts zu sagen.«
»Wirklich? Dabei ist der Typ doch so gut aussehend!«
Sie konnte es sich nicht verkneifen, ihn ein bisschen aufzuziehen. Seine unnötige Besorgnis und seine Eifersucht luden nachgerade dazu ein. Aber sie bereute es noch im selben Moment.
Wütend starrte Gunnar sie an.
»Das war doch nur ein Witz«, lenkte sie ein.
»Findest du das wirklich?«
»Dass er gut aussieht? Ja, früher habe ich das mal gefunden«, sagte sie leichthin und bemühte sich, ungerührt zu wirken.
»Aber jetzt nicht mehr?«, hakte er nach.
»Jetzt hör schon auf.«
»Nur damit ich Bescheid weiß.«
»Hör auf, trink lieber deinen Tee.«
»Sicher?«
»Hör auf zu nerven!«
Jetzt hörte sie das Gitarrensolo, dann Adam, der den Refrain sang.
Gunnar erhob sich und kippte den Inhalt der Teetasse in die Spüle.
»Was machst du?«, fragte Anneli.
»Ich mag keinen Grüntee«, sagte er und ging ins Badezimmer.
Sie seufzte – wegen Gunnar und wegen der Musik, die sie kaum noch aushielt, aber sie hatte keine Lust, den Abend mit einem weiteren Zusammenstoß enden zu lassen, nicht jetzt, da sie gerade erst beschlossen hatten, wieder einmal zusammenzuleben.
Sie war ohnehin schon erschöpft.
Sehr erschöpft.
»Hallo, alles okay bei Ihnen?«
Robin Stenberg hockte sich neben die Frau, die in Embryonalstellung auf dem Boden lag. Die Kette an seiner löchrigen Jeans rasselte. Er sah, dass sie eine stark blutende Kopfverletzung hatte. Gerade wollte er sie berühren, da schlug sie die Augen auf.
»Ich habe alles gesehen«, sagte er. »Ich habe ihn gesehen. Er ist in diese Richtung abgehauen.« Er zeigte mit zitternder Hand zum Fluss.
Die Frau unternahm einen Versuch, den Kopf zu schütteln.
»Hinnn…gefff…lll…nnn«, brachte sie nuschelnd hervor.
»Nein«, sagte er. »Sie sind nicht hingefallen. Sie sind überfallen worden. Wir müssen die Polizei rufen …«
Er stand auf und wühlte in seiner Tasche nach dem Handy.
»Neee …«, murmelte sie.
»Shit, Sie bluten ja total«, sagte er. »Wir müssen einen Krankenwagen rufen oder so.«
Unruhig ging er hin und her.
»Shit, shit, shit«, wiederholte er immer wieder.
Die Frau bewegte sich, hustete.
»Nicht anrufen«, flüsterte sie.
Nun hatte er das Handy gefunden und tippte den Code ein.
Die Frau hustete erneut.
»Bitte nicht anrufen«, sagte sie wieder. Diesmal deutlicher.
Doch er hörte nicht zu, sondern begann die 112 auf seinem Telefon zu wählen. Im selben Moment wurde es ihm aus der Hand geschlagen.
»Was verdammt noch mal …«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis er begriffen hatte, was passiert war.
Sie hatte sich aufgerappelt und stand jetzt vor ihm. Sein Telefon hielt sie in der Hand. Das Blut lief ihr von der Stirn, über das linke Auge und auf die Wange.
»Ich hab gesagt, du sollst nicht anrufen.«
Einen Moment lang glaubte er, es sei ein schlechter Scherz. Aber als er den bedrohlichen Blick der Frau sah, wurde ihm klar, dass sie es ernst meinte. Sie musterte ihn eingehend, und obwohl er vollständig bekleidet war, fühlte er sich nackt.
Sie betrachtete ihn von oben bis unten – seine schwarze Mütze und die schwarz geschminkten Augen, die Schläfe, in die acht kleine Sterne tätowiert waren, und die gepiercte Unterlippe, die gefütterte Jeansjacke und die abgenutzten Springerstiefel.
»Wie heißt du?«, fragte sie.
»R…Robin Stenberg«, stammelte er.
»Gut, Robin«, sagte sie. »Nur damit du es weißt. Ich bin hingefallen und habe mir wehgetan. Sonst nichts.«
Er nickte erschrocken. »Okay.«
»Gut, dann sind wir uns ja einig. Nimm das und hau ab.«
Die Frau warf ihm sein Handy zu. Ungeschickt fing er es auf, ging ein paar Schritte rückwärts und begann dann zu laufen.
Erst als er seine Wohnungstür in der Spelmansgatan hinter sich absperrte, holte ihn die Angst ein.
Im internationalen Terminal des Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok wimmelte es nur so von Menschen. Lange Schlangen hatten sich vor den Schaltern gebildet, und ab und zu wurden Passagiere durch die Lautsprecher gebeten, mit der Information Kontakt aufzunehmen. Jedes Mal wenn ein Koffer auf dem Gepäckband umfiel, erklang ein dumpfes Geräusch.
Laute Stimmen von großen Reisegesellschaften waren zu hören, weinende Kleinkinder und Paare, die über Reiseunterlagen diskutierten.
»Den Pass, bitte.« Die Frau hinter dem Check-in-Schalter streckte die Hand aus.
Pim hielt ihren Pass mit beiden Händen fest, um das Zittern zu überspielen. Man hatte ihr gesagt, sie solle sich nicht verkrampfen, sondern möglichst entspannt und fröhlich wirken. Doch je mehr die Schlange sich vor ihr verkürzte, umso nervöser wurde sie. Sie hatte so viel am Ticket herumgespielt, dass rechts oben eine kleine Ecke fehlte.
Ihr Magen schmerzte. Die Übelkeit kam wellenartig, und sie wünschte, sie könnte sich einen Finger in den Hals stecken. Sie hätte auch gern ausgespuckt, denn bei jedem Würgeanfall sammelte sich Speichel im Mund, aber sie wusste, dass sie es nicht durfte. Deshalb schluckte sie, immer und immer wieder.
In einer anderen Schlange zwei Schalter weiter weg stand Noi und spielte hektisch an einem Riemen ihres Rucksacks herum. Sie warfen einander keine Blicke zu, sondern ignorierten sich.
Denn in diesem Moment kannten sie einander nicht.
So lautete die Regel.
Die Frau hinter dem Schalter tippte auf ihrer Computertastatur herum. Ihre Haare waren dunkel und zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden. Auf der linken Tasche des schwarzen Blazers prangte das Logo der Fluggesellschaft. Darunter trug sie eine weiße Bluse mit rundem Kragen.
Pim legte einen Arm auf den Tresen und beugte sich leicht vor, um die Schmerzen in ihrem aufgequollenen Bauch zu lindern.
»Sie können die Tasche aufs Band stellen«, sagte die Frau und beobachtete, wie Pim ihre Tasche aufs Band hievte. Erneut schlug die Übelkeit zu wie ein Stromschlag, und sie verzog den Mund.
»Ist es das erste Mal?« Die Frau sah sie mit fragendem Blick an. »Also das erste Mal, dass Sie nach Kopenhagen fliegen?«
Pim nickte.
»Das ist aber kein Grund, nervös zu sein. Fliegen ist gar nicht gefährlich.«
Pim antwortete nicht. Denn sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Stattdessen starrte sie auf ihre Schuhe.
»Bitte sehr.«
Pim nahm ihre Boardingkarte in Empfang und wandte sich hastig um.
Sie wollte weg von der Frau mit ihrem fragenden Blick. Im Moment konnte sie sich mit niemandem unterhalten, sie wollte es auch gar nicht.
»Hallo, warten Sie!«, rief ihr die Frau vom Schalter hinterher.
Pim drehte sich um.
»Der Pass«, sagte die Frau. »Sie haben Ihren Pass vergessen.«
Pim ging zurück und murmelte ein Dankeschön. Krampfhaft presste sie ihren Pass mit beiden Händen an die Brust und ging zur Sicherheitskontrolle.
Jana Berzelius sank allmählich zurück auf den Boden und blieb auf den Knien sitzen. Der Schmerz strahlte auf den gesamten Körper aus. Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen. Vorsichtig legte sie die Hand auf den Hinterkopf und tastete ihn ab. Die Finger waren voller Blut. Sie wischte sie an der Jacke ab und sah sich um. Die rote Mütze lag links von ihr, direkt neben der Aktentasche. Langsam reckte sie sich, griff nach der Mütze und spürte das harte Eis an ihren Beinen. Sie konnte nicht auf dem kalten Boden sitzen bleiben.
Erst jetzt bemerkte sie den bitteren Metallgeschmack im Mund. Sie spuckte aus und sah, wie der Speichel das Eis auf dem Boden rot färbte.
Ebenso rot wie ihre Mütze.
Sie zählte bis drei und bemühte sich, wieder auf die Beine zu kommen. Ihr Kopf dröhnte vor Schmerzen, und ihr war schwindelig. Sie stützte sich mit der Hand an der Wand des Torbogens ab.
Noch hatte sie nicht genug Kraft, um weiterzugehen, und blieb stehen.
Das Blut lief ihr die Wange hinab.
3
Pim erwachte davon, dass das Flugzeug schwankte und schaukelte. Sie packte die Armlehnen und atmete rascher. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in ihrem Körper aus, und ihr Herz schlug schneller. Sie hielt nach Noi Ausschau, die sieben Reihen hinter ihr saß, sah sie aber nicht.
Es war ruhig im Flugzeug. Die meisten Passagiere schliefen, und das Kabinenpersonal hatte sich hinter die geschlossenen Vorhänge zurückgezogen. Die Beleuchtung an der Decke war ausgeschaltet, aber hier und da leuchtete eine Leselampe über den Sitzen. Einige lasen, andere sahen sich auf dem Bildschirm am Vordersitz einen Film an.
Das Flugzeug schaukelte wieder, diesmal stärker.
Ihre Hände waren schweißnass, und sie hielt weiterhin krampfhaft die Armlehnen umklammert, schloss die Augen und versuchte, ruhiger zu atmen.
Ihr Magen schmerzte.
Sie verspürte einen Druck und sah über ihre Rückenlehne in den hinteren Teil des Flugzeugs, wo sich die Toiletten befanden. Sie dachte kurz nach, löste dann den Gurt und erhob sich. Vorsichtig ging sie durch den Mittelgang und hielt sich mit der rechten Hand an den Sitzen fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Ihr Magen verkrampfte sich schon wieder, und sie spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Das Flugzeug bewegte sich so heftig, dass sie taumelte und gegen die Sitze stieß.
Eine gedämpfte Stimme des Kabinenpersonals ermahnte sämtliche Passagiere, zu ihren Plätzen zurückzukehren und sich anzuschnallen. Pim blieb stehen, zögerte, ging dann aber weiter zu den Toiletten.
Sie musste gehen, sie konnte nicht umkehren und warten.
Nicht eine einzige Minute.
Sie stolperte vorwärts, doch gerade als sie den hinteren Teil der Kabine erreicht hatte, geriet das Flugzeug ins Schlingern. Sie verlor das Gleichgewicht, wurde zur Seite geworfen, aber es gelang ihr, sich an der Toilettentür abzustützen. Eilig ging sie hinein, schloss die Tür hinter sich und verriegelte sie.
Die Magenschmerzen waren unerträglich.
Sie öffnete den Deckel und sah in die Toilettenschüssel. Der Duft von Putzmittel und Urin schlug ihr entgegen. Auf dem Boden lagen nasse, zerrissene Papierhandtücher. Der weiße Plastikwasserhahn tropfte, und selbst hier drinnen war das Dröhnen der Motoren deutlich zu hören.
Pim zuckte zusammen, als es an der Tür klopfte.
»Hallo, Entschuldigung, aber Sie müssen an Ihren Platz zurückkehren!«, rief eine Stimme auf Englisch.
Pim wollte antworten, doch dann krümmte sie sich vor Schmerzen. Rasch zog sie ihre Hose hinunter und setzte sich auf die kalte Toilettenbrille.
»Hören Sie mich? Hallo?«, sagte die Stimme draußen.
»Okay«, sagte Pim.
Dann konnte sie nichts mehr erwidern.
Die Panik hatte sie mit eisernem Griff gepackt. Die Magenschmerzen sackten tiefer zum Zwerchfell und dann in die Gebärmutter.
Sie hielt die Luft an und saß dreißig Sekunden lang reglos auf dem Rand der Toilette. Dann stand sie auf und blickte wieder in die Schüssel hinein.
Da sah sie die Kapsel. Sie lag ganz unten.
»Sorry, aber Sie müssen jetzt wirklich auf Ihren Platz zurück. All passengers!«
Jemand schlug gegen die Tür, und der Griff bewegte sich auf und ab.
»Yes! Yes!«
Pim wischte sich ab, warf das Toilettenpapier in den Papierkorb und zog die Hose hoch. Zögernd steckte sie die Hand in die Toilettenschüssel und nahm die Kapsel.
Sie würgte heftig, als sie die braune Schicht darauf sah.
Unter fließendem Wasser wusch sie die Kapselhülle und rieb sie mehrmals vorsichtig mit Seife und Wasser ab.
Sie wusste, was sie jetzt tun musste, es gab keinen anderen Ausweg.
Während es wieder an der Tür klopfte, öffnete Pim den Mund und schob die Kapsel in den Hals, legte den Kopf nach hinten und starrte panisch zur Decke.
Sie schwitzte am ganzen Körper, als die Kapsel langsam die Speiseröhre hinabglitt.
Es war früher Morgen, als Jana Berzelius in dem zwanzig Quadratmeter großen Badezimmer ihrem Spiegelbild begegnete. Sie hatte beschlossen, von zu Hause aus zu arbeiten, denn sie hatte keine Lust, in der Staatsanwaltschaft auf Kollegen oder Klienten zu treffen und womöglich Fragen oder neugierige Blicke zu riskieren. Niemand sollte sehen, dass sie nicht in Form war.
Sie ließ die Hände auf dem eckigen Waschbecken ruhen, das in die schwarze Granitarbeitsfläche eingepasst war. Zwei Stapel perfekt gefalteter Handtücher lagen in einem Regal. Die Duschkabine war aus dunkel getöntem Glas, der Duschkopf direkt an die Decke montiert. Der Boden war aus italienischem Marmor. Darüber hinaus gab es zwei Schränke und eine weiße Badewanne. Alles glänzte vor Sauberkeit.
Jana stand in Unterhemd und Slip da. Sie hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ihr Gesicht war geschwollen, und der Nacken schmerzte. Sie tupfte die Wunde am Hinterkopf vorsichtig ab und legte einen neuen Verband an.
Sie dachte an Danilo. Schon den ganzen Vormittag hatte sie an ihn gedacht. Er hatte sie überfallen, misshandelt und erneut versucht, sie zu töten. Sie bebte vor Wut. Wäre dieser schwarz gekleidete magere Typ nicht aufgetaucht, würde sie heute wahrscheinlich nicht hier stehen.
Danilo war hart und brutal gewesen. Er war ihr überlegen gewesen, und sie hatte sich vollkommen machtlos gefühlt.
Ein fremdes und unangenehmes Gefühl.
Sie schüttelte den Kopf und schob sich die Haare hinters Ohr.
Seine Worte hallten in ihrem Kopf wieder. Ich warne dich. Wenn du mir noch einmal folgst, werde ich beenden, was ich hier begonnen habe.
Sie unternahm einen Versuch, ihre schmerzenden Muskeln zu massieren, gab aber auf und ließ die Hand zum Waschbecken sinken.
Noch ein einziges Mal, und du wirst es für immer bereuen. Kapiert?
Die Botschaft war unmissverständlich. Er hatte sie gewarnt, und er hatte es ernst gemeint.
Aber wovor hatte er solche Angst, dass er sie töten wollte? Es verhielt sich doch eher so, dass er eine Bedrohung für sie darstellte, für ihre Karriere, für ihr Leben. Warum wollte er sie töten? Er konnte ihre Existenz vernichten, wenn er wollte – aber solange er sich in seinen Kreisen bewegte und sie sich in ihren, waren sie füreinander keine Bedrohung.
Es war falsch, ihn zu verfolgen, dachte sie. Ich muss versuchen, ihn aus meinem Leben herauszuhalten. Ihr war klar, dass sie sich an einem Scheideweg befand. Nun war es ihre Sache, die richtige Richtung zu wählen.
Es gab bei ihm nichts zu holen. Nächstes Mal würde er sie töten, das war ihr klar. Es durfte einfach kein nächstes Mal geben.
Auf gar keinen Fall.
Sie hatte sich entschieden. Sie würde ihn nie wieder in ihr Leben lassen, die Tür zu ihrer Vergangenheit schließen.
Ihre Hände, die auf dem Waschbecken ruhten, zitterten.
Die Wände kamen auf sie zu, und das Atmen fiel ihr schwer. Ihr ging auf, dass sie gerade einen der schwersten Entschlüsse ihres Lebens gefasst hatte, nämlich Danilo loszulassen, ihre Kindheit loszulassen und weiterzugehen. Dabei hatte sie ihr ganzes Leben mit der Ungewissheit verbracht, wer sie eigentlich war, und gerade die ersten Antworten auf ihre Fragen bekommen.
Sie starrte in den Spiegel. Ihre Augen waren schmal geworden.
Es gibt keinen Raum für Zweifel, dachte sie, drehte sich um und stieß einen lauten Schrei aus. Sie schlug auf die Tür ein, nahm Anlauf, trat dagegen und brüllte.
Dann setzte sie sich keuchend auf den Boden.
Sie konnte ihren Gedanken nicht entkommen. Die Erinnerungen an ihn drängten sich auf. Sein Gesicht dicht an ihrem, sein eiskalter Blick, seine harte Stimme.
Ich warne dich.
»Ich muss«, flüsterte sie. »Ich will nicht, aber ich muss.«
Langsam erhob sie sich und versuchte, sich darin zu bestärken, dass sie den richtigen Entschluss gefasst hatte. Sie ging zum Waschbecken zurück und wusch sich das Gesicht. Dann schob sie den Verband zurecht und zwang sich, ruhig zu atmen.
Von jetzt an ist alles anders, dachte sie.
Von jetzt an muss ich Danilo loslassen.
4
Gunnar Öhrn und Bezirkspolizeichefin Carin Radler standen vor dem ovalen Tisch im Konferenzraum, der im dritten Stock des Polizeireviers lag. Verstohlen sah Gunnar auf die Uhr. Im selben Moment betrat Kriminalobermeisterin Mia Bolander den Raum. Sie kam fast zehn Minuten zu spät zur Besprechung mit der Reichskriminalpolizei.
»Sorry«, sagte sie und murmelte eine Erklärung, die niemand verstand. Dann setzte sie sich an einen Tisch, ignorierte Gunnars müden Blick und sah aus dem Fenster.
Er schloss die Tür und nahm neben ihr Platz.
Am Tisch saßen außer Mia, Gunnar und Carin Radler auch Anneli Lindgren, Henrik Levin und der Kriminaltechniker Ola Söderström. Und noch jemand, wie Mia bemerkte.
So sah er also aus. Der Star der Polizeibehörde.
»Und Jana Berzelius?«, flüsterte sie Gunnar zu.
»Ja?«, erwiderte er leise.
»Ist sie gar nicht hier?«
»Nein.«
»Warum nicht? Warum müssen wir hier rumsitzen und sie nicht?«
»Weil nur wir zu dieser Besprechung eingeladen wurden.«
»Dabei müsste sie eigentlich hier sein. Leider war sie ja die ermittelnde Staatsanwältin.«
»Leider?« Gunnar starrte sie an. »Willst du, dass ich sie anrufe?«
»Nein.«
»Dann sei jetzt bitte ruhig.«
Carin Radler räusperte sich. »Jetzt, da alle versammelt sind, darf ich Ihnen den Leiter der Reichskriminalpolizei vorstellen, Anders Wester.« Sie zeigte auf ihn. »Er und ich haben ein internes Gespräch geführt, und ich habe Sie zu dieser Besprechung eingeladen, weil Sie wissen sollten, was er zu den Ermittlungen des vergangenen Frühjahrs zu sagen hat.«
»Sollten wir uns nicht besser auf andere Dinge konzentrieren als auf die Vergangenheit?«, meinte Gunnar.
Carin Radler ignorierte ihn.
Mia lächelte schief. Das wird eine interessante Besprechung, dachte sie, während ihre Augen zu Andres Wester wanderten. Sie betrachtete seinen Glatzkopf, seine schwarze Brille und seine blauen Augen. Die Lippen waren schmal, und sein Gesicht sah ein wenig blass aus. Seine Körperhaltung wirkte nicht gerade gesund – Wester hatte einen gebeugten Rücken, und seine Füße zeigten nach innen.
»Danke«, sagte Anders Wester. »Wie Carin Radler eben berichtet hat, haben wir im Vorfeld ein Gespräch über die Ermittlungen des vergangenen Frühjahrs geführt, und darüber möchte ich nun mit Ihnen sprechen.«
»Dann schießen Sie los«, sagte Gunnar.
»Es kommt vor, dass gewisse Bezirke auf eigene Faust nationale Mordermittlungen übernehmen, ohne sich an die Reichskriminalpolizei zu wenden. In manchen Fällen ist das Ergebnis zufriedenstellend, in anderen Fällen weniger. Wir haben Carin Radler auf die Fehler hingewiesen, die bei den Ermittlungen im vergangenen Frühjahr gemacht wurden.«
Es war still im Zimmer, und man tauschte vielsagende Blicke.
Gunnar kratzte sich am Kinn und lehnte sich über den Tisch. »Mal ganz ehrlich, Sie finden, dass wir einen schlechten Job gemacht haben, oder?«
»Herr Öhrn«, sagte Carin Radler und hob beruhigend die Hand.
»In der Tat ist Ihnen ein Fehler unterlaufen«, sagte Anders Wester.
»Ein Fehler?«, wiederholte Gunnar. »Was denn für ein Fehler?«
»Haben Sie schon mal was von Zusammenarbeit gehört? Wie Sie wissen, Herr Öhrn, ist es unser Auftrag, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, und um diesen Auftrag so professionell wie möglich auszuführen, müssen wir auf nationaler Ebene zusammenarbeiten. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, für die meisten zumindest …«
»Hören Sie, wir haben alles getan … Es gab nichts, was wir noch hätten tun können.«
»Außer dass Sie früher Kontakt zu uns hätten aufnehmen sollen. Es empfiehlt sich nicht, Sondereinheit zu spielen. Zumindest nicht auf Bezirksebene.«
»Was hätten wir Ihrer Meinung nach denn tun sollen?«
»Sie hätten uns viel früher einschalten sollen, wie gesagt.«
»Wir haben den Fall ja an Sie übergeben.«
»Eine Übergabe, die nicht ganz nach Plan verlaufen ist.«
Gunnar lachte auf. »Und wessen Schuld war das?«
»Herr Öhrn …« Carin Radler warf ihm einen warnenden Blick zu.
Mia streckte die Beine aus.
»Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre«, fuhr Gunnar fort. »Wir haben eine Bande aufgedeckt, die jahrelang illegale Flüchtlingskinder für den Drogenhandel missbraucht hat. Wir haben sogar den Anführer, Gavril Bolanaki, gefasst, und alles war Friede, Freude, Eierkuchen, bis Sie übernommen und angefangen haben, mit Bolanaki zu verhandeln.«
»Sie wissen sehr gut, dass er über wichtige Informationen verfügte.«
»Ja, vielen Dank. Ich weiß, dass Sie ihn schützen wollten, damit er Ihnen im Austausch Informationen gibt: Namen von Zwischenhändlern, von Hehlern, von Übergabeorten. Aber er hat Ihnen ja gar nichts mehr verraten können, oder?«
»Das stimmt, aber was wollen Sie damit sagen?«
»Dass dieser Schutz vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Geben Sie es doch zu, Sie haben nie irgendwelche Infos bekommen.«
»Der Fall ist abgeschlossen. Bolanaki hat sich das Leben genommen. Das hätten wir ohnehin nicht verhindern können.«
»Wer hat eigentlich behauptet, dass er über wichtige Informationen verfügte? Er selbst?«
»Ich bin davon überzeugt, dass Gavril Bolanaki eine wichtige Quelle für uns gewesen wäre«, sagte Anders Wester. »Aber der Fall ist wie gesagt abgeschlossen.«
»Eben. Eine elegante Art, Ermittlungen zu führen: auf eine Lösung verzichten und den Fall einfach abschließen. Man merkt, dass Sie über hohe Kompetenz in operativen Fragen verfügen.«
»Öhrn!«
Carin Radler schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Wester behauptet, wir hätten keinen guten Job gemacht«, erklärte Gunnar. »Aber ich muss ihm widersprechen. Wir haben Gavril Bolanaki gefasst, und ich würde viel eher zu behaupten wagen, dass Sie, Wester, Ihren Job nicht gut gemacht haben, denn schließlich wollten Sieihn schützen.«
Anders Wester lächelte. »Das ist witzig. Offenbar haben Sie gar nicht begriffen, was ich gesagt habe, Öhrn. Es gibt kein Wir und Ihr. Die Polizei ist eine einzige Behörde, und ich hoffe, dass Sie das gelernt haben, bis die Neuorganisation zum Tragen kommt.«
»Vielen Dank. Wir wissen, dass die Reichskriminalpolizei den Namen ändern und demnächst Nationale operative Abteilung heißen wird, NOA. Aber sehr viel mehr wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wie die Organisation im Detail aussehen wird.«
»Das liegt daran, dass noch nicht alles feststeht«, fiel Wester ihm ins Wort.
Gunnar warf Carin Radler einen wütenden Blick zu, was Anders Wester mitbekam.
»Vielleicht ist es besser, wenn Carin Radler Ihnen das Ganze verdeutlicht. Sie ist nämlich sehr gut über die Umorganisation informiert.«
»Aber ich nicht?«
»Sie werden darüber informiert werden, denn im Gegensatz zu Ihnen habe ich mich entschieden, meine Informationen an Sie weiterzugeben und sie Ihnen nicht vorzuenthalten.«
»Wie erfreulich.«
Anders Wester stellte sich hinter Carin Radler und legte ihr die Hand auf die Schulter.
»Carin Radler ist die Position der Regionspolizeichefin Ost angeboten worden, und sie hat zugesagt. Im Lauf des Jahres wird sie zusammen mit den anderen sechs Regionsleitern die Detailorganisation und einen Aktionsplan für das kommende Jahr ausarbeiten. Parallel wird sie ihre Tätigkeit als Bezirkspolizeichefin ausüben, bis sie ihren neuen Posten antritt, was zum nächsten Jahreswechsel sein wird.«
Carin Radler stand auf, zupfte ihren Blazer zurecht und ergriff das Wort.
»Der enge Zeitplan ist eine Herausforderung für uns, aber ich freue mich, dass ich zur nationalen Leitungsgruppe gehören werde. Wir stehen vor einer großen Veränderung. Einundzwanzig Polizeibehörden durch eine einzige große Behörde zu ersetzen schafft man nicht im Handumdrehen. Wie Sie sicher wissen, wird schon seit 2010 daran gearbeitet, und nun steht nur noch der letzte Teil aus. Mir ist klar, dass Sie Fragen haben, und ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten, da mir Ihre Beteiligung ein Anliegen ist.«
Carin Radler nickte dem Team zu, das am Tisch saß. Henrik und Anneli lächelten, Ola hob den Daumen, und Gunnar klatschte vorsichtig in die Hände.
»Dann herzlichen Glückwunsch«, kam es von Mia, die mit verschränkten Armen dasaß.
Die Bezirkspolizeichefin nahm wieder Platz.
»Carin Radler hat recht«, sagte Anders Wester. »Ihre Beteiligung und Ihre Meinung sind uns wichtig.«
Gunnar seufzte laut. Zu laut.
Wester fuhr sich mit der Hand über den kahlen Kopf.
»Wissen Sie, Öhrn, ich sehe mehrere Vorteile bei der neuen Polizeibehörde. Der größte jedoch ist, dass die Grenzen beseitigt werden. Dass es künftig viel leichter sein wird zusammenzuarbeiten. Glauben Sie nicht?«
Die Felder waren schneebedeckt, und die weiße Schicht hatte in der zunehmenden Dämmerung einen blauen Farbton angenommen. Kleine Wege schlängelten sich in den dichten Wald hinein. Die Lichter von den Höfen und Häusern brachten den Schnee zwischen den Bäumen zum Funkeln.
Pim lehnte mit dem Kopf an der vibrierenden Fensterscheibe im Wagen 5 des X2000 zwischen Kopenhagen und Stockholm. Der Zug hatte den Kopenhagener Hauptbahnhof um genau 18.36 Uhr verlassen. Nach vier Stunden sollte er in Norrköping eintreffen.
Sie spielte an ihrem Pass herum, der in ihrem Hosenbund steckte, und spürte eine quälende Unruhe im Zwerchfell. Sie drehte sich zu Noi um, die in der Reihe hinter ihr saß, mit herabhängenden Armen und weit offenem Mund. Den Blick hatte sie in weite Ferne gerichtet, irgendwo dort draußen.
»Schläfst du?«, fragte Pim.
»Nein«, antwortete Noi langsam.
»Bist du sicher, dass uns jemand abholt?«
Noi antwortete nicht. Sie schloss die Augen.
»Noi? Noi!«
Noi schlug die Augen auf und starrte weiter aus dem Fenster.
»Ich friere«, sagte sie und schloss wieder die Augen. Ihr Kopf fiel ihr auf die Brust.
»Wer wird uns abholen? Noi? Noi!«
Noi hob den Kopf und begegnete Pims Blick.
Ihre Pupillen waren so klein, dass es unheimlich aussah.
»Wie geht es dir? Was ist los?«, fragte Pim.
»Nichts … schlafen«, nuschelte Noi.
»Wer wird uns abholen? Kannst du mir nicht antworten?«
Aber Noi antwortete nicht. Sie schlief schon.
Pim kauerte sich auf dem Sitz zusammen und betrachtete die Landschaft, die draußen vor dem Fenster vorbeiglitt. Die Unruhe in ihrem Bauch wurde immer stärker.
Sie wusste sehr wohl, wann sie sich zuletzt so gefühlt hatte. Es war vor einem Monat gewesen, als sie auf dem Boden gesessen und das Gesicht ihrer toten Mutter gesehen hatte. Ihre kleine Schwester Mai hatte es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begriffen. Sie hatte geglaubt, ihre Mutter schliefe, denn das hatte Pim ihr gesagt.
Aber sie schlief nicht. Ihre Mutter hatte Fieber gehabt. Denguefieber. Die Augen waren gerötet, und ihr Körper wies große blaue Flecken auf. Wegen der Schmerzen in Muskeln und Gelenken hatte sie laut geschrien.
Ausnahmsweise wünschte Pim sich, dass ihr Vater da wäre. Damit sie selbst wieder ein Kind sein durfte.
Sie hatte sich gewünscht, dass ein Erwachsener käme und alles wieder in Ordnung brächte. Aber das war ein sinnloser Gedanke gewesen, eine vergebliche Hoffnung. Ihr Vater hatte sie schon vor Langem verlassen und eine neue Familie gegründet, er konnte nicht kommen.
Und als ihre Mutter sich weigerte, ins Krankenhaus zu gehen, war Pims letzte Hoffnung erloschen.
»Es ist am besten so«, sagte ihre Mutter.
»Aber du kannst doch Hilfe kriegen.«
»Hilfe kostet Geld, Pim.«
»Aber …«
»Versprich mir lieber … dass du dich um Mai kümmerst.« Ihre Mutter brachte die Sätze nur mit Mühe heraus und kratzte sich fieberhaft am Arm, woraufhin ein mit Flüssigkeit gefülltes Bläschen platzte.
»Ich kann das doch nicht allein«, hatte Pim gesagt und angefangen zu weinen. »Sie ist erst acht.«
»Du bist fünfzehn. Du schaffst das.«
Jetzt fummelte Pim an ihren Händen herum, dachte an Mai und fragte sich, was ihre kleine Schwester wohl in diesem Moment machte. Ob sie schlief, ob sie sich allein fühlte oder Angst hatte. Aber sie wäre ja nur fünf Tage weg. Schon bald war sie wieder zu Hause bei Mai.
Ihre Unterlippe zitterte, und plötzlich durchfuhr sie wieder ein stechender Magenschmerz.
Ich muss unbedingt wieder nach Hause, dachte sie.
Gunnar Öhrn saß hinter seinem Schreibtisch. Er hatte die Beine gespreizt, streckte die Arme in die Luft und gab ein Grunzen von sich, als er die Schmerzen verspürte, die sich von den Schultern bis zu der Stelle zogen, wo früher der Haaransatz gewesen war. Er fühlte sich übergewichtig und alt, aber vertrieb diese Gedanken wieder, weil er dafür keine Zeit hatte.
Stapelweise Akten lagen im Regal hinter ihm. Es wäre wohl am besten, wenn er irgendwo mittendrin anfangen, effektiv und konzentriert arbeiten und nachdenken würde, um sein Müdigkeitsgefühl loszuwerden.
Eine Mappe nach der anderen nahm er zur Hand und blätterte zerstreut ein paar Dokumente durch, als es an der Tür klopfte. Anders Wester kam mit zwei Tassen Kaffee herein.
»Inzwischen sind Sie also wach?«, fragte er.
»Wieso wach?«, erwiderte Gunnar.
»Es sah so aus, als würden Sie schlafen.«
»Ich habe ein bisschen nachgedacht. Seit wann ist das denn verboten?«
»Ein fieses Wetter heute.«
»Ich habe keine Lust auf Small Talk.«
Anders Wester stellte die Kaffeetassen auf den Tisch, setzte sich Gunnar gegenüber hin und legte die Fingerspitzen aneinander. »Wie geht es ihr?«, fragte er.
»Wem?«
»Anneli.«
»Das geht Sie gar nichts an.«
»Sie sieht müde aus.«
»Ich habe keine Lust auf Small Talk, habe ich gesagt.«
»Ich will doch nur wissen, wie es ihr geht.«
»Das geht Sie einen Scheißdreck an, hören Sie?«
»Immer mit der Ruhe«, sagte Wester grinsend. »Ich habe nur gefragt, wie es ihr geht.«
»Und ich arbeite.«
Gunnar rutschte auf seinem Bürostuhl herum und spürte, wie der Schweiß am Rücken aus den Poren trat. Er betrachtete Anders Wester, der schweigend dasaß. Noch immer hatte er die Fingerspitzen aneinandergelegt, inzwischen hatte er die Hände jedoch zum Mund geführt. Er wirkte überlegen und hatte ein schiefes Lächeln aufgesetzt.
»Kaffee?«
»Müssen wir jetzt auch noch zusammen Kaffee trinken?«
»Bitte«, sagte Wester und schob ihm die eine Tasse hin.
»Dass Sie es wagen hierherzukommen«, sagte Gunnar und betrachtete den Kaffee mit Widerwillen.
»Ich habe Ihre Sicht der Dinge sehr wohl wahrgenommen.«
»Sie haben hier nichts zu suchen.«
»Ich habe gehört, was Sie sagen.«
»Also, dass Sie die Stirn haben, unsere Ermittlungen infrage zu stellen!«
»Ich mache nur meine Arbeit.«
»Und wir machen unsere.«
»Offenbar nicht, sonst wäre ich ja nicht hier.«
»Es muss einen anderen Grund geben, dass Sie hier sind. Ich habe gute Lust, Sie zu bitten, sich zum Teufel zu scheren.«
»Ich weiß.«
»Aber dann riskiere ich vermutlich Repressalien, oder?«
»Das tun Sie vielleicht auch so schon.«
»Was meinen Sie?«
»Genau das, was ich gesagt habe.«
»Drohen Sie mir etwa?«
Anders Wester lächelte immer noch, stützte die Ellbogen auf die Knie und beugte sich vor.
»Nein, Öhrn, warum sollte ich Ihnen drohen? Ich sorge nur dafür, dass Sie hier in Norrköping einen guten Job machen.«
»Ich habe mein ganzes Leben als Polizist gearbeitet. Ich verstehe was von guter Arbeit.«
»Dann muss ich offenbar dafür sorgen, dass Sie noch besser arbeiten.«
»Sie können gern hier herumsitzen und sich über den Tisch beugen, um mir zu imponieren«, sagte Gunnar und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Und Sie können sagen, was Sie wollen. Ich werde Ihnen sowieso nicht zuhören.«
»Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun«, sagte Wester.
»Ich weiß genau, was ich tue.«
»Den Eindruck habe ich aber nicht. Sie scheinen nicht zu begreifen, wie wichtig es ist zu kooperieren. Und dass wir künftig kooperieren werden. Die Kriminalpolizei auf Bezirksebene und auf nationaler Ebene. Norrköping und Stockholm. Sie und ich, Öhrn.«
Er konnte sich das nicht länger anhören. Der Schweiß rann ihm über die Schläfen, aber er weigerte sich, ihn wegzuwischen, wollte sich vor Wester nicht anmerken lassen, wie empört er war.
»Mir ist klar, dass wir