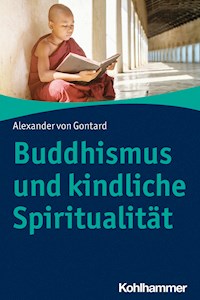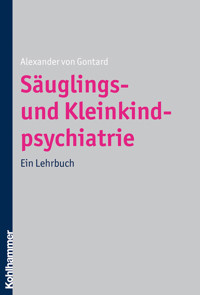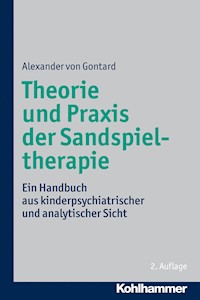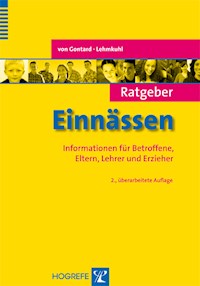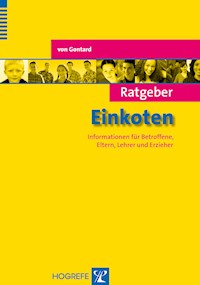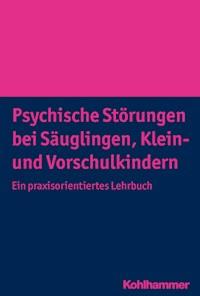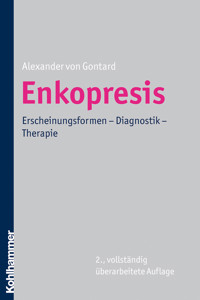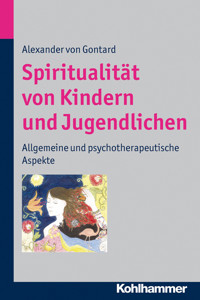23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Enkopresis ist eine häufige funktionelle Störung des Kindes- und Jugendalters. Bei der Diagnose müssen zunächst organische Faktoren ausgeschlossen werden. Nach den neuen Klassifikationssystemen wird zwischen einer häufig auftretenden funktionellen Obstipation – mit und ohne Einkoten – und einer selten auftretenden nicht retentiven Stuhlinkontinenz unterschieden. Die Ausscheidungsstörungen gehen mit hohen emotionalen Belastungen, reduzierter Lebensqualität und einer hohen Rate an psychischen und anderen Begleitstörungen einher. Die Neubearbeitung des Leitfadens vermittelt den derzeitigen Wissensstand zur Beschreibung und Klassifikation, zur Ätiologie sowie zu Verlauf und Prognose dieser Störungen. Ausführlich werden Leitlinien zur Diagnostik, Verlaufskontrolle und Behandlung der Störungen sowie deren Umsetzung in der Praxis vorgestellt. Basierend auf einer exakten Diagnose stehen wirksame Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein tägliches Toilettentraining bildet die Grundlage der Therapie. Beim Vorliegen einer Obstipation ist eine initiale Stuhlentleerung (Desimpaktion) und eine langfristige Gabe von Laxanzien erforderlich. Komorbide Störungen werden zusätzlich behandelt. Bei Therapieresistenz haben sich Schulungsprogramme bewährt. Zahlreiche Materialien, die sich in der Diagnostik und Therapie des Einkotens bewährt haben, werden zur Verfügung gestellt und erleichtern die Umsetzung der Leitlinien in die klinische Praxis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alexander von Gontard
Enkopresis
2., vollständig überarbeitete Auflage
Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie
Band 15
Enkopresis
Prof. Dr. Alexander von Gontard
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof. Dr. Charlotte Hanisch, Prof. Dr. Nina Heinrichs, Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann, Prof. Dr. Paul Plener
Die Reihe wurde begründet von:
Manfred Döpfner, Gerd Lehmkuhl, Franz Petermann
Prof. Dr. med. Alexander von Gontard, geb. 1954. Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendmedizin und Psychotherapeutische Medizin. Seit 2023 ist er Co-Chefarzt an der Abteilung für Eltern-Kind und Jugendliche in der Hochgebirgsklinik Davos, Schweiz. Er ist affiliiert mit dem Governor Kremers Centre, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, Niederlande. Forschungsschwerpunkte: Enuresis, Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz, Intelligenzminderung, Psychische Störungen bei jungen Kindern, Sandspieltherapie, Spiritualität.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete Auflage 2024
© 2010 und 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3032-4; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3032-5)
ISBN 978-3-8017-3032-1
https://doi.org/10.1026/03032-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|V|Einleitung: Grundlagen und Aufbau des Buches
Etwa 1 bis 3 % aller Schulkinder koten ein. Sehr viel mehr Kinder leiden unter Verstopfung. Nach neuen Übersichten sind bis zu 10 % aller Kinder von einer Obstipation betroffen. Viele Eltern, aber auch Fachleute sind erstaunt über diese hohen Prävalenzzahlen. Trotz der Häufigkeit gibt es kaum Störungen des Kindes- und Jugendalters, die mit so hoher Stigmatisierung und Tabuisierung verbunden sind. Eltern stehen unter einem hohen Leidensdruck. Kinder haben eine niedrigere Lebensqualität und vermehrt Schamgefühle. Von allen Ausscheidungsstörungen haben Kinder mit Obstipation und Stuhlinkontinenz die höchste Komorbidität psychischer Störungen.
Eltern und Kinder mit Einkoten und Verstopfung erhalten häufig keine wirksamen Behandlungsangebote. Viele Mythen ranken sich immer noch um das Thema Enkopresis, so z. B., dass die Störung immer psychogen bedingt oder auf eine gestörte Familiendynamik zurückzuführen sei. Auch gibt es – im Gegensatz zum Einnässen – nur wenige Ratgeber und Kinderbücher, an denen sich die Familien orientieren können.
Doch auch Fachleute machen einen großen Bogen um die Störung. In deutscher Sprache wurden bisher nur wenige Monografien zu dem Thema veröffentlicht (z. B. Krisch, 1985; von Gontard, 2011). Auch beschäftigt sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie wenig mit diesem Thema. Die entscheidende Forschung stammt aus dem Fachgebiet der pädiatrischen Gastroenterologie mit vielen grundlegenden Arbeiten, die zur Entstigmatisierung der Obstipation und Stuhlinkontinenz wesentlich beigetragen haben. Da bei Einkoten und Verstopfung psychische und somatische Faktoren eng ineinandergreifen, ist ein interdisziplinärer Zugang besonders wichtig. In den letzten Jahren wurden zunehmend auch psychische Faktoren untersucht und in der Praxis berücksichtigt.
Der hier vorliegende Band der Reihe Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie versucht, sowohl die somatischen als auch die psychischen Aspekte zu berücksichtigen. Er ist praxis- und auch therapieorientiert konzipiert und basiert auf dem aktuellen Stand empirisch gesicherter Erkenntnisse und auf klinischen Erfahrungen. Insofern soll er ärztlichen, psychologischen und psychotherapeutischen Fachleuten helfen, die von den deutschen und internationalen Fachgesellschaften und Arbeitsgruppen geforderten Standards in Diagnostik und Therapie umzusetzen.
Das Buch wurde als Begleitband zum Leitfaden Enuresis konzipiert, der erstmals 2002 veröffentlicht wurde und seit 2018 in einer komplett überarbeiteten dritten Auflage vorliegt (von Gontard, 2018). Als damals der Vorschlag zu einem eigenen Band zur Enkopresis von den Herausgebern der Reihe geäußert wurde, wurde er sofort aufgegriffen, da sich die beiden Bände Enuresis und Enkopresis ideal ergänzen. Zur besseren Orientierung wurde der gleiche Aufbau gewählt. Der parallele Aufbau der Bände kann eine deutliche Arbeitserleichterung bedeuten, wenn z. B. Kinder mit kombinierten Ausscheidungsstörungen behandelt werden, die gar nicht so selten auftreten.
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahr 2010 haben sich wesentliche Aspekte verändert, sodass eine zweite Auflage dieses Leitfadens sinnvoll war. Zum einen hat |VI|sich die Terminologie verändert: Statt „Enkopresis“ wird empfohlen, den neutralen Begriff „Stuhlinkontinenz“ zu verwenden. Weiterhin hat sich die Klassifikation verändert: Statt von einer Enkopresis mit und ohne Obstipation zu sprechen, wird nun von einer Obstipation als übergeordnete Störung und einer nicht retentiven Stuhlinkontinenz ausgegangen, bei der Kinder einkoten, aber nicht verstopft sind. Wenn bei beiden Störungen organische Faktoren ausgeschlossen wurden, dann handelt es sich um funktionelle, d. h. nicht organische Störungen. Und zuletzt hat die Forschungstätigkeit über diese beiden Störungen enorm zugenommen und wichtige Erkenntnisse geliefert, die in diesem Leitfaden zusammengefasst wurden.
Wie bei den bisherigen Bänden dieser Reihe beruhen die Empfehlungen auf den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft medizinischer, wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF). Die bisherigen S1-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und der pädiatrischen Gastroenterologie (von Gontard, 2007; DGKJP, 2007; Koletzko & Grosse, 2007) wurden durch die neue S2k-Leitlinie ersetzt. Basierend auf der aktuellen Forschungslage wurde diese Leitlinie zur funktionellen (nicht organischen) Obstipation und Stuhlinkontinenz im Kindes- und Jugendalter von insgesamt elf Fachgesellschaften und einer Elterngruppe im Konsensverfahren verabschiedet (Claßen & von Gontard, 2022; Zusammenfassung bei von Gontard & Claßen, 2023). Unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (DGKJ) und der Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE) wurde so eine interdisziplinäre Leitlinie geschaffen, die somatische wie auch psychische Faktoren integriert. Die Leitlinie beruht auf den Klassifikationsvorschlägen der pädiatrischen Gastroenterologie, die die sogenannten ROME-IV-Kriterien integriert (Hyams et al., 2016).
Wegen der Überschneidung von Obstipation, Stuhlinkontinenz, Harninkontinenz und Enuresis wird auch wiederholt auf die S2k-Leitlinie zur Enuresis und nicht organischen (funktionellen) Harninkontinenz bei Kindern und Jugendlichen verwiesen (Kuwertz-Bröking & von Gontard, 2021; Zusammenfassung bei von Gontard & Kuwertz-Bröking, 2023).
Der Leitfaden unterteilt sich in insgesamt 5 Kapitel:
1 Im ersten Teil des Buches wird der Stand der Forschung hinsichtlich der Symptomatik, der Komorbidität, der Pathogenese, des Verlaufs und der Therapie in den für die Formulierung der Leitlinien relevanten Aspekten zusammenfassend dargestellt. Es wird auf ausgewählte wichtige Literaturstellen hingewiesen.
2 Im zweiten Teil werden die Leitlinien zu folgenden Bereichen formuliert und ihre Umsetzung in die klinische Praxis dargestellt: Diagnostik und Verlaufskontrolle, Behandlungsindikation, Therapie.
3 Im dritten Kapitel werden Verfahren beschrieben, die für die Diagnostik, die Verlaufskontrolle und Behandlung eingesetzt werden können.
4 Das vierte Kapitel enthält ausführliche Materialien für die Diagnostik und Therapie. Sie können in der vorliegenden Form kopiert oder nach Bedarf eingesetzt werden.
|VII|5 Im fünften Kapitel werden mehrere kürzere Fallbeispiele präsentiert, die die Umsetzung der Leitlinien in die klinische Praxis illustrieren. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt dabei auf einem symptomorientierten, verhaltenstherapeutischen Vorgehen, das bei Bedarf mit Laxanzien kombiniert wird. Auch die Kombination mit weitergehenden kinder- und jugendpsychiatrischen und -psychotherapeutischen Interventionen wird aufgezeigt.
Außerdem wird dieser Band durch den kompakten Ratgeber Einkoten (von Gontard, 2010) ergänzt. Auch dieser Ratgeber orientiert sich an dem bewährten Ratgeber Einnässen (von Gontard & Lehmkuhl, 2012), der ähnlich aufgebaut ist.
Danken möchte ich in diesem Zusammenhang Frau Susanne Weidinger und dem Hogrefe Verlag, die sich für die Neuauflage dieses Leitfadens eingesetzt und das Projekt aktiv unterstützt haben.
Davos, März 2024
Alexander von Gontard
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Grundlagen und Aufbau des Buches
1 Stand der Forschung
1.1 Klassifikation, Untergruppen und Symptomatik
1.2 Klinische Aspekte der funktionellen Obstipation und Stuhlinkontinenz
1.3 Prävalenz
1.4 Differenzialdiagnose
1.4.1 Psychopathologische Differenzialdiagnose
1.4.2 Somatische Differenzialdiagnose
1.5 Komorbide Problembereiche und Störungen
1.5.1 Komorbide psychische Problembereiche
1.5.2 Elterliche Belastung
1.5.3 Misshandlung, Vernachlässigung und Missbrauch
1.5.4 Lebensqualität
1.5.5 Komorbide psychische Störungen
1.5.6 Risikogruppen für eine funktionelle Obstipation/Stuhlinkontinenz
1.5.7 Komorbide somatische Störungen
1.5.8 Komorbide Enuresis und Harninkontinenz
1.6 Pathogenese
1.6.1 Genetik
1.6.2 Neurobiologische Befunde
1.6.3 Gastrointestinale Funktionsbefunde
1.6.4 Lerntheoretische Modelle
1.6.5 Psycho- und familiendynamische Modelle
1.7 Verlauf
1.8 Therapie der Obstipation/Stuhlinkontinenz
2 Leitlinien
2.1 Leitlinien zur Diagnostik und Verlaufskontrolle
2.1.1 Exploration der Eltern
2.1.2 Exploration und psychopathologische Beurteilung des Kindes
2.1.3 Fragebögen und Protokolle
2.1.4 Testpsychologische Untersuchung
2.1.5 Körperliche und neurologische Untersuchung
2.1.6 Spezielle Diagnostik
2.1.7 Verlaufskontrolle
2.2 Leitlinien zur Behandlungsindikation
2.2.1 Toilettentraining
2.2.2 Kombinationsbehandlungen
2.2.3 Biofeedback-Verfahren
2.2.4 Neurostimulation
2.2.5 Medikamentöse Behandlung
2.2.6 Behandlung komorbider Störungen
2.2.7 Teilstationäre oder stationäre Therapie
2.2.8 Entbehrliche Therapiemaßnahmen
2.3 Leitlinien zur Therapie
2.3.1 Beratung der Eltern und des Kindes bzw. der Jugendlichen (Psychoedukation)
2.3.2 Toilettentraining
2.3.3 Kombinierte Therapien
2.3.4 Pharmakotherapie
2.3.5 Therapie komorbider Störungen
2.3.6 Behandlung von seltenen Ausscheidungsstörungen
2.3.7 Übersicht über die Diagnostik und Therapie der Obstipation/Stuhlinkontinenz
3 Verfahren zur Diagnostik und Therapie
4 Materialien
M01 Stuhlinkontinenz-Fragebogen – Lange Version (von Gontard, 2011)
M02 Stuhlinkontinenz-Fragebogen – Kurze Version (von Gontard, 2011)
M03 Stuhlinkontinenz-Fragebogen – Screening-Version (von Gontard, 2011)
M04 48-Stunden-Toilettenprotokoll
M05 Stuhlformen der Bristol Stool Form Scale
M06 Kinderfragebogen: Einkoten
M07 Kinderfragebogen: Häufigkeit
M08 Kinderfragebogen: Obstipation
M09 Kinderbogen: Gefühle
M10 Kinderfragebogen: Trinken
M11 Kinderfragebogen zum Darmproblem (aus Hussong et al., 2020)
M12 Kinder-Trinkprogramm
M13 Kinder-Trinkplan
M14 Mein Trinkplan: Trinken macht Spaß (aus Hussong et al., 2020)
M15 Kinder-Kloprogramm
M16 Monatsplan 1
M17 Monatsplan 2
M18 Schaubild: Obstipation (in Anlehnung an Hussong et al., 2020)
M19 Wie sieht eine Verstopfung aus? (aus Hussong et al., 2020)
M20 Regeln für das Toilettentraining (aus Hussong et al., 2020)
M21 Eltern-Schickplan (Toilettentraining)
5 Fallbeispiele
5.1 Lena: Nichtretentive Stuhlinkontinenz
5.2 Jens: Nichtretentive Stuhlinkontinenz, Dranginkontinenz, primäre Enuresis nocturna
5.3 Maria: Funktionelle Obstipation, Harninkontinenz bei Miktionsaufschub, primäre Enuresis nocturna, Toilettenverweigerungssyndrom
5.4 Leon: Nichtretentive Stuhlinkontinenz, Toilettenverweigerungssyndrom, kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
5.5 Max: Funktionelle Obstipation, Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten, Störung der Feinmotorik
5.6 Daniela: Funktionelle Obstipation, Harninkontinenz bei Miktionsaufschub, emotionale Störung mit sozialen Ängsten, kongenitales Ektodermalsyndrom
6 Literatur
|1|1 Stand der Forschung
1.1 Klassifikation, Untergruppen und Symptomatik
Bisher wurde die Enkopresis als ein willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehenen Stellen ab einem Alter von 4 Jahren nach Ausschluss organischer Ursachen definiert (vgl. Tabelle 1). Diese allgemeine Definition findet sich in den Klassifikationsschemata der ICD-10 und der ICD-11 (WHO, 2008; Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017; WHO, 2022) und des DSM-5 der American Psychiatric Association (APA, 2013).
In der multiaxialen Klassifikation der ICD-10 wird die Enkopresis als psychische Störung der ersten Achse klassifiziert – und nicht als Entwicklungsstörung der zweiten Achse oder als körperliche Erkrankung der vierten Achse (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017). Die ICD-11 ist inzwischen offiziell eingeführt, aber in vielen Kliniken und Praxen nicht umgesetzt. Zu Dokumentationszwecken wird die ICD-10 mit einer Übergangsfrist von 5 Jahren weiterverwendet. Auch gibt es noch keine Multiaxiale Klassifikation basierend auf der ICD-11. Aus diesen Gründen wird in diesem Leitfaden auf die ICD-10, ICD-11 und das DSM-5 eingegangen.
Die genauen Definitionen der ICD-10, ICD-11 und des DSM-5 sind in der Tabelle 1 wiedergegeben. Obwohl sie sich nur in wenigen Punkten unterscheiden, sollen sie getrennt besprochen werden.
Tabelle 1: Klassifikation der Enkopresis nach DSM-5, ICD-10 und ICD-11*
DSM-5
ICD-10
ICD-11
Name
Enkopresis
Enkopresis (F98.1)
Enkopresis (6C01)
Definition
Wiederholtes unwillkürliches oder willkürliches Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehenen Stellen
Willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehenen Stellen
Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehenen Stellen
Alter
Chronologisches Alter: 4 Jahre (oder gleichwertige Entwicklungsstufe)
Chronologisches und geistiges Alter: 4 Jahre
Entwicklungsalter: 4 Jahre
|2|Häufigkeit
Einmal/Monat
Einmal/Monat
Einmal/Monat
Dauer
3 Monate
6 Monate
Mehrere Monate
Ausschlusskriterien
Nicht Folge von Substanzen (wie Laxanzien) oder einer medizinischen Grunderkrankung (Ausnahme: Obstipation)
Spina bifida, Megacolon congenitum und andere organische Erkrankungen
Enkopresis Hauptdiagnose (bei Komorbidität mit anderen psychiatrischen Störungen): nur, wenn dominantes Phänomen
Enkopresis Diagnose, wenn Enuresis und Enkopresis zusammen auftreten
Enkopresis Hauptdiagnose bei gleichzeitiger Obstipation
Andere Erkrankungen (aganglionisches Megakolon, Spina bifida, Demenz)
Subtypen
Mit Obstipation und Überlaufinkontinenz
Ohne Obstipation und Überlaufinkontinenz
F98.12 Einkoten mit sehr flüssigen Faeces, Überlaufenkopresis mit Retention
Enkopresis mit Obstipation und Überlaufinkontinenz (6C01.0)
Enkopresis ohne Obstipation und Überlaufinkontinenz (6C01.1)
Primär
Nicht beschrieben
Verlängerung der normalen infantilen Inkontinenz: F98.10 Unfähigkeit, die physiologische Darmkontrolle zu erwerben
Von Geburt (atypischer Verlauf der normalen infantilen Inkontinenz)
|3|Sekundär
Nicht beschrieben
Nach einer Periode bereits erworbener Darmkontrolle: F98.11 adäquate Darmkontrolle mit Absetzen von Faeces an dafür nicht vorgesehenen Stellen
Nach einer Periode der erworbenen Darmkontrolle
Anmerkung: * DSM-5 (APA, 2013); klinische Kriterien der ICD-10 (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017), ergänzt durch die Forschungskriterien (WHO, 1993); ICD-11 (WHO, 2022)
Klassifikation nach ICD-10
Wie in Tabelle 1 aufgeführt, wird die „nicht organische Enkopresis“ (F98.1) definiert als „wiederholtes, willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Faeces normaler oder fast normaler Konsistenz an Stellen, die im soziokulturellen Milieu des betroffenen Kindes dafür nicht vorgesehen sind“. Die Vorgabe der Altersdefinition von 4 Jahren ist sinnvoll, da 18 % der 3-jährigen Mädchen und 46 % der 3-jährigen Jungen noch einkoten (Largo, Molinari, von Siebenthal & Wolfensberger, 1996). Bei einer so hohen Prävalenz handelt es sich um ein physiologisches Reifungsphänomen. Erst mit dem Alter von 4 Jahren sinkt die Prävalenz plötzlich ab auf 1 % der Mädchen und 8 % der Jungen (Largo, Molinari, von Siebenthal & Wolfensberger, 1996). Obwohl das Einkoten bei Kindern mit einer Intelligenzminderung deutlich erhöht ist (von Wendt, Similä, Niskanen & Järvelin, 1990), bedeutet dies nicht, dass eine Enkopresis erst mit einem Entwicklungsalter von 4 Jahren diagnostiziert und gar behandelt werden kann. Im Gegenteil, in der Praxis können viele Kinder mit Intelligenzminderung schon ab dem chronologischen Alter von 4 Jahren gut behandelt werden – zur Erleichterung der Kinder, der Eltern und Betreuer (von Gontard, 2013b).
Es kann hinterfragt werden, ob es sinnvoll ist, auch das willkürliche Einkoten als Enkopresis zu bezeichnen. Das willkürliche Einkoten ist meistens mit komorbiden psychischen Störungen assoziiert.
Dagegen ist die Häufigkeitsangabe von „einmal pro Monat“ sinnvoll; wenn ein Kind z. B. zweimal im Jahr einkotet, sollte dieses natürlich nicht als Störung bezeichnet werden. Die Störungsdauer von 6 Monaten mag nach der ICD-10 bei dem hohen Leidensdruck der Familien etwas lang erscheinen – |4|die kürzere Definitionsdauer von 3 Monaten nach dem DSM-5 ist hierbei praxisnäher.
Sehr ungünstig sind die Einschränkungen, die die ICD-10 bei komorbiden Störungen vorsieht. Bei anderen psychischen Störungen soll die Enkopresis nach ICD-10 nur diagnostiziert werden, wenn sie das dominante Phänomen darstellt. Beim gleichzeitigen Auftreten von Enuresis und Enkopresis soll nur die Enkopresis diagnostiziert – und die Enuresis weggelassen – werden. Bei gleichzeitiger Obstipation soll ebenfalls nur die Enkopresis klassifiziert werden. Diese Vorgaben der ICD-10 beschränken die Aussagekraft von komorbiden Diagnosen willkürlich und wenig sinnvoll. Gerade bei der Enkopresis ist das gleichzeitige Auftreten mehrerer Störungen, die nicht unbedingt kausal miteinander verknüpft sein müssen, typisch. Von daher hat es sich in der Praxis bei komorbiden Störungen bewährt, jeweils separat den Subtyp der Enkopresis, das Einnässen tagsüber, die Enuresis nocturna sowie weitere komorbide psychische Störungen zu klassifizieren. Diese deskriptive Erfassung aller komorbiden Störungen ist auch zur Therapieplanung von hoher praktischer Relevanz.
Zuletzt werden nach den ICD-10-Forschungskriterien Subgruppen nicht adäquat und vor allem unlogisch voneinander unterschieden. So gibt die ICD-10 zwar an, dass ein Einkoten mit sehr flüssigem Stuhl, Überlaufenkopresis mit Retention (F98.12), vorkommen kann. Andererseits wird eine Obstipation mit Stuhlblockade und nachfolgendem Überlaufeinkoten von flüssigem oder halbflüssigem Stuhl (K59.0) als Ausschluss aufgeführt. Ferner wird zwar zwischen einer primären und sekundären Enkopresis unterschieden, jedoch werden exakte Zeitintervalle nicht angegeben. Als eine Verlängerung der normalen infantilen Inkontinenz wird unter F98.10 die Unfähigkeit, die physiologische Darmkontrolle zu erwerben, beschrieben (also: Primäre Enkopresis). Unter F98.11 wird das Einkoten nach einer Periode bereits erworbener Darmkontrolle erfasst (also: Sekundäre Enkopresis).
Historisch muss beachtet werden, dass die ICD-10 Anfang der 1990er Jahre veröffentlicht wurden. Dies bedeutet, dass sie auf den Forschungsergebnissen bis zu den 1980er Jahren beruhen. Zusammengefasst ist die ICD-10 inzwischen überholt und am wenigsten geeignet, die Enkopresis zu definieren.
Klassifikation nach ICD-11
Die ICD-11 verzichtet auf exakte Häufigkeitsangaben und ist eher deskriptiv (WHO, 2022). Bei der Definition wird nicht mehr zwischen willkürlichem und unwillkürlichem Absetzen von Stuhl unterschieden, was sehr günstig ist. Das Entwicklungsalter von 4 Jahren wird beibehalten, ebenso |5|die Häufigkeitsangabe von einer Episode pro Monat. Eine genaue Angabe der Dauer der Symptomatik fehlt. Bei den Ausschlusskriterien wird die Demenz erwähnt, die im Kindesalter nicht typisch ist. Die Enkopresis mit und ohne Obstipation wird beschrieben, ebenso der Verlauf. Leider werden auch bei der ICD-11 neuere Forschungsergebnisse nicht integriert, sodass sie, obwohl gerade eingeführt, nicht dem aktuellen Stand entspricht (von Gontard, 2021).
Klassifikation nach DSM-5
Die funktionelle Enkopresis wird nach DSM-5 als ein wiederholtes willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Stuhl an nicht dafür vorgesehenen Stellen definiert. Die kürzere Störungsdauer von 3 Monaten ist sinnvoller als die laut ICD-10 vorgesehenen 6 Monate. Laut DSM-5 müssen organische Grunderkrankungen ausgeschlossen werden (außer denen, die mit einer Obstipation assoziiert sind); speziell wird darauf hingewiesen, dass die Störung nicht Folge von Medikamenten (wie Laxanzien) sein darf. Auch finden sich die Einschränkungen bei komorbiden Störungen nicht. Primäre und sekundäre Form werden nicht beschrieben. Stattdessen findet sich die therapeutisch wichtige Unterscheidung der Subtypen Enkopresis mit Obstipation und Überlaufinkontinenz und Enkopresis ohne Obstipation und Überlaufinkontinenz.
Die kürzere Störungsdauer, die fehlenden Einschränkungen bei komorbiden Störungen und vor allem die Unterscheidung in Subformen mit und ohne Obstipation können heute als akzeptable Grundlage der Klassifikation angesehen werden. Neuere Forschungsergebnisse konnten eindeutig zeigen, dass die allerwichtigste Unterscheidung darin liegt, ob eine Obstipation vorliegt oder nicht. Diese Entscheidung muss in jedem Fall getroffen werden, da sie für die gesamte Therapieplanung von höchster Relevanz ist. Dagegen ist die Unterteilung in primäre und sekundäre Formen nicht wirklich bedeutend, da sich die primären und sekundären Formen weder bezüglich der somatischen noch der psychischen Symptomatik unterscheiden. Bei der Enuresis nocturna dagegen macht die Differenzierung in primäre und sekundäre Formen Sinn, da Kinder mit einer sekundären Enuresis nocturna eine sehr viel höhere Komorbiditätsrate von psychischen Störungen aufweisen sowie vermehrt belastende Lebensereignisse erlitten haben.
Zusammengefasst entspricht auch das DSM-5 nicht dem aktuellen Forschungsstand, obwohl die darin angeführten Kriterien noch als orientierende Grundschemata verwendet werden können. Auch sie sind jedoch revisionsbedürftig (von Gontard, 2018). Aus diesen Gründen empfiehlt die Leitlinie, die Definitionen des DSM-5, der ICD-10 und der ICD-11 nicht zu verwenden (Claßen & von Gontard, 2022).
|6|Das aktuellste Klassifikationssystem wurde von der Fachgruppe der pädiatrischen Gastroenterolog:innen entworfen, die ROME-IV-Klassifikation (Hyams et al., 2016). Sie dient auch als Grundlage der neuen Leitlinie (Claßen & von Gontard, 2022).
Klassifikation nach ROME-IV
Es ist ein großes Verdienst der pädiatrischen Gastroenterologie, dass sie sich intensiv um die häufigen und für das Kindesalter wichtigen funktionellen Störungen des Magen-Darm-Traktes gekümmert hat. Nach dem Ort ihrer Konsensustreffen wurden die Klassifikationsschemata „ROME“-Kriterien genannt. So wurden zunächst die ROME-II- (Rasquin-Weber et al., 1999), dann die ROME-III-Kriterien (Rasquin et al., 2006) und zuletzt die aktuellen ROME-IV-Kriterien veröffentlicht (Hyams et al., 2016). Das Ziel war, klinisch relevante Kriterien für Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren mit funktionellen gastrointestinalen Störungen zu definieren, die für Klink und Forschung verwendet werden können. Daneben wurden ROME-IV-Kriterien für das Säuglings- und Kleinkindalter formuliert, die speziell auf diese Altersgruppe ausgerichtet sind (Benninga et al., 2016). Eine Übersicht über die nach ROME-IV definierten Störungen findet sich in Tabelle 2.
Tabelle 2: Funktionelle gastrointestinale Störungen nach ROME-IV (Hyams et al., 2016) – H. Funktionelle Störungen – Kinder und Jugendliche
H1. Funktionelle Übelkeit und Erbrechen
H1a. Syndrom des zyklischen Erbrechens
H1b. Funktionelle Übelkeit und Erbrechen
H1c. Ruminationssyndrom
H1d. Aerophagie
H2. Funktionelle Bauchschmerzen
H2a. Funktionelle Dyspepsie
H2b. Irritables Darmsyndrom
H2c. Abdominelle Migräne
H2d. Funktionelle Bauchschmerzen – nicht spezifiziert
H3. Obstipation und Inkontinenz
H3a. Funktionelle Obstipation
H3b. Nichtretentive Stuhlinkontinenz
Die ROME-IV-Klassifikation umfasst funktionelle Störungen, die den gesamten Gastrointestinaltrakt betreffen. Neben den diagnostischen Kriterien werden auch Grundlagen zur Pathogenese, Diagnostik und Therapie funktioneller gastrointestinaler Störungen zusammengefasst. In diesem |7|Zusammenhang werden ausschließlich die ausscheidungsbezogenen Störungen berücksichtigt, die unter H3 aufgeführt werden. Für diese Störungen sind die spezifischen Kriterien in Tabelle 3 wiedergegeben.
Tabelle 3: Diagnostische Kriterien der Ausscheidungsstörungen nach ROME-IV (Hyams et al., 2016)
H3a. Funktionelle Obstipation
Mindestens einmal pro Woche für mindestens einen Monat vor Diagnose
Ausschluss eines irritablen Darmsyndroms oder einer anderen organischen Erkrankung
Entwicklungsalter von 4 Jahren
Zwei oder mehr der folgenden Kriterien:
Absetzen von Stuhl in die Toilette zweimal pro Woche (oder seltener)
Einkoten mindestens einmal pro Woche
Retentionshaltung oder exzessives willkürliches Zurückhalten von Stuhl
Schmerzhafte Defäkation oder harter Stuhl
Große Stuhlmassen im Rektum
Großkalibrige Stühle, die die Toilette verstopfen können
H3b. Nichtretentive Stuhlinkontinenz
Mindestens ein Monat vor Diagnose
Entwicklungsalter von 4 Jahren
Alle der folgenden Kriterien:
Absetzen von Stuhl in unangemessenen sozialen Kontexten
Keine Stuhlretention
Ausschluss einer anderen organischen Erkrankung
Nach ROME-IV werden zwei Störungen unterschieden, nämlich die funktionelle Obstipation (H3a) und die nichtretentive Stuhlinkontinenz (H3b). Von der ICD-10, der ICD-11 und dem DSM-5 wird nur die Altersdefinition des Entwicklungsalters von 4 Jahren beibehalten, ansonsten sind die Kriterien komplett revidiert. Auch der Begriff Enkopresis wurde fallen gelassen – zugunsten des neutraleren Begriffes der Stuhlinkontinenz. Begrüßenswert ist die Tatsache, dass die Diagnosekriterien immer mit Ergebnissen aus empirischen Arbeiten begründet und mit Häufigkeitsangaben versehen werden (Hyams et al., 2016).
Folgende Kriterien sind zur Diagnose der funktionellen Obstipation nach ROME-IV notwendig:
Die Symptome der funktionellen Obstipation müssen mindestens einen Monat bestanden haben. Diese kurze Störungsdauer wird damit begründet, dass die Obstipation umso schwerer zu behandeln ist, je länger sie andauert. Gerade bei jungen Kindern ist eine frühe Behandlung prognostisch sehr viel günstiger, sodass die Dauer von einem Monat gewählt |8|wurde. Mindestens zwei der in Tabelle 3 aufgeführten Kriterien müssen einmal pro Woche bestanden haben.
Eine akute Obstipation weist demnach eine kürzere Dauer auf, d. h. weniger als einen Monat. Aus einer akuten Obstipation kann sich insbesondere durch verzögerte oder inadäquate Behandlung eine chronische Obstipation entwickeln (Benninga, Voskuijl & Taminiau, 2004). Deshalb ist es wichtig, sie rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, wie es die Leitlinie empfiehlt (Claßen & von Gontard, 2022).
Ein seltener Stuhlgang auf der Toilette ist sehr typisch für die funktionelle Obstipation, wie viele Arbeiten zeigen konnten (Benninga, Buller, Heymans, Tytgat & Taminiau, 1994; Benninga, Voskuijl, Akkerhuis, Taminiau & Buller, 2004). Zwei oder weniger Stuhlgänge bedeutet, dass das Kind z. B. jeden dritten oder vierten Tag Stuhl auf der Toilette absetzt. Dennoch reicht dieses Kriterium natürlich zur Diagnose nicht aus. Es gibt Kinder, die jeden Tag Stuhl auf der Toilette absetzen, aber trotzdem Stuhl retinieren – mit entsprechender Ausweitung von End- und Dickdarm.
Die meisten Kinder und Jugendlichen sind nur obstipiert und koten nicht ein. Andererseits sind die meisten Kinder mit Stuhlinkontinenz auch obstipiert. In einer klinischen Studie waren es 70,7 % (von Gontard et al., 2020), in einer bevölkerungsbezogenen Studie sogar 80 % (Rajindrajith et al., 2010). Wenn sie einkoten, geschieht dieses häufig, nach der Studie von Benninga et al. (1994) sogar täglich. Von daher wurde die Häufigkeit von einer Episode pro Woche als sinnvoll angesehen. Auch die kurze Dauer von einem Monat nach ROME-IV ist ausgesprochen sinnvoll, damit eine akute Obstipation rasch diagnostiziert und behandelt werden kann (Borowitz et al., 2003).
Besonderer Wert wurde auf das Retentionsverhalten gelegt. Viele Kinder zeigen typische Haltemanöver, indem sie den Po zusammenkneifen, die Beine überkreuzen, sich hinhocken oder sogar hin- und herhüpfen. Der Stuhl wird von manchen Kindern auch willkürlich in besonderen Situationen zurückgehalten, wie beim Spielen oder in der Schule. Allerdings nehmen viele Eltern das Retentionsverhalten nicht wahr oder interpretieren es falsch (Rasquin et al., 2006). Eine Übersicht über das Retentionsverhalten findet sich bei Beaudry-Bellefeuille et al. (2017).
Schmerzhafte Defäkation und harter Stuhlgang sind typische Zeichen der Obstipation. Durch die lange Verweildauer des Stuhls im Darm wird Wasser entzogen, er wird dadurch härter, das wiederum führt zu Schmerzen bei der Defäkation. Aus Angst vor diesen Schmerzen halten Kinder den Stuhl oft zurück, was die Akkumulation von Stuhl im Darm weiter verstärkt.
Im Rektum finden sich typischerweise große Stuhlmassen. Zum Teil können die Stuhlballen (Skybala) durch die Bauchdecke hindurch getastet werden. Falls eine rektale Untersuchung durchgeführt wird, lassen sie sich ebenfalls tasten. Heute gelingt der Nachweis einfach mit einer Ultraschalluntersuchung. Typischerweise sieht man dabei einen erwei|9|terten Enddarm (Rektum) mit einem Durchmesser von mehr als 30 mm sowie Impressionen, zum Teil auch Verschiebungen der Blase. Die Ultraschalluntersuchungen können inzwischen auch als Verlaufskontrolle verwendet werden.
Die Stühle haben typischerweise einen großen Durchmesser. Die Einschätzung, was einen großen Durchmesser ausmacht, ist natürlich subjektiv. Deshalb wurde der Zusatz hinzugefügt, dass sie sogar die Toilette verstopfen können (Hyams et al., 2016).
Die nichtretentive Stuhlinkontinenz lässt sich durch Ausschluss leichter definieren, obwohl sie sehr viel weniger untersucht worden ist (Koppen, Gontard et al., 2016). Wieder müssen die Symptome einen Monat bestanden haben. Auch das Entwicklungsalter von 4 Jahren wurde beibehalten.
Folgende Kriterien sind zur Diagnose der nichtretentiven Stuhlinkontinenz nach ROME-IV notwendig:
Dauer von einem Monat in Analogie zur funktionellen Obstipation.
Absetzen von Stuhl in unangebrachten sozialen Kontexten mindestens einmal pro Monat. Viele Kinder mit nichtretentiver Stuhlinkontinenz koteten in einer Studie sehr viel häufiger ein, nämlich drei- bis viermal pro Woche (Benninga et al., 1994).
Eine Stuhlretention liegt nicht vor.
Organische Ursachen müssen ausgeschlossen werden.
Die ROME-IV-Kriterien bedeuten einen deutlichen, wegweisenden Schritt zur empirisch begründeten Operationalisierung von Ausscheidungsstörungen. Die wichtigste Änderung liegt darin, dass die funktionelle Obstipation als übergeordnete Diagnose angesehen wird, die mit oder ohne Einkoten einhergehen kann. Daneben wird die nichtretentive Stuhlinkontinenz als eigenständige Krankheitseinheit definiert.
Leider werden in den ROME-IV-Kriterien Sonderformen wie das Toilettenverweigerungssyndrom (Stuhl nur in die Windel, Urin in die Toilette), Toilettenphobie (Toilette wird für Stuhl und Urin vermieden) und Subformen wie die Slow-Transit-Constipation nicht erwähnt. Es wird spannend sein, zu sehen, wie die ROME-IV-Kriterien sich in den nächsten Jahren zu ROME-V-Kriterien weiterentwickeln werden.
Inzwischen haben sich die ROME-IV-Kriterien weltweit etabliert, sodass auch die AWMF-Leitlinie empfiehlt, sich an ihnen zu orientieren (Claßen & von Gontard, 2022). Die ROME-IV-Kriterien sind eher streng formuliert, mit dem Vorteil, dass eine funktionelle Obstipation mit Sicherheit nicht überdiagnostiziert wird. In manchen Kontexten kann es notwendig sein, andere Definitionen zu verwenden. Zum Beispiel kann es in der Forschung nicht möglich sein, die vollen ROME-IV-Kriterien zu übernehmen. In diesen Fällen wird nach der AWMF-Leitlinie empfohlen, die verwendeten Kriterien genau anzugeben.
|10|Beachte
In diesem Leitfaden werden leitliniengerecht die Begriffe „funktionelle Obstipation“ und „nichtretentive Stuhlinkontinenz“ verwendet. Auf den Zusatz „chronisch“ wird verzichtet, da im Leitfaden überwiegend Störungen behandelt werden, die länger als einen Monat angehalten haben, d. h. es handelt sich nicht um akute Störungen.
Wenn beide Störungen gemeinsam gemeint sind, wird als Kürzel im Text „funktionelle Obstipation/Stuhlinkontinenz“ zur Vereinfachung verwendet. Wenn Studien zur Stuhlinkontinenz allgemein zitiert werden, wird dies gesondert bezeichnet. Abweichungen von dieser Nomenklatur werden jeweils genau benannt.
1.2 Klinische Aspekte der funktionellen Obstipation und Stuhlinkontinenz
Tabelle 4 vermittelt eine Übersicht über die wichtigsten klinischen Aspekte der verschiedenen Ausscheidungsstörungen des Gastrointestinaltrakts. Ohne Zweifel sind die ersten beiden Untergruppen – die funktionelle Obstipation und die nichtretentive Stuhlinkontinenz – die häufigsten und klinisch relevantesten Formen. Die drei seltenen Störungen sind im Prinzip alle drei „Retentionssyndrome“, bei denen es passager oder über längere Zeit zum Zurückhalten von Stuhl kommt. Das Toilettenverweigerungssyndrom hat vor allem im Kleinkindalter eine hohe Bedeutung. Unbehandelt und chronifiziert kann sich daraus eine funktionelle Obstipation entwickeln. Deshalb wird diese Störung ausführlicher behandelt. Die beiden letztgenannten Störungen, die Toilettenphobie und Slow-Transit-Constipation, müssen differenzialdiagnostisch erkannt werden, treten in der Praxis jedoch extrem selten auf. Während das Toilettenverweigerungssyndrom und die Toilettenphobie überwiegend durch psychische Faktoren bedingt sind, überwiegen bei der Slow-Transit-Constipation genetische Faktoren.
Funktionelle Obstipation
Die funktionelle Obstipation kann an typischen Symptomen erkannt werden, wie schon vor 30 Jahren in der klassischen Arbeit von Benninga et al. (1994) zusammengestellt und später bestätigt wurde (Benninga, Voskuijl, Akkerhuis et al., 2004). Die wichtigsten Unterschiede zwischen Kindern mit funktioneller Obstipation und nicht-retentiver Stuhlinkontinenz sind in Tabelle 5 zusammengefasst.
Tabelle 4: Übersicht über klinische Aspekte der funktionellen Störungen des Gastrointestinaltrakts
|11|Funktionelle Obstipation
Seltener Stuhlgang auf der Toilette
Große Stuhlmengen
Nicht normale Stuhlkonsistenz
Tastbare Skybala
Schmerzen bei Defäkation
Bauchschmerzen