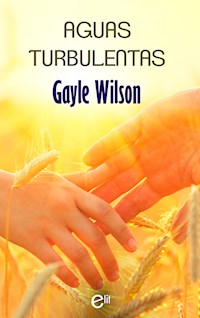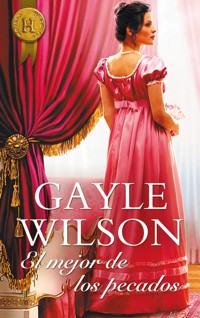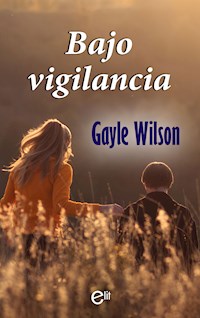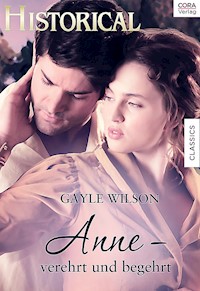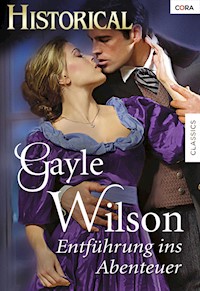
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical
- Sprache: Deutsch
Als ein Husarenstück, das sowohl den verwegenen John Raven als auch der eigensinnigen Lady Catherine Morley diebisches Vergnügen bereitet, beginnt die Ehe dieser beiden passenderweise in Gretna Green. Denn dorthin hat John die blonde Schöne, die vom Vater eigentlich Viscount Amberton versprochen ist, kurzerhand entführt. Der Handel, der dahinter steht: Catherine entgeht der Hochzeit mit dem ebenso ungeliebten wie lüsternen Viscount Amberton. Und John, der seiner Gattin nicht nahezutreten gelobt, kommt durch Catherine den Investoren ein ganzes Stück näher, die er für den Bau seiner Eisenbahnlinie in England sucht. Doch was so trefflich eingefädelt ist, gerät durch Intrigen und jäh erwachendes, uneingestandenes Begehren vollkommen durcheinander
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Gayle Wilson
Entführung ins Abenteuer
IMPRESSUM
Historical erscheint in der Harlequin Enterprises GmbH
Redaktion und Verlag:
Postfach 301161, 20304 Hamburg
Telefon: 040/60 09 09-361
Fax: 040/60 09 09-469
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführung:
Thomas Beckmann
Redaktionsleitung:
Claudia Wuttke (v.l.S.d.P.)
Grafik:
Deborah Kuschel (Art Director), Birgit Tonn, Marina Grothues (Foto)
©
1997 by Mona Gay Thomas Originaltitel: „Raven’s Vow“ erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto in der Reihe: HISTORICAL Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V., Amsterdam
©
Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL Band 106 (1) 1998 by CORA Verlag GmbH & Co, Berlin Übersetzung: Bärbel Hurst
Fotos: Harlequin Books S.A.
Veröffentlicht im ePub Format im 12/2012 - die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
eBook-Produktion: readbox, Dortmund
ISBN 978-3-95446-774-7
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
CORA Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:
ROMANA, BIANCA, BACCARA, TIFFANY, MYSTERY, MYLADY, HISTORICAL
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop
www.cora.de
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Sie erreichen den CORA Leserservice montags bis freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr:
CORA Leserservice
Telefon
01805 / 63 63 65*
Postfach 1455
Fax
07131 / 27 72 31
74004 Heilbronn
* 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz
Werden Sie Fan von CORAVerlag auf Facebook.
PROLOG
London, 1826
„Was Sie brauchen, Mr Raven, ist eine Frau.“
Der hochgewachsene Mann am Fenster drehte sich um. Die Fältchen um seine Mundwinkel schienen tiefer geworden zu sein. Oliver Reynolds hatte in seinen siebzig Lebensjahren nie einen Mann mit einem härteren Zug um den Mund gesehen. Nur die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass der Blick, mit dem John Raven ihn jetzt bedachte, Belustigung ausdrücken sollte.
„Eine Frau?“, wiederholte der Amerikaner. Jetzt klang auch sein Tonfall belustigt.
„Falls Sie nicht irgendwo in Ihrem Stammbaum“, fuhr der Bankier fort, „einen Herzog versteckt haben. Oder einen Grafen. Irgendetwas in der Art. Andernfalls befürchte ich …“ Der alte Mann beließ es bei dieser Andeutung. Er hatte seinen Standpunkt deutlich gemacht, und er wusste, dass sein Klient klug genug war, um keine weiteren Hinweise zu benötigen.
Oliver Reynolds war dafür bezahlt worden – und zwar sehr gut bezahlt worden –, diesem amerikanischen Nabob bei seinen Kontakten mit der vornehmen Londoner Gesellschaft behilflich zu sein. Und der Ratschlag, den er John Raven soeben gegeben hatte, war der beste überhaupt.
„Drei meiner Ahnen flohen nach siebzehnhundertfünfundvierzig aus Schottland, Cumberlands Schlächtern nur um eine Nasenlänge voraus“, bekannte John Raven. Der spöttische Ausdruck in seinen auffallenden kristallblauen Augen zeugte davon, dass er wegen der Umstände, unter denen seine Vorfahren die Alte Welt verlassen hatten, keineswegs verlegen war. Er war am Rande der amerikanischen Wildnis zur Welt gekommen, und er hatte die Siedler über das Land hinwegziehen sehen, immer weiter nach Westen, zum großen Fluss. Sein Land veränderte sich. Die endlosen Wälder mussten allmählich Farmen und Gemeinden weichen, der Sieg der Menschen über die unwirtliche Natur war das Ergebnis der harten Arbeit, die die Generationen seiner Eltern und Großeltern geleistet hatten.
„In diesem Falle …“, begann der Bankier, aber die spöttische Stimme unterbrach ihn.
„Meine Großmutter väterlicherseits immerhin war eine Prinzessin.“
„Eine Prinzessin?“, wiederholte Oliver Reynolds langsam. „Königliches Blut, Mr Raven? Und welcher Dynastie entstammt diese glückliche Ahnin? Trotz seines Selbstbewusstseins und seiner Blasiertheit ist der britische Adel von fremdländischen Königen stets besonders fasziniert gewesen.“
„Der Mauvilla, Mr Reynolds.“
„Mauvilla“, wiederholte der alte Mann und dachte nach. „Ich glaube nicht, dass diese Familie mir ein Begriff ist.“
„Meine Großmutter ist die letzte der königlichen Linie.“
„Eine Indianerin?“ Es war eine plötzliche Eingebung, die er jetzt laut aussprach. Und sogleich erkannte der Bankier, dass dieses Erbe so vieles erklären würde. Die Hautfarbe des Amerikaners zum Beispiel – dieser Bronzeton, der in so auffallendem Kontrast zu den leuchtend blauen Augen stand. Und natürlich sein Haar. „Indianer also“, sagte der alte Mann noch einmal langsam.
Raven neigte zustimmend sein dunkles Haupt. Er lächelte ein wenig. „Indianer“, bestätigte er. „Glauben Sie, dass das Eindruck macht?“
„Ich denke“, begann der Bankier und überlegte, wie er seinen Klienten warnen könnte, ohne zu deutlich werden zu müssen, „Sie sollten verdammt gut darauf achten, dass dieser vornehme Kreis niemals etwas von Ihrer Großmutter erfährt.“
„Sie ist wohl nicht königlich genug für unser Vorhaben?“, vermutete Raven gelassen und ging zurück zu dem Stuhl, auf dem er zuvor gesessen hatte.
Reynolds musterte ihn dabei gründlich. Die breiten Schultern des Amerikaners kamen nun durch Westons hervorragende Schneiderkünste vorteilhaft zur Geltung, der Frackrock warf keine einzige Falte. Unter dem blauen Wollstoff sah man eine dezent gestreifte Weste aus französischer Seide. Die rehbraune Hose saß wie angegossen über dem flachen Bauch und betonte die festen, muskulösen Oberschenkel. Hohe Schaftstiefel, hergestellt von Hobys Meisterhand, vervollständigten den eleganten Eindruck, der zu dem großen Vermögen passte, das der Amerikaner aus dem Osten in die englische Hauptstadt gebracht hatte.
Nach seiner Ankunft in London hatte John Raven ihn um Rat gefragt und sich erstaunlicherweise ganz genau an seine Vorschläge gehalten. Bis auf eine Ausnahme, dachte der Bankier bedauernd. Was die Länge seiner Haare betraf, so war sein Klient nur zu einem wenig befriedigenden Kompromiss bereit gewesen. Der Amerikaner hatte zugestimmt, die dunklen Strähnen, deren schwarzblauer Glanz den Federn des Vogels entsprach, dessen Namen er trug, mit einem Seidenband zusammenzuhalten, sich aber geweigert, sie kürzen zu lassen. Nach dem unerwarteten Bekenntnis von eben verstand Reynolds endlich, warum.
„Wenn sich das herumspricht, Mr Raven, brauchen Sie keine Frau mehr. Eine gute Fee vielleicht. Oder einen Schutzengel.“
„Eine gute Fee, die einen Zauber webt, der mich gesellschaftsfähig macht? Einen Engel, der dafür sorgt, dass meine Fehler unter seinen Flügeln verborgen bleiben?“, spottete der Amerikaner und bemühte sich nicht einmal, seine Enttäuschung zu verbergen.
Zum Teufel mit ihnen, dachte John Raven bitter. Er war nach England gekommen, um etwas Neues aufzubauen. Doch er hatte feststellen müssen, dass die Türen zu den herrlichen Salons und den exklusiven Clubs für ihn verschlossen blieben. Er war hier ein Außenseiter.
Diese arroganten, aufgeblasenen Bastarde. Er war bei ihren Schneidern und ihren Schuhmachern gewesen, und Raven wusste, dass er genauso gut gekleidet war wie jeder andere in London. Und er war mindestens genauso reich. Trotzdem weigerten sich diese Leute, mit ihm über Geschäfte zu verhandeln. Weil er nicht zu ihrer verdammten Gesellschaft gehörte.
„Ich habe es Ihnen gesagt. Nirgendwo auf der Welt werden Sie einen so in sich geschlossenen und engstirnigen Kreis finden“, sagte Reynolds. „Sie würden dem größten Verschwender, Trunkenbold und Taugenichts ihrer eigenen Klasse den Rücken decken, aber ein Außenseiter? Sie hätten genauso gut in Indien bleiben können, um von dort Ihre Geschäfte zu machen, statt zu versuchen, sich hier hineinzudrängen. Niemand wird investieren.“
„Man will mich nicht einmal treffen. Ich habe von allen nur höfliche Absagen erhalten. Wenn sie mich nur anhören wollten, dann würden sie erkennen, dass mein Vorschlag nicht nur Vorteile für Britannien bringt, sondern auch günstig ist für die Investoren. Warum, zum Teufel, will mir niemand zuhören?“
„Weil Sie nicht dazugehören. In dieser Gesellschaft bestimmt die Herkunft eines Menschen über dessen Rang, und Ihre Abkunft ist nicht akzeptabel. Sie brauchen eine Gemahlin, deren Platz in der Gesellschaft so sicher ist, dass sie Ihnen durch ihre eigenen Verbindungen auch Zutritt verschaffen kann.“
„Und wie soll ich Ihrer Meinung nach ein solches Wunderwesen dazu bringen, mich zu heiraten? Indem ich sie meiner Großmutter vorstelle?“, entgegnete Raven höhnisch.
„Die übliche Methode wäre, so viel Geld zu bieten, dass ihre Familie das Angebot unmöglich ablehnen kann.“
„Sie meinen, ich soll mir eine Frau kaufen?“
„So etwas geschieht jeden Tag. Nicht im wörtlichen Sinne, natürlich, aber im Prinzip läuft es auf dasselbe hinaus. Sie sind vermögend. Wir müssen nur noch eine verarmte Adlige finden, deren Familie sich bereit erklärt, sie zu verheiraten, wenn ihnen im Gegenzug finanzielle Sicherheit für den Rest ihres Lebens garantiert wird.“
„Ich dachte, die Sklaverei wäre in Britannien seit langer Zeit abgeschafft“, gab Raven bitter zurück. „Ich will verdammt noch mal keine Frau kaufen. Und ich will auch keine Frau heiraten, die sich zu so etwas freiwillig hergibt.“
„Ich nehme an“, meinte der Bankier vorsichtig, „dass das auch nur selten der Fall ist.“
„Wie bitte?“
„Ich meine, dass eine Frau so etwas wohl nur selten freiwillig tut“, erklärte Oliver Reynolds bedauernd.
„Großer Gott“, rief Raven entsetzt. „Und solche Leute bezeichnen das Volk meiner Großmutter als Wilde! Ich werde keine Frau kaufen, Mr Reynolds, weder mit noch ohne ihr Einverständnis. Wenn die Minen und Bahnlinien, die ich in Britannien bauen will, nur ein Traum bleiben, dann haben diese Bastarde sich das selbst zuzuschreiben.“
John Raven kämpfte mühsam gegen seinen Zorn an, während er die Stufen vom Büro des alten Mannes hinunterstieg. Wenn man eine Frau kaufen musste, um in England Erfolg zu haben, dann würde er verdammt noch mal einen anderen Ort finden, an dem er seine Pläne in die Tat umsetzen konnte.
Raven trat aus dem engen Treppenhaus hinaus auf die Straße mit der ihm eigenen selbstverständlichen Anmut, einer athletischen Eleganz, die in der Hauptstadt bereits Aufmerksamkeit erregt hatte. Die Frauen hier waren an die oft etwas verweichlichte Erscheinung der Gentlemen gewöhnt, die die Mode der Londoner Gesellschaft bestimmten, und mehr als eine hatte während des vergangenen Monats seine entschlossenen Bewegungen mit ihren Blicken verfolgt.
Plötzlich erregte ein Frauenstimme seine Aufmerksamkeit.
„Wenn Sie ihn noch einmal schlagen, dann werde ich meinen Reitknecht anweisen, Ihnen den Stock wegzunehmen und ihn auf Ihrem Rücken tanzen zu lassen.“
Der Hausierer hielt in seinen entschlossenen Bemühungen inne, die bedauernswerte Kreatur anzutreiben, die zwischen den hölzernen Stangen des überladenen Karrens stand. Der kleine Esel, der nicht in der Lage war, seine Last die ansteigende Straße hinaufzuziehen, zitterte und zuckte unter den Hieben, die der Mann ihm mit dem Rohrstock versetzte, um ihn voranzutreiben.
Jetzt hielt der Mann inne, aber als er das Mädchen auf dem Pferd ansah, drückte sein Gesicht weder Verlegenheit noch Bedauern aus. Seine groben Züge waren gerötet vor Zorn.
Der Hass in seinen Augen veranlasste John Raven, einen Schritt näher zu treten, doch er blieb stehen, als der Diener der jungen Dame sich aus dem Sattel schwang. Obwohl er nicht Ravens Größe hatte, so schien er doch in der Lage zu sein, es mit jeder Gefahr aufzunehmen, die von dem alten Hausierer ausging.
„Lade einen Teil der Last von deinem Wagen“, verlangte das Mädchen. „Der Esel kann dies alles unmöglich ziehen.“ Alle Umstehenden konnten sehen, dass sie recht hatte. Aber bis sie sich eingemischt hatte, schien niemandem aufgefallen zu sein, wie grausam der Mann gehandelt hatte.
„Ich habe keine Zeit, um ihn zu verwöhnen. Er ist nur faul, Ma’am“, sagte der Hausierer und zog den formlosen Filz, der ihm als Hut diente. „Er kann die Last ziehen. Er hat es immer getan. Es ist nur eine Laune“, versicherte der Mann. Als er grinste, wurden seine schwarzen Zähne sichtbar. „Sie müssen sich nicht darum kümmern.“
„Wenn Sie Ihr Tier auf offener Straße zu Tode prügeln, sollte sich jemand darum kümmern“, gab das Mädchen zurück. Sie wollte nicht nachgeben und bemühte sich gleichzeitig, ihre unruhig tänzelnde Stute zu zügeln.
Unwillkürlich huschte ein bewunderndes Lächeln über das Gesicht des Amerikaners, während er seinen Blick über sie hinweggleiten ließ. Das schwarze Reitkleid des Mädchens war mit Silberborte reich verziert, ihre porzellanweiße Haut hob sich deutlich von dem dunklen, hohen Kragen und dem dazu passenden Halstuch ab. Strähnen ihres dunklen, rötlich braunen Haars hatten sich unter dem Hut gelöst und ringelten sich um ihr herzförmiges Gesicht. Ihre Züge waren ebenmäßig, doch es waren ihre Augen, die Raven faszinierten. Sie waren von klarem Braun, wie Herbstblätter unter dem ersten Hauch des Frostes. In diesem Augenblick waren sie nur auf den Straßenhändler gerichtet, und das Mädchen achtete nicht auf die Umstehenden.
„Zuweilen ist es nötig, ihn anzutreiben, Ma’am. Tiere fühlen die Schläge nicht so wie wir. Machen Sie sich keine Sorgen seinetwegen. Er wird den Karren ziehen, das verspreche ich Ihnen. Er hat es immer getan.“
Zur Bestätigung seiner Worte wandte er sich wieder dem kleinen Tier zu und hob den Stock, um ihn dann mit jenem pfeifenden Geräusch durch die Luft zischen zu lassen, das zuerst die Aufmerksamkeit des Mädchens erregt hatte. Diesmal jedoch traf er damit nicht den zitternden Rücken, denn der dünne Rohrstock wurde von einer schmalen, behandschuhten Hand festgehalten.
„Ich sagte, genug davon. Laden Sie den Wagen ab!“, befahl sie. Ihre Augen funkelten vor Zorn.
„Dafür habe ich keine Zeit. Und wer soll bewachen, was ich hier zurücklasse? Sie glauben doch nicht, dass meine Waren noch hier sind, wenn ich wiederkomme? Wir sind hier nicht in Mayfair, Ma’am.“
Das Mädchen presste die Lippen zusammen. Sie gab dem Reitknecht einen Wink, und der entwand dem Hausierer den Stock und brach ihn über seinem Knie entzwei.
„Wie viel?“, fragte sie.
Der Händler überlegte. Er sah seinen Broterwerb gefährdet, und gleichzeitig versuchte er abzuschätzen, wie viel die junge Dame wohl zu zahlen bereit war. „Für den Esel?“
„Den Esel, den Karren, die Ladung – was immer nötig ist, um das Tier zu befreien“, erwiderte das Mädchen. Jetzt klang ihre Stimme nicht mehr ungeduldig. Sie beobachtete den Mann vollkommen ausdruckslos.
„Wenn ich meine Ausrüstung verkaufe, kann ich meinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen.“
„Also den Esel.“
„Aber ohne Esel …“, begann er wieder.
„Hol den Konstabler“, wies das Mädchen den Reitknecht an.
„Zwei Pfund“, meinte der Händler schnell – ein lächerlich hoher Betrag.
„In Ordnung“, stimmte sie zu. „Nennen Sie meinem Diener Ihren Namen und die Adresse, und er wird Ihnen das Geld heute Nachmittag bringen. Hol den Esel, Jem“, befahl Catherine Morley und wendete ihre Stute. Sie würde sich bei ihrer Verabredung im Hyde Park ohnehin verspäten.
Der Hausierer begann zu widersprechen, während der Reitknecht sich schon an den Stricken zu schaffen machte. „Sie nehmen mein Eigentum nicht an sich, ohne zu bezahlen. Woher soll ich wissen, dass Sie den Mann mit dem Geld schicken? Ich glaube, ich sollte den Konstabler holen, wenn Sie das Tier mitnehmen. Ich kenne meine Rechte“, schloss er angriffslustig und zerrte an dem Strick, mit dem der Diener das Tier wegführen wollte. „Sie, geben Sie mir meinen Esel zurück!“
Catherine Morley presste enttäuscht die Lippen zusammen. Sie hatte natürlich kein Geld bei sich, und sie bezweifelte, dass Jem eine solch hohe Summe mit sich führte. Sie sah den Diener an, der noch immer den erschöpften Esel am Zügel hielt. Er schüttelte als Antwort auf ihre unausgesprochene Frage nur den Kopf. So würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als jemanden wegen des Geldes nach Hause zu schicken und in der Zwischenzeit den Händler hier festzuhalten.
„Wenn ich Ihnen meine Hilfe anbieten darf“, sagte jemand mit tiefer, akzentuierter Stimme neben ihr.
Sie sah hinunter in ein Paar Augen, die von tieferem Blau waren als alles, was sie jemals gesehen hatte. Sie hatten die leuchtende Farbe des Sommerhimmels und waren betont von dichten, gebogenen Wimpern.
Ein Mann, der in einem heißen, sonnigen Klima gelebt hat, dachte sie kurz. Er war groß, so groß, dass sie nicht weit nach unten blicken musste, um sich in diesem Blau zu verlieren. Sie sah, wie er mit langen, sehnigen Fingern den verschwitzten Hals ihrer nervösen Stute tätschelte. Er flüsterte ihr etwas zu, so leise, dass Catherine es nicht verstehen konnte, aber Taras Ohren zuckten aufgeregt.
Als er weitersprach, spürte Catherine, wie auf wunderbare Weise die Unruhe, die die Betriebsamkeit der Straße und die Verzögerung des versprochenen Ausritts verursacht hatten, von ihrer Stute wich. Tara drehte den Kopf und stieß mit der Nase gegen die starken gebräunten Finger, und Catherine stellte fest, dass sie diese Liebkosung fasziniert beobachtete. „Zwei Pfund waren es, nicht wahr?“, fragte der Fremde.
Catherine nickte verwirrt. Sie sah zu, wie er Tara ein letztes Mal streichelte und dann zu dem wartenden Händler ging. Falls Jems imponierende Größe den Mann beeindruckt hatte, so hatte er sich nichts davon anmerken lassen, aber auf das Erscheinen des Amerikaners reagierte er beinahe furchtsam und wich hastig zurück, als der hochgewachsene Mann seine Hand ausstreckte. Raven wartete geduldig, bis der Hausierer seinen Mut zusammengenommen hatte, das Geld einsteckte und seinen Hut wieder aufsetzte.
Der Händler nahm den Platz des Esels zwischen den hölzernen Stangen nun selbst ein und wendete mühsam den schwer beladenen Karren, sodass er die Straße hinunter und nicht mehr hinauf zeigte. Zu dritt sahen sie zu, wie er sich langsam schwankend entfernte, und die normale Betriebsamkeit ergriff wieder Besitz von der Straße, in der das Drama sich abgespielt hatte.
Raven wandte sich dem Mädchen zu und stellte fest, dass ihr Blick nicht länger auf der allmählich kleiner werdenden Gestalt des Händlers ruhte, sondern auf ihm. Sie wundert sich über meine Hautfarbe, vermutete er, oder über mein Haar. Er wusste nicht, warum er sich über ihre freimütige Musterung Gedanken machte. Er hatte sich längst an die Blicke gewöhnt, die er in London auf sich zog.
„Danke“, sagte sie einfach und sah ihm in die Augen. Dann streckte sie ihm ihre kleine, behandschuhte Hand entgegen, mit der sie den Stock des Hausierers festgehalten hatte. Nicht, damit ich sie küsse, stellte Raven erstaunt fest, sondern damit ich sie schüttele.
Ihre Hand verschwand fast in seiner, aber ihr Griff war angenehm fest.
„Wenn Sie Jem Ihre Adresse nennen …“, begann sie.
„Betrachten Sie es als Geschenk“, unterbrach er sie freundlich und sah, wie sie schnell einen Blick auf das Tier warf, das er gerade gekauft hatte. Der Esel stand mit gesenktem Kopf geduldig da und wartete auf den nächsten Hieb. An mehreren Stellen war auf seinem Fell Blut zu sehen, da, wo der Stock ihn getroffen hatte.
Das Mädchen presste die Lippen zusammen und holte tief Atem. „Verdammter Bastard.“ Dann erst bemerkte sie, dass sie laut geflucht hatte, und sah den Amerikaner an. In ihren braunen Augen schimmerten Tränen, aber sie blinzelte rasch, und die unglaublich langen, dunklen Wimpern verbargen die Gefühle, die Raven nur zu gut erraten konnte.
„Vielen Dank“, sagte sie noch einmal und sah in sein scharf geschnittenes Gesicht. Etwas in seinen kristallblauen Augen schien sich verändert zu haben. Auf ihren Dank hin erwiderte er nichts.
„Für das Geschenk“, fügte sie leise hinzu und verzog die Lippen zu jenem Lächeln, das Männerherzen schneller schlagen ließ, seit sie vierzehn Jahre alt war. Catherine Morley dachte an all die Geschenke, die sie in den letzten drei Jahren von Verehrern erhalten hatte. Keiner von ihnen hatte natürlich je daran gedacht, ihr einen misshandelten Esel zu schenken.
Das dunkle Gesicht des Fremden blieb ausdruckslos. Es ist kein wirklich hübsches Gesicht, dachte Catherine, dazu ist es zu kantig. Aber die Adlernase und die hohen Wangenknochen hatten etwas unerklärlich Anziehendes. Und diese Augen – nie zuvor hatte sie Augen von einem solchen Blau gesehen.
Plötzlich merkte Raven, dass sie mit ihm gesprochen hatte, aber er hatte nicht die geringste Ahnung, was sie gesagt haben mochte. Etwas von einem Geschenk. Etwas – er holte tief Luft, und das makellose herzförmige Gesicht schien vor seinen Augen zu verschwimmen.
„Engel“, sagte er leise in der Sprache seiner Großmutter. Oliver Reynolds hatte ihm gesagt, dass er einen Schutzengel brauchen würde. Und auf einmal lächelte John Raven.
Catherine Morley stellte fest, dass ihre Hand noch immer in seiner ruhte, und dass ihre Kehle trocken geworden war. Die leichte Bewegung seines Mundes faszinierte sie – bis sie bemerkte, was er tat: Er lächelte sie an.
Raven spürte ihre Verwirrung und machte einen Schritt zur Seite. Widerstrebend zog Catherine ihre Hand zurück. Sie hatte dem Mann zweimal gedankt, und nun hatte sie ihm wirklich nichts mehr zu sagen. Sie kannte nicht einmal seinen Namen und würde ihn wohl auch nie erfahren. Sie hatte ihn nie zuvor gesehen und würde ihn mit großer Wahrscheinlichkeit auch niemals wiedersehen. Gewiss gehörte er nicht zu jener auserwählten Gruppe, zu Londons guter Gesellschaft, in der sie verkehrte. Was heute geschehen war, war nichts als die zufällige Begegnung mit einem Fremden auf einer belebten Londoner Straße.
Raven trat zurück und gab den Weg für sie frei. Sie berührte Tara mit ihrem Stiefelabsatz und setzte ihren Weg fort.
John Raven sah der schmalen Gestalt nach, bis sie zwischen den Reitern und Kutschen verschwunden war. Als er merkte, dass er ihr länger nachgestarrt hatte, als die Höflichkeit es erlaubte, wandte er sich dem Diener zu, der sorgfältig die Verletzungen des Tieres inspizierte.
„Soll ich für ihn ein Zuhause suchen?“, bot Raven an und fragte sich, was diese junge Dame wohl in Mayfair mit einem Esel anfangen wollte.
„Sie glauben, dass sie ihn vergisst?“, fragte der Reitknecht, ohne von seiner Beschäftigung aufzusehen. „Sie glauben, dass sie ihn spontan gekauft und schon vergessen hat, ehe sie zu Hause ist?“ Das Geräusch, das er folgen ließ, machte deutlich, was er über Ravens Vermutungen, seine Herrin betreffend, dachte.
„Nein?“, fragte Raven und lächelte wieder.
„Wenn ich ihn bis zu ihrer Rückkehr nicht im Stall untergebracht und seine Wunden versorgt habe, dann wird sie meinen Kopf dem alten Herrn zum Mittagessen servieren.“
„Dem alten Herrn?“
„Montfort“, sagte der Diener, als bedürfte dies keiner weiteren Erklärung. Er ging auf die andere Seite des Esels und ließ seine kundigen Hände über die hervorstehenden Rippen gleiten. Dann hob er eines der zitternden Vorderbeine hoch, um einen unbehandelten Riss zu untersuchen.
„Montford“, wiederholte Raven wie ein Echo.
„Seine Gnaden, der Duke of Montfort“, sagte der Diener und hob endlich den Kopf, um den Mann anzusehen, der so unwissend war, dass er nicht einmal diesen Namen kannte. „Man nennt ihn den Teufel. Natürlich nicht öffentlich“, sagte er und dachte an den Jähzorn seines Herrn. Der Beiname war redlich erworben und sehr passend.
„Wer ist sie?“, fragte der Amerikaner und blickte die Straße hinunter, wo das Mädchen verschwunden war.
„Des Teufels Tochter“, sagte Jem und bemerkte zum ersten Mal die Haartracht dieses ausländischen Gentleman. Der Diener runzelte ganz leicht die Stirn, aber er hatte kein Recht, dazu etwas zu sagen. „Lady Catherine Morley. Die einzige Erbin des Duke of Montfort.“
„Danke“, sagte Raven, griff in seine Westentasche und warf dem Diener eine Münze zu. Der Mann lächelte dankend, dann widmete er sich wieder der sorgfältigen Untersuchung des Esels.
John Raven überquerte die Straße und eilte, zwei Stufen auf einmal nehmend, hinauf in Reynolds Büro. Der alte Mann sah von seinen Notizen auf.
„Lady Catherine Morley“, verkündete John Raven. Mit seinen breiten Schultern füllte er den Türrahmen beinahe völlig aus.
„Morley … Die Tochter des Duke of Montfort?“, wiederholte der Bankier und fragte sich, wie schon bei seiner ersten Begegnung mit dem Amerikaner, ob dieser nicht mehr als nur ein wenig exzentrisch war.
„Ist Lady Catherine Morley für unsere Zwecke engelhaft genug?“, wollte Raven wissen.
Für einen Augenblick sah der Bankier verständnislos drein und fragte sich, wie sein Klient wohl auf diesen Namen gekommen sein mochte.
„Ist sie es?“, fragte Raven noch einmal, wohl wissend, dass die Antwort des Bankiers im Grunde keine Rolle spielte. Mitten auf einer belebten Straße Londons hatte er seine Wahl getroffen, aber Reynolds Zustimmung würde zumindest eine Sicherheit bieten.
„Catherine Morley stellt gewissermaßen den gesamten himmlischen Chor dar, um im Bilde zu bleiben“, bekannte der alte Mann wahrheitsgemäß. Er sah, wie sich das Lächeln des Amerikaners vertiefte. „Aber ich fürchte, dass der Duke of Montfort …“
„Sie sagten, man müsste nur genügend Geld aufbieten.“
„Montfort gehört zu den wenigen Männern in London, die nicht einmal Sie kaufen können. Und ich muss Ihnen sagen …“ Der Bankier unterbrach sich. Er hasste es wirklich, diesen Mann zu kränken, aber er wusste, dass der Herzog John Raven niemals als Bewerber um die Hand seiner Tochter akzeptieren würde. Seiner einzigen Tochter, seines einzigen lebenden Kindes und seiner Erbin. Einen Augenblick lang gestattete er sich die Vorstellung, dass diese beiden Vermögen von seiner Bank verwaltet wurden. Und warum auch nicht? Gehörte ihm nicht das älteste Finanzinstitut der Stadt? Er verbannte diese Verlockungen aus seinen Gedanken und schüttelte bedauernd den Kopf.
„Er wird Ihnen niemals erlauben, Ihre Bewerbung überhaupt nur vorzutragen. Vergessen Sie Catherine Morley, John. Montfort ist so stolz, kaltblütig und arrogant wie alle diese alten englischen Aristokraten. Sie können nichts tun, um seine Tochter zu gewinnen, und Sie können ihr nichts bieten, was sie nicht schon hat.“
Der Blick aus den blauen Augen ruhte einen Moment auf dem Gesicht des alten Mannes, ungetrübt trotz der Hindernisse, die Reynolds ihm gerade in den Weg geworfen hatte.
Bisher hatte John Raven geglaubt, nach London gekommen zu sein, um Geld zu verdienen. Dieser Wunsch in ihm war so stark gewesen, dass er Indien mitten während eines erfolgreichen Minengeschäfts verlassen hatte. Sein Instinkt hatte ihn so direkt in diese Stadt geführt, wie er ihn zuvor nach Delhi gezogen hatte. Wo immer es Geld zu verdienen gab – John Raven spürte es. Er dachte, die wachsende Bergbauindustrie und die Möglichkeiten, die die Entwicklung der Lokomotive mit sich brachte, hätten ihn nach England gelockt.
Jetzt wusste er, dass seine Ankunft in London damit nichts zu tun hatte. Sie brauchen eine Frau, hatte Oliver Reynolds gesagt, und beinahe die gleichen Worte hatte seine Großmutter ausgesprochen, als er sie vor nun mehr als fünf Jahren zuletzt gesehen hatte. Er fragte sich, wie viele Gebete den heiligen weißen Zedernrauch begleitet hatten, der in den Jahren seither zum Großen Geist aufgestiegen waren. Und belustigt fragte John Raven sich, ob seine Großmutter vielleicht in einem ihrer Trancezustände jemanden wie Lady Catherine Morley gesehen hatte.
1. KAPITEL
„Ich bin nicht hinausgegangen, um mich schlecht behandeln zu lassen. Ich bin gekommen, um etwas Luft zu atmen, die nicht von hundert schwitzenden Leibern mit zu viel Parfüm verdorben ist“, sagte Catherine und fragte sich, warum die Zärtlichkeiten eines so blendend aussehenden und durchaus angemessenen Verehrers sie derart kühl ließen. Sie entzog sich der Umarmung ihres Begleiters, der sie mit leisem Lachen losließ.
Viscount Amberton beobachtete, wie Catherine sich anmutig gegen die steinerne Balkonbrüstung lehnte. Er wusste, dass sie sich um den sündhaft teuren Stoff ihres Kleides so wenig kümmerte, als trüge sie Sackleinen. Natürlich hatte sie die vielen Perlen, mit denen es verziert war, auch nicht in stundenlanger Arbeit selbst aufgestickt. Sie stützte ihr Kinn auf die Hand und starrte in den dunklen Garten hinaus.
„Gib es zu, Catherine. Du langweilst dich. Zu viele Bälle, zu viele Dinnerpartys mit immer denselben Leuten. Zu viele Verehrer, die dir ihre unsterbliche Liebe gestehen. Warum sagst du nicht, wer der Glückliche ist, und erlöst sie alle von ihrem Leid?“, schlug der Viscount vor.
Amberton wusste nur zu gut, dass er die besten Aussichten hatte, jedenfalls beim Duke, wenn schon nicht bei dessen Tochter. Und er wurde zunehmend ungeduldiger, weil Catherine eine Eheschließung noch immer ablehnte. Vor allem, wenn er daran dachte, wie sehr er sich bei dem alten Mann hatte einschmeicheln müssen. Und dabei war der Viscount nicht einmal annähernd so ungeduldig wie seine Gläubiger. Der einzige Grund, warum sie noch immer schwiegen und auf ihr Geld warteten, war, dass sie die Spielregeln kannten. Ein kleiner Hinweis darauf, dass Lord Amberton das Geld Montforts brauchte, würde genügen, damit er niemals eine Guinee davon sah.
„Sie alle?“, fragte sie spöttisch und lächelte ihn über die Schulter hinweg an.
„Uns alle, wenn du so willst“, lenkte er ein. „Du weißt, dass mein Herz dir gehört. So war es schon immer. Das weißt du ganz genau.“
„Aber mein Herz ist das Problem“, sagte Catherine leise.
„Es wird allgemein nicht als Hinderungsgrund für eine Ehe angesehen, nicht verliebt zu sein“, versicherte er ihr. Tatsächlich wussten sie beide, wie selten eine Liebesheirat in ihren Kreisen war.
„Ich glaube einfach, dass es wenigstens einen Mann geben muss, der mich nicht schon nach einem Monat zu Tode langweilt.“
„Du bist ein verzogenes kleines Ding, meine Liebe. Es gibt Schlimmeres als Langeweile“, sagte Gerald leichthin.
„Das bezweifle ich“, erwiderte sie, schon wieder lächelnd.
„Du bist achtzehn, am Ende deiner zweiten Saison. Das einzige Kind des Duke of Montfort, und er will einen Enkel. Er wird nicht mehr sehr lange warten.“
„Ich weiß.“ Sie hatte diese Argumente schon zu oft gehört, von Amberton und auch von ihrem Vater. Sie fürchtete allmählich, dass der Herzog sich nicht an das Versprechen halten würde, das er ihr vor zwei Jahren gegeben hatte: ihre Wünsche bei der Wahl eines Ehemannes zu berücksichtigen.
„Gib nach, ehe dir keine Wahl mehr bleibt“, schlug Gerald vor. Und ehe man mich in den Schuldturm bringt, dachte er bitter.
„Nachgeben“, wiederholte sie. „Und dann? Immer jemandem gehorchen müssen. Für immer gefangen sein in den Wünschen und Plänen eines anderen. Bestimmt von …“
Amberton unterbrach ihre Klagen mit einem Lachen. „Und du glaubst natürlich, dass du die Ausnahme bist und man dir erlaubt, deine eigenen Entscheidungen zu treffen.“
„Bis zu einem gewissen Grade. Warum nicht? Ich habe nicht so viele Fehler begangen, dass ich mich bei allem den Entscheidungen meines Gemahls unterwerfen müsste“, erklärte sie.
„Und wenn du Fehlentscheidungen getroffen hast, dann war dein Vater durchaus bereit und in der Lage, dich aus den entsprechenden Situationen zu befreien. Wie bei einer gewissen heimlichen Reise an die Grenze.“
Catherine war erst sechzehn gewesen, und der Mitgiftjäger, der diese Flucht arrangiert hatte, hatte Charme und Schönheit genug besessen, um die Köpfe weitaus älterer und klügerer Damen zu verdrehen. Doch er hatte nur die Tochter des Duke of Montfort gewollt.
„Nicht“, verlangte sie leise. Die Erwähnung dieses Ereignisses schmerzte noch immer. „Ich hätte dir nichts davon erzählen dürfen. Aber du hast versprochen, nie wieder davon zu reden.“
„Deine Geheimnisse sind bei mir sicher aufgehoben, meine Liebe. Vor allem, wenn du einverstanden bist, meine Bewerbung anzunehmen“, bekannte er und lächelte sie an. „Dann habe ich ein besonderes Interesse, deinen guten Ruf zu schützen.“
„Willst du mich erpressen, Gerald?“
„Aber nicht doch. Nur ein weiteres Versprechen von deinem ältesten Bewerber.“
„Der Älteste?“, wiederholte sie und lachte, froh darüber, wieder auf dem vertrauten Boden der Koketterie zu sein. „Du hast Ridgecourt vergessen.“
„Dann bin ich eben der Erste, meine Liebe. Ich glaube, du weißt, dass wir ganz gut miteinander auskommen. Und ich verspreche dir ein gewisses Maß an Freiheit. Aber ich fürchte, ich werde dir keine so lange Leine lassen wie dein Vater.“
„Lange Leine!“, wiederholte sie verzweifelt. „Oh, Gott, Gerald, davon rede ich ja!“
„Es ist nur eine Redensart, Liebes. Du musst nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, als hätte ich vor, dich einzusperren.“
„Aber genau so stelle ich mir die Ehe vor! Ich bin jetzt schon von genügend Vorschriften umgeben. Reite nicht zu schnell. Tanze mit demselben Gentleman stets nur einmal. Für unverheiratete Frauen gehört es sich nicht, diese Farbe oder jenen Schnitt zu tragen. Himmel, ich habe das alles so satt! Selbst mein Vater stößt inzwischen düstere Prophezeiungen aus, dass ich noch eine alte Jungfer werde, obwohl er in der vergangenen Woche mindestens drei Anträge entgegengenommen hat.“
„Es gibt einen Ausweg“, erinnerte Gerald sie.
„Eine Heirat, ich weiß. Ein Gefängnis gegen ein anderes tauschen. Einer anderen Person das Recht zugestehen, zu korrigieren, zu kritisieren und zu ermahnen. Weißt du, Gerald, dass es Männer gibt, die ihre Frauen schlagen, wenn sie ihnen nicht stets gehorchen? Wie soll ich wissen …“
Er hob den Arm und gelobte: „Ich werde dich niemals schlagen, Catherine. Es gibt bessere Möglichkeiten als Gewalt, um eine Frau zu beherrschen. Weitaus angenehmere Möglichkeiten.“ Es gab Methoden, die er diesem Mädchen nur zu gern zeigen würde, ihr, die seine Pläne mit ihrem Starrsinn ernsthaft bedrohte.
„Wirklich?“, fragte sie spöttisch. Sein Tonfall gefiel ihr nicht.
„Heirate mich, meine Süße, und ich wäre entzückt, dir die Macht der Liebe zu zeigen.“
„Nein“, sagte sie einfach und wandte sich wieder dem Garten zu, der sich unter ihr in der Dunkelheit erstreckte. „Ich will nicht heiraten. Niemanden.“
„Aber …“, begann er.
„Nicht heute Abend, bitte. Ich möchte heute Abend nicht daran denken. Geh, Gerald. Lass mich die Einsamkeit genießen. Ich habe das Gefühl, dass die Tage, in denen ich mein eigenes Schicksal kontrolliere, dahinschwinden, und das macht jeden nur noch kostbarer. Die Tage meiner Freiheit mögen gezählt sein, aber ich stehe noch nicht unter deiner Herrschaft. Oder unter der irgendeines anderen Mannes. Noch nicht“, fügte sie fast resignierend hinzu.
Amberton sah, wie die schmalen Schultern sich hoben, als sie tief Luft holte. Aber er gehorchte, noch immer lächelnd. Sollte sie doch glauben, dass sie eine Wahl hätte, solange sie noch konnte.
Nachdem Gerald gegangen war, umgaben sie nur noch die Geräusche der Nacht und die leise Musik aus dem Ballsaal. Sie stützte beide Ellenbogen auf die steinerne Brüstung, verschränkte die Finger unter dem Kinn und seufzte wieder.
Ungläubig hörte sie, dass hinter ihr jemand in die Hände klatschte. Sie wandte sich um und sah eine hochgewachsene Gestalt in den Schatten am Rande des Balkons stehen.
„Bravo“, sagte der Fremde leise. „Eine bemerkenswerte Unabhängigkeitserklärung. Ich applaudiere der Erklärung, auch wenn ich bezweifle, dass Sie bei der Ausführung Erfolg haben werden.“
„Wie lange sind Sie schon hier?“, wollte sie wissen. „Sie haben ein ausgesprochen privates und persönliches Gespräch belauscht. Sie, Sir, sind offensichtlich kein Gentleman.“
„Offensichtlich nicht“, stimmte er zu.
Jetzt, da sie den ersten Schreck überwunden hatte, begann sie, ihn zu betrachten. Er war wesentlich größer als alle anderen Männer, die sie kannte – mehr als sechs Fuß. Und er hatte sehr breite Schultern.
Als er in den Lichtschein am Fenster trat, bemerkte sie die bronzefarbene Haut, die hohen Wangenknochen und die glatten, rasierten Wangen. Großer Gott, dachte sie ungläubig, das ist der Mann, der den Esel gekauft hat! Der Mann mit den auffallenden Augen.
Sie schluckte plötzlich und war wieder fasziniert von seiner Fremdartigkeit. Das schwarze Haar trug er straff zurückgekämmt und im Nacken zusammengebunden, sodass die kräftige Nase und das kantige Gesicht betont wurden.
Dann fiel ihr auf, dass sie ihn anstarrte. Sie ärgerte sich, auch darüber, dass er sie in einer so peinlichen Situation belauscht hatte, und wandte sich wieder der Brüstung zu, um Zeit zu gewinnen, bis sie sich beruhigt hatte.
Stille breitete sich aus, nur die leise Musik war zu hören. Catherine hatte eine Reaktion erwartet – eine Entschuldigung für sein Eindringen, eine Erinnerung daran, dass sie einander bereits begegnet waren, und dass sie ihm etwas schuldete. Doch er schwieg.
Beinahe gegen ihren Willen drehte sie sich zu ihm um. Er stand noch genauso da wie zuvor, beobachtete sie mit diesen seltsam leuchtenden Augen. Diesen einzigartig schönen Augen! Bei diesem Gedanken fragte sie sich, was da mit ihr geschah. Gewiss war sie weltgewandt genug, um nicht stumm einem Fremden zu Füßen zu sinken, nur weil er schöne blaue Augen hatte.
„Ich würde gern mit Ihnen sprechen“, sagte er. Sein Akzent war auffallend, und sie fragte sich, warum sie ihn zuvor nicht bemerkt hatte. Wahrscheinlich, weil es ihr zu peinlich war, dass er ihre Auseinandersetzung mit Amberton belauscht hatte.
„Wenn ich Geralds Gesellschaft nicht wünsche, der ein sehr alter Freund ist, sollte es offensichtlich sein, dass ich mit Ihnen erst recht nicht sprechen möchte.“
„Ich bin nicht Gerald“, erwiderte er ausdruckslos.
„Wie bitte?“
„Ich bin nicht Gerald“, wiederholte er.
„Ich weiß, was Sie gesagt haben. Ich meinte nicht, dass ich Sie nicht gehört hätte. Ich meinte …“
Er wartete höflich und mit ausdrucksloser Miene auf ihre Erklärung.
„Ich meinte, ich weiß nicht, warum Sie das sagten – dass Sie nicht Gerald sind. Offensichtlich sind Sie nicht Lord Amberton.“
„Ich heiße Raven“, stellte er sich vor.
„Mr Raven“, sagte sie freundlich. Raven? Was war das für ein Name?
Raven neigte den Kopf, kein bisschen beeindruckt von ihrer nur scheinbaren Höflichkeit. Jetzt war sie sicher, dass sie ihn zur Hölle wünschte.
„Gehen Sie“, entgegnete sie und wandte sich wieder ab.
Sie hörte ihn leise lachen. Er lachte über sie – wer immer er sein mochte.
„Ich bin es nicht gewöhnt, dass ein Gentleman nicht das tut, worum er gebeten wird“, sagte sie kühl.
„Das habe ich auch nicht erwartet“, erklärte er sachlich. „Wie auch immer – ich habe etwas Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen. Ich glaube, dies ist eine Gelegenheit, wie sie sich mir vielleicht nie wieder bieten wird.“
Sie hörte die Belustigung in seiner tiefen Stimme.
„Etwas Geschäftliches?“, wiederholte sie und sah ihn an. „Ich versichere Ihnen, dass ich nichts Geschäftliches mit Fremden zu besprechen pflege.“
„Aber ich bin kein Fremder. Wir sind uns bereits einmal begegnet. Ich dachte, Sie würden sich daran erinnern.“
„Natürlich erinnere ich mich daran. Ich glaube, ich habe mich für den Esel bei Ihnen bedankt. Und jetzt muss ich darauf bestehen, dass Sie mich allein lassen. Wenn Sie so freundlich wären …“ Sie wusste selbst nicht, warum sie versuchte, ihn loszuwerden. Wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie in den letzten Tagen häufig an ihn gedacht hatte.
„Ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten“, sagte Raven, vollkommen unbeeindruckt von ihren wiederholten Versuchen, ihn fortzuschicken.
Sie sah ihn an, zu erschrocken, um zu sprechen, und fühlte, wie sie errötete. Er hatte Geralds unerhörte Umarmung beobachtet und glaubte offensichtlich, dass sie …
„Mein Vater wird Sie auspeitschen lassen“, drohte sie.
Er lächelte. „An so einen Vorschlag dachte ich nicht“, erklärte Raven. „Ich bin schockiert, dass eine so gut erzogene junge Frau glauben könnte, dass ich ihr ein solches Angebot machen könnte. Sie überraschen mich.“ Er schüttelte den Kopf. Der Zorn, den er empfunden hatte, als er sah, wie dieser blonde Engländer sie in den Armen gehalten hatte, verrauchte allmählich. Sie war offensichtlich nicht so leichtfertig, wie er vermutet hatte, als er dem Paar aus dem überfüllten Ballsaal gefolgt war.
„Was wollen Sie? Bitte erklären Sie mir Ihr Geschäft, und dann gehen Sie“, verlangte Catherine. „Ihre Manieren sind barbarisch.“
„Amerikanisch“, korrigierte er und wusste doch, dass sie vermutlich recht hatte – zumindest nach ihren Maßstäben.
„Ah“, sagte sie mit einem spöttischen Lächeln. „Das erklärt einiges.“ Er war also Amerikaner. Kein Wunder, dass er so ganz anders wirkte.
„Das hoffe ich“, entgegnete Raven höflich, als hätte er den Spott in ihren Worten nicht bemerkt. „Ich bin nicht sehr vertraut mit den anscheinend recht komplizierten Regeln Ihrer Kreise, wie man einer Dame den Hof zu machen hat. Verzeihen Sie mir also, wenn es mir nicht gelingt, stets das Richtige zu sagen. Ich bin ein Mann, der gern sofort auf das Wesentliche kommt. Ich möchte Sie heiraten.“
Catherine öffnete den Mund, sagte aber nichts. Doch dann, als sie den ersten Schreck überwunden hatte, begann sie zu lachen, ehrlich erheitert darüber, dass er glaubte, einfach so aus dem Nichts auftauchen und ihr einen Heiratsantrag machen zu können – ein Fremder mit dem Gesicht eines Indianers und der Figur eines Preisboxers.
Raven zeigte keine Reaktion auf ihre Belustigung. Er hatte nicht erwartet, dass sie lachen würde. Nur wenige Menschen hatten bisher über John Raven gelacht. Allein seine Körpergröße hatte stets einschüchternd gewirkt. Aber er erinnerte sich an die Warnungen seines Bankiers.
Der Amerikaner wartete, und sein Gesicht drückte nichts als Geduld aus. Nach und nach klang ihr Lachen gezwungener, selbst in ihren eigenen Ohren, und sie verstummte.
Er lächelte spöttisch. „Es freut mich, dass ich Sie erheitern konnte. Ich nehme an, dass Sie schon seit Monaten nicht mehr so herzlich gelacht haben.“
„Das war wirklich lustig.“ Sie zwang sich zu einem spöttischen Tonfall. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie komisch ich das finde, Sie und Ihren Antrag. Sie sind der ungewöhnlichste Bewerber, den ich jemals hatte, das versichere ich Ihnen.“
„Zumindest langweile ich Sie nicht“, meinte er leise.
Überrascht stellte sie fest, dass er recht hatte. Sie hatte sich in den vergangenen Minuten nicht einen Moment gelangweilt.
„Es gibt Schlimmeres als Langeweile“, entgegnete sie spöttisch ohne zu merken, dass sie Ambertons Bemerkung wiederholte, die Raven zweifellos auch gehört hatte.
„Das bezweifle ich“, wiederholte er die Worte, die sie darauf gesagt hatte. „Zumindest in diesem Punkt stimmen wir überein.“
„Ich denke, dies ist der einzige Punkt, in dem wir jemals übereinstimmen werden“, sagte sie, öffnete ihren Fächer und bewegte ihn anmutig hin und her.
Einen Moment lang betrachtete er ihre Finger, dann hob er den Kopf und musterte ihr Gesicht. Nie zuvor hatte er eine so schöne Frau gesehen. Trotz ihrer rötlichen Haare hatte sie keine einzige Sommersprosse auf der schmalen, zierlichen Nase. Die langen Wimpern, die die braunen Augen umgaben, waren sehr dunkel. Wahrscheinlich hat sie sie gefärbt, dachte er.
Catherine war dankbar, dass die Dunkelheit ihr Erröten verbarg, während er sie so ausführlich musterte. Ihre anerkannte Schönheit, ein Erbteil ihrer Mutter, hatte stets männliches Interesse erregt, aber er betrachtete jeden einzelnen Zug ihres Gesichtes, als wollte er ihn sich auf immer einprägen.
„Und ich glaube, dass es noch wichtigere Punkte gibt, in denen wir übereinstimmen“, sagte er endlich und sah sie durchdringend an.
„Zum Beispiel?“, wollte sie wissen.
„Zum Beispiel, dass eine Frau nicht unbedingt von einem Mann beherrscht werden muss. Dass ihr ein großes Maß an persönlicher Freiheit zustehen sollte. Mit ein paar notwendigen Einschränkungen, natürlich.“
Sie können dem Mädchen nichts bieten, was es nicht schon hat, hatte Reynolds zu ihm gesagt. Aber Catherine Morley hatte ihm selbst einen Schlüssel gegeben, einen Anreiz, der sie dazu bringen könnte, seinen Antrag immerhin zu erwägen. Sie hatte gesagt, dass sie die Freiheit wollte, und vielleicht, wenn er ihr dies versprach …
„Natürlich.“ Sie lächelte spöttisch.
„Ich biete Ihnen fast grenzenlosen Reichtum. Genügend Geld, um die eleganteste Frau in ganz London zu werden. Sie werden Ihren eigenen Haushalt haben, ganz nach Ihren Wünschen eingerichtet und ausgestattet. Ein unbegrenztes Konto für Vergnügungen. Schmuck, Pferde, Kutschen, Reisen – was immer Sie wünschen, es wird Ihnen gehören.“
Wieder lächelte sie, diesmal fast mitleidig, über seine Naivität. „Und wenn ich Ihnen sage, dass ich diesen Luxus bereits besitze? Können Sie mir etwas bieten, das ich nicht schon habe?“
Er betrachtete einen Moment lang ihr Gesicht. „Die Freiheit“, sagte er wieder, und sie schüttelte einfach den Kopf und lachte. „Sie müssten sich nicht von Männern umwerben lassen, die Sie verabscheuen“, fuhr er fort. „Sie wären frei von den Zwängen der Gesellschaft und befreit von dem Wunsch Ihres Vaters nach einem Enkel.“
„Ah“, sagte sie wieder spöttisch. „Aber um diese besondere Freiheit zu erlangen …“ Sie beließ es bei dieser Andeutung.
„Ich brauche keine Geliebte“, entgegnete Raven sanft. „Ich brauche eine Gastgeberin, eine Dame des Hauses.“ Sie wollte sein Versprechen, dass er keine körperlichen Forderungen an sie stellte, und obwohl ihm nie zuvor der Gedanke gekommen war, dass sie diesen Teil seines Vorschlages ablehnen könnte, wusste er, dass er alles tun würde, nur damit Catherine Morley eines Tages ihm gehörte. Selbst wenn es bedeutete, für eine gewisse Zeit auf das zu verzichten, was sein natürliches Bedürfnis war.
Eine platonische Beziehung hatte John Raven ganz gewiss nicht im Sinn gehabt, aber er war ein sehr geduldiger Mann. Er hatte sich in dieser Geduld seit seiner Kindheit geübt. Er konnte warten, warten auf die Art von Beziehung, die er mit dieser Frau haben wollte.
Es überraschte Catherine, dass sie einen Anflug von Bedauern spürte, als er auf ihre Herausforderung nicht einging. Gütiger Himmel, dachte sie bei sich, warum sollte es mich interessieren, ob er ein Dutzend Mätressen hat oder Hunderte?
„Wie sollte ich dann dem Wunsch meines Vaters nach einem Enkel entsprechen?“, fragte sie. „Oder wird Ihre Mätresse auch das übernehmen?“
„Das sollten wir abwarten. Und vielleicht …“
„Vielleicht?“, fragte sie und lächelte, weil er in die Falle getappt war, die er selbst gestellt hatte.
„Er wird glauben, Sie seien unfruchtbar oder wollen das Bett nicht mit mir teilen – welche Version Ihnen lieber ist. Ich versichere Ihnen, mir ist es egal.“
Sie zeigte ihm nicht, wie sehr seine sachlichen Äußerungen über die mögliche Reaktion ihres Vaters sie schockierten. „Sie verlangen keinen Erben für diesen grenzenlosen Reichtum, den Sie mir zur Verfügung stellen?“
„Vielleicht doch“, sagte er wieder, genauso ruhig wie zuvor, und sah sie an. „Aber Sie können sich soviel Zeit lassen, wie Sie wollen, ehe Sie diesen Wunsch erfüllen.“ Die Worte standen zwischen ihnen. Sie verstand nur zu gut, was er meinte. „Gewiss werden Sie mütterliche Gefühle entwickeln, ehe ich Sie dazu dränge, meinen Familienzweig fortzuführen“, fuhr er fort. „Schließlich sind Sie, glaube ich, erst achtzehn. Oder täuschte Amberton sich auch in diesem Punkt?“
„Wie alt sind Sie?“, fragte sie.
„Vierunddreißig.“
Fast doppelt so alt wie sie. „Warum brauchen Sie eine Gastgeberin?“, fragte sie. Sie verstand nicht, warum sie sich überhaupt der Mühe unterzog, auf den lächerlichen Vorschlag, den er ihr unterbreitet hatte, einzugehen. Vielleicht lag es an seiner Bereitschaft, jede Einzelheit seines Plans mit ihr zu besprechen. Er schien von ihren Fragen nicht schockiert zu sein. Im Gegenteil.
„Ich habe bereits in die britische Industrie investiert …“
„Um welche Art von Investitionen handelt es sich?“, unterbrach sie ihn.
„Kohle“, sagte er und dachte erfreut an die Minen, die bereits jetzt mehr Gewinn brachten, als er beim Kauf erwartet hatte.
In seinen Augen lag ein ganz besonderer Glanz, und sie hörte aus seiner Stimme denselben Besitzerstolz, den sie gelegentlich in den Stimmen von Frauen gehört hatte, wenn diese über ihren Schmuck oder, was seltener vorkam, über ihre Kinder sprachen.
„Ich kaufe Kohleminen“, fuhr er fort.
„Warum?“
„Damit ich die Eisenbahn bauen kann.“ Als Catherine daraufhin verwundert den Kopf schüttelte, zeigte er wieder sein kleines, beherrschtes Lächeln. „Die Kohle ist die Grundlage für die industrielle Entwicklung in diesem Land, und der Mann, der die Kohle kontrolliert …“ Er unterbrach sich und beobachtete einfach nur ihr Gesicht.
„Sie investieren in Kohleminen und Eisenbahnen?“, erkundigte sie sich vorsichtig. Wieder hatte sie das Gefühl, etwas Unwirkliches zu erleben, als sie hier in der Dunkelheit mit einem Fremden zusammenstand und über Kohle sprach.
„Und in Gießereien. Um Eisen herzustellen. Die Männer jedenfalls, die entscheiden werden, welche Richtung die britische Industrie in den nächsten Jahren einschlagen wird, gehören zu den Kreisen, in denen Sie verkehren. Ich muss mit Ihnen sprechen, sie beeinflussen, um den Wert meiner Investitionen zu steigern. Aber ich habe keinen Zutritt zu diesem Kreis und diesen Männern. Ich brauche eine Ehefrau, die mir hilft.“
„Welche Männer?“, fragte sie gegen ihren Willen interessiert. Seine tiefe Stimme hatte etwas Zwingendes.
„Männer wie Ihr Vater. Mächtige, einflussreiche Männer. Männer, die im Oberhaus den Ton angeben und das Land regieren.“
„Solche Männer sprechen nicht beim Dinner über Geschäfte“, erklärte sie ernsthaft, indem sie auf seine Fantasien einging.
„Und nach dem Dinner? Bei Portwein und Zigarren? Wenn die Damen nicht dabei sind?“, fragte Raven. Das hatte Reynolds ihm gesagt.
„Vielleicht“, gab sie widerstrebend zu.
„Aber zuerst …“
„Zuerst müssen sie bereit sein, zum Dinner zu kommen.“
„Ja“, sagte er nur.
Sie betrachtete sein markantes, klar geschnittenes Gesicht.
„Ich kann Sie nicht heiraten“, erklärte sie endlich. Sie zögerte und dachte an all das, was er ihr angeboten hatte. „Selbst wenn …“, begann sie wieder und fragte sich, warum sie überhaupt noch etwas dazu sagen wollte. Es schien fast so, als hätte er sie dazu gebracht, seinen Vorschlag ernsthaft zu erwägen. „Selbst wenn ich wollte.“
„Ihre Freiheit“, erinnerte er leise.
„Mit Einschränkungen“, fügte sie hinzu. Und dann fiel ihr ein: „Sie haben mir die Einschränkungen noch nicht genannt.“ Wie von selbst erwiderte sie sein Lächeln, mit einer Herzlichkeit, die sie sonst nur für ganz alte Freunde aufbrachte.
„Keine Liebhaber“, sagte er. Raven war nicht ganz sicher, was die Konventionen dieser Gesellschaft betraf, aber er hatte seit seiner Ankunft in London einiges über die Moral der besseren Kreise gelernt. Und er wusste, dass er keinem anderen Mann gestatten würde, sie zu berühren. Was immer er ihr auch bezüglich der Freiheit versprochen hatte.
„Wie bitte?“, fragte Catherine erschrocken, und ihr Lächeln verschwand.
„Keine Liebhaber“, wiederholte er und suchte nach einer Erklärung, die glaubwürdig klang. „Ich würde das, was ich so mühsam errungen habe, niemals einem anderen …“
„Wie können Sie es wagen!“, unterbrach sie, ehe er den Satz beenden konnte.
„Davon abgesehen, fallen mir keine weiteren Einschränkungen ein“, fuhr er gleichmütig fort. „Es steht Ihnen frei, zu kommen und zu gehen, wann immer Sie wollen, so viel von meinem Geld auszugeben, wie es Ihnen nur möglich ist, vorausgesetzt, Sie bringen die Männer in mein Haus, die ich brauche, um meine Investitionen erfolgreich voranzutreiben.“
„Ihnen steht es frei, eine Geliebte zu haben, aber ich darf mir keine Liebhaber nehmen. Ist es das, was Sie vorschlagen?“
„Wenn Sie keinen anderen Vorschlag haben, wie meine körperlichen Bedürfnisse erfüllt werden könnten“, sagte Raven und fragte sich, wie er wohl diese Bedürfnisse kontrollieren würde, falls sie wunderbarerweise doch zustimmen sollte, ihn zu heiraten.
„Und was ist mit meinen Bedürfnissen?“, gab sie verärgert zurück. Genau diese Einschränkungen der Gesellschaft hasste sie. Für ihn war eine Geliebte durchaus akzeptabel, aber sie musste sich an seine „Einschränkungen“ halten.
„Ich hatte nicht die Absicht, so etwas zu verlangen.“
„Wie bitte?“, fragte Catherine. Irgendetwas musste ihr entgangen sein.
„Ich wäre selbstverständlich entzückt, Ihre Bedürfnisse zu befriedigen“, erklärte Raven und versuchte, seine Heiterkeit zu unterdrücken. „Allerdings …“
„Wie können Sie es wagen!“, wiederholte Catherine empört. „Ich versichere Ihnen, dass ich nicht möchte …“ Sie konnte nicht glauben, wozu er sie gebracht hatte, und was sie um ein Haar gesagt hätte.
„Das habe ich auch niemals vermutet“, sagte er und verbannte jeden Anflug von Belustigung aus seiner Stimme. „Ich schlage Ihnen nur ein Geschäft vor. Sie müssen heiraten. Sie werden dazu gezwungen sein, und das wissen Sie. Sie möchten die Freiheit, das zu tun, was Sie wollen. Ich biete Ihnen diese Freiheit, mit einer Einschränkung. Einer sehr vernünftigen Einschränkung. Und als Gegenleistung führen Sie mich in die Gesellschaft ein, zu der ich ohne Ihre Hilfe niemals Zutritt erlangen würde.“
„Glauben Sie, Sie können diese Vereinbarung …“