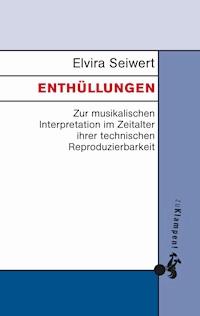
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Adornos Aufführungstheorie, die im Nachlassband »Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion« zusammengefasst ist, blieb fragmentarisch. Elvira Seiwert verfolgt sie in ihren Hauptzügen, setzt sie in Beziehung vor allem zu Benjamin und seiner Findung der »dialektischen Bilder«, nicht zuletzt auch zum Spontaneitätsgedanken Ulrich Sonnemanns. Der Dirigent Michael Gielen schreibt: »Was bei Adorno angedeutet wurde, ist hier breit ausgeführt und mit Beispielen und Analysen belegt, für die die langjährige Rundfunkarbeit der Autorin das phantasievolle Gerüst liefert. Die Arbeit von Elvira Seiwert sollte obligatorische Lektüre all der meist ahnungslosen Musikbeflissenen sein.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elvira Seiwert
Enthüllungen
Zur musikalischen Interpretation im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit
Dieses Buch wird gefördert von der FAZIT-Stiftung.
In seiner ursprünglichen Fassung wurde es unter dem TitelMusikalische Interpretation im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit als Habilitationsschrift 2010 von der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main, Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften akzeptiert.
© 2017 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
Umschlaggestaltung: Groothuis, Lohfert, Consorten · Hamburg
Satz: Paul Fiebig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-86674-659-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Kapitel 1 Musikalische Interpretation im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit
Medien-Lektüren
Lesart 1
Neues vom / zum Radio?
Lesart 2
Konvergenzen oder Über den physischen Effekt als Bedrohung und Attacke
Im Vorfeld der Bilder
Lesart 2 (Fortsetzung). »Die Form der Schallplatte« als »dialektisches Bild«
Im Radio: zwei Fälle
Nadelkurven und Kaiserpanorama
Kapitel 2 Die zuständige Wissenschaft
Positionen
Zur aktuellen Praxis 1: Stationen der Interpretationsgeschichte und Interpretationstheorie (Anfang). Am Beispiel Furtwängler
Zur aktuellen Praxis 2: Perspektiven des Musiklebens. Am Beispiel Furtwängler weiterhin
Apropos Radio
Musikarchiv
Zur aktuellen Praxis 3: Stationen (Fortsetzung). Panoramaschau mit Invarianten
Kapitel 3 Theodor W. Adorno, Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion
»Fragment über Musik und Sprache«
Lesen
Zwischen Benjamin und Kolisch
Im Radio 1: »Charakter …«
Das Zeitmoment
Im Radio 2: »… und Tempo«
Einschaltung (ad libitum): Reproduktion und Wiederholungszwang oder Radio als Form (Interpretationsgeschichte als Universal-Traumatisierung)
Kapitel 4 »Interpretation ist eine Form«. Benjamins Spur in Adornos Reproduktionstheorie und wohin sie wohl führt
Kapitel 5 Bilder
Frühschriften
»Hölle«
Korrespondenzen: Zur Geschichte des Bildes
Landschaft mit »luziferischer Senkrechte«, »Hölle« (Fortsetzung)
Bilderlose Bilder
Auf der Galerie. Zauberoper und Blick der Medusa
In der Schwebe: die Original-Kopie-Konstellation oder »Ritter Gluck«
Nur als Geister im Gedächtnis. Nur den Geistern ein Gedächtnis?
Kapitel 6 Modelle
Modell I Svjatoslav Richter und Glenn Gould. Anhand von Haydn (Anfang)
Voraussetzungen 1: Portrait-Skizzen vor Betriebs-Hintergrund
Voraussetzungen 2: Zur Subjektivität des Interpreten
»Sponte«
Svjatoslav Richter und Glenn Gould. Anhand von Haydn (Schluß)
Wer ist der Intrigant?
Modell II Im Radio: Franz Schubert, Deutsche Tänze vom Oktober 1824. Für Orchester gesetzt von Anton Webern (1931)
Modell III Rosamunde oder die Emanzipation. Zu einer Schubert/Webern-Montage von Michael Gielen
Bilderwelt
»… in einem idyllischen Tal«
Märchenland?
Vorgeschichte 1: Von der Geschichte der Themen und der Geschichte als Thema
Vorgeschichte 2: Montage
Der Dirigent als Physiognomiker
Anhang
Von der (Un-)Möglichkeit musikalischer Interpretation. Ein Radioprojekt
Ein Musikfeuilleton 1: Auf der Suche nach dem Original
Ein Musikfeuilleton 2: Neumen, Noten, Nadelkurven
Literaturverzeichnis
Fußnoten
Einleitung
»Nicht Trostlosigkeit ist die Mutter der Phantasie, sondern Freude. Phantasie ist mimetisch, nicht kompensatorisch.«
(Hermann Schweppenhäuser, Dicta importuna1)
Was heißt hier »Enthüllungen«?
Zunächst einmal – nicht immer gilt’s ja gleich, Spektakuläres zu ›entbergen‹– die Dinge schlicht beim Wort nehmen. »Things are what is said about them«2, sagt Komponist Herbert Brün, anschleichendem Hintersinn sogleich den Weg abschneidend. Friedrich Nietzsche, vergleichbar vom Ergebnis her, steuert, aus der Gegenrichtung, die Geschichte bei vom Schleier, wie ihn Gewohnheit und Vergeßlichkeit mal grob, mal fein gewebt: »Der Ruf, Name und Anschein, die Geltung, das übliche Maß und Gewicht eines Dinges – im Ursprunge zu allermeist ein Irrtum und eine Willkürlichkeit, den Dingen übergeworfen wie ein Kleid und seinem Wesen und selbst seiner Haut ganz fremd – ist durch den Glauben daran und sein Fortwachsen von Geschlecht zu Geschlecht, dem Dinge allmählich gleichsam an- und eingewachsen und zu seinem Leibe selber geworden«3. Vergessen also in der Zeit, und weil man sich an ihn gewöhnt4, sind Zweck und Final-Effekt besagten Überwurfs (am Ursprung schon von schlechtem Sitz), der jetzt gleichwie »vom Himmel hoch« gefallen scheint und nun, von Glaubens wegen, autoritär erstrahlen kann. Mal heilig, mal profan.
Sofern er sich ›verwissenschaftlicht‹, mag er zu beidem werden. Georg Forster (ohne daß er damit Karriere gemacht) warnte früh schon »vor jenem in allen Wissenschaften noch so wirksamen zünftigen Despotismus, der […] darauf ausgeht, die Menschen in den Zauberkreis eines Systems zu bannen, ausser welchem die Wahrheit nicht anzutreffen seyn soll, und innerhalb dessen Bezirk gleichwohl die Beschränktheit des Raums und die Armuth der Ideen die Hälfte unserer Anlagen zur Unthätigkeit verdammen, indeß die andere ein mechanisches opus operatum treibt.«5 Des Schleiers Heiligung kam man dann später auf die Spur. Im Anschluß an Emile Durkheims Tradition, nach welcher »die soziale Gruppe als Ursprung des Heiligen« angenommen, sie, in »mystischer Vergegenständlichung«, zum Maßstab von »Rechtschaffenheit und Wahrheit«, ja, »jeglicher Legitimität«6 erhoben ward, ließ sich, mitten hinein in Forsters »Zauberkreis« akademischer Institutionen, investigativ die Frage stellen: »Can we say absolutely anything we like?« Die Antwort gibt sich wie von selbst. Das zugehörige Tableau – als Kampfplatz dekoriert (die »große Waffe der Akademiker zur Abwehr neuer Interpretationen ist die Gleichgültigkeit«) – zeigt sich von drei Prinzipien reguliert: »institutioneller Mitgliedschaft, institutionalisiertem Wissen und institutioneller Kompetenz«, welche ihrerseits aus sich heraus die Regel geben: »Nicht alles kann gleichermaßen für möglich gehalten werden, vielmehr stellt eine solche ›Omnipossibilität‹ geradezu eine Häresie dar.«7
Da also ist es nun, das Wort, das die bunte Fahne, Symboltuch der Eintracht, zum Schleier macht, der den Kampfplatz fadenscheinig überwebt. Der »Stabilität gelehrter Traditionen« (»Wir können nicht reden, wie es uns gefällt, denn die akademische Wissenschaft paßt auf«8), die solchen Garantien sich verdankt, korrespondiert konfektioniert-stabilisierte Wahrheit, deren Schnitt und »schlechter Sitz« dem »Überwurf« aus Nietzsches Atelier zum Verwechseln ähnlich scheint. Solcher Mode Zeit? Ist die ›reine‹, rein chronometrische, geschichtsbereinigte. Sie allein bürgt für die Ewigkeit, dank Ausschluß von Geschichte und Vergänglichkeit. Die Wahrheit demnach? Die andernorts – nach anderm »Theoriedesign«9 – dank eines »Zeitkerns« sich in Bewegung zeigt: scheint wie ›entkernt‹. Was dann tatsächlich, wo es begegnet, zu »enthüllen« bleibt.
›Nicht die Wahrheit, eine andere Wahrheit!‹10 wäre (mit einer Paraphrase Kierkegaards) notwendig zu reklamieren. Da nun kommt ein andrer Schleier in Betracht, von gänzlich anderer Textur. Walter Benjamin, in kritischer Tradition gleichsam der »Lehrlinge zu Sais«, sucht ihn, im Essay über »Goethes Wahlverwandtschaften« und bei Gelegenheit der Reflexion von Kunstkritik, zu fassen: »Nicht Schein, nicht Hülle für ein anderes ist die Schönheit. Sie selbst ist nicht Erscheinung, sondern durchaus Wesen, ein solches freilich, welches wesenhaft sich selbst gleich nur unter der Verhüllung bleibt. Mag daher Schein sonst überall Trug sein – der schöne Schein ist die Hülle vor dem notwendig Verhülltesten. […] Hier gründet die uralte Anschauung, daß in der Enthüllung das Verhüllte sich verwandelt, daß es ›sich selbst gleich‹ nur unter der Verhüllung bleiben wird.«11
Das Geheimnis also, das es zu enträtseln gilt, liegt an der Oberfläche. Die freilich nicht geglättet, nicht ›harmonisiert‹, vielmehr als Physiognomie, als reaktive Gestaltung, zu erkennen und zu lesen bleibt. Die angemessene Zeit: ist die, wie Geschichte je sie prägt. So mag sie fließen, springen, stillestehen; zerspringen gar, im äußersten, extremen Fall – doch kaum je ohne eine Spur zu ziehen und zu hinterlassen.12
Musikalische Interpretation im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit
Überhaupt wollte Walter Benjamin seinen Kunstwerk-Essay13 als »Manifest« verstanden wissen: »gegen den Faschismus und dessen Ästhetisierung der Politik«, welcher er »die Gründung der Ästhetik auf Politik« kontrastierte. Dem komme das Kunstwerk selber entgegen, insofern es per technischer Reproduzierbarkeit »sich seiner angestammten Reservate und tradierten Qualitäten«14 begebe. Es sind die Bild-Medien, deren anscheinend vielfältig aufklärerisches Potential im Zustande ihrer massenhaften Reproduzierbarkeit Benjamin mit anklingender Zuversicht diskutiert. Frage: ob eine analoge Diskussion für die Reproduktion von Musik, ein Transfer quasi der Benjamin-Thesen möglich sein könnte? »Reproduziert« ja wird Musik – sofern sie ›gemacht‹– von vorneherein. Was aber bedeuteten die dazumal neuen Reproduktions-Medien für sie? wurden tatsächlich neue Qualitäten geschaffen? wurde in die Verhältnisse des Originals eingegriffen? Respektive: was wäre das ›Original‹ der Musik selbst schon im Moment ihrer originären – nicht erst im Zustand ihrer technischen – Reproduktion? Fragen wie diese – Benjamin hatte sie für Film und Fotografie formuliert – ließen sich, versuchsweise, der Musik applizieren.
Der Medienaspekt ja zeigt sich im Musikfall in vielfacher Vermittlung. Musik, aufgeführt, wird aufgezeichnet, mittels Ton- resp. Datenträger reproduziert, per Massenmedien verbreitet. Die Tontechnik – diskreter Schatten oder Strippenzieherin ex machina – ist immer mit dabei. Angesichts ihres Ursprungs im Funk- und Fernmeldewesen, ihrer Kompetenz als Nachrichten-Medium, muß sie es sich gefallen lassen, daß man sie befragt: ob sie in einer »genuin instrumentellen Dimension des Mittel-Zweck-Verständnisses«15 aufgehe – ohne Rest und Rückstand; oder ob nicht in ihr, vom ursprünglichen Zweck ungeheilt, und ihrem Medienstatus entsprechend, ein »gar nicht zu überschätzendes, wenn auch diffus theologisch-sakrales Erbe«16 fortwese – an dessen Auflösung schließlich, nach Benjamin, gelegen wäre. Dieses opake Netzwerk zu durchleuchten nach Maßgaben, wie die Musik sie stellt, ist eine der Angelegenheiten vorliegender Arbeit.
Die wiederum ihren Ausgang gleich beim reproduzierenden Medium selber nimmt: bei dessen frühem Auftritt vor einem (von der Zeitschrift »Pult und Taktstock« 1925 versammelten) Forum von Komponisten, Dirigenten, Musikern im allgemeinen. Als Herold des »Medienumbruchs«17 präsentiert sich Hans Heinz Stuckenschmidt, vorauseilend Anpassung proklamierend – der Musik an ihre mediale Vermittlung, des Zwecks ans Mittel. Zur gleichen Zeit: hält das Radio als Produktionsinstanz Einzug in die Geschichte der Musik-Reproduktion – mit Gesten ›gelingender Anmaßung‹ sogleich. Wenn auch Aufnahmetechnik und Verbreitungsmedium noch in den Kinderschuhen stecken, wird normativ agiert: wird technische Insuffizienz in ästhetische Maßgabe verwandelt (Stichwörter: Neue Sachlichkeit, Kammerorchester). Wie, notabene, dieser Medien-Auftritt sich gestaltete, Radio-Geschichte weiterverlief: daran war ihre Zukunft fast schon abzulesen; gleichgültig gegen Inhalte, wird es, das Radio, am Ende zu dem geworden sein, was es am Anfang war: Alarmmedium, »Groschengrab«18.
Ein Gespür aber für die Gefahr, daß das Medium bei seiner instrumentellen Funktion kaum sich bescheide, vielmehr weit und hinein wirke in Belange von Anthropologie und Ästhetik, bildete sich synchron. So konstatierte Adorno in den 1950ern, sich einer Radioübertragung von Beethovens Siebter unter Arturo Toscanini erinnernd: es klang so, »als wäre mit der ersten Note die Musik bereits vorentschieden wie eine Grammophonplatte, anstatt zu entstehen; als gliche die Interpretation selber bereits ihrer mechanischen Übertragung«19. Früher schon und düsterer noch: »Während unaufhaltbar Interpretation der Treue mechanischer Darstellungsmittel überantwortet wird, die das steinerne Bild ihrer abgestorbenen Formen schaffen, beginnen die absterbenden Werke selbst sich zu zersetzen.«20
Wider das Reinheitsgebot
Lange alleine- und stehengelassen wurden Phänomen und Problem der (technischen) Musik-Reproduktion von der Musikwissenschaft. Als Thema blieb es den Medien überlassen: Schauplatz und monopoler Markt von Musikpraxis und Interpretationskultur. Standhaltende Reflexion allerdings war kaum ihr Metier noch Geschäft. Jedoch, noch einmal: die Musikwissenschaft hielt lange abseits sich und unberührt.
Ihren Impuls zu einer Archäologie der Musik-Reproduktionsgeschichte erhielt die vorliegende Arbeit denn auch vor Zeiten im und durchs Radio – ohne daß freilich seinerzeit theoretisches Rüstzeug zur Tiefenschürfung irgendwo in Sicht gewesen. Musik im Radio schien Ansichts- oder Glaubens-Sache. Eine unentschiedene Situation, in welcher der Primat der Institution (Universität versus Massenmedium) sich behauptete eher, als daß man sich an der gemeinsamen Sache orientierte. Als ob ein Medium, welches sich von der Verantwortung für das, was es vermittelt, entpflichtet, sich nicht ebenso in Frage stellen lassen müßte wie ein Wissenschaftsbetrieb die Nachfrage erlauben, wie er’s denn mit der Praxis halte (für die auszubilden ja immerhin auch Aufgabe und Gebot). Im nicht akzeptierten Modus des aufeinander Verwiesenseins kommt die Not eines zerteilten Ganzen zum Ausdruck: »Das eine Teil ist dem andern ein Anderes; Fremdes; ein Abgetrenntes, also Verwundendes«. Die Angst vor der Berührung verhindert ein Zusammenstimmen, Kooperieren – »in Harmonie oder in Integrität«21 –, wodurch eben beide die je eigene Chance und damit das gemeinsame Ganze verspielen.
Die vorliegende Arbeit nun denkt sich diesbezüglich vermittelnd. Mit Vermittlungen umzugehen, ohne diese selber zu umgehen dabei, kann auch bedeuten, Fragen nach Anwendungen zuzulassen sowohl, wie selber medial vorzugehen. (Auch von daher die eingestreuten Rundfunksendungen: als Dokumentation der Möglichkeiten von Musik im Radio gedacht – stets eingedenk des vertrackten Doppelaspekts von Reproduktion.)
In den 1990er Jahren schließlich öffnet die Musikwissenschaft sich zunehmend der negligierten Reproduktionsproblematik, konzediert, daß diese »die Interpretationskunst vermutlich stärker verändert« habe als alles bisher Dagewesene. Hermann Danuser, 1996: »Die Praxis der Interpretationspädagogik, aber auch die Theorie der Interpretationskunst hinken weit hinter den aktuellen Perspektiven, die diese Tatsache aufwirft, hinterher«22. Veröffentlichungen zu Einzelproblemen mehren sich. Ausdrücklich gar auf eine Theorie hinaus will der insgesamt dem Problem gewidmete Band des »Neuen Handbuchs der Musikwissenschaft«.
Ein solitärer, neue Bahnen öffnender und alte ungewohnt justierender Markstein in der Problemgeschichte: Adornos 2001 aus dem Nachlaß veröffentlichte Fragmente »Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion«. Ihrer Kontextualisierung und Interpretation gelten weite Teile dieser Arbeit. Zentral Adornos These: »Interpretation ist eine Form«. Womit eine Spur gelegt ist, in welcher das Eigenrecht der Interpretation sich begründen, »Glaubens- und Ansichts-Sachen« hinsichtlich musikalischer Reproduktion sich widerlegen, als Vorurteil wo nicht Ideologie enthüllen lassen.
Für ein begründetes Verständnis der Fragmente war auf den Diskussionszusammenhang von Adorno und Benjamin in den 1920er und 1930er Jahren zurückzugreifen; waren einschlägige Schriften Benjamins zu konsultieren: insofern Adorno aus ihnen Motive rekrutiert, deren Niederschlag vielerorts in den Fragmenten begegnet. Neben besagter These von der Interpretation als Form sind es Aspekte der Medien- und Reproduktions-Problematik; Reflexionen der Bildform und Allegorie; ist es Sprach- und Übersetzungstheoretisches schließlich.
Adornos Fragmente, Skizzen, Materialien umkreisen das Reproduktionsthema, nähern sich ihm von allen Seiten. Sie repräsentieren (auch) einen historischen Stand der Reproduktion: wie er im Schönberg-Kreis generiert, durch Kolisch und Steuermann zumal tradiert wurde. Den Aufführungslehren älterer Zeit vergleichbar haben sie ihren historischen Grund, sind aber, im Unterschied zu jenen, grundsätzlich auf Aktualisierung aus. Hier rückt die These vom »Ausdruckszusammenhang« ins Zentrum, nach der »die Wahrheit der Interpretation nicht in Geschichte als ein dieser Fremdes und ihr Ausgeliefertes liegt, sondern Geschichte in der Wahrheit der Interpretation, als ein nach deren immanenten Gesetzen sich Entfaltendes«23. –
Gleichwie auf die theoriebedürftige Reproduktions-Situation gemünzt schreibt Adorno an Benjamin im Jahre 1938: »Das Aussparen der Theorie affiziert die Empirie. Es verleiht ihr einen trügend epischen Charakter auf der einen Seite und bringt auf der andern die Phänomene, als eben bloß subjektiv erfahrene, um ihr eigentliches geschichtsphilosophisches Gewicht.«24 Eine den »empirischen« Reproduktionen genuin sich anmessende Theorie wäre, im Glücksfall, zu denken nach Art von Goethes »zarter Empirie«, »die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird«25. Hier kommen mimetisches Vermögen und dialektische Bilder ins Spiel – ihnen gelten das vierte und fünfte Kapitel. (Beide Begriffe finden sich schon, wie hingewürfelt, im Schematisierungsversuch der Reproduktionstheorie, den Adorno unter dem Datum des 21. Juni 1946 in Los Angeles zu Papier gebracht.26)
Der »zarten Empirie« gewissermaßen auf der Spur: die »Modelle« des letzten Kapitels, »historisch-materiale Prototypen«, »in denen das Typische, Besondere und Einzelne, das es zu erforschen und zu ›erhärten‹ gilt, planartig (wie die Landschaft auf einer ›Landkarte‹, das Sternbild auf der ›Sternkarte‹ […]) […] abgebildet ist«27. In zwei von ihnen ist Schubert im Zentrum, einen Gestus gleichsam reproduzierend, wie Adorno ihn in der Reproduktionstheorie vorgebildet: »Um jene Schubertschen Melodien zu retten vor dem Ruhm, den sie doch wiederum ihrer unvergleichlichen Schönheit verdanken, müssen sie wie aus der Erinnerung gespielt […] werden«. Michael Gielens Schubert / Webern-Montage (Modell III) enthüllt, durch ein multiples Spiel mit der ›ordentlichen‹ Chronologie, eine verstörende, das historische Ordnungsgefüge demontierende Verwandtschaft; führt hörbar vor, daß bei Schubert anklingt, was Webern nicht fremd ist. Und schon wird das »Vergangene« zur Sache »gegenwärtiger Erfahrung«28.
Die den Gang dieser Arbeit begleitende Radio-Spur, zunächst gewissermaßen synchron verlaufend, sich verlierend unterwegs, wiederaufgenommen in einem der »Modelle«, auslaufend in den Anhang, hat ihren zentralen (»ad libitum« zu handhabenden) Auftritt im dritten Kapitel, wo, Stichwort »Interpretationsgeschichte als Universal-Traumatisierung«, eine Möglichkeit des »Radios als Form« demonstriert sein will. Das Medium – mittels ›atlantischer Allüre‹: einem immer tieferen Absinken, Abtauchen, hin zur finalen Katastrophe, welche sich mit den Mitteln des Radios, also akustisch, simulieren läßt – bei seinen Möglichkeiten genommen: mit Räumen zu arbeiten, sie ›auszuleuchten‹, Zeiten zu verschränken, vielseitig zu montieren, wie’s ja auch, und noch immer enklavenhaft zulässig, der Fall der Radiokunst.
Der Anhang dient der Dokumentation, was im und mit dem Radio möglich war und wäre. Als gelte es, einen Beweis für Hegels Doppelsinn zu liefern, will veranschaulicht sein, daß es, während sich das Radio mit seiner sich selbst abschaffenden Aufhebung beschäftigt, hier an der aufhebenden Bewahrung eines Zusammenhangs gelegen ist, wie er im Radio sich wohl bald nicht einmal mehr träumen läßt.
Zum Verfahren schließlich, in methodenegalisierten Zeiten und entlang des doppelsinnigen »Enthüllungs«-Postulats: es orientiert sich, in Hinsicht auf Tempo und Dynamik, an Nietzsches Verständnis von Philologie als einer »ehrwürdigen Kunst«, »heute nötiger als je«, »in einem Zeitalter der Hast, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit allem gleich ›fertig werden‹ will«, selbst aber »nicht so leicht (fertig) irgend womit« wird; und folgt Adornos (allgemein gewendeter) Analyse-Forderung: dem ›Komponierten‹ »das vorzugeben, was (es) sich selbst vorgibt, um überhaupt in (seine) Struktur analytisch eindringen zu können«29. Statt also es dem zu Klärenden, zu Erforschenden, vorauseilend, mit »Bescheidwissen ›zu geben‹«30, will sich der Impuls, mit Nietzsche wieder, »gut (zu) lesen«, etablieren, »das heißt langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offengelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen«31. Von daher mögen Zitate, nicht durch übereilte Wortabschneiderei lädiert oder voreiliges Interpretieren (wie’s ja oft nur getarnte Meinung oder schlechte Übersetzung ist32) korrumpiert, für sich sprechen zunächst, ehe ihnen, nach dialogischem Prinzip und mit dialektischen Mitteln, nahegerückt, sie verwickelt werden in, entwickelt nach Verfahren von Kommentar, Konstellation, Montage.
»Nur wenn, was ist, sich ändern läßt, ist das, was ist, nicht alles«33? Zu imaginieren immerhin, was und wie’s anders sein könnte, dazu verhalfen – im Horizont Kritischer Theorie: Hermann Schweppenhäusers Anwendungen und Aktualisierungen; Paul Fiebigs musikbetriebskritische Radio-Praxis; Michael Gielens physiognomisches Dirigieren. Ihnen ist diese Arbeit verpflichtet. Dank gilt der FAZIT-Stiftung, die sie durch ein großzügiges Stipendium und ausdauernde Langmut möglich gemacht hat.
Berlin 2010/2016
Kapitel 1
Musikalische Interpretation
im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit
»Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt. Man ahnet, man sieht auch wohl, daß es nur ein Behelf ist; liebt sich nicht aber Leidenschaft und Parteigeist jederzeit Behelfe? Und mit Recht, da sie ihrer so sehr bedürfen.«
(Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen34)
Als wollte er dem technisch-medialen Aspekt gleich von Beginn an begrifflich Rechnung tragen, spricht Adorno schon früh, in einer ersten kleinen Arbeit zum Thema35, von »Reproduktion«36 statt von »Interpretation«. Ohne der allein schon durch den Begriff »Interpretation« evozierten Mehrdeutigkeit nachzugeben, springt so der Akzent von selber aufs Nachschaffen, Nachahmen; wird überdies der (Neben-)Gedanke ans reproduzierende Medium zugelassen. Das freilich seinerseits (als, vom Begriff her, ›Mitte‹, ›Mittleres‹, ›Vermittelndes‹) vieldeutig schillernd in, historisch, wandelnden Gestalten erscheint. Einen zumal spiritualistisch-spiritistischen Auftritt hat es in Zeiten der Romantik. In E.T.A. Hoffmanns Erzählung vom »Ritter Gluck« etwa erscheint ein Phantom des »Ritters« als Medium, das die Verhältnisse von Glucks Originalkompositionen reproduziert und dabei in neuer Weise ordnet37; aktuell versorgen die Mittel der Digitalisierung mit neuen, virtuellen Welten. Herbeizitiert jedenfalls ist als zugehöriger Bereich die Medientheorie.
Die – notabene – selbst heute auf Grundlegungen, wie sie Benjamins Essay vom »Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« liefert, nicht nur nicht verzichten will, vielmehr solchen Frühgeschichts-Reflexionen eine Konjunktur beschert. Die Jahrtausendwende ist das Datum, an welchem zurückgeschaut und der Kurs der Mediendiskussion resümiert werden wollte. Und so informiert das rechtzeitig erschienene »Kursbuch Medienkultur«: daß die seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ausgebildeten Medien nicht allein als die Instrumente, die sie vorgeblich sind, zu lesen, sondern »gerade als Instrumente« selbst zu »Quellen kultureller Praxis« geworden wären und eine ihrer Eigenwilligkeit sich anmessende Deutung erforderten. Freilich sei die Disziplin »Medienwissenschaft« verhältnismäßig jung, ihre Geschichte »noch nicht geschrieben«. Das liege nicht zuletzt »an der Unklarheit darüber, wessen Abkömmling das, was sich heute Medienwissenschaft nennt, eigentlich sei«. »Denn hier«, heißt es weiter, »treffen die Auslagerungen der alten und erprobten Philologien, der kunst- und geschichtswissenschaftlichen Disziplinen, mit Nachrichtentechnik, Publizistik, Ökonomie, kommunikationswissenschaftlichen und wissenshistorischen Fragen in einem unbestimmten Mischungsverhältnis aufeinander und machen nur deutlich, daß ein gemeinsamer Ort ungewiß und ein gemeinsamer Gegenstand wenigstens problematisch ist.« Als ›Ausweg‹ wird ein »erstes medientheoretisches Axiom« statuiert: »daß es keine Medien gibt, keine Medien jedenfalls in einem substantiellen und historisch stabilen Sinn«. Allenfalls winke ein »gemeinsamer Horizont«, vor dem Medien dann als »systematisierbare Objekte« erkannt werden könnten, die das, »was sie speichern, verarbeiten und vermitteln, jeweils unter Bedingungen stellen, die sie selbst schaffen und sind«. Womit wieder in eine bewährte Flugbahn eingeschwenkt wäre, deren Kurs von einem weiteren »Klassiker« der Medientheorie eingestellt worden war: Marshall McLuhans »Magischen Kanälen« aus den frühen 1960er Jahren und seiner lakonischen These, daß »das Medium die Botschaft« sei38. Im Versuch, den weiten Horizont auf die Dimension eines (unter Umständen) bestellbaren Untersuchungsgebietes zu komprimieren, heißt es bei Tholen: »Die von der Mediengeschichte über die Mediensoziologie bis zur Medienästhetik inzwischen anerkannte, aber epistemologisch noch nicht abschließend geklärte Frage, ob Medien den Wandel von Gesellschaft, Kultur und Wahrnehmung konstituieren oder nur sekundär begleiten, führte zur Begründung zumindest eines einheitlichen Forschungs- und ›Grabungsfeldes‹, das man […] gemäß der starken Bedeutungsvariante des Medienbegriffs die ›mediologische‹ Perspektive einer gewiß noch nicht kanonisierten Medienwissenschaft nennen kann.«39
Eine Medientheorie, welche die Sache der Musik betriebe, fand sich seinerzeit nahezu ausschließlich – da von zuständiger Seite kaum eine Widerrede deutlich wurde – in den Händen der allgemeinen Disziplin, wo ihr, dank der allgemeinen Verunsicherung, auf eigentümliche Weise zugesetzt werden konnte. So etwa in den technikfrohen und zeitgeistaffinen Arbeiten von Norbert Bolz, der, in Marshall McLuhans Spuren, sich zu Wagners »Gesamtkunstwerk« aufmacht, das »aus der Immanenz der Gutenberg-Galaxis nicht zu verstehen« sei40. Nietzsche (wie ihn der französische Strukturalismus versteht) ist sein Zeuge: von »medienästhetischer Prägnanz« sei dessen »Kampfparole: ›Überwindung des Begriffs ›Litteratur‹ –: Wagner.‹« »Das«, meint Bolz, »ist die radikale Antithese zu jeder vergeistigten Musikästhetik, von der Adorno meint, daß sich das adäquate Hören neuer Musik eigentlich im einsamen Studium der schweigenden Partitur erfülle. In Wagner zerbricht die durch Lesen, Schreiben und Studium kontinuierte Tradition der Gutenberg-Galaxis«. Und: »An die Stelle von Literatur tritt eine viel strengere Form von ›Styl-Überlieferung‹, nämlich körperliche Einschreibung. Die musikalische Praxis des Gesamtkunstwerks ist ›nicht mit Zeichen auf Papier, sondern in Wirkungen auf menschliche Seelen eingeschrieben‹. Diese Einschreibung ist Einübung eines neuen Sprachvermögens – antimodern in dem genauen Sinne, daß sie gegen die Konvention der Gutenberg-Galaxis gerichtet ist. Wagner ist der Herold derer, die in der ›absoluten Verstandessprache‹ der Moderne ›gewissermaßen nicht mitsprechen‹ können und deshalb in die Musik ›flüchten‹«. Eine Flucht, die bekanntlich in Deutschland schon einmal fatale Karriere gemacht, und deren »Einschreibungen« Ulrich Sonnemann als psychohistorisches Verhängnis der Deutschen diagnostiziert hat. Kein Grund also zum Feiern. Bolz aber – unbekümmert um musikalische Sachverhalte, sich am jargonkonformen Gleichklang Genüge tuend: »Rauschmusik erobert das Spektrum des Rauschens«41 – feiert den Dithyrambus als Reflexions-Ersatz: »So beginnt mit Wagners Gesamtkunstwerk ein Exerzitium der Sinne, an dessen Ende sich die elektronischen Medien zu einer neuen mythischen Welt zusammenschließen werden«. Das Licht, in dem diese schöne neue Welt aufblitzt, verdankt sich einem Kurzschluß von McLuhan mit Wittgenstein, bei dem die Musik endlich vollends auf der Strecke bleibt. »Denn die Welt ist alles, was unsere Sinne in ihren medialen Extensionen inszenieren«42. –
Medientheoretische Reflexion seitens der Musikwissenschaft jedenfalls akzentuiert zumal den »Mittel«-Aspekt der neuen Medien, unterscheidet sich insofern grundsätzlich von der allgemeinen Medientheorie. Einschlägig hier: die Arbeiten von Hermann Gottschewski. Dem »Remastering« historischer Aufnahmen – ehemals mit Rauschunterdrückung sich bescheidend (Bolz’ Rauschmetaphysik als kuriose Pointe) – eröffnet die digitale Technik Möglichkeiten des Eingriffs in Klangfarbe, Dynamik und selbst Agogik, so daß die Gefahr, daß »vom Original nicht mehr viel übrig bliebe«, nicht von der Hand zu weisen sei. »Daß dabei der Bearbeiter als erneuter Interpret in Erscheinung tritt, eröffnet für unsere pluralistische Kultur neue Perspektiven« – und vervielfältigt die Probleme der Interpretationstheorie. Allein: die Frage nach der Bedeutung des Mediums selber (schon die nach der Abbildungs-Zuverlässigkeit des ›Originals‹, i.e. des ›originalen‹ Tonträgers) – sie wird hier nicht gestellt.43
Adornos früher Reproduktions-Essay übrigens war seinerseits Reaktion, gliederte sich ein in eine Umfrage der Zeitschrift »Pult und Taktstock« zum Thema »Mechanisierung der Musik« von 1925. Hier, in der von der Wiener Universal Edition herausgegebenen, als »Fachzeitschrift für Dirigenten« konzipierten Zeitschrift – mit Erwin Stein als verantwortlichem Schriftleiter (Erscheinungszeit 1924 bis 1930; dann sang- und klangloses Ende respektive offizielle Überführung in die andere UE-Zeitschrift, den »Anbruch«) – läßt sich der Doppelaspekt von Reproduktion in krisenhafter Frühzeit studieren. In weiträumigem An- und Umgang werden diskutiert: die damals junge Radiotechnik samt der ihr verschwisterten Mechanisierungsmöglichkeit der Musik44, sowie, ebenso assoziiert und polemisch unters Stichwort »Dirigentendämmerung« gefaßt, Anmerkungen über den Komponisten als den »wahren« Interpreten seiner Musik. In seinem Artikel: »Über den Vortrag von Schönbergs Musik« schreibt Erwin Stein: »Der Behauptung […], ›es wäre am besten, wenn immer der Komponist selbst seine neuen Werke einstudieren und dirigieren würde‹, ist von vielen Dirigenten widersprochen worden. Es sei nicht die Regel, daß ein guter Komponist auch ein guter Kapellmeister sei, zur Interpretation bedürfe es einer gewissen Distanz usw. Ich gestehe, daß ich bei meiner Behauptung in erster Linie an einen Standard-Fall gedacht habe: an Schönberg und seine Werke. Und wenn auch jetzt der Widerspruch nicht verstummt, so muß doch gesagt sein: Es geht hier nicht um das Handwerkszeug des Dirigenten, nicht um deutliche und suggestive Zeichengebung, nicht um temperamentvolles Anpacken und dergleichen, auch nicht um die Erzielung einer Wirkung auf das Publikum, sondern vor diesen Dingen zuerst einmal um etwas Ernsteres. Es geht um die wahrhafte Gestalt dieser Musik, die sich von jeder anderen so sehr unterscheidet. Und die weiß doch wohl der Komponist am besten.«
Womit das fundamentale Problem benannt und der gordische Knoten gelöst wäre? Jedenfalls: wenn der Komponist tatsächlich der prädestinierte Interpret seiner Werke wäre, dann ja ließen sich mittels der damals schon gegebenen Möglichkeiten der »Mechanisierung der Musik« (so ja auch der Titel des einschlägig-programmatischen Artikels aus der Feder Hans Heinz Stuckenschmidts) so gut wie alle Interpretationsprobleme in einem Aufwasch erledigen.
Stuckenschmidt konstatiert in seinem Beitrag – ökonomische und ästhetische Probleme zur Engführung nötigend –, erstens, die, aufgrund chronisch schiefer Kosten-Nutzen-Relation, nurmehr parasitäre Existenz der großen Orchester; postuliert, dagegen, die hochspezialisierten, kostengünstigeren Formationen des Kammerorchesters: mit der Maßgabe als Hintersinn, die Musik auf die Abbildmöglichkeiten des neuen Mediums, des Radios, zuzuschneiden, das seinerseits als Funktionär im Hintergrund der Argumente Kontur gewinnt45. – Den Kreis der an der medientauglichen Kunstproduktion Beteiligten programmatisch abschreitend, gerät ihm schließlich der Interpret ins Visier: in seiner Antiquiertheit als Mensch, als Mängelexemplar. Die Mode von damals, die »neue Sachlichkeit«, bestimmt die Textur des fadenscheinigen Arguments. »Das zunehmende Bedürfnis unserer Zeit nach Präzision und Klarheit erhellt immer mehr die eigentliche Unfähigkeit des Menschen, als Interpret von Kunstwerken zu gelten.«46 Der Beweis, die Überforderung des Menschen betreffend, führt übers Kunstwerk: argumentiert wird mit der Uneindeutigkeit der musikalischen Notation als Schrift; sowie dem Tempo als, so es lediglich unverbindlich charakterisierend über die gängigen italienischen Bezeichnungen gewonnen werde, historische Kategorie. Durch Mechanisierung aber, per Metronom, ließe sich »ein absoluter Maßstab für den Zeitablauf eines Tones [?!]«47 angeben, der Wünschelrutengang nach zu eruierenden Charakteren abblasen. Das »Tempo« aber, abseits seiner empiristischen Reduktion und im Sinne einer »Gabe, den Geist an jenem Zeitmaß teilnehmen zu lassen, in welchem Ähnlichkeiten, flüchtig […], aus dem Fluß der Dinge hervorblitzen«48, käme kaum mehr in Betracht, müßte nicht länger bedacht werden.
Eigentümlicherweise, so Stuckenschmidt weiter, habe die Dimension des Tempos allein bisher in der Geschichte ihre Maschine gefunden, und »merkwürdigerweise« sei man erst später darauf verfallen, »auch alle anderen Elemente zu mechanisieren, d.h. der Maschine völlig die Interpretation einer Musik anzuvertrauen«49
NB. Stuckenschmidts Spekulation ist zeitgemäße Aktualisierung eines immer wiederkehrenden Traums, in dem sich erste Natur im Spiegel der Technik beschaut. Eine Planskizze des zugehörigen Panoramas zeigt im steten Wechsel: wie der Natur – mittels Maschine – ihre Defekte ausgetrieben; der Maschine, qua Technik, Natur eingebleut werden soll. In Johann Joachim Quantz’ »Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen«50 heißt es: »Man könnte eine musikalische Maschine durch Kunst zubereiten, daß sie gewisse Stücke mit so besonderer Geschwindigkeit und Richtigkeit spielete, welche kein Mensch, weder mit den Fingern noch mit der Zunge nachzumachen fähig wäre. Dieses würde auch wohl Verwunderung erwecken; rühren aber würde es niemals: und wenn man dergleichen ein paarmal gehöret hat, und die Beschaffenheit der Sache weiß; so höret auch die Verwunderung auf. Wer nun den Vorzug der Rührung vor der Maschine behaupten will, der muß zwar jedes Stück in seinem gehörigen Feuer spielen: übermäßig übertreiben aber muß er es niemals; sonst würde das Stück alle seine Annehmlichkeit verlieren.« Dem kommt, aus der Zukunft, die Digitalisierung entgegen, die – sie hat ihre Lektion gelernt – das Natur-Defizit der Technik beheben will. Beispiel: ein vom Pariser IRCAM in den 1990ern entwickeltes Programm namens »Chant«. Erarbeitet wurde die Simulation nach der Natur klingender Flötentöne (mit extremer Luftbeimischung, wie sie nur ein hyperventilierender Flötist zustande brächte, als Authentizitäts-Index). Das Ergebnis dreimonatiger Arbeit: vier Takte einer beliebigen, »annehmlichen« Pièce. – Zwischen diesen historischen Außenposten – krisenhafter Durchgang – die Puppe Olimpia in E.T.A.
Hoffmanns Nachtstück vom »Sandmann«. Sie, ein Automat, ist Gestalt gewordene Virtuosität, die allgemeines Staunen, doch Rührung allein im Gemüt des an der Schwelle des Wahnsinns balancierenden Nathanael erregt. Ein Freund warnt Nathanael: »Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehm richtigen geistlosen Takt der singenden Maschine und ebenso ist ihr Tanz. Uns ist diese Olimpia ganz unheimlich geworden, wir möchten nichts mit ihr zu schaffen haben, es war uns als tue sie nur so wie ein lebendiges Wesen«51. Ihr Spielwerk, abschnurrend, ausleiernd, muß immer wieder aufgezogen werden – das »Schlüssel-Problem« der Olimpia gewissermaßen.
Der wiederkehrende Traum also: zeigt die Maschine als Objekt mimetischer Begierde; erzählt von der Sehnsucht des Maschinen-Benutzers nach maschineller Selbstaufhebung. Der inverse Olimpia-Effekt als zeitgemäße Version einer romantischen Vision52.
Auf die Mechanisierung der Musikinstrumente jedenfalls läuft es bei Stuckenschmidt vorerst noch hinaus: aufs elektrische Klavier, die Drehorgel, das Orchestrion; sowie den Phonographen und das Grammophon. Auf welch letzteres Stuckenschmidt, als Herold der damaligen Medien-Euphorie, zuvörderst spekuliert: als Mittel der Konservierung der durch den Komponisten vorgenommenen oder autorisierten Interpretation, deren jederzeit dann und bis in alle Ewigkeit möglichen Reproduktion; schließlich als Medium der Produktion selber. Denn »die wesentliche Bedeutung dieser Maschinen«, so Stuckenschmidt, »liegt in der Möglichkeit, authentisch für sie zu schreiben«53. Man könne nach kurzem Studium dieser Reliefschrift – Runen quasi des technischen Zeitalters – »direkt in ihr, wie früher in Noten, komponieren«: mit »mathematisch genau festgelegten Tempi, dynamischen Zeichen und Phrasierungen«. Ein Problem allenfalls bleibe: daß die Schrift auf der Grammophonplatte mikroskopisch klein sei. Nur mit Hilfe scharfer Gläser wäre es möglich, ihren Charakter und die Beschaffenheit ihrer Merkmale zu erkennen. »Die Klangfarben, die Tonhöhen und Stärkegrade werden durch unendlich kleine Variationen in den Wellenlinien bezeichnet. Es handelt sich also darum, eine bedeutende Vergrößerung dieser Wellenschrift zu ermöglichen.« Was prompt geschah54. Das Bauhaus-Mitglied László Moholy-Nagy, berichtet Stuckenschmidt, regt an: »eine riesige Platte, etwa fünf Meter im Durchmesser, mit entsprechend großen Linien zu versehen und dann dieses Original auf photomechanischem Wege auf die für das Grammophon erforderliche Größe zu reduzieren«. Diese Lösung, konstatiert Stuckenschmidt zufrieden, erscheint »nach gründlicher Prüfung als völlig zureichend«. Gleich zwei Probleme auf einmal wären auf diesem Wege zu erledigen: erstens wäre »die Gestalt des Kunstwerkes […] auf der Platte ein für allemal mit mathematischer Präzision festgelegt«; und, zweitens, gehöre »die Rolle des Interpreten der Vergangenheit« an. Diese Vision – Günther Anders’ Thesen von der »Antiquiertheit des Menschen« scheinen antezipiert – hat, mit Walter Benjamin lakonisch zu sprechen, »den Vorzug der Deutlichkeit«55. Ist doch der Gestus der sich programmatisch verstehenden Ausführungen so ketzerisch wie konform: kurzsichtiger Agent des Medienbetriebs, entgeht es Stuckenschmidt, wie er zum Parteigänger seiner Abschaffung wird. –
Jedenfalls entfachen Stuckenschmidts Thesen von der Antiquiertheit des Interpreten, der Funktionalisierbarkeit der Nadelkurven und der Ahistorizität des Kunstwerks in den Folgenummern von »Pult und Taktstock« eine stürmische Diskussion, welche, seitens des Herausgebers Erwin Stein geschürt, von den Lesern: Komponisten und Interpreten (Dirigenten zumal) mit Verve geführt wird, und in die schließlich Arnold Schönberg sich einmischt mit seinem Grundsatzartikel über »Mechanische Musikinstrumente«. Die medientrunkene Vision Stuckenschmidts ernüchternd, argumentiert er mit dem ›Zeitkern‹ der Werke und der Not der Interpretation, diesen auszuformen; postuliert (sie derart auf ihren Mittelaspekt zurechtstutzend) Möglichkeit und Notwendigkeit, die neuen Medien zu beherrschen – ohne Rest und kraft des Geistes allein.
Allgemein aber ist die Verunsicherung. Plädiert wird für den Menschen und die menschliche Unzulänglichkeit – als Motor allen Strebens nach Vollkommenheit, und gegen jede »Ein-für-allemal«-Festschreibung und Geschichtsbereinigung der Werke. Der Weisheit letzter Schluß – ein Kalauer: daß eine Grammophonplatte allenfalls die »platte Wahrheit«56 liefere.
In den Vordergrund sind sie nun allerdings gerückt: die Probleme der technischen Reproduktion von Musik und ihrer Vermittlung durch die neuen Medien. Die seinerzeit freilich noch defizitäre Reproduktionstechnik (die abbildbaren Frequenzbereiche waren begrenzt, Klangfarben ein vielfach unlösbares Problem) schwang sich, ihren Mittelcharakter weit überschreitend, auf zum ästhetischen Maßstab: die Verordnungen einer »rundfunkeigenen Musik« – mit besagtem »Kammerorchester« als übertragungsgeeignetem Klangkörper – erweisen sich denn als der »Neuen Sachlichkeit« verschwistert.
NB. Daß die »Neue Sachlichkeit« neue Problemstellungen der Interpretation provozierte, ist auch eine der Thesen Reinhard Kapps, wie er sie in seinen »23 Thesen. Musikalische Analyse und Interpretation betreffend« formulierte. Die resümierende, insofern in mehr als nur einem Sinne abschließende 23ste These lautet: »Innerhalb des Zeitraums, der die ›große‹ Musik des Zeitalters umspannt, das auf dasjenige der heute Alten Musik folgt, haben vier Umwälzungen stattgefunden, welche die Kompositionsgeschichte und die Interpretationsgeschichte gleichermaßen erfaßt haben. Die erste, der Übergang von Mozart zu Beethoven, betrifft noch die Konstitutionsphase. Die zweite […] um 1850 hat die Interpretation erstmals als ein eigenes Problem hervortreten lassen. Die dritte, als deren prägnantesten Ausdruck man die Neue Sachlichkeit ansprechen kann, zeigt den Prozeß der Entfremdung in und von der Musik im akuten Stadium. Die vorläufig letzte, High Fidelity, markiert das Ende dieser ganzen glorreichen Periode«57. Ob in der Tat ein »Ende« erreicht ist – und welches –, sei noch dahingestellt.
Spezielle Auskunft, wie das »Umwälzende« der »Neuen Sachlichkeit« sich konkretisiert, gibt Adorno in einem seiner »Neunzehn Beiträge über neue Musik« (1942): »Der Impuls der neuen Sachlichkeit ist ein doppelter: einmal die Musik aller überflüssigen Zutaten zu entäußern und rein aus der Notwendigkeit des konkreten musikalischen Gedankens zu entwickeln […]. Zum anderen aber hat man neue Sachlichkeit verstanden als Eliminierung aller Ausdrucksmomente der Musik, als deren Reduktion auf bloßes Spiel unter Rückgriff auf die gegen Wagner gerichtete Lehre Hanslicks von der tönend bewegten Form. Während beide Tendenzen fraglos in tiefer Beziehung miteinander stehen, hat ihre blanke Identifikation viel Unheil angerichtet, indem sie das Ideal eines materialgerechten, technisch verantwortlichen und nicht scheinhaften Komponierens mit der hämischen Freude am Schnöden, Mechanischen und Repressiven kompromittierte. Im Problem der neuen Sachlichkeit spiegelt sich ein gesellschaftliches wider, die Auflehnung gegen das Moment der Unwahrheit im Individualismus des 19. Jahrhunderts, die in faschistischen Kollektivismus umzuschlagen droht.«58 Allemal ist der Blick zurück, dahin, wo zukunftsweisende Motive sich konkretisieren, geboten59. Benjamin, im Oktober 1935, brieflich an Werner Kraft: »Was mich betrifft, so bemühe ich mich, mein Teleskop durch den Blutnebel hindurch auf eine Luftspiegelung des neunzehnten Jahrhunderts zu richten, welches ich nach den Zügen mich abzumalen bemühe, die es in einem künftigen, von Magie befreiten Weltzustand zeigen wird. Natürlich muß ich mir zunächst einmal dieses Teleskop selber bauen«.60 Die teleskopischen Beobachtungen führten dann eben zu dem Essay über »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«. Ein »Ende« also ist, bei dialektischer Betrachtung der Dinge, so schnell nicht in Sicht.
Der Rundfunk selber nun meldet sich, ab 1927, zu Wort: Alfred Szendrei, Direktor der Mitteldeutschen Rundfunk A.G. in Leipzig, zum Beispiel, tut kaum durch die Blume, vielmehr ganz und gar unverblümt kund: »Die Zukunft des Rundfunks wird alle geistigen Kräfte der Nation in seinen Dienst zwingen. Lassen Sie an sich die Mahnung richten, schon jetzt freiwillig, nicht erst unter dem Zwang der Verhältnisse, mit uns zusammenzuarbeiten.«61 Und, dem Mittel als Zweck ein zugehöriges ästhetisches Programm assoziierend, formuliert Ernst Latzko, »musikalischer Leiter der Sendestelle Weimar«: »Die ›neue Sachlichkeit‹ hat sich einen Darstellungsstil geschaffen, der die Freude an der Technik wiedergewonnen hat, einen Stil, der das Verhältnis zwischen Ausdruck und Technik zugunsten der letzteren ins Gegenteil verkehrt hat, einen Stil, der häufig ein ›non expressivo‹ vorschreibt. Diese Musik, die so stark im Technischen wurzelt und die auch ebenso technisch wiedergegeben sein will, hat selbstverständlich die stärksten Beziehungen zum Rundfunk und müßte von ihm ganz besonders gepflegt werden; in dem gleichzeitigen Entstehen der ›neuen Sachlichkeit‹, der Vervollkommnung und Ausbreitung des Rundfunks und den immer intensiver auftretenden Mechanisierungsbestrebungen in der Musik [!] darf sicher kein Zufall erblickt werden, liegt bestimmt eine Art Gesetzmäßigkeit«62.
Medien-Lektüren
»Aufgabe der Wissenschaft ist es nicht, verborgene und vorhandene Intentionen der Wirklichkeit zu erforschen, sondern die intentionslose Wirklichkeit zu deuten, indem sie kraft der Konstruktion von Figuren, von Bildern aus den isolierten Elementen der Wirklichkeit die Fragen aufhebt, deren prägnante Fassung Aufgabe der Wissenschaft ist.«
(Theodor W. Adorno an Walter Benjamin, 193163)
Lesart 1
Eine vom Grunde her andere Lesart des neuen Mediums findet sich 1930, drei Jahre nach den zitierten Radio-Selbstdarstellungen, im »Anbruch«. Günther Stern (später Günter Anders) veröffentlicht eine essayistische Miniatur mit dem Titel »Spuk und Radio«64. Am Phänomen des neuen Mediums entzünden sich Sterns Spekulationen über das (doppelsinnige) Verhängnis der »Raum-Neutralität« einer durchs Radio vermittelten Musik. Diese nämlich werde vervielfältigt, im Raum zerdehnt, zur Strecke gemacht. Musik gerate in einen ›Zeit-Raum‹, werde zur Geistererscheinung. Nicht länger an ein »Hier und Jetzt« gebunden – als Aufführung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort –, etabliere sich, per Radio, eine »Pluralität, ja Numerabilität von Musiken«, wie sie der Musik, vom Wesen her, nicht zukomme: jedes einzelne Stück Musik – »eine kleine Welt für sich, die von sich aus außerhalb ihrer selbst keine andere mehr vermuten lassen kann«. »Daß diese durch das Hier- und Dortsein ermöglichten numerablen andern Musiken obendrein noch als Doppelgänger, ja Dreifachgänger auftreten, da hier und dort nicht nur die gleiche, sondern schlechthin dieselbe Musik aufklingt, macht das Phänomen noch spukhafter.« – Der Verlust des »Originals«, der Ausfall des »Hier und Jetzt«, wie Benjamin ihn im Medium der bildenden Künste als Signum des durch technische Reproduktion verursachten Kulturwechsels (samt seiner anthropologischen Konsequenzen) beschreiben wird65: hier, bei Stern, ist er im Medium der Musik und qua ihrer medialen Vermittlung durchs Radio (der beliebigen und universellen Etablierungen dort) als problematisch schon registriert. Die mögliche Neutralisierung des Raums, wie sie angesichts der praktischen »Entwurzelung« der Musik durchs beliebig sie verortende neue Medium deutlich wird, gehört ins Arsenal der zeitgemäßen Raumerkundungs-Tendenzen. So war auch die Entdeckung der Umwelt als ›kalkulierbarer Lebensraum‹ an der Zeit: durch die mögliche Kontaminierung – der erste weiträumige Giftgas-Einsatz seitens der deutschen West-Armee im Ypern-Bogen (am 22. April 1915) als ›säkulare‹ »Urszene«66 – rückte sie als unmerklich verriegelbarer Lebensraum erstmals ins Bewußtsein, nötigte und führte zu Überlegungen einer »Raumbildungskunst«67, an der es gelegen wäre, den Raum in seinem qualitätslosen Dasein, dem Zustand der Entqualifizierung oder »Neutralisierung«, zu markieren, zu konturieren, auszumalen respektive, folgt man Günther Sterns Diagnose, akustisch zu kennzeichnen. Denn erst unterm Zugriff der Technik enthülle sich der Raum als »Lebensraum« und als Raum ohne Zeit. »Es ist höchst sonderbar und einer Interpretation bedürftig, daß Technik akzidentiell Spuk mit sich bringen kann.« Im entqualifizierten, von der Zeit entbundenen Raum etabliert sich eine »Geisterwelt«, die ihrem Wesen nach geschichtslos bzw. »nur uneigentlich, nämlich parasitär, zeitlich zu nennen« ist68. Das Spukhafte, Unheimliche daran? Sigmund Freud eruiert in seiner auch historisch zugehörigen Untersuchung des »Unheimlichen« (1919) den »Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens« respektive fragt, »umgekehrt«, »ob ein lebloser Gegenstand«, wie eine mechanisierte Puppe, ein Automat, »nicht etwa beseelt sei« (erneut das »Olimpia«-Syndrom); listet sodann, für den Bereich der »Ich-Störungen«, die Spielarten des Doppelgängermotivs auf: die »Ich-Verdopplung, Ich-Teilung, Ich-Vertauschung – endlich: die beständige Wiederkehr des Gleichen«69, welch letztere, mechanisiert, als »Wiederholungszwang« sich manifestiert. Der Doppelgänger selbst: »ursprünglich eine Versicherung gegen den Untergang des Ichs, eine ›energische Dementierung der Macht des Todes‹«, später, bei geändertem Vorzeichen, ein »unheimlicher Vorbote des Todes«. Der Charakter aber des Unheimlichen könne »nur daher rühren, daß der Doppelgänger eine den überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung ist, die damals allerdings einen freundlicheren Sinn hatte«70. »Wir können nun nicht mehr verkennen«, resümiert Freud, »auf welchem Boden wir uns befinden. Die Analyse der Fälle des Unheimlichen hat uns zur alten Weltauffassung des Animismus zurückgeführt, die ausgezeichnet war durch die Erfüllung der Welt mit Menschengeistern, durch die narzißtische Überschätzung der eigenen seelischen Vorgänge, die Allmacht der Gedanken und die darauf aufgebaute Technik der Magie, die Zuteilung von sorgfältig abgestuften Zauberkräften an fremde Personen und Dinge (Mana), sowie durch alle die Schöpfungen, mit denen sich der uneingeschränkte Narzißmus jener Entwicklungsperiode gegen den unverkennbaren Einspruch der Realität zur Wehr setzte. Es scheint, daß wir alle in unserer individuellen Entwicklung eine diesem Animismus der Primitiven entsprechende Phase durchgemacht haben, daß sie bei keinem von uns abgelaufen ist, ohne noch äußerungsfähige Reste und Spuren zu hinterlassen, und daß alles, was uns heute als ›unheimlich‹ erscheint, die Bedingung erfüllt, daß es an diese Reste animistischer Seelentätigkeit rührt und sie zur Äußerung anregt.«71 Der »Fortschritt« demnach, den das neue Medium beschert, erweist sich – die Analyse Günther Sterns im Sinn – als Rückschritt; als vom Rückfall in animistische Zeiten und Zauberwelten bedroht. Womit ja die fundierende These der siebzehn Jahre späteren, programmatisch so genannten, »Dialektik der Aufklärung«: »Aufklärung schlägt in Mythologie zurück«72, gewissermaßen vorformuliert wäre, samt zugehöriger Qualifizierung des »neutralisierten«, geschichtslosen Raums als »unwiderruflichem Schema aller mythischen Zeit«73.
Günther Stern jedenfalls sucht, das medial generierte »Unheimliche« betreffend, nach Deutungshilfen in den Medien der Kunst, findet sie im französischen Surrealismus: »Hier versucht man […] nun doch ›mitzukommen‹ mit jenen gesetzwidrigen Geistern, die der Ungeist einer gesetzmäßigen Technik berief; nun doch noch empfindend gewachsen zu sein jenen unmäßigen Erfindungen, die der Mensch zwar herstellte, die ihm aber über Kopf und Herz hinauswuchsen.«74 Von daher es plausibel erscheint, daß es das »erklärte und unerklärte Ziel« des Surrealismus gewesen sei, »schöpferische Prozesse explizit zu machen und ihre Quellgebiete nach Möglichkeit technisch aufzuschließen«75. Kunst denn also als Aufgebot – so das Analyseangebot aus mehreren Richtungen und Zeiten –, der Technik, als Veranstaltung zweiter Natur, standzuhalten. – Diente Kunst einstmals, Kult und Ritual assoziiert, erst magischen, dann theologischen Zwecken (dem beschwichtigenden, beschwörenden Umgang mit der übermächtigen ersten Natur respektive numinosen Mächten), so soll sie nun, nach der langen Weile ihrer Säkularisierung (während der sie auch, als l’art pour l’art, als »Theologie der Kunst«76, die Verklärung ihrer selbst betrieb), zur Einübung in respektive Beschwichtigung der zweiten dienen. So jedenfalls ließe sich Walter Benjamins Exkurs zur Kunstgeschichte im Reproduktions-Aufsatz resümieren. Den Kreis, den Kreislauf, zu vollenden: die »emanzipierte Technik steht […] der heutigen Gesellschaft als eine zweite Natur gegenüber und zwar, wie Wirtschaftskrise und Kriege beweisen, als eine nicht minder elementare wie die der Urgesellschaft gegebene es war. Dieser zweiten Natur gegenüber ist der Mensch, der sie zwar erfand aber schon längst nicht mehr meistert, genau so auf einen Lehrgang angewiesen wie einst vor der ersten. Und wieder stellt sich in dessen Dienst die Kunst.«77
Günther Stern, seinerseits resümierend, und gleichwie ein ›Vorecho‹ Benjamins im Zeitraum: »Ein merkwürdiges Schauspiel: die Seele, die sich abmüht, den seelenlosen Bewegungen ihrer wild gewordenen Hand sich nachträglich einzufühlen und anzumessen, als stammten die Bewegungen doch noch von ihr; die unmenschlich gewordenen Produkte einzuholen, zu sich zurückzuholen, und selbst dem maßlos und sinnlos Gewordenen sich noch zuzubekennen, selbst auf die Gefahr, sich selbst daran zu verlieren. Der Grund für diesen Wettlauf ist die Angst: gibt der Mensch seine eigenen Produkte frei, so erntet er den Spuk. Erschreckend hört er die bellende Leinwand des Tonfilms und die doppelgängerhaften Stimmen des Radio. Sieht er ausdrücklich fort, so entsteht programmatische Humanität. Bekennt er sich aber zu ihnen, versucht er sich dem Schreck zu entwöhnen, dem Unmäßigen innerlich sich anzumessen, dem Unerhörten zu entsprechen, und gelingt dieser Versuch, so wird er selbst unmenschlich. Und der einholende Griff nach dem Entwachsenen bleibt hängen und wird mitgezogen.«78
Der Ertrag nun solcher Medienlektüre: Tiefendiagnose der Stuckenschmidtschen Mechanisierungs-Thesen (Nötigung zu Mimesis, Mimikry als Überlebensstrategie); Einsichten in die per Medien verhängten Gegebenheiten des Raums (als Zeitraum, Lebensraum, Geschichtsraum und »Schema« »aller mythischen Zeit«); Ausblicke auf Nutzen und Nachteil medial produzierter Virtualisierung (»Im Rundfunk, aus dem es oft ›Hier Paris‹ oder ›Hier London‹ tönt, erfüllt die Nennung der Weltstädte die Mission eines ordinären Fusels«; Siegfried Kracauer, 193079). Diagnosen wie den später von Benjamin im Kunstwerk-Essay ausformulierten – von der Technik als zweiter Natur, dem Ausfall der Humanisierung, den Konstellationen des »Chocs« (als Voraussetzung eines sich anmessenden, »bewältigenden« Verhaltens) – entrollt sich hier das Untersuchungsgebiet.
Neues vom / zum Radio?
(Raum mit großem Hall / verschachtelte Zeit)
A (rufend) »Dahin entrückt das Trauerspiel seine Gemordeten!
B (delirierend) ›O wehe, ich sterbe, ia, ia, Verfluchter, ich sterbe, aber du hast die Rache von mir annoch zu befürchten: auch unter der Erden wird ich dein grimmiger Feindt und rachgieriger Wüttrich des Meßinischen Reichs verbleiben. Ich werden deinen Thron erschittern, das Ehebeth, deine Liebe und Zufriedenheit beunruhigen und mit meinem Grimme dem König und dem Reich möglichsten Schaden zufügen.‹«
(Josef Anton Stranitzky, Die Gestürzte Tyrannay in der Person deß Messinischen Wüttrichs Pelifonte III80)
1940er Jahre, Adorno: »… daß die Leute lieber über Musik reden hören als diese selbst, gehört in eine Geschichtsphilosophie der Interpretation«81.
1994, Auskunft eines ARD-Musikredakteurs: »Wovon reden sie, wenn Musik ihr Thema ist? Von etwas anderem […]. Analysen würden dem Hörer ohnehin nicht helfen: sind sie trocken, hört er weg; sind sie blumig, verhüllt sozusagen das Stück sein Haupt und schämt sich still in sich hinein.«82
2006, Bescheid einer ARD-Musikchefin: »Unsere Welt und die Wissenschaft hat sich verändert, auch die Musiksendungen müssen darauf reagieren und neue formale und inhaltliche Wege gehen.« (Meint: »Die Mission darf nur tönen, sie muß sprachlos sein«83. Oder: Die Angst der ›Programmverantwortlichen‹ vor dem Wort.)
24. April 2010, »Süddeutsche Zeitung«: »Am Anfang war das Wort. Es zählt bis heute. Das Internet brachte Geräte, die jeden zum Programm-Manager machten und den Schluß nahelegten, das Radio würde sterben. Doch dem Radio geht es gut.« (Dank Anpassung und Ausverkauf)
2016, »Programmbeobachtung« eines ARD-Musikredakteurs, Titel »Der Runterbruch«: »Wenn ich, sagt der Abteilungsleiter im Funk, noch einen auf dem Weg zum Mikrofon mit einem Manuskript in der Hand sehe – entsichere ich den Revolver? Nein, so sagt er’s natürlich nicht. Und doch weiß er, von wem er sich morgen, leider, trennen muß.«84
Lesart 2
Gleichsam ergänzt und bestätigt (wenn auch um ein Geringes zeitlich versetzt) werden Günther Sterns Reflexionen des musikalischen Raums durch solche Adornos über die musikalische Zeit. Versammelt hat Adorno sie in der Aphorismenfolge »Nadelkurven« (1927) und dem kleinen Essay »Die Form der Schallplatte« (1934). Gerade der Schallplatten-Essay läßt sich als grundlegende Korrektur jenes Stuckenschmidtschen Versuches lesen, die Nadelkurven (mystische Union von Klang, Bild und Schrift) zu entzaubern, ja, zu korrumpieren.
Adornos »Form der Schallplatte« also, Benjamins Sprachtheorie verpflichtet, kreist um die »Lesarten« der musikalischen Werke. Unterliegt die Notenschrift, als Schrift, der Konvention, so bietet die Reproduktion (die Aufführung) des Werkes eine Lesart in der Zeit. Die technische Reproduktion nun einer Reproduktion überführt jene tönende Lesart in gravierte Chiffren, »Nadelkurven« eben, eine ihrerseits »gänzlich unleserliche Schrift«, zu deren Entzifferung noch keine Konvention bereitsteht. Als noch nicht entzifferbare »Geheimschrift« ist sowohl die sie begründende Konvention wie auch ihre Bedeutung unbekannt.
Abseits noch der Fragwürdigkeiten von Musik-Konserve und -Depot, ist die Schallplatte »die erste Darstellungsweise von Musik, die als Ding sich besitzen läßt«85, und in verdinglichter Form kommt sie, wie sich zeigen kann, ihrer möglichen Interpretation als »dialektisches Bild« entgegen.
»Mit den Schallplatten erobert sich die Zeit einen neuen Weg zur Musik«. Freilich nicht die chronologisch reine, noch die geschichtlich geprägte (mit der Musik als »Denkmal«), vielmehr die naturgeschichtlich indizierte, Natur und Geschichte homogen rhythmisierende: »Es ist die Zeit als Vergängnis, dauernd in stummer Musik.« Vergangenheit, wie sie, zur Erinnerung geronnen, »den Drehorgeln als bloßer Klang zwangvoll, doch unbestimmt anhaftet«, und »durch die Grammophonplatte handlich und offenbar geworden« ist86. Die Medien-Frühzeit generiert ihre Bilder: »Was ist die Neunte Symphonie neben einem Gassenhauer, den ein Leierkasten und eine Erinnerung spielen!«87 Doch weiter in Adornos Text: »Den Schlüssel zum eigentlichen Verständnis der Schallplatten müßte die Kenntnis jener technischen Akte liefern, die einmal die Walzen der mechanischen Spielwerke und Orgeln in die phonographischen verwandelten.« – Heißt: im Drehorgel-Fall »komponiert« und »interpretiert« man, stanzend, ins Mechanische hinein – ohne Interpreten-Zwischeninstanz; Schallplatten aber sind mechanische ›Konservatorien‹ lebendiger Einspielungen88. Womit – lange vor Marshall McLuhan und dem von ihm diagnostizierten »Botschaft«-Charakter des Mediums selbst – die Frage nach Herkunft und Funktion der technischen Mittel gestellt wäre: woher kommen sie, was tun sie (dem Vermittelten an), wozu überhaupt sind sie da? Ob insofern nicht etwa, apropos Radio, dessen Ursprung in der Kriegstechnologie für bislang noch kaum registrierte, schwer dingfest zu machende Nebenwirkungen verantwortlich zeichnen müßte, für weit- und fernhin wirksame Metastasierungen gesorgt hätte? Von ähnlicher Tendenz scheinen Adornos weitere Überlegungen: »Wenn man späterhin, anstatt ›Geistesgeschichte‹ zu treiben, den Stand des Geistes von der Sonnenuhr menschlicher Technik ablesen sollte, dann kann die Vorgeschichte des Grammophons eine Wichtigkeit erlangen, welche die mancher berühmter Komponisten vergessen macht. Keinem Zweifel unterliegt: indem Musik durch die Schallplatte der lebendigen Produktion und dem Erfordernis der Kunstübung entzogen wird und erstarrt, nimmt sie, erstarrend, dies Leben in sich auf, das anders enteilt. Die tote rettet die ›flüchtige‹ und vergehende Kunst als allein lebendige. Darin mag ihr tiefstes Recht gelegen sein, das von keinem ästhetischen Einspruch wider Verdinglichung zu beugen ist. Denn dies Recht stellt, gerade durch Verdinglichung, ein uraltes, entsunkenes doch verbürgtes Verhältnis wieder her: das von Musik und Schrift.« Hier denn also – gelegentlich der Schürfungen in den Naturgeschichts-Tiefen der Medienlandschaft – taucht es auf: jenes zentrale Theorem, das Adorno nie wieder ruhen lassen, das im gesamten Werk seine Kreise ziehen und Konstellationen stiften; dessen sich vervielfältigendes Echo in den späteren Fragmenten der Reproduktionstheorie, ja, noch im vielseitig bedeutenden »Fragment über Musik und Sprache« einzufangen sein wird. Hier aber, an Ort und Stelle: reflektiert Adorno es noch, wiewohl unausgesprochen, entlang der Vorlage, mit der Benjamins Trauerspielbuch ihn versorgt. »Musik, zuvor von der Schrift befördert«, verwandelt sich »mit einem Male selber in Schrift«: »um den Preis ihrer Unmittelbarkeit, doch mit der Hoffnung, daß sie, dergestalt fixiert, einmal als die ›letzte Sprache aller Menschen nach dem Turmbau‹ lesbar wird, deren bestimmte, doch chiffrierte Aussage jeder ihrer ›Sätze‹ enthält. Waren aber die Noten noch ihre bloßen Zeichen, dann nähert sie durch die Nadelkurven der Schallplatten ihrem wahren Schriftcharakter entscheidend sich an.«89 (Und wieder zünden die Krisenarsenale der Romantik: diesmal in Form der »Gedanken über den hohen Wert der Musik« aus E.T.A. Hoffmanns »Kreisleriana«, handelnd von der Musik als der »geheimnisvollen, in Tönen ausgesprochenen Sanskritta der Natur«90.) »Entscheidend, weil diese Schrift als echte Sprache zu erkennen ist, indem sie ihres bloßen Zeichenwesens sich begibt: unablöslich verschworen dem Klang, der dieser und keiner anderen Schall-Rinne innewohnt.« Das späterhin häufig beschworene Desiderat des musikalischen Textes als »das Ideal des Klanges«: hier ist es, sowie die geweitete Konstellation von Klang / Schriftzeichen – Notation / Reproduktion (um welche Adornos Reproduktionstheorie, unabgeschlossen, unabschließbar kreisen wird), erstmals formuliert91.
Folgt in Adornos äußerst verdichtetem Schallplatten-Text: eine geschichtsphilosophische Abbreviatur – Kondensat gewissermaßen seiner Fortschritts- und Erkenntniskritik, wie er sie, mit ständiger Rücksicht auf Benjamin, entwickelt und in seinen Arbeiten zum extremen Erkenntnisvermögen eines jeden genuinen »Spätstils«92 (seiner Tendenz zur Allegorisierung mit der Katastrophe als letztem zu konfigurierenden Bild) zuspitzen wird; und er kombiniert sie mit (und zu) einem (dialektischen) Bild der Schallplatte: »Ist in den Schallplatten die musikalische Produktivkraft erloschen; haben sie keine Form mehr mit ihrer Technik gestiftet, so verwandeln sie dafür den jüngsten Klang alter Gefühle in einen archaischen Text kommender Erkenntnis.« Urgeschichtliche Versteinerungen, Ablagerungen des Idealismus, kurz: den gesamten Horizont, wie er von (und in) zweiter Natur konturiert wird, ruft Adorno herauf mit der Evokation jenes unvermeidlichen Knotenpunkts von Natur und Geschichte (daß der Tod dem naturgeschichtlichen Denken die wirkliche und unscheinbare Vermittlung von Natur und Geschichte vor Augen rückt): »daß der Wahrheitsgehalt der Kunst erst aufsteigt, wofern der Schein des Lebendigen sie verläßt: daß die Kunstwerke erst ›wahr‹, Bruchstücke der wahren Sprache werden, wenn Leben aus ihnen entwich. […] Dann könnte […] die Form der Schallplatte sich bewähren: als Schriftspirale, die im Zentrum, der Öffnung der Mitte verschwindet, aber dafür dauert in der Zeit.«93 Verdinglichung also ist das Zauberwort, vermittels dessen die »Form der Schallplatte« zum dialektischen Bild werden kann.94 Und die Fortschreibung der Kunst (in alle Ewigkeit?) ist der Ertrag. Die neue Form aber erweist sich, schicksalhaft, als Gestalt gewordene Einlösung einer älteren Erkenntnis von den »schriftgemäßen Urbildern des Klanges«, wie sie die »Chladnischen Klangfiguren« konfigurieren. Womit sich das Zukunftsbild der Schallplatte in bestimmter Vergangenheit – bei Johann Wilhelm Ritter – begründen läßt. »Die jüngste technische Entwicklung jedenfalls hat fortgeführt, was dort begann: die Möglichkeit, Musik, ohne daß sie je erklang, zu ›zeichnen‹«. Und sie habe »die Musik zugleich noch unmenschlicher verdinglicht und sie noch rätselhafter dem Schrift- und Sprachcharakter angenähert«. Stuckenschmidts Vision des »authentischen« Komponierens erweist sich gleichsam als Formulierung einer alten Erkenntnis fürs neue Medium. Die »Nadelkurven« als Konservatorien eines Klangs, der nie erklungen sein muß, noch je wird erklingen müssen, kreisen vor dem Hintergrund jener »Romantisierung der Naturwissenschaft«95, wie Ritter sie praktiziert, und die Benjamin im Trauerspielbuch das Desiderat einer »geschichtsphilosophischen Auseinandersetzung über Sprache, Musik und Schrift« empfinden läßt. Benjamin zitiert aus einer, »wenn man so sagen darf, monologisierenden Abhandlung« Ritters, »in welcher dem Forscher aus einem Briefe über die Chladnischen Klangfiguren unterm Schreiben vielleicht fast absichtslos die vieles kräftig oder tastender umgreifenden Gedanken sich entspinnen«: »Schön wäre es, … wie, was hier äußerlich klar würde, genau auch wäre, was uns die Klangfigur innerlich ist: – Lichtfigur, Feuerschrift … Jeder Ton hat somit seinen Buchstaben immediate bey sich … Die so innige Verbindung von Wort und Schrift, – daß wir schreiben, wenn wir sprechen … hat mich längst beschäftigt. Sage selbst: wie verwandelt sich uns wohl der Gedanke, die Idee ins Wort; und haben wir je einen Gedanken, oder eine Idee, ohne ihre Hieroglyphe, ihren Buchstaben, ihre Schrift? – Fürwahr, so ist es; aber wir denken gewöhnlich nicht daran. Daß einst aber, bey kräftigerer Menschennatur, wirklich mehr daran gedacht wurde, beweist das Daseyn von Wort und Schrift. Ihre erste, und zwar absolute, Gleichzeitigkeit lag darin, daß das Sprachorgan selbst schreibt, um zu sprechen. Nur der Buchstabe spricht, oder besser: Wort und Schrift sind gleich an ihrem Ursprunge eins, und keines ohne das andere möglich … Jede Klangfigur eine electrische, und jede electrische eine Klangfigur.« »Ich wollte … also die Ur- oder Naturschrift auf electrischem Wege wiederfinden oder doch suchen.«96 Und in der Form der Schallplatte, diesem schwarzen rundläufigen Ding, graviert mit geheimnisvoller Chiffrenschrift; diesem haltbar gemachten Depot von Klangfiguren, »Nadelkurven« (erstarrter Lesart tönend bewegter Formen, welche wieder in klingenden Fluß zu geraten vermögen): scheint sie, in modernen Zeiten, gefunden. – »Die Möglichkeit« also, so noch einmal Adorno, »Musik, ohne daß sie je erklang, zu ›zeichnen‹, hat die Musik zugleich noch unmenschlicher verdinglicht und sie noch rätselhafter dem Schrift- und Sprachcharakter angenähert.«
Konvergenzen oder
Über den physischen Effekt als Bedrohung und Attacke
Adorno spricht, gegen Ende des Textes über die »Form der Schallplatte«, vom »panischen Schreck, den vor dieser Erfindung manche Komponisten bekunden«, der »genau die ungeheure Gefahr« treffe, »die dem Leben der Kunstwerke von dorther«97 drohe.
Günther Stern spricht von »Choc« – angesichts der spukhaft, zum Phantom und Doppelgänger werdenden Musik im Falle ihrer technischen Reproduktion und Vermittlung; konstatiert Notwendigkeit und Unmöglichkeit von Orientierung, welche gewissermaßen zum Appell nötigten: ›Du mußt deine Wahrnehmung ändern‹.
Walter Benjamin spricht von der »physischen Chocwirkung« des Films, mit welcher er, als Kunstform, der »betonten Lebensgefahr, in der die Heutigen leben«, entspreche. Die Versenkung des Zuschauers ins Werk werde verhindert durch die ›taktile Attacke‹ seitens des Kunstwerkes: Gefährdung geschehe durchs Werk (bedrohe es nicht selber). »Daß alles Wahrgenommene, Sinnenfällige ein uns Zustoßendes ist – diese Formel der Traumwahrnehmung (umfaßt) zugleich die taktile Seite der künstlerischen«98. – Womit unmittelbar der Akzent aufs »Medium der Wahrnehmung« gelegt ist, in welchem technische Reproduktion effektiv werden kann: indem (wie Benjamin es für die Filmaufnahme analysiert) per »Aufnahmeapparatur« die Wirklichkeit vielfältig manipuliert und »außerhalb eines normalen Spektrums der Sinneswahrnehmung« agiert werden kann. »Viele der Deformationen und Stereotypien, der Verwandlungen und Katastrophen, die die Welt der Gesichtswahrnehmung in den Filmen betreffen können, betreffen sie in der Tat in Psychosen, in Halluzinationen, in Träumen. Und so sind jene Verfahrungsweisen der Kamera ebenso viele Prozeduren, dank deren sich die Kollektivwahrnehmung des Publikums die individuellen Wahrnehmungsweisen des Psychotikers oder des Träumenden zu eigen zu machen vermag.«99 Daß der Boden jedenfalls ins Wanken gerät, scheint, als spezifische Erfahrung, an der Zeit. »Ich habe Erfahrung«, zitiert Benjamin im Kafka-Essay eine frühe Aufzeichnung Kafkas, »und es ist nicht scherzend gemeint, wenn ich sage, daß es eine Seekrankheit auf festem Lande ist.« »Nicht umsonst«, kombiniert Benjamin, »erfolgt [Kafkas] erste ›Betrachtung‹ von einer Schaukel aus. Und unerschöpflich ergeht sich Kafka über die schwankende Natur der Erfahrungen«100. – Gleitendes Entgleiten der gewohnten Koordinaten orientierender Weltwahrnehmung auf seiten des individuellen wie kollektiven Subjekts; Attacke, »Zugriff«, seitens des Kunstwerks: drastisch in den, dem Film historisch vorgreifenden, Aktionen des Dadaismus vorgeführt. Das dadaistische Kunstwerk, sagt Benjamin, wurde aus einem »lockenden Augenschein oder einem überredenden Klanggebilde […] zu einem Geschoß. Es stieß dem Betrachter zu.«101
Im Vorfeld der Bilder
»Vielen Jungen geht es nur noch um den Dauerbeschuß mit Bildern, und Tempo, um den schnellen Wow-Faktor. Ein paar Traditionalisten arbeiten noch da draußen, die sich geschworen haben, ihr Publikum nur dann zu verwirren, wenn die Geschichte wirklich danach verlangt. Viele sind es nicht mehr. Aber das Gute ist, daß die großen Klassiker, die Beispiele, wie man es richtig macht, ja noch da sind. Wir müssen sie nur immer wieder anschauen.«
(Steven Spielberg, Süddeutsche Zeitung, 22. Juni 2009)
»Nie werde ich das Empfinden von Grauen, Schrecken und Bewunderung vergessen, mit dem ich um mich sah. Das Schiff schien wie durch Magie auf halber Höhe an der Innenfläche eines Trichters von riesigem Umfang und fürchterlicher Tiefe zu hängen, dessen vollkommen glatte Wandung man leicht hätte für Ebenholz halten können, wäre nicht die bestürzende Geschwindigkeit gewesen, mit welcher sie im Kreise wirbelte, und der schimmernde geisterhafte Schein, der davon ausging, als die Strahlen des Vollmonds durch jenes Kreisloch in den Wolken […] in einer Flut von goldenem Glanz an den schwarzen Wänden hinströmten, hinab bis in den innerstuntersten Schlund des Abgrunds«.
(Edgar Allen Poe, Sturz in den Malstrom, 1841102)
Lesart 2 (Fortsetzung)
»Die Form der Schallplatte« als »dialektisches Bild«
Wird die technisch reproduzierte Musik (nach Stern) zum nicht dingfest zu machenden Phantom; so birgt die Verdinglichung der Musik, in der Form der Schallplatte (nach Adorno), den Keim vom Ende der Musik als Klang. Indem Musik in den Nadelkurven sich verschriftlicht, geht ihr Klang ein in die Kurvatur, geht auf in einer nach innen drehenden, malstromartig dem Innensog nachgebenden, lautlosen Spirale. Die drohende Gefahr (vom Ende tönender Musik) reflektiert sich in »panischem Schrecken«103: Ausdruck blitzartiger Erkenntnis dessen, was da droht.104
Die andere Seite der Reproduktions-Medaille zeigt Benjamin: wie, konfrontiert mit den Potentialen technischer Reproduktion, die menschliche Apperzeption sich ändern; wie Wahrnehmungsweisen mechanisiert, aber auch trainiert werden können.
In seinem grundlegenden Versuch, die keinesfalls einsinnigen Bildvorstellungen Adornos und Benjamins zu vermitteln, bestimmt Hermann Schweppenhäuser dialektische Bilder als »bildliche Vorstellungen besonderer Art«. Ihre »Quelle«: die »vornehmlich reproduktive«, aus dem Bewußtsein oder Unbewußten sich speisende, »Einbildungskraft des – individuellen wie des kollektiven – Subjekts«105. Als ›reproduktive‹ schmiegt sich die Einbildung ans Gegebene, immer des kleinsten Impulses gewärtig, der eine zu revidierende Ansatzstelle signalisiert. Die reproduktive Einbildungskraft demnach als geistesgegenwärtige Revisions-Instanz, die, gemäß ihrer Herkunft (aus Bewußtsein oder Unbewußtem), als ein Depot von Geschichtserfahrung vorzustellen ist, das zur Aktualisierung allzeit bereit: eine Revisions-Instanz also in Permanenz.
»Auf dialektischer Konstruktion des Traums – oder der Erinnerung –: des authentischen objektiven ›Geschichts-Bildes‹«, so wieder Schweppenhäuser, »insistierte Adorno von vorneherein; so, wie Benjamin auf dem widerständigen, chochaft-verfremdenden Bild-Element in der als ›Bewußtseinstatsache‹ gegebenen dialektischen Bild-Konstellation bestand«106. Anders auch wäre sie kaum in Bewegung zu denken107. Adorno also denkt sich die Schallplatte als »Rätsel«, zu dessen Lösung er ansetzt an »den Konturen seiner Dinglichkeit«. Als »erste Darstellungsweise von Musik, die als Ding sich besitzen läßt«, konnte sie zum Sammelobjekt werden, in Gestalt von Schallplatten-Alben die seinerzeit ausbrechende Sammelleidenschaft bedienend, welche Bilder, Photographien, Briefmarken, auch Schallplatten nun, »Herbarien künstlichen Lebens«, säuberlich zu kasernieren trachtete. Was man sich damit, um den Preis der Unmittelbarkeit »lebendiger Produktion« (der einmaligen, unwiederholbaren Aufführung), eingehandelt hat? Eine haltbar gemachte, mechanisierte Musikkonserve von defektem, das Medium parasitär mitklingen lassendem Klang.
Auf seiner Suche nach Konvergenzen (statt Differenzen) der Adorno / Benjamin-Bildkonstitutionen konstatiert Schweppenhäuser: »Hinsichtlich der methodischen Figur der ›Konstellation‹ von bildlichen und begrifflichen Elementen, denen bei der Konstruktion108 von authentischen dialektischen Bildern spezifisch Rechnung zu tragen sei, haben Adorno und Benjamin über einen vorläufigen definitiven Begriff des dialektischen Bildes sich verständigen können.«109 Um einen anschaulichen Begriff von Schallplatten-Verhängnis und -Verheißung





























