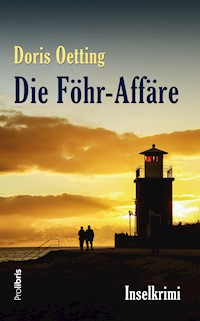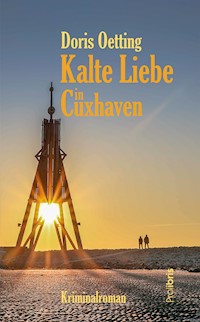Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schatten über dem Inselidyll Als Maja mit ihren Kindern die Sommerferien auf Norderney verbringt, sehnt sie sich nach Ruhe und einem Neuanfang, aber als plötzlich eine alte Bekannte auftaucht, nimmt ihr Urlaub eine unerwartete Wendung. Caro, charmant und rätselhaft, zieht Maja immer mehr in ihren Bann. Was zunächst als harmloses Wiedersehen beginnt, entwickelt sich bald zu einem trügerischen Spiel, in dem die Dinge völlig anders sind, als man glaubt. Während die Nordsee unaufhörlich gegen die Küste brandet, verwandelt sich Majas Leben zu einem Drama, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Wem kann sie noch vertrauen? Alle Menschen in ihrem Umfeld spielen ein falsches Spiel, selbst ihre Kinder entgleiten ihr. Und ein schreckliches Geheimnis, das sie mit niemandem teilen wollte, scheint nicht länger unentdeckt zu bleiben. Der Traumurlaub wird zu einem Albtraum. Ein fesselnder Thriller voller Spannung und einzigartiger Inselatmosphäre – für alle, die den Nervenkitzel lieben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Doris Oetting
Entscheidung auf Norderney
Doris Oetting, geboren 1970 in Lübbecke, lebt mit ihrem Mann in Minden. Sie arbeitet hauptberuflich im Vertriebsmarketing und freiberuflich als Autorin.
Im März 2016 veröffentlichte sie ihren ersten Roman im Self Publishing, bevor sie Verlagsautorin wurde.
Neben mehr als zwanzig Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien sind seitdem mehrere Bücher von Doris Oetting erschienen, von Familiengeschichte bis Krimi. Der vorliegende Thriller ist ihr sechster Roman.
www.doris-oetting.de
DORIS OETTING
Entscheidung auf Norderney
Originalausgabe
© 2025 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH
Am Markt 7 · DE-54576 Hillesheim · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
[email protected] · www.kbv-verlag.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere Herstellung: [email protected] · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von © Steffen - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
ISBN 978-3-95441-721-6 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-95441-728-5 (eBook)
Zu Ehren von Sophie Wörishöffer
1838 - 1890
Inhalt
PROLOG 8. November 1890, Altona (damals noch preußische Provinzstadt)
Samstag, 18. Mai 2024, Norderney
Dienstag, 21. Mai 2024, Westerstede
Sonntag, 23. Juni 2024, Norderney
Montag, 24. Juni 2024
Dienstag, 25. Juni 2024
Mittwoch, 26. Juni 2024
Donnerstag, 27. Juni 2024
Freitag, 28. Juni 2024
Samstag, 29. Juni 2024
Sonntag, 30. Juni 2024
Montag, 1. Juli 2024
25. September 2024
EPILOG Ein Jahr später
Danksagung
PROLOG8. November 1890, Altona(damals noch preußische Provinzstadt)
FRANZ
Er stand mit kraftlos herabhängenden Armen vor dem zerschlissenen Sofa. Sein Leinenhemd hatte Flecken, seine dunkle Hose war an den Knien ausgebeult, die Weste dünn und fadenscheinig, aber das alles störte ihn nicht. Und Sophie störte es auch nicht. Es hätte Sophie nicht gestört, korrigierte er sich in Gedanken. Beinahe jeden Tag war er in den vergangenen zwölf Jahren hier gewesen, hatte sie besucht und nebenbei Reparaturen am oder im Haus erledigt. Manchmal am Nachmittag, manchmal am Abend und manchmal auch am Vormittag, so wie heute. Je nachdem, wie sein Tagesablauf in seiner kleinen Schreinerwerkstatt ausgesehen hatte. Sie hatten über Gott und die Welt geredet, über das Wetter gejammert und über die Politik geschimpft. Aber am liebsten hatten sie über die Bücher diskutiert, die sie, die erfolgreiche Schriftstellerin Sophie Wörishöffer, geschrieben und die er mit Begeisterung gelesen hatte – obwohl es sich um Jugendromane handelte und er dafür eigentlich zu alt war. Er hatte die Unterhaltungen mit ihr genossen und sich jeden Tag darauf gefreut wie ein Kind auf Weihnachten.
Eine schöne Frau war sie nicht gewesen. Nicht vor zwölf Jahren, als sie Nachbarn wurden, und auch jetzt nicht, als ihr Leben im Alter von zweiundfünfzig Jahren endete. Ihre Haare waren dünn und immer streng zurückgekämmt gewesen. Ihr Haaransatz lag so weit hinten, dass sie manchmal fast kahlköpfig wirkte. Die Augen standen eng beieinander, der Mund war ein bisschen schief, und sie hatte eine Himmelfahrtsnase, aber all das hatte seine Faszination für diese geistreiche und blitzgescheite Frau nicht schmälern können. Im Laufe der Jahre und vieler gemeinsam verbrachter Stunden hatte er erfahren, dass sie 1838 als Sophie Andresen in Pinneberg zur Welt gekommen war. Nach dem frühen Tod ihres Vaters, Sophie war zu dem Zeitpunkt erst dreizehn Jahre alt gewesen, war sie mit ihrer Mutter und den beiden jüngeren Geschwistern nach Altona gekommen und hatte mit dem Schreiben von Erzählungen für verschiedene Zeitschriften begonnen. Sophie hatte nie gerne über sich gesprochen. Es hatte vieler Ansätze und Fragen bedurft, bis sie ihm nach und nach ein paar Einzelheiten aus ihrem Leben erzählt hatte. 1866 hatte sie Albert Fischer Wörishöffer geheiratet, der bis dahin ihr Vermieter gewesen war. 1878 war Franz mit seiner Familie ins Nachbarhaus gezogen.
Und jetzt war Sophie tot. Vor wenigen Minuten hatten sie sie abgeholt. Genau zur Mittagszeit. Jetzt war das Haus ganz still, zu still. Er hörte nicht mehr das Geräusch ihrer Schritte, kurz bevor sie sich zu ihm an den Tisch setzte. Er roch nicht mehr das Aroma des Tees, das aus der Tasse aufstieg, die sie ihm jedes Mal ungefragt vor die Nase stellte. Da war auch nicht mehr ihr Lachen, das den Raum erfüllte. Alles, was von ihr geblieben war, war eine kühle, bedrückende Stille. Auf dem kleinen Tisch neben dem Sessel, in dem sie oft viele Stunden am Stück gelesen hatte, lag noch ein Buch. Franz ging langsam darauf zu. Seine Finger zitterten leicht, als er es berührte. Die Seiten waren vergilbt. Er konnte fast vor sich sehen, wie sie dort saß, in ihre Lektüre vertieft, während das Feuer leise im Kamin knisterte. Seine Brust schnürte sich zusammen, und eine Welle von Schmerz durchflutete ihn. Er sollte nach Hause gehen. Zu seiner Frau und seinem Sohn. Aber irgendetwas hielt ihn zurück. Er hatte sich längst eingestanden, dass er Sophie geliebt hatte. Auf eine gänzlich unschuldige Art und Weise, die nie in Konkurrenz gestanden hatte zu der Liebe, die er für seine Frau Emilie empfand. Niemals hätte er Sophie seine Gefühle erklärt oder sich ihr gar genähert. Er verehrte sie rein platonisch wegen ihrer Klugheit, ihrer Fantasie und ihrer Kunst, Geschichten zu erzählen.
Mit müden, schweren Schritten ging er zu dem Regal an der Wand, in dem sie ihre Bücher aufbewahrte. Sie hatte längst nicht von all ihren Veröffentlichungen eigene Exemplare, aber zumindest stand da ihr Werk Aus den Erfahrungen einer Hausfrau mit dem Untertitel Ein Weihnachtsgeschenk für Deutschlands Bräute. Außerdem die Romane Am Abgrund, Die Diamanten des Peruaners, Durch Urwald und Wüstensand, Die Schatzsucher in Peru, Unter Korsaren sowie Kreuz und quer durch Indien. Und eine gut erhaltene Ausgabe des 1877 erschienenen Debütromans Robert des Schiffsjungen Fahrten und Abenteuer auf der deutschen Handels- und Kriegsflotte. Während Franz mit den Fingern über die Buchrücken strich, sann er weiter über die Dinge nach, die er über Sophie wusste. Ihr Mann starb bereits 1870 nach nur vier Jahren Ehe und ließ sie mittellos zurück. Ihr erstgeborener Sohn Philipp starb im Kindesalter. 1871 kam ihr zweiter Sohn Hugo unehelich zur Welt. Von da an hatte sie geschrieben, um den Lebensunterhalt für ihr Kind und sich zu verdienen. Bestimmt würde Hugo bald kommen, um das Haus zu räumen. Dann wären all ihre Sachen verschwunden, ihr einstiges Zuhause wäre nur noch eine leere Hülle, und nichts würde mehr an sie erinnern.
Plötzlich wurde in Franz das Gefühl übermächtig, etwas von dieser außergewöhnlichen Frau behalten zu wollen. Mit den Augen suchte er die Stube ab und hoffte, etwas zu finden, ohne in ihrem Haus herumwühlen zu müssen, denn das wollte er auf keinen Fall tun. Sein Blick blieb an einem hölzernen Kasten hängen, den er schon häufiger bemerkt, sich aber noch nie genau angesehen hatte. Er nahm das Kästchen in die Hand und erkannte, dass es sich um eine Zigarrenkiste handelte. Zedernholz vermutlich, denn Zigarrenkisten waren meistens aus Zedernholz. Hatte Sophies Mann Zigarren geraucht, und sie hatte die Kiste, in der, gemessen an ihrer Höhe, Platz für mindestens vier oder fünf Lagen war, als Erinnerung aufbewahrt? Das Etikett war größtenteils abgekratzt worden, die Schrift auf den kläglichen Überresten verblichen und dadurch unleserlich. Franz hielt den Kasten in seinen Händen wie den Heiligen Gral und öffnete ihn dann langsam und beinahe ehrfürchtig. Sofort stieg ihm würziger Zigarrenduft in die Nase. Oder bildete er sich das nur ein? Die Kiste war doch viel zu alt, um den Duft noch immer abzugeben. Spielte sein Gehirn ihm einen Streich, weil er nun mal wusste, dass es sich um eine Zigarrenkiste handelte? Was er im Innern des Kastens fand, ließ Franz kurz den Atem stocken. Da lag eine goldene Uhrkette mit Uhr, die wahrscheinlich Sophies Mann oder sogar ihrem Vater gehört hatte. Franz fand auch eine goldene Brosche mit einem beeindruckend großen Smaragd. Er kannte sich mit Edelsteinen zwar nicht aus, aber die markante grüne Farbe des Steins war unverkennbar. Außerdem waren da noch verschiedene goldene und silberne Haarspangen und ein Ring mit einem Rubin. Zumindest mit einem roten Stein, und waren Rubine nicht rot? Franz nahm die Schmuckstücke nacheinander aus der Kiste und legte sie ins Regal, denn darunter lagen beschriebene Papiere, die seine Neugier geweckt hatten. Behutsam nahm er das erste Blatt heraus und sah es sich genauer an. Dann begannen seine Hände zu zittern. Was er gefunden hatte, waren Notizen in Sophies unverkennbarer Handschrift. Rohfassungen eines ihrer Manuskripte. Er traute seinen Augen nicht. Um welchen Roman handelte es sich? Franz wischte seine vor Aufregung feuchten Hände an seinen Hosenbeinen ab, bevor er weiterblätterte. Auf einigen Blättern hatte Sophie wild herumgekritzelt, Wörter durchgestrichen oder mit Kringeln und Pfeilen markiert, sodass man kaum noch etwas lesen konnte. Auf anderen wiederum waren ganze Absätze sauber und ohne Verbesserungen oder Streichungen verewigt. Franz besah sich die Seiten genauer und wäre am liebsten in die Luft gesprungen, als er erkannte, dass es sich bei den Notizen um Passagen aus Onnen Visser, der Schmugglersohn von Norderney handelte. Das Buch war sein Lieblingsroman und seiner Meinung nach das größte Meisterwerk aus Sophies Feder. Hintergrund der Erzählung war das Leben an der ostfriesischen Küste und auf den Inseln, vor allem auf Norderney, während der Franzosenzeit. Besonders die Schilderung von Napoleons Feldzug gegen Russland hatte es Franz angetan. Mit den Manuskriptseiten in der Hand ging er hinüber zu Sophies Lesesessel, setzte sich und vertiefte sich in seine Lektüre.
Über den Wassern der Nordsee stand ein schweres Gewitter. Träge lief die Flut an den Strand von Norderney, und doch bewegte sich auf dem Wasser ein Kanonenboot, dessen Besatzung emsig spähend nach allen Seiten ausblickte.
Franz lächelte beim Lesen. Was hier wie eine rasch hingekritzelte Notiz aussah, waren die beiden allerersten Sätze seines Lieblingsromans. Er fühlte sich freudig erregt und suchte in der Kiste nach der nächsten gut leserlichen Textpassage.
Und die Wagenbudenreihe brannte lichterloh. Hier und da in den Straßen glühte es auf. Der Brand von Moskau, das entsetzlichste Ereignis des neunzehnten Jahrhunderts, hatte begonnen.
Oh ja, er erinnerte sich so gut an die Geschichte. Vor Aufregung wurde ihm ganz flau, während er Blatt für Blatt aus der Zigarrenkiste nahm und studierte.
Erst als es dämmerte, kehrte Franz in die Wirklichkeit zurück. Er ging zum Regal hinüber, legte die beschriebenen Blätter zusammen mit den Schmuckstücken zurück in die Zigarrenkiste und verbarg sie unter seiner Weste. Nun blieb etwas von ihr bei ihm. Er konnte nach Hause gehen. Die alten Dielen knarzten unter seinem Schritt, als er langsam zur Haustür ging, vorbei an vergilbten Tapeten und ein paar verblassten Bildern an den Wänden. Draußen zog er die Tür hinter sich zu und schloss dann ab. Der Schlüssel, den sie ihm vor vielen Jahren für alle Fälle übergeben hatte, drehte sich schwer im Schloss, als wollte das Haus ihn nicht gehen lassen.
»Ihr glaubt, dass ja doch alles Übrige Nebensache sei, wenn nur das Kapitel Liebe und Treue zur Zufriedenheit ausgefallen.«
(Sophie Wörishöffer: Aus den Erfahrungen einer Hausfrau)
Samstag, 18. Mai 2024, Norderney
CARO
Es ist halb drei in der Nacht von Freitag auf Samstag. Seltsamerweise bin ich innerlich ganz ruhig. Müsste eine Person, die in wenigen Minuten einen Mord begehen wird, nicht nervös sein, schweißnasse Hände und einen rasenden Herzschlag haben? Nichts von alledem trifft in diesem Moment auf mich zu, während ich die Richthofenstraße entlanggehe, auf dem Weg zum Gelände des Kleingärtnervereins Norderney. Tagsüber, gerade an den Wochenenden, ist hier einiges los, aber jetzt, mitten in der Nacht, bin nur ich hier unterwegs. Alles sieht still und friedlich aus. Ich betrete das sogenannte »Schlickdreieck«, das größere der beiden Areale des Vereins, und der schmale Viertelmond wirft sein spärliches Licht auf den Weg vor mir, während ich an einzelnen Parzellen vorbeigehe. Ich war zuvor noch nie hier, aber über die Gartenlaube, zu der ich unterwegs bin, habe ich mir jahrelang viele Erzählungen und Schwärmereien angehört. Während ich einen Fuß vor den anderen setze, um mich meinem Ziel zu nähern, wundere ich mich über meine Gelassenheit.
Da steht sie. Die Hütte, über die ich so viel gehört habe, dass ich glaube, sie schon lange zu kennen. Ich bleibe stehen und sehe mir alles an. Die Laube ist klein, aber man erkennt die Liebe zum Detail und die sorgfältige Pflege. Das dunkle Holz, aus dem sie gebaut wurde, wirkt weniger deprimierend als in meiner Vorstellung. Die hellbraunen Dachschindeln, die weiß gerahmten Sprossenfenster und die ebenfalls weiße Tür wirken einladend. Vorne gibt es sogar eine winzig kleine Veranda mit einem üppig bepflanzten Blumenkübel. Bestimmt das Werk seiner Frau. Seinen Erzählungen zufolge verbringen die beiden nahezu jedes Wochenende hier auf der Insel. Am Freitag kommen sie mit der letzten Fähre am Abend her, und am Sonntag fahren sie mit der letzten Fähre zurück aufs Festland. Nach anderen Urlaubsreisen und ferneren Zielen stand ihnen nie der Sinn, sie verbrachten schon immer jegliche arbeitsfreie Zeit hier. Das weiß ich aus Erzählungen meines Vaters, der trotz des Altersunterschieds von knapp zwanzig Jahren eng mit ihnen befreundet gewesen war.
Ich gehe langsam auf die Laube zu und hoffe, dass ich unbemerkt an die Schrotflinte gelange, von der ich weiß, dass er sie geladen und schussbereit im Schirmständer hinter der Tür aufbewahrt. Nachts sind sie oft allein hier, daher will er sich und seine Frau jederzeit gegen Eindringlinge verteidigen können. Im Internet habe ich gelesen, dass die tödliche Wirkung bei einem Schrotschuss durch die sogenannte Schockwirkung eintritt. Das bedeutet, dass ein Zusammenbruch des Nervensystems verursacht wird, weil das Opfer von vielen Schrotkugeln gleichzeitig getroffen wird. Hoffen wir mal, dass es genau so abläuft. Ich habe nur diese eine Chance, denn er ist in dieser Nacht allein, weil seine Frau ausnahmsweise erst heute Vormittag auf die Insel kommt.
Ich bin angekommen. Es gibt kein Zurück, und ich will auch nicht zurück. Was ich gleich tue, muss getan werden. Ich habe meine Gründe, auch wenn diese für die meisten Menschen kaum nachvollziehbar wären. Aber ich bin eben nicht wie die meisten Menschen. Ich bleibe stehen, nehme die mitgebrachten Nitril-Handschuhe aus meiner Hosentasche und streife sie über. Plötzlich läuft mir doch ein Schauer über den Rücken. Aber was ich spüre, ist keine Angst, denn ich bin niemals ängstlich. Ich bin ungeduldig, aggressiv, explosiv und reagiere oft extrem und übertrieben. Aber ängstlich? Nein, ängstlich bin ich nicht. Was ich in diesem Augenblick spüre, ist Macht. Die letzten Schritte bis zur Tür lege ich in Zeitlupe zurück, um das berauschende Gefühl möglichst lange auszukosten. Ich hole den Schlüssel, den ich mir habe nachmachen lassen, aus der Jackentasche und schließe leise auf. Sofort fällt mein Blick auf den Schirmständer und die Schrotflinte darin. Alles erscheint außergewöhnlich scharfkantig und konturenreich, als wäre ich mitten in einem Computerspiel. Ich nehme die Waffe, wiege ihr Gewicht in meinen Händen und fühle ihre tödliche Kraft. Die Hütte besteht aus dem Raum, in dem ich jetzt stehe, und einem abgetrennten winzig kleinen Schlafbereich. Auch das wusste ich aus seinen endlos scheinenden Erzählungen. Ich sehe, dass die Tür zum Schlafraum nur angelehnt ist, und schiebe sie mit der Schuhspitze auf. Dabei hebe ich die Schrotflinte auf Augenhöhe. Alle meine Sinne sind hellwach. Ich sehe, wie er sich, noch halb schlafend, aus dem schmalen Bett hievt. Scheinbar war ich doch nicht ganz geräuschlos und habe ihn geweckt. Er trägt ein weißes Doppelripp-Unterhemd und eine gestreifte Pyjamahose, über der sein Wohlstandsbauch hängt. Als er den Kopf dreht, treffen sich unsere Blicke. Natürlich erkennt er mich sofort, denn wir beide kennen uns lange und gut. Beinahe im selben Moment ziele ich kurz und drücke ab. Fasziniert sehe ich zu, wie sein Blut an die Wand hinter ihm spritzt. Er fällt zurück aufs Bett, in dem er bis vorhin noch selig geschlummert hat. Seine Augen sind weit offen und zur Decke gerichtet. Ich drehe mich um, stelle die Schrotflinte zurück in den Schirmständer und gehe. Es dauert nicht mehr lange, bis es hell wird, daher sollte ich besser verschwinden. Irgendwann heute Vormittag wird seine Frau eintreffen und ihn finden. Vermutlich wird sie trauern, denn sie weiß ja nicht, was ich weiß. Dass er ihr nicht treu war. Dass er sie bereits seit mehr als zwei Jahren betrogen hat. Ich hätte nie gedacht, dass er diese Heimlichtuerei, diese Zweigleisigkeit, organisatorisch hinbekommt. Und noch weniger hätte ich gedacht, dass sich neben seiner seit Ewigkeiten Angetrauten noch eine weitere Frau für diesen Schmierlappen erwärmen könnte.
Draußen ziehe ich die Handschuhe aus und stopfe sie zurück in meine Hosentasche. Während ich mich vom Schlickdreieck entferne und wenig später die Richthofenstraße verlasse, werden meine Schritte immer schneller. Plötzlich glaube ich, hinter mir einen Schrei zu hören, aber bestimmt habe ich mir das nur eingebildet. Es war ja weit und breit keine Menschenseele außer mir hier. Wahrscheinlich war es nur eine schlaflose Möwe. Noch immer bin ich voller Adrenalin. Denn ich weiß, dass dies erst der Anfang war.
Dienstag, 21. Mai 2024, Westerstede
MAJA
Scarlett O’Hara war nicht eigentlich schön zu nennen. An diesen ersten Satz aus ihrem Lieblingsroman Vom Winde verweht musste Maja denken, als sie auf dem Weg in die Küche einen kurzen Blick in den Garderobenspiegel warf. Okay, mit sechsundvierzig war sie eine Frau in den mittleren Jahren, das ließ sich nicht leugnen. Aber sie musste sich eingestehen, dass sie älter aussah, als sie war. Ihre kinnlangen blonden Haare waren glanzlos, ihre Haut war blass und fleckig, ihr Blick müde, und die Krähenfüße würden auch bei Mondschein oder Kerzenlicht nicht mehr als Lachfalten durchgehen. Sie musste sich mit ihrem Äußeren wieder mehr Mühe geben. Ein Friseurbesuch und ein Termin im Kosmetikstudio waren dringend nötig. Morgen, sagte sie sich in Gedanken. Morgen kümmere ich mich darum.
Jetzt musste sie erst mal dafür sorgen, dass die Kinder pünktlich aus dem Haus kamen. An den Schultagen war es morgens immer hektisch. Samstags auch, denn da ging Lia vormittags zum Reitunterricht, weil sie Turnierreiterin werden wollte, und Ben zum Fußballtraining, weil er Lionel Messi werden wollte. Deshalb freute sich Maja jede Woche auf den Sonntag. Sie fühlte jedes Mal beinahe körperliche Schmerzen, wenn sie zu wenig Zeit mit ihren Zwillingen verbringen konnte. Zum Glück waren es nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien. Sie wusste, dass sie sich zu sehr an die Kinder klammerte, aber sie konnte nicht aus ihrer Haut. Sie hatte Lia und Ben erst mit vierunddreißig bekommen und auch nur mit ärztlicher Hilfe und einer Hormontherapie, die ihrem Körper viel abverlangt hatte. Aber sie hätte alles getan, um endlich schwanger zu werden, nachdem Heiko und sie sich mit der Familienplanung mehr als zehn Jahre lang vergeblich abgemüht hatten. Ja, eine Mühe war es gewesen. Vielleicht nicht von Anfang an, aber mit den Jahren immer mehr. Anstatt um Liebe und Romantik hatte sich alles um Eisprungtermine und Spermienqualität gedreht. Zum Sex kam es nicht mehr aus Lust und Spontaneität, sondern auf Verabredung. Als es dann endlich geklappt hatte, verlief die Schwangerschaft komplikationslos, und die Zwillinge kamen an einem Sonntag im März vor zwölf Jahren zur Welt. Vielleicht liebte Maja die Sonntage deswegen so sehr.
Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als ihre Kinder laut polternd die Treppe herunterkamen.
»Das erlaubt Mama nie!«, stellte Ben fest.
»Ist ja nicht dein Problem«, gab Lia zurück.
»Um was geht’s?«, fragte Maja, als ihre Kinder die Küche betraten.
»Lia will ein Tattoo.«
»Halt dich doch einfach mal raus, kleiner Bruder!« Lia wusste genau, wie sehr die Bezeichnung »kleiner Bruder« Ben ärgerte, denn es ging um gerade einmal vier Minuten.
»Aber es stimmt«, sagte Maja. »Das erlaube ich nie.«
Lia schob trotzig die Unterlippe vor. »Dann mach ich’s eben, wenn ich achtzehn bin, dann kann mir keiner mehr reinquatschen. Dauert ja gar nicht mehr so lange.«
»Na klar!« Ben tat so, als würde er sich vor Lachen kaum halten können. »Nicht mehr lange. Nur schlappe sechs Jahre. Also noch mal so lange, wie wir jetzt schon zur Schule müssen.« Ben hatte den Tag der Einschulung genossen, aber gleich danach war seine Begeisterung für die Schule zusammengefallen wie ein Soufflé.
Die Zwillinge gingen in die siebte Klasse des örtlichen Gymnasiums, aber während Lia der Unterrichtsstoff kaum Mühe bereitete, musste sich Ben alles hart erarbeiten. Trotzdem waren seine Noten fast so gut wie die seiner Schwester, denn er wollte sich ihr gegenüber keine Blöße geben.
»Mama hat gesagt, dass die Zeit immer schneller vergeht, wenn man älter wird«, entgegnete Lia altklug.
Jetzt musste auch Maja lachen. »Das betrifft aber noch nicht die Jahre zwischen zwölf und achtzehn.«
»Ich freu mich jedenfalls jetzt schon darauf, eine eigene Wohnung zu haben und tun und lassen zu können, was ich will.«
»Aha«, erwiderte Maja. »Und freust du dich auch darauf, den ganzen Tag arbeiten zu gehen, um alles bezahlen zu können? Und nach Feierabend zu putzen und zu waschen und zu bügeln und einzukaufen und zu kochen und …«
»Boah, Mama!«, fiel Lia ihr ins Wort. »Du kannst einem echt alles vermiesen.«
»Ich zeige dir nur die Realität auf.«
Lia sah sie mit einem Blick an, der beinahe Funken sprühen ließ. Solche Gespräche führten sie in letzter Zeit leider immer häufiger. Die Pubertät hatte Lia fest im Griff, während Ben irgendwie noch immer Majas kleiner Junge war.
»Jedenfalls werde ich mal nicht so spießig wie du«, erklärte Lia. »Jeden Tag putzen, obwohl doch alles wieder schmutzig wird. Jeden Tag die Betten machen, obwohl man sich abends wieder reinlegt. Jeden Tag kochen, obwohl man an jeder Ecke was Essbares kaufen kann. Viel zu viel Aufwand für nix und wieder nix.«
Maja lachte, aber sie hörte selbst, dass es beleidigt klang. »Das nennst du Aufwand? Das ist doch gar nichts. Dich auf die Welt zu pressen, das war Aufwand.«
»Boah, eklig!«, rief Lia aus, während Ben sich schlapplachte. Dann verkündete Lia: »Ich gehe nach der Schule noch mit zu Janne. Sie hat neue Reitklamotten, die will sie mir zeigen.«
»Okay«, sagte Maja nur, um die Wogen wieder zu glätten.
»Gibt es denn auch Reithosen für Dicke?«, stichelte Ben.
»Janne ist nicht dick!«, verteidigte Lia ihre Freundin.
»Ist sie wohl. Weißt du eigentlich, wie man eine gut gelaunte Dicke nennt? Ausgelassenes Fett!«
»Schluss jetzt, Ben!« Maja warf ihrem Sohn einen warnenden Blick zu.
»Janne kann jedenfalls super reiten«, holte Lia zum Gegenschlag aus. »Was kannst du eigentlich? Außer stundenlang Playstation spielen, meine ich.«
»Sag ich nicht«, gab Ben zurück. »Ich habe jede Menge verborgene Talente.«
»So gut verborgen, dass sich noch kein einziges davon bemerkbar gemacht hat.«
»Schluss, habe ich gesagt«, ging Maja erneut dazwischen. »Beeilt euch lieber, wenn ihr nicht zu spät kommen wollt!«
Die Zwillinge warfen sich gegenseitig noch ein paar böse Blicke zu, sagten aber nichts mehr. Trotz wiederholter Ermahnungen schlangen sie den Toast im Stehen hinunter, packten ihre Schulbrote und etwas Obst ein und waren aus dem Haus gestürmt, ehe Maja sich richtig hatte verabschieden können.
MARGARETE
Wer war die Frau? Und wen oder was suchte sie hier? Margarete Kranewecker verließ ihren Wachposten am Schlafzimmerfenster und ging ins Wohnzimmer. Sofort heftete sich ihr Blick wieder auf die Fremde, die nun schon zum dritten Mal die Straße entlang und am kraneweckerschen Einfamilienhaus im Tulpenweg vorbeiging und sich dabei suchend nach allen Seiten umsah. Jetzt wurde es Margarete zu bunt. Sie stopfte das Staubtuch, mit dem sie gerade ihre tägliche Runde durchs Haus drehte, in die Schürzentasche und betrat den Flur. Gewohnheitsmäßig überprüfte sie im Spiegel den ordnungsgemäßen Sitz ihrer Dauerwelle, bevor sie aus der Haustür trat und beinahe im Stechschritt über den schmalen Kiesweg in Richtung Straße marschierte. Dass sie bei ihren Nachbarn in der Siedlung den Ruf einer neugierigen und sich in alles einmischenden Person hatte, war ihr schon vor langer Zeit gleichgültig geworden. Eines Tages, da war sich Margarete sicher, würden sie ihr noch mal dankbar dafür sein, dass sie alles im Blick hatte und Störenfriede vertrieb, bevor sie irgendeinen Schaden anrichten konnten.
Als sie die Pforte des Jägerzauns öffnete, jaulten die alten Scharniere gequält auf. Sie musste sie dringend ölen. Das laute Quietschen hatte nicht nur Margarete selbst erschreckt, auch die fremde Frau auf der Straße war stehen geblieben und hatte sich umgedreht. Gut so, dachte Margarete und eröffnete das Feuer.
»Hallo? Hören Sie mich? Was machen Sie hier?«
»Ich bin … Ich wollte …«, stammelte die Fremde überrumpelt. Dann holte sie tief Luft, sah Margarete direkt in die Augen und sagte um einiges selbstsicherer: »Guten Tag. Ja, ich höre Sie, Sie waren ja laut genug. Ich gehe spazieren. Oder spricht etwas dagegen?« Sie milderte ihren schnippischen Tonfall durch ein, das musste Margarete zugeben, offenes und sympathisches Lächeln ab.
Aber Margarete Kranewecker ließ sich nicht so leicht abwimmeln. »Nun, Sie sind in der vergangenen halben Stunde dreimal hier vorbeigegangen. Suchen Sie jemanden?«
Die Fremde kam mit langsamen Schritten auf Margarete zu, die breitbeinig und mit vor dem beachtlichen Busen verschränkten Armen mitten auf dem Tulpenweg stand. Vermutlich würde sie sich gleich wieder anhören müssen, dass sie das nichts anging, dass sie sich raushalten und um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollte. Daran war sie gewöhnt. Es kränkte sie längst nicht mehr. Es ermüdete sie nur noch. Wenigstens war die Fremde um einen freundlichen Gesichtsausdruck bemüht. Damit unterschied sie sich schon von denen, die Margarete sonst diese Sätze entgegenschleuderten.
Kurz vor Margarete blieb die fremde Frau stehen. Sie war schätzungsweise um die fünfzig. Die kleinen Fältchen in ihrem Gesicht konnten ihrer Attraktivität nichts anhaben. Und wer kam schon ganz ohne Falten, Narben oder Blessuren durchs Leben? Das Lächeln der Frau wirkte herzlich. Ein Anblick, dem Margarete sich nicht oft gegenübersah. Aber so leicht ließ sie sich nicht einwickeln, daher veränderte sie nichts an ihrer Haltung oder Mimik.
»Ja, ich suche jemanden«, sagte die Fremde. »Ach, ich bitte um Entschuldigung, wo sind bloß meine Manieren? Ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Caroline von Weidlitz. Sagen Sie bloß, das hier ist Ihr Garten! Was für eine Blütenpracht!«
Damit war Margaretes harte Schale nun doch geknackt. Als eifrige Leserin sämtlicher Adelsgazetten hatten ihre Augen schon geleuchtet, als die Fremde ihren wohlklingenden Namen nannte. Von Weidlitz. Dass sie nun auch noch den Vorgarten gebührend bewunderte und lobte, setzte, um im Bild zu bleiben, allem die Krone auf. Margarete sah sich Frau von Weidlitz genauer an. Sie war groß, ungefähr so groß wie Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen. Ihre Kleidung war sportlich-elegant wie die von Prinzessin Kate, wenn sie nicht gerade bei einem offiziellen Termin war. Auch die Haare hatten denselben sanften Braunton wie die von der Princess of Wales. Allerdings trug Frau von Weidlitz die Haare nicht offen, sondern als Hochsteckfrisur, ähnlich der von Victoria von Schweden. Das einzig Unkönigliche an Frau von Weidlitz waren die riesigen Creolen. Solch übertriebenen Schmuck würde kein Mitglied eines europäischen Königshauses jemals tragen. Aber das Wichtigste war, dass sie keinerlei Ähnlichkeit hatte mit dieser geschiedenen Schauspielerin aus Amerika, die aus dem Volksliebling Prinz Harry in Nullkommanichts eine Handpuppe ohne eigene Meinung gemacht hatte. Nun, Margarete selbst trug wenigstens denselben Vornamen wie die ehemalige Königin von Dänemark, wenn auch die dänische Schreibweise eine andere war, aber so eng musste man es ja nun wirklich nicht sehen.
»Nett, Sie kennenzulernen, Frau von Weidlitz«, säuselte sie. »Ich bin Margarete Kranewecker. Sehen Sie sich die Beete gerne genauer an.« Einladend schubste sie die Jägerzaunpforte auf, die diesmal keinen Ton von sich gab, als wollte auch sie sich angesichts des vornehmen Gastes von ihrer besten Seite zeigen. Zu Margaretes großem Entzücken schritt Caroline von Weidlitz tatsächlich durch die Pforte.
»Möchten Sie vielleicht einen Kaffee trinken und sich etwas ausruhen? Ich kann Ihnen bestimmt bei Ihrer Suche helfen, ich kenne hier jeden Grashalm.«
Frau von Weidlitz nickte huldvoll, und die kraneweckersche Haustür schloss sich hinter den beiden ungleichen Frauen.
CARO
Veilchenweg, Rosenweg, Tulpenweg – hier hatte sich vermutlich ein Blumenliebhaber bei der Stadtplanung hemmungslos ausgetobt. Nelkenweg, Dahlienweg – bin ich hier nicht überall schon gewesen? Laufe ich im Kreis? Oder sieht hier alles absolut identisch aus? Die Häuser in dieser Siedlung sind überwiegend Einfamilienhäuser aus den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Viele von ihnen sind grau, verwittert und schmucklos und scheinen sich unter der Last ihrer Jahre zu beugen. Andere trotzen durch die unermüdlichen Bemühungen ihrer Bewohner mal mehr und mal weniger erfolgreich dem Zahn der Zeit. Jedes dieser Häuser war oder ist der betonierte Traum einer vermutlich ebenso langweiligen wie austauschbaren Kleinfamilie. Schon bilde ich mir ein, den Geruch von Mottenkugeln wahrzunehmen.
In einem dieser Häuser im niedersächsischen Westerstede werde ich die Person finden, nach der ich suche. Aber in welchem? Ich erinnere mich gut an unser Gespräch vor knapp zwei Monaten, das mir damals wie das Geschenk einer guten Fee vorkam. Ich könnte es beinahe wortgetreu nacherzählen. Vollkommen unvermutet und aus heiterem Himmel hatte ich hochinteressante Informationen erhalten. Wie bei einem Gemälde, bei dem man vorsichtig die Staubschicht entfernt, um die Farben darunter wieder erstrahlen zu lassen. Mit jedem Satz hatte sich meine Aufregung gesteigert. Nur schwer hatte ich meine Gefühle verbergen können, während ganz langsam eine Idee entstand und sich zu einem ausgeklügelten Plan entwickelte. Nur das Detail der genauen Adresse hier in dieser Siedlung war mir dummerweise entfallen. Ich hatte mir den Ort gemerkt, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Und natürlich weiß ich den Namen noch, aber das war’s. Erneut krame ich in meiner Erinnerung. Der Straßenname enthielt eine Blume. Aber welche? Ich überlege, wie ich am besten vorgehe. Ich kann unmöglich von Haustür zu Haustür gehen, um die Namen auf sämtlichen Klingelschildern zu lesen. Erstens dauert das ewig, und zweitens macht es bestimmt einen sehr merkwürdigen Eindruck. Und ich habe absolut keine Lust, pausenlos angesprochen zu werden.
Mitten in meine Überlegungen hinein ertönt hinter mir ein lautes Quietschen. Ich bleibe stehen, drehe mich um und höre eine Frauenstimme, die mich keifend fragt, was ich hier mache. Ich setze mein charmantestes Lächeln auf, das seine Wirkung noch nie verfehlt hat. Einige Meter von mir entfernt steht eine deutlich übergewichtige Frau mitten auf der Straße und erinnert mich in ihrer Haltung an einen schlecht gelaunten Türsteher. Ich setze mich in Bewegung und gehe langsam auf die Frau zu. Beim Näherkommen schätze ich sie auf Mitte siebzig, und beim Anblick der verwaschenen Schürze und der Filzpantoffeln mit Kunstfellbesatz sträuben sich mir die Nackenhaare.
Nach einer kurzen Unterhaltung, in der ich zuerst mit meinem Namen imponieren und dann mit ein paar geheuchelten Garten-Komplimenten punkten kann – Menschen vom Schlag dieser Frau sind so haarsträubend berechenbar –, finde ich mich in der Gruft wieder, die diese Margarete Kranewecker ihr Zuhause nennt. Hatte ich draußen noch gedacht, dass der Jägerzaun das Schlimmste an diesem Domizil ist, werde ich im Inneren des Hauses eines Besseren belehrt. Alles ist dunkel, alles riecht muffig, alles ist überladen mit Nippes und Staubfängern und wirkt wie das Set für eine Fernsehwerbung aus der Wirtschaftswunderzeit. Nur mühsam unterdrücke ich ein Gähnen, weil die Atmosphäre in diesem stickigen Haus meinem Gehirn sofort Sauerstoffmangel meldet. Frau Kranewecker sitzt neben mir auf dem dunkelbraunen Sofa und redet, angestachelt durch meine vorgetäuschte Begeisterung für den Garten, über geeignete Pflanzzeiten, passende Erden, Gießintervalle und Schädlingsbekämpfung. Ihr zuzuhören, strengt mich enorm an. Es gibt keinen einzigen Ort auf der Welt, an dem ich jetzt nicht lieber wäre als hier, aber ich reiße mich zusammen, staune, nicke und lächle.
Endlich, nach der zweiten Tasse des viel zu starken Kaffees, kommen wir zum Punkt, als Frau Kranewecker fragt: »Und wen suchen Sie nun?«
Ich bemühe mich um einen verlegenen Gesichtsausdruck. Mit Empfindungen wie Verlegenheit, Peinlichkeit oder Scham kenne ich mich absolut nicht aus, aber ich verfüge zum Glück über ein ausgeprägtes schauspielerisches Talent. »Wissen Sie, es klingt bestimmt seltsam, aber ich suche eine Frau, die ich kaum kenne, aber gerne wiedersehen würde.«
Ich sehe, dass Frau Kranewecker eine Augenbraue hochzieht, und in dem Moment wird mir klar, dass ich sie durch diesen Satz auf eine vollkommen falsche Fährte gebracht habe. Schnell füge ich hinzu: »Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt, wenn ich mich recht erinnere, in dieser Siedlung. Ihr Name ist Maja Herwein, und wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt, weil wir im selben Zimmer lagen.« Beinahe muss ich lachen, als Frau Kranewecker vor Erleichterung aufatmet.
»Ach, die Familie Herwein! Die kenne ich natürlich. Die wohnen im Asternweg.«
Genau, die Astern fehlten noch in diesem bunten Blumenstrauß der Straßennamen. Ich sage: »Wie Sie bemerkt haben, bin ich ja schon etwas hier herumgeirrt, aber den Asternweg habe ich noch nicht entdeckt.«
»Kein Wunder«, erklärt Frau Kranewecker. »Der Asternweg liegt etwas außerhalb des Siedlungskerns. Den muss man kennen, um ihn zu finden.« Sie greift nach der braunen Warmhaltekanne und gießt erneut Kaffee in meine Tasse, bevor ich es schaffe, dankend abzulehnen. Mit dieser Koffeindosis im Blut werde ich wahrscheinlich nie wieder schlafen können.
»Ich wusste gar nicht, dass Frau Herwein im Krankenhaus war«, plappert Frau Kranewecker munter weiter. »Was fehlte ihr denn?«
Unfassbar, wie indiskret diese Frau ist, denke ich, bevor ich bereitwillig antworte. »Wir waren beide im Krankenhaus auf Norderney. Ich war über Ostern dort und Frau Herwein mit ihren Kindern auch. Eines Morgens wollte sie schnell mit dem Rad zum Bäcker fahren, verzichtete auf den Fahrradhelm, stürzte prompt und zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu. Sie kam für eine Nacht zur Beobachtung ins Krankenhaus.«
»Die Arme«, sagt Frau Kranewecker. »Wer hat sich denn dann um die Kinder gekümmert?«
»Frau Herwein erzählte von einer Bekannten, die die Aufsicht übernahm. Es war ja wie gesagt auch nur für eine Nacht.«
Margarete Kranewecker nickt mit dem Gesichtsausdruck einer Gouvernante, deren Schützling sich zu ihrer vollsten Zufriedenheit entwickelt. Dann besinnt sie sich wieder auf mich. »Und warum waren Sie im Krankenhaus?«
Ist es Neugier, Naivität oder Unverfrorenheit, die diese Frau dazu bringt, solche Fragen zu stellen? Unfassbar, denke ich erneut, aber wieder zögere ich nicht mit der Antwort. »Ich hatte einen sehr ausgeprägten Hallux valgus.« Frau Kranewecker nickt, um mir zu verstehen zu geben, dass ihr dieser medizinische Begriff durchaus geläufig ist. »Diese Fehlstellung habe ich operativ korrigieren lassen. Das Krankenhaus auf Norderney genießt für diese Art der Operation einen hervorragenden Ruf, müssen Sie wissen. Man hatte mir zu einer Übernachtung in der Klinik geraten, um nach dem Eingriff bestmöglich versorgt zu sein. Frau Herwein und ich haben also einen Tag und eine Nacht lang das Zimmer geteilt.«
»Und in der kurzen Zeit haben Sie sich angefreundet?«, fragt Frau Kranewecker.
»Na ja, um eine Freundschaft aufzubauen, braucht man natürlich mehr Zeit. Aber wir waren uns auf Anhieb sympathisch, haben uns super verstanden und viel erzählt. Und wir haben uns versprochen, in Kontakt zu bleiben. Dieses Versprechen möchte ich heute einlösen. Allerdings haben wir in dem ganzen Trubel bei der Entlassung dann vergessen, unsere Adressen und Telefonnummern aufzuschreiben. Was für ein blödes Versäumnis.« Ich schüttele über mich selbst den Kopf. »Zum Glück konnte ich mich an den Ort erinnern und dass ihre Adresse etwas mit Blumen zu tun hatte.«
Margarete Kranewecker stellt ihre Tasse ab und tätschelt doch tatsächlich mein Knie. Schon wieder so eine Übergriffigkeit, hat diese Frau denn gar kein Gespür für die angemessene zwischenmenschliche Distanz? Für meine angespannten Nerven ist sie das reinste Gift. Ich bin ein bisschen verwundert über mich selbst, denn ich war davon ausgegangen, dass ich meinen Plan gänzlich unaufgeregt und souverän in die Tat umsetzen würde. Umso überraschter bin ich, dass ich bereits jetzt am Rand meiner Selbstbeherrschung angelangt bin. Ich versteife mich, was von meiner Gastgeberin allerdings gänzlich unbemerkt bleibt.
»Dafür bin ich ja jetzt da«, sagt sie und fühlt sich sichtlich wohl in der Rolle der Retterin. »Sie werden den Asternweg schon finden. Sie gehen von hier aus auf dem Tulpenweg weiter nach links. An der Einmündung zum Veilchenweg gehen Sie geradeaus weiter, obwohl es dort aussieht, als gäbe es keine weiteren Häuser. Es folgen aber noch zwei Wege, die nach rechts abgehen, und zwar zuerst der Lilienweg, da gehen Sie noch vorbei, und dann der Asternweg. Es ist wirklich ganz einfach. Man muss es nur wissen.« Sie lacht über ihren Witz, und ich verziehe das Gesicht zu etwas, das hoffentlich nach Belustigung aussieht.
»Wissen Sie was?«, ruft sie plötzlich und haut sich mit der flachen Hand auf den fleischigen Oberschenkel. »Ein kleiner Spaziergang wird mir guttun, ich bringe Sie hin.«
Sofort protestiere ich. Inzwischen geht mir die Kranewecker extrem auf die Nerven. Das fehlt mir gerade noch, dass sie sich an meine Fersen heftet. »Das ist wirklich nicht nötig, ich habe schon zu viel Ihrer Zeit beansprucht.«
»Papperlapapp. Keine Widerrede. Ich bringe schnell das Geschirr in die Küche, und dann geht’s los.«
Ich sehe ein, dass ich deutlicher werden muss, um sie abzuschütteln. »Ich bin Ihnen für die Gastfreundlichkeit und Ihre Hilfe wirklich dankbar, aber ich möchte nicht, dass Sie mich begleiten. Haben Sie mich verstanden?«
Der kraneweckersche Gesichtsausdruck wechselt im Bruchteil einer Sekunde von entspannt auf misstrauisch. In dem Bemühen, sich das Ruder nicht aus der Hand nehmen zu lassen, sagt sie: »Aber dann sollten wir Frau Herwein anrufen, bevor Sie bei ihr klingeln. Wer weiß, ob es ihr gerade passt, Besuch zu empfangen. Immerhin ist ja Mittagszeit.« Sie greift nach dem schnurlosen Telefon, das neben ihr auf einem Beistelltisch in der Ladestation steckt. Wäre es ein Apparat mit Wählscheibe und bordeauxrotem Samtüberzug gewesen, hätte es mich auch nicht gewundert. Ich erkenne, dass sie die Nummer der Auskunft eintippt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie im Zeitalter des Internets noch gibt, und kurz darauf höre ich: »Hallo? Hier ist Kranewecker. Ich brauche die Telefonnummer von Familie Herwein im Asternweg in …«
In diesem Moment nehme ich ihr grob das Telefon aus der Hand und beende das Gespräch. Ich dachte, ich hätte meine Aggressionen inzwischen besser im Griff, aber da habe ich mich gründlich getäuscht. Wenigstens lächle ich dabei auf diese Art und Weise, die ich perfekt beherrsche: freundlich, aber absolut keinen Widerspruch duldend. Wenige Minuten später verlasse ich das Haus im Tulpenweg. Margarete Kranewecker begleitet mich nicht zur Tür.
MAJA
Nachdem ihre Kinder das Haus verlassen und sich auf den Weg zur Schule gemacht hatten, stürzte sich Maja in die Hausarbeit. Sie wollte die anfallenden Arbeiten am Vormittag erledigen, damit sie den Nachmittag mit ihren Zwillingen verbringen konnte. Falls die beiden dazu Lust hatten, was mittlerweile leider immer seltener der Fall war.