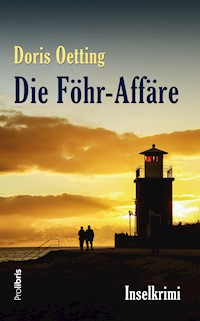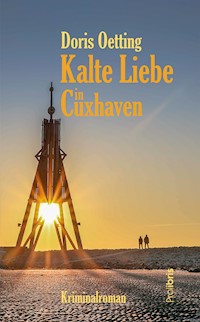5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carola Seifert ist 40, geschieden und einsam. Ihr Leben befindet sich in einer Phase, in der nichts und niemand mehr von Bedeutung zu sein scheint, erst recht nicht sie selbst. Als sie im Nachlass ihrer Oma Gegenstände findet, die ihr Rätsel aufgeben, ist sie wild entschlossen, diese Rätsel zu lösen. Dabei kommt Carola zuerst einem gut gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur, bevor sie die Suche nach der Wahrheit in längst vergangene Zeiten und schließlich in die Arme eines Mannes führt, der nicht der ist, der er zu sein scheint. Carola muss auf sich selbst und ihren Instinkt vertrauen und lässt endlich wieder "Glaube, Liebe, Hoffnung" in ihr Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Doris Oetting
Am Größten aber ist die Liebe
www.tredition.de
© 2016 Doris Oetting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7345-1798-3
Hardcover:
978-3-7345-1799-0
e-Book:
978-3-7345-1800-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Kapitel 1
„Ein jeder hat sein Los, und leicht ist keines.“ (Hermann Hesse)
Februar 2011
Carola Seifert war noch nie von ihrem Chef zu einem Gespräch unter vier Augen gebeten worden. Sie war die einzige Angestellte, die er in seinem kleinen Reisebüro in Oldenburg beschäftigte, und ihr Umgang miteinander war entspannt, aber respektvoll. Wenn er ihr etwas zu sagen hatte, war dies bisher immer während des ganz normalen Geschäftsbetriebes geschehen, weil es natürlich zwischendurch immer wieder Momente gab, in denen kein Kunde da war und sie frei reden konnten. Aber heute hatte er sie am Nachmittag von unterwegs angerufen und sie gebeten, nach Ladenschluss noch etwas Zeit für ein Personalgespräch einzuplanen. Das war um kurz nach vier gewesen.
Schon den ganzen Tag war es Carola so vorgekommen, als ob die Stunden und Minuten nur im Zeitlupentempo vergingen. Dieses Gefühl verstärkte sich jetzt noch, weil sie sich die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrach, was Herr Abraham mit ihr zu besprechen haben könnte. Personalgespräch klang so hochoffiziell, dass sie immer nervöser wurde. In all den Jahren, die sie jetzt schon für ihn arbeitete, war das noch nie vorgekommen.
Carola war froh, dass der heutige Nachmittag sehr ruhig war, denn auf einen komplizierten Kunden mit extravaganten Reisewünschen hätte sie sich bestimmt nicht konzentrieren können.
Pünktlich um kurz vor halb sieben erschien Herr Abraham, begrüßte Carola so freundlich wie immer und verschwand im Hinterzimmer. Wenige Minuten später schloss Carola das Reisebüro ab, schaltete den Anrufbeantworter ein und ihren Computer aus. Herr Abraham kam nach vorne und setzte sich an seinen Schreibtisch. Dann zeigte er auf den Stuhl gegenüber, auf dem sonst Kunden Platz nahmen. Sie setzte sich. Mit nicht vorhandener Gelassenheit schlug sie die Beine übereinander und strich sich eine Strähne ihres blonden halblangen Haares aus dem Gesicht.
Dann sah sie ihn erwartungsvoll an.
„Carola“, begann er freundlich und sein Lächeln war offen und echt, „wie lange arbeiten Sie jetzt schon für mich?“
„Vierzehn Jahre“, beantwortet Carola die rein rhetorische Frage, denn das wusste er doch selber ganz genau.
„Ja, und in dieser ganzen Zeit war ich immer sehr zufrieden mit Ihnen.“
War? Carola wurde noch unruhiger und spielte nervös an ihrer
Armbanduhr herum. Sie antwortete nichts, er hatte ja auch nichts gefragt.
„In der letzten Zeit hatte ich allerdings häufiger das Gefühl, dass Sie niedergeschlagen und unkonzentriert waren. Haben Sie Sorgen, bei denen ich Ihnen vielleicht helfen kann?“
„Habe ich Fehler gemacht? Gab es Beschwerden?“, gab Carola erschrocken zurück.
„Nein, nein“, sagte Herr Abraham beschwichtigend, „es ist mir nur aufgefallen, weil ich Sie so bisher nicht kannte. Sie sollen wissen, dass Sie mir als langjährige Mitarbeiterin am Herzen liegen. Wenn ich also etwas für Sie tun kann, lassen Sie es mich bitte wissen.“
Carola war gerührt. Das also war der Grund für dieses so offiziell einberufene Personalgespräch? Er wollte wissen, ob sie Sorgen hatte und bot seine Hilfe an? Wie unglaublich nett von ihm.
„Vielen Dank, Herr Abraham, ich weiß Ihre Freundlichkeit wirklich zu schätzen. Es stimmt, ich bin seit einiger Zeit nicht in Höchstform. Dafür gibt es private Gründe, über die ich aber bitte nicht sprechen möchte.
Ich kann mich nur dafür entschuldigen und Ihnen versprechen, dass ich alles tue, um mich schnellstmöglich wieder besser im Griff zu haben.“
„Sie müssen sich nicht entschuldigen, wir haben alle unsere Hochs und Tiefs. Aber Sie sollten sich tatsächlich in absehbarer Zeit wieder mehr auf die Arbeit konzentrieren, weil …“ Herr Abraham machte eine wirkungsvolle Pause und Carolas Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Weil? Was kam denn jetzt?
„Weil ich Ihnen ab sofort mehr Außeneinsätze übergeben möchte. Sie wissen schon, neue Hotels besichtigen, Testreisen unternehmen, prüfen, was wir unseren Kunden mit gutem Gewissen anbieten können. Wären Sie dazu bereit?“
Ob sie dazu bereit wäre? Machte er Witze? Davon hatte sie immer geträumt. Aber wenn sie künftig mehr unterwegs wäre, wer war dann hier im Büro? „Und wer hält hier die Stellung, wenn ich weg bin?“
„Ich“, gab Herr Abraham zurück. „Wir wechseln uns in Zukunft einfach ab. Ich möchte nicht mehr so viel von zu Hause weg sein wie bisher. Ich werde langsam zu alt für dieses Nomadenleben. Außerdem geht es meiner Frau nicht gut und ich möchte sie nicht so viel alleine lassen.“
„Das mit Ihrer Frau tut mir wirklich leid. Ich würde natürlich sehr gerne die eine oder andere Reise für Sie übernehmen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen“, sagte Carola.
„Das haben Sie sich in all den Jahren wirklich verdient. Ich freue mich sehr, dass wir uns einig sind. Über das Finanzielle sprechen wir ein anderes Mal, jetzt muss ich dringend nach Hause.“
„Natürlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Abraham. Und nochmals vielen Dank.“
Wenige Minuten, nachdem ihr Chef gegangen war, verließ auch Carola das Reisebüro und fuhr nach Hause. Schon im Auto spürte sie, dass leider auch das erfreuliche Gespräch und die tollen beruflichen Zukunftsaussichten sie nicht wirklich aufheitern konnten. In letzter Zeit berührte alles immer nur noch die Oberfläche. Kaum etwas erreichte ihr Innerstes.
Zu Hause angekommen wurde es dann wie erwartet der nächste traurige und einsame Abend in einer ganzen Reihe trauriger und einsamer Abende. Carola wanderte unruhig durch ihre kleine, gemütlich eingerichtete Wohnung. Am Küchenfenster blieb sie stehen und sah hinaus auf die Straße. Tränen liefen über ihr Gesicht wie die Regentropfen über die Fensterscheibe. Sie schien es allerdings gar nicht zu bemerken.
Vielleicht hatte sie sich aber auch einfach nur daran gewöhnt, weil sie beinahe ununterbrochen weinte, seitdem sie vor zwei Wochen vom Tod ihrer Oma erfahren hatte. Für eine 40-jährige Frau war das sicher kein sehr typisches Verhalten, aber das einzige, zu dem sie gerade fähig war. Die Welt vor ihrem Fenster sah genauso traurig aus wie sie sich fühlte. Beinahe den ganzen Tag hatte es geregnet und die Straßen schimmerten dunkel im fahlen Licht der Straßenlaternen. Carola vergrub die Hände tief in den Taschen ihrer bequemen, wenn auch ziemlich ausgeleierten Jogginghose, die sie zu Hause fast immer trug. In der rechten Tasche umschlossen ihre Finger den kleinen scharfkantigen Gegenstand, durch dessen Berührung sie sich sofort seltsam getröstet und ein bisschen weniger alleine fühlte. Durch das Fenster beobachtete sie eine Weile den Verkehr, der sich träge am Haus vorbei schleppte. Es war schon nach 20.00 Uhr, aber auf den Straßen war noch ziemlich viel los. Sie fragte sich, warum all diese Leute wohl jetzt noch unterwegs waren. Schließlich hatten inzwischen fast alle Geschäfte geschlossen und die Kinder, zumindest die kleineren, mussten doch auch bald ins Bett. Aber was ging sie das alles an? Sie hatte keinen Partner und weder kleine noch große Kinder. Daher war sie nur für sich selbst verantwortlich. Kein Ehemann nörgelte, weil es kein Essen gab oder eins, das ihm nicht schmeckte. Kein Kind rebellierte dagegen, ins Bett geschickt zu werden. All das passierte nicht in ihrem Leben, und sie bemühte sich seit Jahren, darüber froh zu sein. Leider gelang es ihr nicht besonders gut. Zu sehr sehnte sie sich danach, dass jemand für sie da war, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Sie litt unter ihrer Einsamkeit und ließ die Wochen, Monate und Jahre einfach an sich vorbeiziehen. Wäre da nicht sogar ein hin und wieder schlecht gelaunter Ehemann immer noch besser als gar keiner? Und seit Omas Tod war nun alles noch schlimmer als vorher. Carola fühlte sich leer und antriebslos, fast wie ein Fremdkörper in ihrem eigenen Leben. Sie konnte einfach nicht aufhören zu grübeln und wie eine Getriebene nach Antworten zu suchen, die einem das Leben einfach nicht gab. Es war schließlich der Lauf der Dinge, dass man irgendwann sogar ohne seine Eltern auf der Welt zurückblieb, wie normal war es da erst, dass Großeltern starben? Aber ihre Oma war eben keine dieser Großmütter gewesen, die man zu Geburtstagen oder an Weihnachten besuchte, um sich pflichtbewusst nach ihrem Befinden zu erkundigen und dann nach zwei Stunden heilfroh wieder in sein eigenes Leben zurückzukehren. Ihre Oma war für Carola seit der frühesten Kindheit ihre engste Bezugsperson gewesen. Zwar verstand sie sich auch gut mit ihren Eltern, aber mit Oma war es einfach etwas anderes. Ihren Eltern, besonders ihrer Mutter gegenüber, hatte Carola immer eine gewisse Distanz gespürt. Sie hätte nicht sagen können, woher dieses Gefühl kam, es war einfach da. Irgendetwas am Verhalten ihrer Eltern und auch ihres Bruders Arno hatte immer dafür gesorgt, dass sie sich wie ein Außenseiter fühlte. Möglicherweise bildete sie sich das auch schon seit Jahrzehnten nur ein, aber mit Oma war es immer viel einfacher gewesen. Mit ihr hat alles Spaß gemacht, weil sie das Leben als großes Geschenk betrachtete, auch in schwierigen Zeiten. Für jedes Problem und jede sich stellende Sinnfrage fand sie kluge und hilfreiche Worte und beinahe schon philosophische Ansätze, die es einem ermöglichten, aus jeder schwierigen Situation gestärkt hervorzugehen. Carola konnte sich niemanden vorstellen, der sich nach einem Gespräch mit ihrer Oma nicht besser gefühlt hätte. Für Carola selbst war sie die beste Freundin, die klügste Ratgeberin, die schärfste Kritikerin und der Rettungsanker in allen Lebenslagen gewesen. Sie hatten beinahe täglich telefoniert und sich mindestens einmal pro Woche getroffen. Abwechselnd hatten sie sich in ihren Wohnungen besucht oder waren ins Café oder zum Essen ausgegangen. Und in den letzten Wochen hatte Carola ihre Oma fast täglich nach der Arbeit im Krankenhaus besucht.
All das war nun nicht mehr möglich. Sie würde nie mehr Omas ruhige Stimme hören, die sie tröstete, wenn es ihr schlecht ging. Nie mehr den resoluten Tonfall, wenn sie sich dumm oder falsch verhalten hatte und dafür den Kopf gewaschen bekam. Und nie mehr den tadelnden Unterton, wenn sie mit ihrem Leben haderte, obwohl es eigentlich nichts zu hadern gab. Alles, was blieb, waren Erinnerungen.
Carola wandte sich vom Küchenfenster ab und ging hinüber ins Wohnzimmer. Auf dem kleinen Couchtisch rückte sie ein paar Dinge zurecht, die natürlich sowieso an ihrem Platz standen. Seufzend ließ sie sich aufs Sofa fallen, um nach ungefähr fünf Sekunden wieder aufzuspringen. Sie ging zum Bücherregal und kontrollierte die Reihenfolge der einsortierten Bücher. Alles okay, ein jedes an seinem Platz. Wie sollte es auch anders sein, wenn man alleine wohnte? Die Sinnlosigkeit ihrer Handlungen war Carola die ganze Zeit über schmerzlich bewusst, aber sie konnte dennoch nicht damit aufhören. Viel zu oft spürte sie, dass sie immer noch verzweifelt nach ihrem Platz auf der Welt suchen musste. Lange Gespräche mit ihrer Oma hatten dann immer die wirren Gedanken sortiert, ihre Seele gestreichelt und ihren Blick auf das Wesentliche gelenkt: Sie war gesund, hatte einen Beruf, der ihr Spaß machte, eine gemütliche Wohnung und finanzielle Unabhängigkeit. Und das große Glück in der Liebe würde schon noch kommen, davon war Oma so felsenfest überzeugt gewesen, dass sie Carolas diesbezügliche Zweifel immer milde lächelnd ignoriert hatte. Zu Carolas Scheidung und ihrer daran anschließenden Phase des Selbstmitleids hatte Oma nur gemeint, dass es besser sei, ohne Mann zu leben als mit dem falschen. Und dass der Richtige eben manchmal auf sich warten ließe.
Seit ihrer Scheidung waren jetzt vier Jahre vergangen, in denen Carola sich mit ihrem Single-Dasein irgendwie arrangiert hatte. Sie wünschte sich zwar einen liebevollen Partner, mit dem sie ihr Leben teilen konnte, hatte aber gleichzeitig auch Angst vor zu viel Nähe und zog sich immer sofort wieder zurück, sobald ein netter Mann Interesse an ihr zeigte.
Zumal sie ein solches Interesse an ihrer Person sowieso meistens sehr irritierte, denn sie fand sich so durchschnittlich wie es durchschnittlicher kaum noch ging. Ihre blonden kinnlangen Haare waren Durchschnitt, ihr Kleidungsstil war Durchschnitt und ihre Figur war leider sogar unter dem Durchschnitt, weil sie auf Sport schon immer gut hatte verzichten können. Wenn sie also schon nicht mit einem Partner glücklich werden konnte, wollte sie wenigstens alleine so zufrieden wie möglich sein. Sie hatte ihre Arbeit, ihre Hobbies, ihre Freundinnen – und bis vor zwei Wochen auch die tollste Oma der Welt.
Während sie ihren Rundgang durch die Wohnung fortsetzte, wanderten ihre Gedanken zurück zu dem Tag, an dem ihre geliebte Oma gestorben war. Es war ein Freitag und Carola wollte in ihrer Mittagspause für das Wochenende einkaufen, damit sie nach Feierabend sofort in die Klinik fahren konnte. Sie hatte gerade den Supermarkt betreten, als ihr Handy klingelte. Es war ihre Mutter und Carola ahnte sofort, dass etwas passiert sein musste. Der Anruf an sich war dabei gar nichts Ungewöhnliches, Mutter und Tochter telefonierten mehrmals wöchentlich miteinander. Trotzdem war sofort klar, dass dies kein Telefonat wie jedes andere war. Gerdas Stimme klang ganz fremd, als sie sich zu erkennen gab. Wie immer erkundigte sie sich zunächst vorsichtig danach, ob sie ihre Tochter auch wirklich nicht gerade bei was auch immer stören würde.
„Hallo, Mama. Nein, natürlich störst du nicht. Ist was passiert? Du klingst so komisch.“
Am anderen Ende der Leitung holte Gerda Seifert tief Luft, als bräuchte sie für den nun folgenden Satz alle Kraft, die sie aufbringen konnte.
„Carola, die Oma ist heute gestorben. Sie ist ganz friedlich eingeschlafen.“
Wortlos und wie in Zeitlupe ließ Carola die Hand, in der sie das Handy hielt, sinken. Mehrere Minuten stand sie reglos mitten im Eingangsbereich des um diese Zeit sehr vollen Supermarktes. Um sie herum wurde geredet, gerufen und gelacht. Da waren so viele Menschen und die meisten von ihnen hatten es sehr eilig. Einige warfen ihr verwunderte oder sogar vorwurfsvolle Blicke zu, weil sie da einfach im Weg herumstand.
Nur langsam drang das eben Gehörte so richtig in Carolas Bewusstsein.
Ihre Oma war gestorben. Sie würde von nun an einfach nicht mehr da sein. Zwar war schon seit beinahe zwei Jahren klar gewesen, dass sie den Kampf gegen ihre schwere Krebs-Erkrankung nicht gewinnen konnte, erst recht nicht in ihrem hohen Alter von beinahe hundert Jahren. Aber bis jetzt hatte Carola diesen traurigen Gedanken immer schnell beiseitegeschoben und lieber darüber gescherzt, wie Oma wohl ihren Hundertsten im nächsten Jahr feiern würde. Aber jetzt war sie nicht mehr da. Jetzt fehlte für immer ein Teilchen in ihrem Familienpuzzle, noch dazu ein so wichtiges.
Wie in Trance war Carola an diesem Tag zurück ins Reisebüro gegangen. Mechanisch hatte sie ihre Arbeit erledigt, bis sie endlich nach Hause gehen konnte. Dort hatte sie um ihre Oma geweint, bis keine Tränen mehr da waren. Sie konnte nichts denken, nichts essen und schlief kaum in dieser Nacht. Am liebsten hätte sie sich für immer verkrochen. Sie wusste doch gar nicht, wie das ging Leben ohne Oma.
Irgendwann am Nachmittag des nächsten Tages war Carola zu ihren Eltern gefahren, um bei allem, was nun zu erledigen war, zu helfen. Die folgenden Tage liefen ab wie ein schlechter Film und forderten viel Kraft und Durchhaltevermögen. Ihr Bruder übernahm die meisten der organisatorischen Aufgaben. Sein Verhältnis zu Oma war auch sehr liebevoll gewesen, aber nicht so innig wie das von Carola. Er war von allen jetzt derjenige, der sich am besten auf die anstehenden Erledigungen konzentrieren konnte.
Zur Trauerfeier für Oma erschienen unzählige Leute, die Carola zum Teil noch nie gesehen hatte. Eine gute Woche später wurde dann die Urne beigesetzt. Bei dieser Zeremonie waren nur die engsten Angehörigen anwesend, also Carola, ihre Eltern, ihr Bruder Arno mit seiner Frau und ihren beiden Kindern. Carola hatte vorher nie eine Urnenbeisetzung erlebt. Sie fand es unvorstellbar, dass alles, was von einem geliebten Menschen übrig blieb, in diese verzierte Blumenvase passte.
Aber Oma hatte das alles selber so gewollt. Sie hatte alle Details für ihre Beerdigung geplant und aufgeschrieben. Seit sie verwitwet war, hatte sie ihre Angelegenheiten schließlich immer selbst geregelt, und daran sollte sich bis über ihren letzten Atemzug hinaus nun auch nichts mehr ändern.
In den Notizen und Unterlagen, die sie schon vor langer Zeit an ihre Tochter Gerda übergeben hatte, stand:
„Ich will nicht, dass ihr euch jahrzehntelang verpflichtet fühlt, immer wieder frische Blumen zu pflanzen, verwelkte Blumen zu entsorgen, Unkraut zu entfernen und Hecken zu stutzen. Das kostet Zeit, Geld und Nerven. Vielleicht würde ich euch nach meinem Tod damit mehr auf die Nerven gehen, als ich es zu Lebzeiten hoffentlich je getan habe.“
Und dann hatte sie genau aufgelistet, was die Familie tun sollte, wenn sie gestorben war. Eine To-do-Liste für ihren Abschied von der Welt sozusagen. Sachlich und unaufgeregt, so wie Oma eben war. In diesen Papieren hatten sie auch die Adresse einer Firma für Haushaltsauflösungen gefunden mit der Notiz:
„Ich möchte, dass sich jeder von euch aus meiner Wohnung mitnimmt, was er zur Erinnerung an mich vielleicht behalten möchte. Danach aber überlasst ihr bitte alles den Profis, anstatt euch damit das Herz unnötig schwer zu machen.“
An dieser Notiz war mit einer Büroklammer noch ein Briefumschlag befestigt und darauf stand „Für Carola“. Erst Stunden später in ihrer Wohnung hatte Carola den Umschlag geöffnet und die Botschaft gelesen:
„Meine liebe Carola, ich wünsche dir so sehr, dass du irgendwann zur Ruhe kommst und dich endlich mit dem Leben anfreunden kannst. Die Welt dreht sich und du solltest dich unbedingt mit ihr drehen. All deine Grübeleien, deine Ängste, deine unbeantworteten Fragen versperren dir nur den Weg zum Glück. Aber auch das Glück ist im Leben vorgesehen, es ist Teil des Plans. Es wird Zeit, dass du dich um diesen Teil kümmerst. Das Leben wird sich nicht ändern, nur weil du dich darüber beklagst. Es ist oft rätselhaft, aber es ist insgesamt auch viel schöner, als du es dir vorstellen kannst. In meiner Kommode im Schlafzimmer liegt unter den Handtüchernein Buch, das von nun an dir gehören soll. Außerdem findest du dort auch die Schürze, die ich immer trug, als du noch klein warst. In der Tasche ist etwas, das dich immer an mich erinnern soll. Vielleicht erhältst du damit die Antworten auf ein paar deiner Fragen. Ich wünsche es mir sehr für dich und habe dich immer lieb. Deine Oma.“
September 1907
Hedi Kofler saß in der geräumigen Küche und putzte gelangweilt das gute Silberbesteck. Dabei war es sowieso sauber und funkelte im Sonnenlicht, das durch die geöffnete Tür von draußen hereinfiel. Wozu man etwas putzen und polieren sollte, das gar nicht schmutzig war, verstand Hedi einfach nicht. Sie schob sich mit dem Handrücken eine widerspenstige braune Locke, die sich aus ihrem Haarknoten gelöst hatte, aus dem Gesicht. Wie gerne würde sie jetzt draußen auf der kleinen Mauer sitzen, ihr Gesicht in die Sonne halten und die Beine baumeln lassen. Oder in einem Buch lesen, wenn sie nur eins hätte. Aber stattdessen musste sie hier zusammen mit ihrer Mutter Martha die ganze Hausarbeit verrichten für Onkel Konrad und seine Familie. Onkel Konrad – so durfte sie ihn auch gar nicht mehr nennen. Noch vor einem Jahr war das vollkommen in Ordnung gewesen, weil Hedis Vater hier in Travemünde ein angesehener Arzt und die Familien befreundet gewesen waren. Der reiche Kaufmann Konrad Dressler war sehr oft mit seiner kränklichen Frau Adelheid in die Praxis gekommen und daraus war dann mit der Zeit eine Freundschaft entstanden, die sich zuerst auf die Familien, später aber nur noch auf die beiden Männer bezogen hatte. Onkel Konrad hatte die Koflers anfangs häufig zu sich nach Hause eingeladen und diese Besuche waren für Hedi immer etwas ganz Besonderes gewesen, auf das sie sich schon Tage vorher gefreut hatte. Konrad Dressler hatte erst zwei Jahre zuvor ein großes Haus für sich und seine Familie bauen lassen, eine richtige Villa mit großer Veranda. Das Haus befand sich in der Straße, die parallel zum Strand verlief und den beeindruckenden Namen Kaiserallee trug.
Diese Gegend war den reichen Leuten vorbehalten und noch weitgehend unbebaut, aber das würde sich in den nächsten Jahren sicher ändern. Und weil ein Teil der anliegenden Straßen in dieser Gegend so verliefen, dass sie die Form eines Schiffs bildeten, hatte man ihnen auch Namen gegeben, die zu einem Schiff passten, zum Beispiel Achterdeck, Mittschiffs, Backbord oder Steuerbord.
Bei ihren Besuchen hatte Hedi sich im Haus von Familie Dressler immer sehr wohl gefühlt, alles war so schön und sauber und der Garten war so gepflegt und einladend. Es musste doch herrlich sein, in so einem Haus zu wohnen und es in seiner ganzen Pracht täglich genießen zu können.
„Warte nur, mein Engel“, hatte Hedis Vater oft zu ihr gesagt, „in ein paar Jahren, wenn ich noch mehr Kranke geheilt habe, werden wir auch so ein großes Haus haben.“
Aber dann war Dr. Kofler Anfang des Jahres überraschend gestorben und zu der übergroßen Trauer kam für Hedis Mutter auch noch der Schock, dass ihr Mann beim Kartenspiel mehr Geld verloren hatte, als überhaupt jemals da gewesen war.
Daraufhin änderte sich schlagartig alles. Das Leben, das Hedi bis dahin gekannt hatte, war zu Ende. Sofort musste die Mutter sich nach einer neuen Bleibe für sich und ihre Kinder und nach einer bezahlten Arbeit umsehen. Onkel Konrad bot Martha sofort an, in seiner Villa zu kochen und den Haushalt zu führen. Sein langjähriges Dienstmädchen, das auch für die Familie gekocht hatte, war nämlich kurz zuvor zu ihrer kranken Schwester gezogen, um diese zu pflegen. Damit wäre doch allen gedient, hatte Konrad Dressler gemeint, denn wohnen würden sie als Dienstboten natürlich mit im Haus. Für Marthas Kinder fand sich auch ganz schnell eine Beschäftigung, denn Hedi konnte ihrer Mutter im Haushalt helfen und ihr Bruder Fritz kümmerte sich ab sofort um die Pferde, die Hühner und den Garten. Lohn für ihre Arbeit bekamen sie vorerst noch nicht, denn Hedis Vater hatte fürs Kartenspiel eine Menge Schulden bei Onkel Konrad angehäuft.
„Aber in eurer jetzigen Situation ist das wohl für alle die beste Lösung“, hatte Onkel Konrad verkündet. Und Hedis Mutter hatte nur stumm genickt, denn sie hatte ja gar keine andere Wahl.
Seitdem konnte Hedi nun also nicht mehr zur Schule gehen, obwohl sie doch erst zwölf war und noch so viel lernen wollte. Stattdessen musste sie hart arbeiten, denn im Haushalt des gnädigen Herrn - so mussten sie Onkel Konrad jetzt nennen - war immer unglaublich viel zu tun.
Dem 14jährigen Fritz machten all diese Veränderungen im Gegensatz zu seiner Schwester wenig zu schaffen. Er war gerne an der frischen Luft und liebte Pferde über alles. Die Schule hatte ihm nie Spaß gemacht, und er fühlte sich eigentlich nur wohl, wenn er hart arbeiten und dabei so richtig schmutzig werden konnte.
„Nach mir kommt der Junge leider kein bisschen“, hatte der Vater oft geklagt, „anstatt für Medizin und Wissenschaft interessiert er sich nur für Pferdedung.“ Hedi dagegen lernte gerne, besonders das Lesen machte ihr großen Spaß. Es war so spannend, all die Dinge zu erfahren, die es auf der Welt gab. Jetzt allerdings hatte sie gar keine Zeit mehr zum Lesen. Und Bücher besaß sie auch keine mehr, denn in der kleinen Dienstbotenkammer, die sie sich mit ihrer Mutter teilen musste, war nur Platz für das Allernötigste. Fritz musste auf einem alten Sofa in einer Ecke der Küche schlafen, aber das störte ihn nicht. Für viele andere Mädchen in Hedis Alter, die aus armen Bauernfamilien stammten, war es ganz normal, reichen Leuten den Haushalt zu führen anstatt zur Schule zu gehen, um so zum Lebensunterhalt ihrer oft großen Familien beizutragen. Aber Hedi hatte ein anderes Leben gekannt und haderte jeden Tag aufs Neue mit ihrem jetzigen Dasein.
Rrriiing. Das Klingeln ließ Hedi zusammenzucken, so sehr war sie in ihre Gedanken vertieft gewesen. Sie warf einen Blick auf das große Wandbrett mit den vielen kleinen Messingglöckchen. Es gab für jedes Zimmer im Haus ein Glöckchen, so dass man bei jedem Läuten wusste, in welchem Zimmer man gebraucht wurde. Hedi musste dann immer schnell in das entsprechende Zimmer eilen, denn ihre Mutter war meistens mit dem Zubereiten der Mahlzeiten beschäftigt und konnte dann nicht vom Herd weglaufen. Diesmal kam das Klingeln aus dem Salon, also hatte die gnädige Frau einen Wunsch. Hedi nahm schnell die Arbeitsschürze ab, unter der sich die kleine weiße, aber auch sehr unpraktische Zierschürze verbarg, wusch sich eilig die Hände und lief los. Vor der Tür zum Salon blieb sie kurz stehen, denn die gnädige Frau mochte es nicht, wenn man abgehetzt und außer Atem mit ihr sprach. Nach einem kurzen Anklopfen trat Hedi ein.
Der Salon war ein wunderschöner Raum mit einer gelben Wandbespannung, die einem bei jedem Wetter das Gefühl gab, die Sonne würde hineinscheinen. Die Wände schmückten Bilder in schweren goldenen Rahmen und unter der Decke hing ein Kronleuchter, der zwar schwierig abzustauben war, dafür aber anschließend so schön funkelte und glitzerte, dass die Mühe sich lohnte.
Frau Dressler saß in einem hohen Sessel vor dem Fenster. Sie war blass wie immer und sah sehr leidend aus, aber darüber machte sich Hedi schon lange keine Gedanken mehr, denn niemand im Haus kannte es anders. Die strenge Frisur, zu der Frau Dressler ihr dunkelblondes Haar immer auftürmte, ließ sie viel älter aussehen als sie tatsächlich war. Mit einem vorwurfsvollen Blick aus ihren kalten Augen sagte sie: „Du hast mich lange warten lassen.“
„Verzeihung, gnädige Frau, ich war beim Silberputzen und musste mir erst die Hände waschen“, gab Hedi zurück.
„Ich bin sicher, wir würden ein Mädchen finden, bei dem das schneller geht, also gib dir mehr Mühe.“
„Ja, gnädige Frau.“ Unter der kleinen weißen Schürze ballte Hedi ihre Hände zu Fäusten. Wie sehr sich alles verändert hatte. Zwar hatte Adelheid Dressler auch früher keinen herzlichen Umgangston mit den Kindern von Dr. Kofler gepflegt, aber so überheblich und herablassend war sie trotzdem nicht gewesen. Jetzt aber behandelte sie Hedi und ihre Familie oft wie Insekten, die gegen ihren Willen durch ihr Haus krabbelten und die man bestenfalls übersah. Dabei war sie doch angewiesen auf gutes Hauspersonal, denn selber tat sie den ganzen Tag lang gar nichts. Konrad Dressler hatte sich leider auch verändert, auch er war den Dienstboten gegenüber oft arrogant, aber nicht immer.
Manchmal, wenn seine Frau es nicht hörte, war er sogar fast so nett wie früher.
„Hast du nicht verstanden, du dummes Ding?“
Hedi erschrak. Was hatte die gnädige Frau gerade gesagt?
„Du sollst meinem Sohn sein Schulbuch aufheben, es ist ihm vom Tisch gefallen.“
Hedi hatte noch gar nicht bemerkt, dass Karl sich auch im Salon aufhielt. Der Sohn von Adelheid und Konrad Dressler war ein Jahr älter als Fritz und viel netter als seine Eltern. Er war immer freundlich und verhielt sich nie so, als sei er was Besseres. Außerdem war er noch dazu ein wirklich hübscher Junge mit seinen blonden Haaren und den strahlenden blauen Augen. Hedi mochte ihn sehr, und manchmal kam es ihr so vor, als würde Karl sie auch mögen. Als sie nun in die Hocke ging, um das Schulbuch aufzuheben, bückte sich auch Karl herunter, sehr zum Missfallen seiner Mutter.
„Karl, sitz gerade, fürs Bücken haben wir das Mädchen.“
Karl sah Hedi lächelnd an und verdrehte dabei die Augen, denn er selbst fand es unmöglich, dass seine Mutter wegen eines heruntergefallenen Buches das Dienstmädchen rief. Hoffentlich wusste Hedi, dass er anders war. Er hatte sie sehr gerne, weil sie nicht so eine dumme Gans war wie die Mädchen in seiner Schule. Hedi war klug und hatte das Herz am rechten Fleck. Und ihre grünen Augen blickten ehrlich, aber viel zu traurig in die Welt. Karl mochte sie wirklich sehr und er wollte unbedingt auch von ihr gemocht werden, aber das durften seine Eltern nicht wissen. Hedi lächelte zurück und ging zur Tür, aber die gnädige Frau rief sie zurück. „Moment, ich habe dir noch was zu sagen.“
„Ja bitte, gnädige Frau?“
„Am morgigen Sonntag erwarten mein Mann und ich Gäste. Deine Mutter ist bereits über meine Wünsche für das Abendessen informiert. Du wirst zusammen mit ihr servieren, denn wir sind elf Personen und ich wünsche nicht, dass jemand auf sein Essen warten muss. Und jetzt kannst du gehen!“
Hedi nickte und verschwand. Plötzlich war sie ganz aufgeregt. Das war das erste Mal, dass sie beim Servieren helfen sollte. Bisher hatte sie Gäste immer nur kurz zu Gesicht bekommen, wenn sie sie an der großen Haustür empfing, denn dann hatte ihre Mutter ja in der Küche mit dem Essen zu tun. Außerdem war die gnädige Frau wohl der Ansicht, dass selbst Hedi beim Öffnen einer Tür nicht viel falsch machen konnte. Hedi war immer ganz entzückt von den feinen Leuten, die ihrerseits das Mädchen meistens gar nicht zur Kenntnis nahmen und beinahe nicht mal einen Gruß für nötig hielten. Die Herren sahen so vornehm aus in ihren gut sitzenden Anzügen. Und die Damen waren gehüllt in lange Kleider, nach der neuesten Mode mit Rüschen verziert, und Ärmeln, die oben ganz bauschig und unten ganz eng waren. Dazu trugen sie oft wunderschöne große Hüte auf ihren hochgesteckten Haaren.
„Mutter, denk nur, ich soll dir morgen beim Servieren helfen, wenn die Gäste zum Abendessen da sind“, rief Hedi, sobald sie die Küche erreicht hatte.
Ihre Mutter, die draußen in der Spülküche Schuhe geputzt hatte, teilte ihre Begeisterung nicht. „Ja, ich weiß schon. Aber vor das Servieren hat der Herrgott das Kochen gestellt. Wir haben morgen viel zu tun und müssen daher sehr früh aufstehen. Und zur Kirche können wir auch nicht, wir brauchen jede Minute, um alles herzurichten.“
Hedi spürte die Enttäuschung ihrer Mutter, für die der sonntägliche Kirchgang sehr wichtig war. Martha haderte sehr mit ihrem Schicksal, das sie mit nur achtunddreißig Jahren zur Witwe gemacht hatte.
Und als sei es nicht schon schwer genug, mit den beiden Kindern alleine dazustehen, hatte sie außer dem Ehemann auch den Wohlstand und das Ansehen verloren, weil Erich Kofler die Karten auch dann nicht aus der Hand gelegt hatte, als bereits alles verloren war. Martha war ein gottesfürchtiger Mensch, aber manchmal, wenn sie so über alles nachdachte und ihr jetziges Leben betrachtete, fiel es ihr doch schwer, den von Gott gewählten Weg für sich und ihre Kinder klaglos anzunehmen. Vielleicht konnte sie die Momente des Zweifels ausbügeln, indem sie nur häufig genug zur Kirche ging. So oft wie möglich besuchten sie sonntags deshalb alle drei zusammen den Gottesdienst in der St.-Lorenz-Kirche. Anschließend gingen sie dann zum Friedhof und verweilten einige Zeit am Grab von Dr. Kofler. Dabei waren sie sich der teils mitleidigen, teils schadenfrohen Blicke der anderen Leute stets bewusst. An den meisten Sonntagen gab es im Haushalt von Kaufmann Dressler ohnehin nur wenig zu tun, denn Onkel Konrad machte mit seiner Familie oft Ausflüge in Cafés oder zur Strandpromenade. Travemünde war schließlich ein schöner und blühender Ort, in dem es viel zu sehen gab. Und natürlich wollte man auch selber gerne gesehen werden, wenn man es zu etwas gebracht hatte.
Kapitel 2
„Es hört doch jeder nur, was er versteht.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
März 2011
Seit dem Tod ihrer Oma waren inzwischen acht Wochen vergangen. Bisher hatte Carola noch nicht den Mut und die Kraft gehabt, das Buch, die Schürze und das geheimnisvolle Etwas zu holen. Es widerstrebte ihr zu sehr, Omas Wohnung zu betreten. Viel Zeit blieb nun aber nicht mehr, denn am Morgen hatte Gerda ihrer Tochter mitgeteilt, dass in drei Tagen der Termin für die Haushaltsauflösung war. Genau wie Oma es gewollt hatte, hatten Carolas Eltern die Firma beauftragt, die die Wohnung räumen sollte. Heute, morgen oder übermorgen musste Carola sich ihre Erinnerungsstücke nun also holen, sonst würde es zu spät sein. „Dann eben heute“, dachte Carola, und machte sich auf den Weg zu Omas Wohnung. Sie wollte endlich in der Kommode nach der Schürze und in der Schürze nach – ja, nach was eigentlich - suchen.
Beim Betreten der Wohnung wurde ihr ganz übel. Vielleicht lag das daran, dass sie erneut die Trauer überrollte beim Anblick all der vertrauten Möbel und Gegenstände, die sie schon seit Kindertagen so gut kannte. Ganz bestimmt lag es aber auch an dem muffigen Geruch, der in den Räumen hing. Durch Omas langen Krankenhausaufenthalt war hier schon lange nicht mehr gelüftet worden. Carolas Eltern hatten bei all den Sorgen nur selten daran gedacht, in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen. In Carola regte sich das schlechte Gewissen, denn sie selbst war auch nicht auf diese Idee gekommen. Ganz langsam und leise, als wäre sie an einem verbotenen Ort, bewegte sich Carola durch die Wohnung. An der Garderobe hing Omas Mantel, als sei sie gerade von einem Spaziergang zurückgekehrt. Im Wohnzimmer legten die vertrockneten Pflanzen darüber Zeugnis ab, dass sich seit geraumer Zeit niemand mehr um sie kümmerte. Auf dem kleinen Tisch neben Omas Lieblingssessel lag eine aufgeschlagene Zeitschrift mit einem zur Hälfte gelösten Kreuzworträtsel und über der Lehne hing die schwarze Strickjacke, die sie abends gerne anzog, weil sie so leicht fror.
Carola hatte gehofft, dass sie sich ihrer Oma noch einmal nahe fühlen würde, wenn sie sich hier aufhielt, aber nun war das Gegenteil der Fall. Tatsächlich fühlte es sich ganz falsch an, hier zu sein. Sie kannte diese Räume und ihre Einrichtung in- und auswendig, aber das Wichtigste fehlte, nämlich Oma selber. Und da diese nicht mehr da war, gehörte auch Carola nicht hierher, das spürte sie auf einmal so deutlich, dass es fast wehtat. Sie wollte nur noch schnell erledigen, wofür sie hergekommen war, und dann sofort wieder gehen.
Mit eiligen Schritten ging sie ins Schlafzimmer. Das Buch unter den Handtüchern in der Kommode fand sie sofort. Es trug den Titel „Deutsches Vogelbuch“ und war 1907 erschienen. Es enthielt sehr hübsche Bilder und die kurzen Beschreibungen waren in altdeutscher Schrift gedruckt. Das Buch war sehr abgegriffen und fiel fast schon auseinander. Auf der ersten Seite gab es noch den aufschlussreichen Untertitel „Für Forst- und Landwirte, Jäger, Naturfreunde und Vogelliebhaber, Lehrer und die reifere Jugend und für alle Gebildeten des deutschen Volkes“. Beim Weiterblättern zog Carola sofort der für alte Bücher so typische Geruch in die Nase, der von längst vergangenen Zeiten erzählte. Hinten war in den Umschlag ein winziges Foto eingeklebt, das ein kleines Mädchen mit niedlichen Zöpfen und einem blütenweißen Kleidchen zeigte. Carola erkannte auf Anhieb, dass das Kind auf dem Foto ihre Oma war, die Gesichtszüge waren unverkennbar.
Unter dem Buch kam die Schürze zum Vorschein, deren Anblick Carola sofort in ihre Kindheit zurückversetzte. Wie oft hatte Oma mit dieser Schürze Pudding gekocht oder zu Weihnachten Kekse gebacken? Sie nahm die Schürze auseinander, griff in die rechte Tasche und fand – nichts. Aber in der linken Tasche befand sich etwas Hartes mit einer scharfen Kante. Carola zog die Hand heraus und betrachtete verständnislos ihren Fund. Es handelte sich um die Hälfte einer Muschel. Die Bruchkante war scharf und die Oberfläche rau und uneben. Irritiert steckte sie das Muschelstück in ihre Jackentasche, schnappte sich Buch und Schürze und verließ die Wohnung.
Zu Hause angekommen hatte Carola das Gefühl, sich unbedingt irgendwie beschäftigen zu müssen. Sie war innerlich ganz aufgewühlt durch diesen allerletzten Besuch in der Wohnung ihrer Oma. Noch war ihr die Bedeutung ihrer Erbstücke nicht klar. Aber sie wollte darüber jetzt auch nicht nachdenken. Sie musste irgendwas tun, das müde machte, damit sie in der Nacht Schlaf fand. Es durfte aber auch nicht zu viel Konzentration erfordern, denn die konnte sie gerade absolut nicht aufbringen. Carola griff zu Putzmittel und Lappen und begann, das Badezimmer auf Hochglanz zu bringen. Anschließend spülte sie das wenige Geschirr vom Frühstück, wischte die Fußböden und bügelte zum Abschluss noch die beiden Blusen, die sie nach dem Waschen erstmal einfach in den Schrank gehängt hatte. Als sie fertig war, war es schon kurz nach Mitternacht, Carola war erschöpft, aber zufrieden.
Wenn sie als Kind bei ihrer Oma übernachtet hatte und wegen irgendeines Kummers nicht hatte einschlafen können, hatte Oma immer gesagt:
„Lass den Tag gehen, denn morgen ist heute gestern.“ Mit diesem Gedanken und eingekuschelt in ihren Lieblingsschlafanzug legte sich Carola ins Bett und schlief sofort ein.
Als Carola am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sie sich ausgeruht und putzmunter. Das war erstaunlich, denn ein Blick auf den Wecker neben ihrem Bett zeigte ihr, dass es erst kurz nach sechs Uhr morgens war. Heute war Sonntag, also gab es nicht den geringsten Grund, vor zehn Uhr aufzustehen. Dann war der ödeste aller Wochentage schließlich immer noch lang genug. Sie drehte sich auf die andere Seite und zog sich die Bettdecke bis über die Ohren.
Nach einigen Minuten und hartnäckigen Versuchen, wieder einzuschlafen, musste sie allerdings einsehen, dass sie wirklich überhaupt nicht mehr müde war. Ihr Blick wanderte durchs Schlafzimmer und blieb an Omas Schürze hängen. Gestern hatte Carola sie achtlos auf den Wäschekorb geworfen. Beim Anblick der Schürze fielen Carola auch das Muschelstück und das Buch wieder ein. Es war Oma eine Herzensangelegenheit gewesen, dass sie genau diese drei Dinge bekam. Aber was steckte dahinter? Die Karte mit der Botschaft musste doch hier irgendwo in der Nachttischschublade sein. Carola wühlte mit einer Hand zwischen Handcremetube, Fusselbürste und mehreren Päckchen Papiertaschentüchern und wurde schließlich fündig. Wie lange war es wohl her, seit Oma diese Karte geschrieben hatte? Ihre Handschrift sah gleichmäßig und kraftvoll aus. Im letzten Stadium ihrer Krankheit wäre ihr das so sicher nicht mehr gelungen. Also hatte sie die Botschaft notiert, als es ihr noch wesentlich besser ging. Carola las den Text wieder und wieder. „Aber auch das Glück ist im Leben vorgesehen, es ist Teil des Plans. Es wird Zeit, dass du dich um diesen Teil kümmerst“, hatte Oma geschrieben. Was wollte sie ihr damit sagen? Dass sie sich zu wenig bemühte, glücklich zu sein? Dass glücklich zu sein viel einfacher war, als sie dachte? Vielleicht sogar, dass Carola das Glück selbst dann noch übersah, wenn es ihren Weg kreuzte? „Das Leben ist oft rätselhaft, aber es ist insgesamt auch viel schöner, als du es dir vorstellen kannst.“
Rätselhaft? Von was für einem Rätsel war hier die Rede? Und wie sollte Carola es lösen, wenn sie schon das Rätsel selbst nicht verstand? Eins aber war sicher: Hinter diesen Worten steckte eine Botschaft, die sie entschlüsseln musste. Oma hatte nie geredet, nur um zu reden, sie würde ihr auch jetzt zum Schluss keine leeren Worte hinterlassen. Irgendetwas Wertvolles war in diesen Zeilen verborgen. Aber was? Vielleicht sollte sie sich das Vogel-Buch einfach noch einmal genauer ansehen. Wo hatte sie es gestern denn nur hingelegt?
Carola tapste durch die Wohnung, fand das Buch auf dem Couchtisch und nahm es mit ins Bett. Dort blätterte sie ein bisschen herum, aber die Bilder und die dazugehörigen Beschreibungen konnten ihre Aufmerksamkeit nicht wirklich fesseln. Schon nach wenigen Minuten versank sie erneut in der Betrachtung des Fotos, das ihre Oma als Kind zeigte. Als sie es umdrehte, sah sie eine Notiz auf der Rückseite. Die Buchstaben waren blass und kaum noch lesbar. Nur das Wort „Enkelkind“ konnte Carola noch entziffern. Seltsam. Oma hatte auf Fragen nach ihrer Kindheit immer sehr ausweichend geantwortet, dass sie ein Kind ohne Verwandtschaft gewesen war. Aber das Wort Enkelkind auf der Rückseite des Fotos wies doch eindeutig auf die Existenz eines Großvaters oder einer Großmutter hin. Carola wurde schlagartig bewusst, dass es trotz der großen Nähe zwischen ihnen viel zu viel gab, was sie nicht über ihre Oma wusste. Manchmal hatte Oma von ihrer Mutter erzählt. Bis zu deren Tod vier Jahre vor Carolas Geburt hatten die beiden ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Andere Personen aus ihrer Kindheit, ob nun verwandt oder nicht, hatte sie nie erwähnt. Dafür hatte sie umso häufiger von ihrer Hochzeit 1933 erzählt und von ihrer glücklichen, wenn auch kurzen Ehe mit Opa Hermann. Er war im Zweiten Weltkrieg gefallen, und sein Tod brach ihr erneut das Herz, nachdem ihr erstes Kind bereits im Alter von nur sechs Jahren gestorben war. Trotzdem war sie zu einem zufriedenen und demütigen Menschen geworden, der nicht mit dem Leben haderte, sondern es an jedem einzelnen Tag bewusst und dankbar annahm. Seltsam war nur, dass es zwischen Oma und Gerda, Carolas Mutter, kaum Herzlichkeit gab. Beide gingen freundlich und höflich miteinander um, hielten aber immer einen gewissen emotionalen Abstand zueinander, der scheinbar durch nichts zu überbrücken war. Es war das gleiche Gefühl von Distanz, das Carola selber auch ihren Eltern, besonders aber der Mutter gegenüber spürte. Einmal hatte sie sich getraut, ihre Oma nach einem möglichen Grund zu fragen. Daraufhin hatte diese nur gesagt, das müsse Carola schon selber mit ihren Eltern klären. Dabei hatte sie einen Ton angeschlagen, der keinen Zweifel aufkommen ließ, dass sie das Gespräch für beendet hielt. Und da Carola keinen Streit mit ihrer geliebten Oma wollte, hatte sie nachgegeben und nie wieder gefragt. All diese Gedanken gingen Carola durch den Kopf, während sie ihre Jacke von der Garderobe holte, das Muschelstück aus der Tasche nahm und eingehend betrachtete. Erst jetzt fiel ihr auf, dass etwas in die Oberfläche eingeritzt war. Carola erkannte einzelne Buchstaben. Da stand ein A, dann ein U, darunter ein E und ein W, dann ein D und ein E und darunter noch ein K und ein A. Scheinbar waren diese Buchstaben ein Teil einer Botschaft. Ob die andere Hälfte der Muschel noch existierte? Vielleicht zerbrach sich gerade irgendwo jemand genauso wie sie den Kopf über ein paar rätselhafte Buchstaben. Und bestimmt war dieser Jemand dann deswegen genauso verwirrt wie sie.
Oktober 1907
Hedi war müde. Es war schon spät und die Kartoffeln waren so schwer. Immer öfter musste sie stehen bleiben und den Korb kurz abstellen.
Schritt für Schritt schleppte sie sich weiter. Der Weg nahm aber auch kein Ende. Bis zum Kartoffelbauern waren es gute drei Kilometer hin und wieder zurück. Von der Kaiserallee aus war Hedi über den Helldahl und weiter zum Brodtener Steilufer gegangen. Martha hatte sie zum Kartoffelbauern geschickt, weil die Vorräte zur Neige gingen. Am Montag wollte sie sowieso hin, aber für das Essen mit elf Personen morgen reichte es jetzt schon nicht mehr. Leider gab es in der näheren Umgebung kaum Kartoffelbauern. Die meisten Männer, die nicht so klug und so reich waren wie Onkel Konrad, verdienten sich ihren Lebensunterhalt mit dem Fischfang, denn dafür war die Lübecker Bucht bestens geeignet. Außerdem kamen für die gnädige Frau nur die besten Kartoffeln in Frage und für die musste man weit laufen, weil es sie nun mal nur bei Bauer Hinrichsen gab.
Der Hinweg hatte Hedi noch Spaß gemacht, aber da war es auch noch ganz hell und der Korb leer und leicht gewesen. Auf dem Weg hatte sie immer wieder die Zappis aufgescheucht, die Blässhühner, von denen es hier so viele gab. Es sah lustig aus, wenn sie aufgeregt vor ihr wegliefen. Aber jetzt dämmerte es schon, und der Spaß an dem Spaziergang war ihr längst vergangen. Wenn sie doch nur schon daheim wäre, die Mutter machte sich bestimmt Sorgen.
„Pst, Hedi. Hedi, hör doch mal.“
Als sie das Flüstern hörte, gefror ihr beinahe das Blut in den Adern. Was sollte sie tun? Weglaufen mit dem schweren Korb? Unmöglich.
Weglaufen und den Korb einfach zurücklassen? Nicht auszudenken, was das für einen Ärger gäbe. In diesem Moment sprang Karl Dressler hinter einem Baum am Wegesrand hervor.
„Wo bist du nur mit deinen Gedanken, hast du mich denn nicht gehört?“
Hedis Erleichterung war zu groß, um irgendetwas zu erwidern. Und scheinbar wartete Karl auch gar nicht auf eine Antwort.
„Ich hab gehört, dass deine Mutter dich losgeschickt hat, und bin gekommen, um dir zu helfen. Es ist ja schon gleich dunkel.“
„Ach, das macht mir nichts aus und so schwer ist der Korb auch gar nicht“, log Hedi.
„Meine Mutter hätte euch auch wirklich früher sagen können, dass morgen Besuch kommt“, murmelte Karl vor sich hin.
„Vielleicht hat sie sich wieder nicht wohl gefühlt, da hat sie’s sicher vergessen. Es macht mir wirklich gar nichts aus. Meine Mutter und der Fritz und ich, wir müssen froh und dankbar sein, dass wir bei euch Arbeit und Unterkunft haben.“
„Ha, das haben sie dir aber schön eingetrichtert, du hörst dich ja schon an wie meine Eltern.“
Hedi spürte, wie sie rot wurde.
„Sei nicht böse, ich wollte dich nicht ärgern, aber mir gegenüber musst du nicht so buckeln. Und jetzt gib mir endlich den Korb, ich trag ihn für dich nach Hause.“
Beherzt griff er mit der einen Hand nach dem schweren Kartoffelkorb und mit der anderen nach Hedis Hand, und so setzten sie ihren Weg fort.
Eine ganze Weile sprach keiner von beiden ein Wort. Hedi war glücklich. Sie war Karl noch nie so nahe gewesen und musste ihn immer wieder verstohlen von der Seite ansehen. Seine blonden Haare wehten ihm ins Gesicht und seine blauen Augen sahen sie hin und wieder beinahe liebevoll an, so dass Hedi ganz schwindelig wurde. Mit seinen fünfzehn Jahren kam er ihr schon sehr erwachsen vor, was sicher auch daran lag, dass er sie um zwei Kopflängen überragte. Er war ziemlich dünn, aber Hedi war sicher, dass ein stattlicher Mann aus ihm werden würde. Dass er ihr gefolgt war, um ihr mit dem schweren Kartoffelkorb zu helfen, war doch wohl der Beweis, dass er sie auch mochte. Plötzlich konnte der Weg für Hedi gar nicht lang genug und die Welt gar nicht schöner sein. Doch je näher sie der Kaiserallee kamen, umso nervöser wurde sie.
„Nun gib mir den Korb lieber wieder zurück, sonst sieht deine Mutter noch, dass du mir geholfen hast, und das würde ihr sicher nicht gefallen.“
„Ach was, sie hat sich hingelegt. Mit Kopfschmerzen oder was auch immer. Sie leidet viel zu sehr, um auch nur einen Blick aus dem Fenster zu werfen.“
„So darfst du nicht reden, es ist doch schlimm, dass sie so oft krank ist. Und außerdem ist dein Vater inzwischen sicher auch zu Hause und er will bestimmt auch nicht, dass du dich mit mir abgibst.“
„Na gut, wenn du unbedingt willst, dann nimm den Korb. Es ist ja jetzt nicht mehr weit. Aber mir wäre die Schelte ganz egal, dass du’s nur weißt. Und ich werde mich auch immer wieder gerne mit dir abgeben.“
Mit diesen Worten sprang Karl flink über den Gartenzaun und verschwand.
„Mutter, die Hedi ist wieder da und sie sieht gar nicht müde aus“, verkündete Fritz, sobald er Hedi erblickt hatte.
Eigentlich hatte Martha ihn zum Kartoffelbauern schicken wollen, aber er hatte sich in der Kutsche versteckt, als sie nach ihm rief. Allerdings hatte er sein Versteck dann zu früh verlassen, weil er dachte, die Mutter wäre schon wieder ins Haus gegangen. Aber er war ihr leider fast in die Arme gelaufen und deshalb wusste sie jetzt ganz genau, dass er in der Nähe gewesen war und ihr Rufen nur zu deutlich gehört hatte.
„Du frecher Bengel, dich so vor der Arbeit zu drücken. Aber der Herrgott sieht alles und dein Vater wäre heute sicher nicht stolz auf dich.“
Martha wusste, dass sie Fritz mit diesen Worten treffen konnte. Nicht so sehr wegen der Sache mit dem Herrgott, dafür war der Junge zu ihrem Leidwesen nicht sehr empfänglich, aber seinem Vater hatte Fritz immer gefallen wollen. Die beiden waren nur leider sehr verschieden, so dass es meistens bei der guten Absicht geblieben war. Martha schämte sich für ihre Bemerkung, als sie sah, wie ihr Sohn mit gesenktem Kopf wieder im Kutschenschuppen verschwand. Aber sie konnte doch nicht dulden, dass er zum Faulenzer wurde, denn wie sollte er sonst später mal seine eigene Familie ernähren können? Und dann war da noch Marthas Angst, dass auch ihr Sohn später dem Kartenspiel verfallen und mehr im „Gasthaus zur Sonne“ oder im „Schifferhaus“ als daheim bei seiner Frau sein würde. Außerdem hätte sie selber Hedi gut im Haus gebrauchen können, als sie die Öfen für die Nacht auffüllen und die Betten für die Herrschaft anwärmen musste. Dazu hatte Martha zuerst glühende Kohlen in eine Bettpfanne geschaufelt, so wie Hedi es sonst jeden Abend tat. Danach musste sie gut aufpassen, die Bettpfanne nur noch an ihrem langen Holzstiel anzufassen, damit sie sich nicht die Hände verbrannte. Dann war sie in die Schlafzimmer der Familie gegangen, hatte überall das Bettzeug angehoben und die Pfanne zwischen den Leinentüchern hin und her bewegt. Schließlich mussten reiche Leute nicht in kalten Leinentüchern liegen. Mit all diesen Erledigungen wären sie zu zweit viel schneller fertig geworden.
Früh am Sonntagmorgen war Hedi schon hellwach, als ihre Mutter noch in tiefem Schlummer lag. Die Dienstbotenkammer, in der sie beide schliefen, sah aus wie ein großer Schrank, denn man gelangte durch zwei Türen hinein und ein Fenster gab es nicht. Auf einer gemauerten Erhöhung lagen ein Strohsack als Unterlage und dazu Kissen und Decken. Darüber an der Wand war ein Brett, auf dem Marthas Bibel lag. Außerdem standen dort noch der Wecker und Hedis Schatzkiste. So nannte sie die Zigarrenkiste, die sie seinerzeit von ihrem Vater bekommen und mit Muscheln und bunten Steinen beklebt hatte. In der Kiste bewahrte sie ihre Haarspange, ein Stück Schleife und eine Ansichtskarte von Travemünde auf, die irgendwann mal mit der Post gekommen war, als das Leben noch schön war. Ein Stuhl und ein kleines Schränkchen passten noch gerade so mit in das kleine Kämmerchen, mehr nicht – aber mehr besaßen die Koflers ja sowieso nicht mehr. Um halb sechs würde der Wecker klingeln, aber jetzt war es erst fünf und so hatte Hedi noch Zeit, ihren Gedanken nachzuhängen. Immer wieder dachte sie an Karl und daran, wie er ihr gestern mit den Kartoffeln geholfen hatte. Er war so ein netter Junge, ach, wie sie ihn mochte. Kaum vorstellbar, dass er der Sohn von der schrecklichen gnädigen Frau war. Hedi gestand sich ein, dass es ihr sehr schwer gefallen war, Karls Mutter in Schutz zu nehmen, als dieser sich über ihr Unwohlsein lustig gemacht hatte. Es war anstrengend, so zu tun, als würde man Leute mögen, die überhaupt nicht nett zu einem waren.
Und Adelheid Dressler war nie nett. Wie machte das wohl Onkel Konrad? Zu ihm war sie auch immer unfreundlich, obwohl er ihr alles nur recht machen wollte. Zum Glück war Karl ganz anders. Bestimmt würde aus ihm mal ein feiner Herr werden, der seine Dienstboten freundlich behandelte. Hedi war so glücklich darüber, dass Karl sie offenbar auch mochte, dadurch erschien ihr alles leichter und die Welt, in der sie nun leben musste, viel fröhlicher. Inzwischen war auch Hedis Mutter aufgewacht.
„Schnell, Hedi. Auf mit dir. Wir haben viel zu tun.“
Hedi wusch sich, zog sich an und ging durch die Spülküche zum Kutschenschuppen, wo der Abtritt für die Dienstboten war, denn natürlich durften diese nicht das Klosett der gnädigen Familie benutzen. Fritz schlief sicher noch. Fast beneidete Hedi ihren großen Bruder, weil ihm bei den Arbeiten, die er zu verrichten hatte, nicht besonders auf die Finger geschaut wurde. Mit Karl verstand er sich ganz prima, die beiden verbrachten gerne Zeit zusammen, und manchmal half Karl sogar bei der Gartenarbeit. Das musste natürlich vor seiner Mutter streng geheim gehalten werden. Konrad Dressler hatte viel zu viel zu tun, um sich für den Stalljungen zu interessieren, außerdem ging er an den Werktagen sowieso lieber zu Fuß in sein Geschäft. Am Wochenende nahm er für Besorgungen zwar gerne mal die Kutsche, aber dann musste Fritz nur hinten auf dem Trittbrett mitfahren, um auf das Pferd aufzupassen, wenn sie irgendwo anhielten. Adelheid Dressler vertrug den Pferdegeruch nicht und begab sich deshalb nie in den Kutschenschuppen oder in den Stall. Und wenn die Familie sonntags ihre Spazierfahrt machte und Fritz dabei auf dem Kutschbock saß, behandelte sie ihn einfach wie Luft.
Der Tag schien nur so vorbeigeflogen zu sein. Martha und Hedi hatten kaum eine ruhige Minute gehabt. So viel war zu tun. Am Vormittag hatte Hedi einen ganzen Eimer voll Kartoffeln geschält, denn am Abend sollten ja elf Personen satt werden. Martha hatte sich um das Frühstück für die Familie kümmern müssen und um einen leichten Imbiss zum Mittag. Außerdem mussten die Betten ordentlich gemacht, aufgeräumt und Staub gewischt werden. Und den ganzen Tag musste darauf geachtet werden, dass die Öfen nicht ausgingen, denn die kränkliche gnädige Frau fror sogar bei Sonnenschein, und wenn ihr kalt war, wurde sie noch ungerechter und unfreundlicher.
Aber sie hatten alles geschafft. Der große Braten schmorte im Ofen und würde bald gar sein. Die ganze Küche duftete nach gekochtem Gemüse und im Speisezimmer war die lange Tafel gedeckt und vorbereitet. Hedi hatte eine saubere Zierschürze umgebunden und die Hände sauber geschrubbt, bis sie ganz rot waren. Ihre Freude darüber, dass sie heute servieren durfte, war verflogen, so müde war sie von dem arbeitsreichen Tag. Aber sie musste sich zusammenreißen, denn schon läutete es an der Haustür und sie musste die Gäste in Empfang nehmen.
Kurze Zeit später war die feine Gesellschaft vollzählig. Alle hatten an der festlich gedeckten Tafel im Speisezimmer ihre Plätze eingenommen. An dem einen Tischende saß natürlich der Hausherr Konrad Dressler, ihm gegenüber seine Frau Adelheid, wie immer blass und leidend. Karl Dressler saß zur Rechten seiner Mutter, an ihrer linken Seite hatte ihre Schwester Wilma Kladde Platz genommen. Die Schwestern ähnelten einander äußerlich kein bisschen, denn Wilma war derb und rundlich und mit einer rosigen Gesichtsfarbe gesegnet. In ihrer Überheblichkeit war sie allerdings ihrer Schwester keineswegs unterlegen. Wilmas Mann Heinrich gehörte das „Schifferhaus“, aber er stand schon lange nicht mehr selber als Wirt hinter der Biertheke, denn das Gasthaus war eine Goldgrube und so konnte Heinrich es sich leisten, andere für sich arbeiten zu lassen. Trotzdem war er ein freundlicher Mann geblieben und hatte das Herz am rechten Fleck. Die Arroganz seiner Frau im Umgang mit den Angestellten war ihm oft unangenehm und peinlich.
Zwischen Wilma und Heinrich saßen ihre Töchter Luise und Klara in ihren schönsten Sonntagskleidchen und reckten ihre winzigen Näschen möglichst vornehm in die Luft. Auf der anderen Seite, neben Karl, saß der ebenfalls sehr wohlhabende Jonathan Schilling mit seiner Ehefrau Renate. Er hatte 1898 die Schilling-Werft gegründet, die vor gerade zwei Jahren auf den Priwall umgezogen war. Die Geschäfte liefen tadellos, und er pflegte sowohl privat wie auch beruflich einen engen Kontakt zu Kaufmann Konrad Dressler. Jonathan hatte eine unverheiratete Schwester, Lieselotte, die ihren Verlobten im Krieg verloren hatte und darüber sehr griesgrämig geworden war und am liebsten ganz zurückgezogen leben wollte. Ihrem Bruder Jonathan bereitete das große Sorge und so versuchte er, seine Schwester so gut wie möglich in sein eigenes Familienleben mit einzubeziehen. Das wusste Konrad Dressler und daher war auch Lieselotte heute sein Gast und saß zu seiner Linken. Ganz klein und unauffällig war da außerdem noch der kleine Max Schilling. Er fühlte sich offenbar nicht wohl in seinem feinen Matrosenanzug mit dem engen Kragen und rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, eingezwängt zwischen seiner Mutter und Tante Lieselotte.
Hedi hatte ihnen allen die Haustür geöffnet und die Mäntel und Hüte abgenommen. Aber als sie nun beim Eintreten ins Speisezimmer die Gesellschaft so bei Tisch sitzen sah, wurde sie doch wieder schrecklich nervös. Der sonst eher schmucklose Raum wirkte mit dem für so viele Personen festlich gedeckten Tisch ganz verändert. Die Wandbespannung, die hier in einem dunklen Grün gehalten war, schimmerte warm im Licht der vielen Kerzen, die auf der Tafel und auf der Anrichte aufgestellt worden waren. Die Gedecke waren genauestens ausgerichtet worden und die Bestecke lagen kerzengerade, das hatte die gnädige Frau natürlich persönlich überprüft.
Hedi hielt das schwere Tablett mit den fünf Suppenterrinen so fest, dass ihre Finger schon schmerzten. Auf dem Tablett, das ihre Mutter trug, standen sogar sechs Terrinen, aber Martha servierte die Suppe ja auch nicht zum ersten Mal. Hedi bewegte sich so vorsichtig wie möglich auf die Anrichte zu, auf der sie das Tablett abstellen sollte. Geschafft, jetzt musste sie nur noch die Terrinen verteilen. Sie sollte bei der gnädigen Frau beginnen und dann die Tischreihe hinunter deren Schwester samt Töchtern und Ehemann Heinrich bedienen.
„Und immer von rechts, Hedi, immer nur von rechts. Und bloß nicht kleckern, pass gut auf“, hatte ihre Mutter ihr heute wohl schon hundertmal gesagt. Martha selbst übernahm die andere Seite des Tisches, beginnend mit dem Hausherrn. Aufgeregt nahm Hedi in jede Hand eine Suppenterrine und stellte die erste vor Adelheid Dressler ab. Nachdem auch die zweite Terrine heile vor der dicken Wilma Kladde stand, fiel ein bisschen Anspannung von Hedi ab. Sie holte wieder zwei Terrinen und näherte sich Wilmas Töchtern. Gerade als sie Luise ihre Suppe servieren wollte, gab diese ein vornehmes Hüsteln von sich und Hedi erschreckte sich, so dass ein bisschen Suppe auf den Unterteller schwappte. Was nun?
Die Suppe trotzdem hinstellen oder wieder mitnehmen? Aber dann müsste sie aus der Küche eine neue Terrine für Luise holen und die bekäme dann ihre Suppe viel später als die anderen. Das durfte nicht sein, deshalb sollte sie ja überhaupt mit servieren. Also stellte sie die Terrine mit dem bekleckerten Unterteller vor Luise ab, die sofort zusammen mit ihrer Schwester Klara ein albernes Kichern von sich gab. Ein strenger Blick von Wilma genügte und ihre Töchter verstummten sofort. Adelheid Dressler gab ein qualvolles Stöhnen von sich, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und legte den Handrücken leidend an die Stirn, als hätte ihr Hedis Missgeschick körperliche Schmerzen bereitet. Konrad Dressler sah gar nicht auf, sondern starrte konzentriert in seine Suppe.
Hedi hatte inzwischen auch Klara bedient und war mit der letzten Terrine auf dem Weg zu Heinrich Kladde. Heinrich lächelte freundlich und sagte: „Kopf hoch, Mädel, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn meine verwöhnten Töchter selbst servieren müssten, wäre wohl in den Terrinen kaum noch Suppe übrig geblieben.“
Hedi lächelte zurück, dankbar für diese freundlichen Worte. Von seiner Frau und seinen Töchtern allerdings wurde Heinrich mit zornigen Blicken bedacht, was ihm aber nicht das Geringste auszumachen schien. Von den Worten seines Onkels ermutigt, traute sich nun auch Karl zu murmeln: „Um Suppe servieren zu können, muss sie ja auch erst mal einer kochen können. Wie froh können wir da sein, dass wir die Martha und die Hedi haben.“
Heinrich lachte schallend, aber er war leider der Einzige, den diese Bemerkung erheiterte. Adelheid schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen, bevor sie sagte: „Ich glaube nicht, dass dich jemand um deine Meinung gebeten hat, Karl. Vielleicht erinnerst du dich an deine guten Manieren, wenn du auf den Nachtisch verzichtest. Der kleine Max freut sich sicher über eine zweite Portion.“
Karl sah die Genugtuung in den Gesichtern von Wilma und ihren Töchtern, aber er sah auch die dankbare Zuneigung in Hedis Gesicht und was war dagegen schon ein Nachtisch?
Im weiteren Verlauf des Abendessens gab es dann zum Glück keine Zwischenfälle mehr, aber Hedis Anspannung ließ auch nicht nach, als sie zusammen mit ihrer Mutter und Fritz am Küchentisch saß und sie die Reste des guten Essens unter sich aufteilten. Sie hatte gar keinen Appetit und stocherte nur auf ihrem Teller herum. Martha, die der Meinung war, dass Hedi trotz allem ihre Sache gut gemacht hatte, legte ihrer Tochter tröstend die Hand auf den Arm.
„Es ist alles gut, Hedi, sei nicht mehr traurig. Beim nächsten Mal ist das mit der Suppe schon viel leichter.“
Und mit einem Blick auf die Stapel von schmutzigen Tellern und Schüsseln, die in der Spülküche standen, fügte sie hinzu: „Komm, wir haben noch viel zu tun!“
Während Hedi das Geschirr abtrocknete, das Martha ihr reichte, und dabei immer wieder ein Gähnen unterdrücken musste, stand Konrad Dressler draußen auf der Veranda und rauchte zur Entspannung eine Zigarre. Die Gäste waren fort, und er hatte die Fliege gelöst und die Hemdsärmel hochgekrempelt. Tief sog er die kühle Abendluft ein. Es war bis auf den kleinen Zwischenfall beim Essen ein recht angenehmer Abend gewesen. Martha kochte wirklich gut, das musste man ihr lassen. Ach, sie konnte einem schon leidtun, es war eine schwierige Situation, in die der Tod ihres Mannes sie gebracht hatte. Aber ihr die Stelle in seinem Haus anzubieten, war alles, was er hatte für sie tun können, denn Adelheid wachte wie ein Fuchs über alles, was er tat. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er der Martha sofort einen Lohn für ihre Arbeit und die der Kinder gezahlt, denn sie hielten Haus, Garten, Stall und Kutschenschuppen tadellos in Ordnung. Und er hätte ihnen auch die Schulden vom Kartenspiel erlassen, sozusagen als letzten Akt seiner Freundschaft zu Erich Kofler. Aber das hätte Adelheid niemals zugelassen.
„Jeder muss sehen, wo er bleibt. Wer hart arbeitet, hat auch Geld, von nichts kommt schließlich nichts“, hatte er sie oft sagen hören.
Ausgerechnet sie, die den ganzen Tag nichts tat und ihm sogar noch auf die Nerven ging, wenn er spätabends aus seinem Geschäft nach Hause kam.