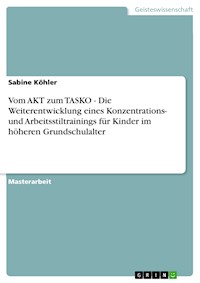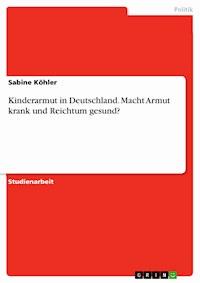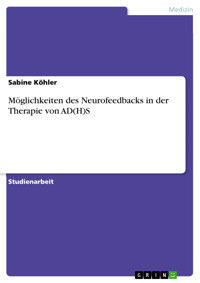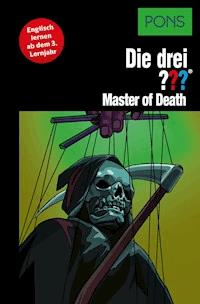Entwicklung, Konstruktion und Erprobung eines Konzentrationstrainingsprogramms für Kinder im höheren Grundschulalter - (Band 1) E-Book
Sabine Köhler
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Psychologie - Intelligenz und Lernpsychologie, Note: sehr gut, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institut für pädagogische Psychologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung und Überblick "Konzentriere Dich!" ; "Hier spielt die Musik!"; "Du hast mal wieder nicht zugehört!"; "Hör auf, mit dem Stift zu spielen!"; "Diese Fehler wären nicht nötig gewesen!"; … Solche und ähnliche Aussprüche aus dem Mund von Lehrern, Erziehern und Eltern frustrieren täglich eine große Zahl an Kindern.. Das schon Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Frankfurter Nervenarzt Heinrich Hoffmann beschriebene Phänomen des Zappelphilipp und des Hans-guck-in-die-Luft scheint heutzutage noch immer hochaktuell. Eltern und Lehrer geraten im Umgang mit konzentrationsgestörten oder sogenannten hyperaktiven Kindern häufig an ihre Grenzen. Auch eine medikamentöse Behandlung, die mit der Einführung der Stimulanzientherapie, insbesondere des Methylphenidat (Ritalin®), neue Möglichkeiten eröffnete, scheint keine Dauerlösung für die vielschichtigen Probleme der von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen betroffenen Kinder zu bieten. Es zeichnet sich immer stärker ab, daß es einer Zusammenarbeit von Ärzten, in Beratung und Therapie tätigen Psychologen und Pädagogen bedarf, um der Not dieser Kinder effektiv begegnen zu können. Was steht eigentlich hinter den vielverwendeten Begriffen Aufmerksamkeit, Konzentration oder Hyperaktivität? Was versteht man unter einer Konzentrationsstörung? Und welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, diesen Fragen nachzugehen. Zur Einführung in das Thema werden nach einer kurzen begrifflichen Diskussion unterschiedliche Theorien und Befunde aus dem Bereich der Aufmerksamkeitsforschung wiedergegeben. Im Anschluß an einen Überblick über verschiedene ätiologische und therapeutische Ansätze folgt im Hauptteil der Arbeit die Darstellung und theoretische Begründung eines eigens entwickelten Trainingsprogramms. Auf dem Therapiemarkt existiert ein breites Angebot an Aufgabensammlungen, Programmen und Trainingsvorschlägen zur Verbesserung konzentrativer Fähigkeiten. In den seltensten Fällen jedoch lassen die unterbreiteten Übungsvarianten die klare theoretische Basis ihres Vorgehens erkennen. Was nun letztlich trainiert wird, wenn von Konzentration oder Aufmerksamkeit die Rede ist, und warum es gerade in der jeweils angegebenen Art und Weise geschieht, bleibt häufig den Interpretationen des interessierten Lesers überlassen. Welche spezielle Fähigkeit oder kognitive Teilfunktion mit welcher konkreten Übung angesprochen werden soll, ist meist ebensowenig explizit...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Page 2
Danksagung
Ich danke allen Personen, die mir bei der Erstellung meiner Diplomarbeit in irgendeiner Form zur Seite standen. Mein Dank gilt zuerst den Betreuern der Arbeit, Herrn Prof. Dr. P. Noack und Herrn Dipl.-Psych. J. Nyári, für die vielen nützlichen Hinweise und das hohe Maß an Freiraum, welches sie mir bei allen richtungsweisenden Anregungen zugestanden haben.
Weiter möchte ich dem "Kontakt in Krisen (KIK) e. V." für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten danken sowie meiner Versuchsperson, die über acht Wochen bereitwillig und kooperativ mit mir zusammenarbeitete.
Einen besondereren Dank meiner Familie, meinen Eltern und verschiedenen Freunden, die mich vor allem in den letzten arbeitsintensiven Wochen auf unterschiedliche Weise unterstützten und ermutigten. An dieser Stelle möchte ich vor allem meinem Vater danken, dessen Assistenz in computertechnischen Angelegenheiten mir unverzichtbar war. Ich danke Annett Ziermann für die zwischenzeitliche Durchsicht des Theorieteils der Arbeit und die verschiedenen hilfreichen Rückmeldungen.
Ebenso bin ich Gisela Willenberg sehr dankbar, die mit dem Einsatz ihrer zeichnerischen Talente eine ansprechende und kindgerechte Gestaltung der Trainingsmaterialien ermöglicht hat.
Mein höchster Dank gebührt Gott, dem Erfinder all jener komplexen und genialen Zusammenhänge des menschlichen Organismus, für alle Weisheit, Kraft, Kreativität und Geduld, die ich für die Erarbeitung dieses vielschichtigen Themas besonders nötig hatte.
Page 5
6. Abschlußdiskussion...............................................................................................
Literaturverzeichnis....................................................................................................... 87
Anhang
•Anweisung zur Durchführung des Aufmerksamkeits - Komponenten -92 Trainings und zur Handhabung der Trainingsmaterialien......................................
Anlage
•Aufmerksamkeits - Komponenten - Training
(Das Trainingsprogramm umfasst 106 Seiten und bildet einen eigenen Band)
Page 6
Einleitung und Überblick 1
1. Einleitung und Überblick
“Konzentriere Dich!” ; “Hier spielt die Musik!”; “Du hast mal wieder nicht zugehört!”; “Hör auf, mit dem Stift zu spielen!”; “Diese Fehler wären nicht nötig gewesen! ”; … Solche und ähnliche Aussprüche aus dem Mund von Lehrern, Erziehern und Eltern frustrieren täglich eine große Zahl an Kindern.. Das schon Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Frankfurter Nervenarzt Heinrich Hoffmann beschriebene Phänomen des Zappelphilipp und des Hansguck- in-die-Luft scheint heutzutage noch immer hochaktuell. Eltern und Lehrer geraten im Umgang mit konzentrationsgestörten oder sogenannten hyperaktiven Kindern häufig an ihre Grenzen. Auch eine medikamentöse Behandlung, die mit der Einführung der Stimulanzientherapie, insbesondere des Methylphenidat (Ritalin®), neue Möglichkeiten eröffnete, scheint keine Dauerlösung für die vielschichtigen Probleme der von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen betroffenen Kinder zu bieten. Es zeichnet sich immer stärker ab, daß es einer Zusammenarbeit von Ärzten, in Beratung und Therapie tätigen Psychologen und Pädagogen bedarf, um der Not dieser Kinder effektiv begegnen zu können. Was steht eigentlich hinter den vielverwendeten Begriffen Aufmerksamkeit, Konzentration oder Hyperaktivität? Was versteht man unter einer Konzentrationsstörung? Und welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, diesen Fragen nachzugehen. Zur Einführung in das Thema werden nach einer kurzen begrifflichen Diskussion unterschiedliche Theorien und Befunde aus dem Bereich der Aufmerksamkeitsforschung wiedergegeben. Im Anschluß an einen Überblick über verschiedene ätiologische und therapeutische Ansätze folgt im Hauptteil der Arbeit die Darstellung und theoretische Begründung eines eigens entwickelten Trainingsprogramms. Auf dem Therapiemarkt existiert ein breites Angebot an Aufgabensammlungen, Programmen und Trainingsvorschlägen zur Verbesserung konzentrativer Fähigkeiten. In den seltensten Fällen jedoch lassen die unterbreiteten Übungsvarianten die klare theoretische Basis ihres Vorgehens erkennen. Was nun letztlich trainiert wird, wenn von Konzentration oder Aufmerksamkeit die Rede ist, und warum es gerade in der jeweils angegebenen Art und Weise geschieht, bleibt häufig den Interpretationen des interessierten Lesers überlassen. Welche spezielle Fähigkeit oder kognitive Teilfunktion mit welcher konkreten Übung angesprochen werden soll, ist meist ebensowenig explizit. Manche Trainingsprogramme versuchen ihr Vorgehen allein über die erzielten positiven Effekte in der Folge ihres Einsatzes
Page 7
Einleitung und Überblick 2
zu begründen. Welche Trainingsfaktoren und involvierten Mechanismen jedoch im einzelnen für eine erzielte Veränderung in dem einen oder anderen Verhaltens- oder Leistungsbereich verantwortlich sind, bleibt weitestgehend ungeklärt. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb auch, dem Anspruch der theoretischen Fundierung der entwickelten und konstruierten Programmelemente stärker gerecht zu werden. Neben der Beschreibung des Programmes selbst und seiner Anfertigung bilden dazu die in einer Aufmerksamkeitstheorie zusammengefaßten theoretischen Vorüberlegungen sowie die Begründung eingesetzter therapeutischer Prinzipien einen wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkt. Aus den Erfahrungen während der probeweisen Durchführung des Programms mit einem Kind im höheren Grundschulalter werden erste Erkenntnisse darüber gewonnen, inwieweit eine praktikable und altersangemessene Umsetzung der vorangestellten theoretischen Überlegungen gelang, und Schlußfolgerungen für eine Optimierung der Trainingsgestaltung gezogen.
Page 8
Aufmerksamkeit und Konzentration 3
2. Aufmerksamkeit und Konzentration
2.1. Begriffsbestimmung
In der Literatur stößt man auf ein recht breites Spektrum an Definitionsvarianten zu den Begriffen der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Beide Begriffe werden von den verschiedenen Autoren nicht einheitlich differenziert, sehr facettenreich oder auch synonym verwendet. Dieser Tatbestand ist sicher nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß es sich hier um ein äußerst komplexes, aus mehreren Perspektiven zu betrachtendes Phänomen handelt. Je nachdem, auf dem Hintergrund welcher Fragestellung, welcher psychologischen Schule, ob im Rahmen von Forschungsarbeiten oder zum Zweck einer Diagnosestellung die begriffliche Diskussion stattfindet, kommen verschiedene Aspekte von Aufmerksamkeit und Konzentration zum Vorschein. Eine stärker auf die Verhaltensebene ausgerichtete Betrachtung lassen beispielsweise Krämer und Walter (1996) erkennen, wenn sie Konzentration als “die Fähigkeit, eine klar beschriebene Aufgabe über einen definierten Zeitraum sorgfältig und zügig auszuführen” (S.11). charakterisieren. Walschburger (1993) hingegen identifiziert Konzentration aus handlungstheoretischer Sicht eher als eine Prozeßvariable, die sich aus der Summe diverser Mechanismen auf mentaler Ebene zusammensetzt: ”Eine Person handelt in dem Maße konzentriert, in dem sie verschiedene , an der Informationsverarbeitung und Handlungsregulation beteiligte Funktio nen ausrichtet und abstimmt, um ein bestimmtes, schwer erreichbares Handlungsziel zu verfolgen.” (S.184). Aus neuropsychologischem Blickwinkel wiederum lassen sich vordergründig zentralnervöse Vorgänge als Grundlage für die Herausbildung sämtlicher konzentrativer Bestandteile erkennen (Roth und Schlottke, 1991).
Was die gegenseitige inhaltliche Abgrenzung von Aufmerksamkeit und Konzentration betrifft, so tragen Definitionen vonKonzentrationin der Literatur häufig stärker dem Aspekt der Selektivität Rechnung. Dorsch (1998) spricht beispielsweise von “Sammlung, Ausrichten der Aufmerksamkeit auf eng umgrenzte Sachverhalte” (S.460), wenn er Konzentration beschreibt. Allerdings wird dieses, mit Konzentrationsprozessen stark assoziierte Merkmal der Selektivität nicht ausschließlich dem Terminus der Konzentration vorbehalten, sondern ebenfalls mit Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht. Cammann & Spiel (1991) verstehen
Page 9
Aufmerksamkeit und Konzentration 4
Aufmerksamkeit als die “Fähigkeit, das Denken auf…einen Reiz zu richten und die gleichzeitig auftretenden übrigen Reize möglichst nicht zu beachten” (S.11). Ferner zeigt sich die Tendenz, Aufmerksamkeit in Abgrenzung zu Konzentration eher im Sinne allgemeiner Wachheit, Vigilanz oder Bewußtheit, weniger objektbezogen und funktional als Konzentration zu interpretieren bzw. mit den für die Orientierungsreaktion verantwortlichen psychophysiologischen Prozessen gleichzusetzen (Aebi, 1993, Kinze, W. & Barchmann, H., 1990).
Verschiedene Aufmerksamkeitstheorien, auf die im folgenden noch ausführlicher eingegangen werden soll, lassen erkennen, daß es sich bei den Merkmalen der Selektivität und Vigilanz um nur zwei von mehreren unterscheidbaren Teilaspekten handelt, die das Konstrukt der Aufmerksamkeit bzw. Konzentration gemeinsam konstituieren. Je nach dem, aus welchem Blickwinkel heraus die begriffliche Klärung erfolgt, tritt die eine oder andere Komponente stärker in den Vordergrund. Diese Betrachtungsweise, die von dem Vorhandensein unterschiedlicher, nebeneinander existierender Aspektkategorien ausgeht (vgl. z.B. Schöttke & Wiedel, 1993), spricht weniger für eine qualitative Unterscheidung beider, in englischsprachigen Publikationen einheitlich mitattentionbezeichneten Konstrukte. Unter dem Gesichtspunkt des Zusammenspiels mehrerer Teilfunktionen ließe sich in Übereinstimmung mit Knapp und Rost (1987) Konzentration bestenfalls als "quantitativer Aufmerksamkeitsgipfel" (S. 87) bezeichnen oder als Ausdruck “intensiver und anhaltender Aufmerksamkeit” (Kurth nach Schöll, 1997, S.5) interpretieren. Der Begriff d er Konzentration eignet sich nach diesem Verständnis zur Beschreibung von Aufmerksamkeit ausgesprochen hoherIntensität(Rubinstein, 1961) undBeständigkeit(Knopf, 1991) im quantitativen Sinne, nicht aber als Bezeichnung eines der Konzentration im Wesenskern, also qualitativ, verschiedenen Phänomens. Folglich sollten dem, was letztlich im Verhalten als "Aufmerksamkeit" oder "Konzentration" in Erscheinung tritt, einheitliche Mechanismen und Funktionen zugrunde liegen. Im Rahmen meiner Arbeit scheint es mir auf diesem Hintergrund angemessen, keine inhaltliche Differenzierung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration vorzunehmen. Bei der Wiedergabe unterschiedlicher theoretischer Konzepte, Beiträge oder Forschungsergebnisse halte ich mich an die von den jeweiligen Autoren verwendete Terminologie. Qualitativ voneinander abzugrenzende Konzentrations- bzw. Aufmerksamkeitsaspekte treten bei einer ausführlicheren Betrachtung verschiedener
Page 10
Aufmerksamkeit und Konzentration 5
existierender Modelle und Theorien zum Thema in Erscheinung, um die es im nächsten Abschnitt gehen soll.
2.2. Modelle und Theorien
Den ersten Versuch, Konzentration in ein umfassenderes theoretisches Konzept einzubetten unternahm Mierke in den 50er Jahren mit seiner Theorie der willkürlichen Konzentration. Die Ursprünge dieser Theorie liegen in der sogenanntenWillenspsychologie,die motivationale Faktoren wie Wille und Interesse als energetische Komponenten zur Herstellung eines Bewußtseinsfeldes betonen. Mierke kennzeichnet Konzentration als die “zuchtvolle Organisation und Ausrichtung der Aufmerksamkeit durch das (den Geist und seine Wertbindungen repräsentierende) Ich auf das Erfassen oder Gestalten von Sinn- und Wertgehalten.” (1957, zitiert nach Beckmann, 1993, S. 16). Eine Bewußtseinseinengung auf bestimmte Sachverhalte entsteht als Folge “energischen Wollens”. Anstelle des Willensbegriffs findet sich in neueren Theorien der Begriff der Intention (vgl. Berg, 1991 oder Hoffmann, 1993), der stärker die Bedeutung von Handlungszielen anstelle der moralisch gefärbten Kategorie d er Willensstärke oder -schwäche zur Erzeugung von Konzentrationsleistungen zum Ausdruck bringt. Theoretische Konzeptualisierungen dieser Art gehören in die Rubrik derProzeßmodelle.Inhalt der Betrachtungen bilden hier vordergründig funktionale Aspekte von Aufmerksamkeit und Konzentration im Rahmen von Prozessen zur Handlungssteuerung und -regulation.
Im Unterschied zu den Prozeßmodellen befassen sich theoretische Ausführungen, die denStrukturmodellenzuzuordnen sind, mit den Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, nach denen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen ablaufen.
Verschiedene Autoren versuchen der Vielseitigkeit des Aufmerksamkeitskomplexes dadurch gerecht zu werden, daß sie die Ergebnisse unterschiedlich begründeter theoretischer Ansätze in Komponentenmodellen zueinander in Beziehung setzen und auf diese Weise integrieren (vgl. z.B. Neumann, 1996).
Page 11
Aufmerksamkeit und Konzentration 6
2.2.1. Strukturmodelle
Die strukturalistische Psychologie läßt sich unter anderem auf Wund im beginnenden 20. Jahrhundert zurückführen. Sie ging davon aus, daß an der Oberfläche Beobachtbares durch die Aufdeckung zugrunde liegender Variablen und deren Organisation erklärt werden könne. Innerhalb der strukturtheoretischen Ansätze heben sich drei aufeinander bezogene, sich teils überlagernde Entwicklungsphasen verschiedener Aufmerksamkeitsverständnisse voneinander ab.
2.2.1.1. Filtermodelle
Die Filter- oder auch Flaschenhalsmodelle gründen sich auf informationstheoretische Vorstellungen, nach denen das menschliche Verarbeitungssystem eine begrenzte Kapazität besitzt. Demzufolge ist es dem Organismus nur möglich, einen bestimmten Umfang an Information aufzunehmen, weiterzuleiten und zu analysieren. Als Konsequenz ergibt sich die Notwendigkeit selektiver Prozesse, die auch den Kern der Betrachtunge n dieser theoretischen Richtung bilden.
Besonderen Stellenwert erlangte Broadbents Ende der 50er Jahre entwickelte Theorie. Er kennzeichnet Aufmerksamkeit als eben diesen erforderlichen Filtermechanismus mit der Funktion, die kognitive Struktur des Individuums, das sogenannte P-System, vor Überlastung zu schützen. Die Lokalisation des Filters mit der Aufgabe, aus der Menge vorhandenen sensorischen Materials weiterzuverarbeitende Stimuli auszuwählen, postuliert Broadbent zwischen dem Kurzzeitspeicher und dem P-System, in welchem die tiefere Verarbeitung selektierter Information stattfindet. Die Entscheidung darüber, ob ein Wahrnehmungsinhalt als relevant der Weiterverarbeitung freigegeben oder als irrelevant zurückgewiesen wird, orientiert sich an der physikalischen Beschaffenheit, also an Merkmalen wie der Intensität oder Raumlage, eines Reizes. (nach Neumann, 1996, Schöll, 1997, Kristofferson, 1993) Dieser Vorstellung einer frühen Reizselektion stehen neuere Auffassungen gegenüber, die eine Selektion erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich im Stadium des Speicherns und Handelns, unmittelbar vor der Responseselektion, also der Auswahl eines bestimmten Antwortverhaltens, postulieren (vgl. Kristofferson, 1993).
Page 12
Aufmerksamkeit und Konzentration 7
Bereits Hebb (1949, nach Kristofferson, 1993), dessen Arbeiten Ende der 50er Jahre eine erneute Hinwendung der Forschung zu dem Gegenstandsbereich der Aufmerksamkeit und Konzentration hervorriefen, stellt Aufmerksamkeit als einen Prozeß heraus, der die Organisation der Wahrnehmung und dieReaktiona uf bestimmte sensorische Stimuli beeinflußt.
Die Hypothese, daß die Selektion stärker vom Reaktionsmuster (response set) als vom Reizmuster her bewirkt werde, stützt sich auf Befunde, die eine semantische Verarbeitung, auch von nicht beachtetem Material n ahelegen. Die in diesem Zusammenhang häufig angewandte experimentelle Methode der Überlagerungstechnik bzw. des dichotischen Hörens führte zu interessanten Erkenntnissen. Beispielsweise werden Informationen, die für eine Person von hoher Bedeutung sind, wie Nachrichten, in denen der eigene Name auftaucht, bevorzugt wahrgenommen (Kristofferson, 1993). Dies ist als ein Hinweis darauf zu werten, daß noch vor der “Aufmerksamkeit” im Sinne Broadbents eine andere Interpretation sensorischen Materials stattfinden muß.
Die Funktion der Aufmerksamkeit besteht unter Annahme einer späten Selektion nicht wie bei Broadbent in der adäquaten Verarbeitung eintreffender Sinnesreize, sondern vielmehr darin, eine adäquate Ausführung der momentan wichtigsten Handlung zu gewährleisten.
Die Filtertheorien verstehen Aufmerksamkeit als Filtermechanismus und liefern vordergründig Beschreibungen selektiver Prozesse. Sie erweisen sich jedoch als zu statisch, um auch Aufschluß über die Entstehung beobachteter Konzentrationsschwankunge n geben zu können.
Gleichwohl muß ihnen der Verdienst zugerechnet werden, Forschungen in vielerlei Richtungen angeregt zu haben, deren Ergebnisse sowohl, wie bereits weiter oben schon angedeutet, die ursprüngliche Theorie noch verschiedentlich modifizierten als auch die Entwicklung andersartiger Ansätze vorantrieben.
2.2.1.2. Kapazitätsmodelle
Wie die Filtertheorien gehen auch die Kapazitätstheorien, wie schon der Name sagt, von einer begrenzten Kapazität des informationsverarbeitenden Systems aus, die selektive Prozesse erforderlich macht. Die Entscheidung darüber, welche Informationen, oder besser, welche Handlungen (Reaktionen), aufrechterhalten werden, hängt jedoch ebenso von
Page 13
Aufmerksamkeit und Konzentration 8
intraindividuellen Gegebenheiten wie auch von inhaltlichen Aufgabenmerkmalen ab und macht sich nicht einzig an äußeren Merkmalen eingehender Stimuli fest. Beschriebene Aufmerksamkeitsmechanismen sind hier energetischer Natur und beruhen zu einem guten Teil auf psychophysiologischen Zusammenhängen. Den Ausführungen Kahnemanns (1973) zufolge kann die Energie-Kapazität des Organismus nur auf eine begrenzte Anzahl konkurrierender Aktivitäten verteilt werden. Das Ausmaß zur Verfügung stehender Energie richtet sich dabei nach dem Niveau der allgemeinen Wachheit bzw. zentralnervösen Erregung (“arousal”). Die situativen zentralnervösen Aktiviertheitsbedingungen wiederum unterliegen dem wechselseitigen Einfluß motivationaler und emotionaler Prozesse (“effort”). Komponenten wie Wille und Anstrengung bilden damit einen wesentlichen Teil des Verteilermechanismus, der die verfügbare Energie kanalisiert.
Kahnemann distanziert sich mit seinen Vorstellungen einer zweistufigen Leistungsregelung von eindimensionalen Aktivierungstheorien, zu denen zum Beispiel auch das klassische Yerkes-Dodson-Gesetz zählt, die von einem direkten Zusammenhang von Aktivierung und Leistung ausgehen.
Galley (1993) ergänzt Kahnemanns Modell um den Einflußfaktor eines Prioritätenregisters und setzt damit einen Akzent auf die Zielgerichtetheit von Leistungsverhalten. Entsprechend seiner Ausführungen kommt es erst dann zu einer Verstärkung der Hirnstammaktivierung, wenn die Zielerreichung im Konzentrationsprozeß nicht mehr gewährleistet ist, z. B. infolge des Auftretens störender Handlungsimpulse. Andernfalls sei konzentriertes Arbeiten auch bei geringer Aktivierung, z. B. unter Müdigkeit, möglich, solange nur leitende Ziele hinter dem betreffenden Handlungsprozeß stehen. Höher liegende, das heißt zunehmend abstraktere Handlungsziele, gilt es dabei gegenüber näherliegenden störenden Zielen zu erhalten. Die Voraussetzung einer Zielorientierung impliziert die Bedingung der Fähigkeit, ablenkende Handlungsimpulse, wie beispielsweise die Tendenz zu einem vorschnellen Antwortverhalten, zurückweisen zu können. “Konzentration ist zu eine m guten Teil auch Hemmung und Hemmungsfähigkeit für irrelevante Handlungsimpulse.” (S.239) Galleys Modell ist seinem Ansatz nach eng mit den handlungstheoretisch begründeten Prozeßmodellen verbunden, denen sich das nächste Kapitel stärker zuwendet.
Im deutschsprachigen Raum erlangte das Modell von Westhoff (1991) Bedeutung, der den Konzentrationsmechanismus einem Akku vergleicht, dessen grundsätzliche Kapazität