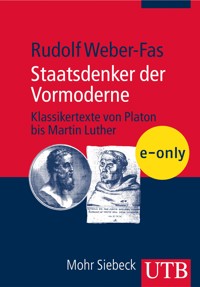Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch "Epochen deutscher Staatlichkeit" bietet eine kurzgefasste Gesamtdarstellung insbesondere für Studierende und Praktiker der Rechts- und Staatswissenschaften, der Geschichte und der Politik. Außerdem richtet es sich an ein allgemeines Publikum, das sich für die Grundlinien der historischen Entwicklung deutscher Staatlichkeit interessiert. In einer neuartigen leserfreundlichen Konzeption gliedert sich der Band in folgende Kapitel: I. Mittelalterliche Ursprünge II. Verfassungsentwicklungen im Heiligen Römischen Reich III. Der Deutsche Bund IV. Norddeutscher Bund und Deutsches Reich V. Zwischen Reichsgründung und Geburt der Republik VI. Die Weimarer Republik VII. Das Dritte Reich VIII. Deutsche Staatlichkeit nach 1945
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2006
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch 'Epochen deutscher Staatlichkeit' bietet eine kurzgefasste Gesamtdarstellung insbesondere für Studierende und Praktiker der Rechts- und Staatswissenschaften, der Geschichte und der Politik. Außerdem richtet es sich an ein allgemeines Publikum, das sich für die Grundlinien der historischen Entwicklung deutscher Staatlichkeit interessiert. In einer neuartigen leserfreundlichen Konzeption gliedert sich der Band in folgende Kapitel: I. Mittelalterliche Ursprünge II. Verfassungsentwicklungen im Heiligen Römischen Reich III. Der Deutsche Bund IV. Norddeutscher Bund und Deutsches Reich V. Zwischen Reichsgründung und Geburt der Republik VI. Die Weimarer Republik VII. Das Dritte Reich VIII. Deutsche Staatlichkeit nach 1945
Rudolf Weber-Fas studierte Rechts- und Staatswissenschaften u.a. in Bonn (Dr. jur.) und Harvard (Master of Laws). Er war Richter an einem obersten Gerichtshof des Bundes und ist Ordinarius für Öffentliches Recht und Staatslehre in Mannheim. Er ist Autor zahlreicher Buchveröffentlichungen über Verfassungsrecht und politische Ideengeschichte.
Rudolf Weber-Fas
Epochen deutscher Staatlichkeit
Vom Reich der Franken bis zur Bundesrepublik
Verlag W. Kohlhammer
Professor Dr. jur. Rudolf Weber-Fas Master of Laws (Harvard) Bundesrichter a.D. Ordinarius für Öffentliches Recht und Staatslehre (Univ. Mannheim)
Alle Rechte vorbehalten © 2006 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart
Printed in Germany 978-3-17-019505-9
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028268-1
mobi:
978-3-17-028269-8
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Mittelalterliche Ursprünge
1. Das fränkische Königtum
2. Strukturen der Lehnsverfassung
3. Kaisertum und Papsttum
II. Verfassungsentwicklungen im Heiligen Römischen Reich
1. Die Kurfürsten
2. Rechtsstellung des deutschen Königs
3. Kaiser und Reich
4. Reichshoheit und Landesherrschaft
5. Fürstlicher Absolutismus
6. Die Reichsverfassung nach dem Westfälischen Frieden
7. Der Untergang des Alten Reiches
III. Der Deutsche Bund
1. Napoleons Ende
2. Wiener Kongress und Deutsche Bundesakte
3. Landständische Verfassungen
4. Grundsätze der konstitutionellen Monarchie
5. Vormärzliche Forderungen und politische Gegenkräfte
6. Märzrevolution und Frankfurter Nationalversammlung
7. Leitgedanken der Paulskirchenverfassung
8. Das preußische Staatsgrundgesetz von 1850
9. Zusammenbruch des Deutschen Bundes
IV. Norddeutscher Bund und Deutsches Reich
1. Struktur des Norddeutschen Bundes
2. Beitritt der süddeutschen Staaten
3. Die Reichsverfassung von 1871
V. Zwischen Reichsgründung und Geburt der Republik
1. Verfassungswandel im Kaiserreich
2. Das Ende der deutschen Monarchie
3. Novemberrevolution und Rätesystem
VI. Die Weimarer Republik
1. Verfassungsgebende Nationalversammlung
2. Prinzipien der Weimarer Reichsverfassung
3. Oberste Staatsorgane der Republik
4. Grundrechtsordnung und Gerichtsbarkeit
5. Niedergang des parlamentarischen Regierungssystems
VII. Das Dritte Reich
1. Die „Machtergreifung“
2. Totalitärer Führerstaat in Deutschland
3. Der Untergang des „Großdeutschen Reiches“
VIII. Deutsche Staatlichkeit nach 1945
1. Konstituierung von Ländern
2. Bundesrepublik und DDR
3. Kerngedanken des Grundgesetzes
Anhang
Literaturhinweise
Abkürzungen
Register
Vorwort
Der vorliegende Band bietet eine kurzgefasste Überblicksdarstellung insbesondere für Studierende der Rechts- und Staatswissenschaft, der Geschichte und der Politik. Darüber hinaus wendet das Buch sich an ein größeres Publikum, das sich für die Grundlinien der historischen Entwicklung deutscher Staatlichkeit interessiert. Wer einzelne Fragen näher vertiefen möchte, findet im Anhang zu jedem Kapitel eine Auswahlbibliographie.
I.Mittelalterliche Ursprünge
1. Das fränkische Königtum
Die Franken, ein germanischer Stamm, entwickelten sich unter ihren Herrschergeschlechtern der Merowinger und der Karolinger zur bestimmenden politischen Kraft des frühen Mittelalters. Das fränkische Reich (Regnum Francorum) wurde zum Vorläufer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Ohne sich von manchen militärischen Niederlagen entmutigen zu lassen, waren die Franken in der weströmischen Spätzeit wiederholt offensiv geworden, ehe sie mit Chlodwig, der um 500 n. Chr. getauft wurde, erstmals zu reichspolitischer Bedeutung gelangten.
Im Vorspruch zum salfränkischen Gesetzbuch (Lex Salica), einer Zusammenstellung des Volksrechts der salischen Franken zu Anfang des 6. Jahrhunderts, heißt es von ihnen: „Der Franken erlauchtes Volk, durch Gott den Schöpfer begründet, tapfer in Waffen, fest im Friedensbund, tiefgründig im Rat, körperlich edel…, jüngst zum katholischen Glauben bekehrt… Christus bewahre ihr Reich, erfülle ihre Führer mit dem Licht seiner Gnade, schütze das Heer… Freude des Friedens und Zeiten des Glücks schenke der Herr den Herrschenden… Der Römer härtestes Joch schüttelten die Franken kämpfend von ihren Nacken.“
Die aus Teilstämmen sich formende fränkische Nation gründete vor allem auf den Saliern, die ursprünglich zwischen Maas und Somme siedelten. Sodann auf der Francia Rinensis, etwa räumlich begrenzt von Rhein, Mosel und Maas. Die salischen Franken brachten die Dynastie der Merowinger hervor, so genannt nach dem Sagenkönig Merowech. Er soll der Vater Childerichs gewesen sein. Mit dessen Hilfe hatten die letzten römischen Feldherrn im ausgehenden 5. Jahrhundert den vordringenden Westgoten und Sachsen einstweilen zu widerstehen vermocht.
Bei den fränkischen Vorstufen mittelalterlicher Staatlichkeit konnte von einer territorialen Herrschaft im modernen Sinne noch keine Rede sein. Ebenso wenig von einem Patriarchalregime über die ins Große ausgedehnte Sippengemeinschaft oder von einer auf Grundeigentum fußenden patrimonialen Gewalt. Damals und noch lange Zeit später gründete hoheitliche Macht kaum auf räumlich-institutionellen Faktoren. Vielmehr waren es besondere persönliche Bindungen zwischen oben und unten, die eine Vielzahl von Menschen zusammenfügte zum politischen Verband.
Mit dem neuchristlichen König Chlodwig (482–511) beginnt die dynastische Herrschaft der Merowinger im fränkischen Reich. Diesem Fürsten war es gelungen, die römischen Restgebiete zwischen Loire und Somme zu erobern, das westgotische Aquitanien bis zur Garonne zu gewinnen und die Franken – nicht zuletzt durch entschlossene Ausschaltung anderer Teilkönige – unter seiner Führung zu vereinen. Der Versuch, bis ans Mittelmeer vorzudringen, scheiterte freilich an Theoderich d. Gr., dem König der Westgoten. Als Chlodwig starb, hatte er eine Art von Großreich geschaffen, das sich unter seinen Nachfolgern auf fast alle Westgermanen erstreckte.
Zur Frage der ungefähren Periodisierung sei noch angemerkt: Der fränkischen Epoche – etwa von der Mitte des 5. Jahrhunderts bis zum Ende des 9. Jahrhunderts – liegt die germanische Zeit voraus. Auf das hohe und späte Mittelalter – ungefähr vom Beginn des 10. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts – folgt die nachmals sog. Neuzeit. Sie setzt sich nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (1806) bis in die Gegenwart fort als Neueste Zeit.
Das fränkische Großkönigtum Chlodwigs I. war aus dem salischen Teilkönigtum hervorgegangen. Der Aufstieg verdankte sich einer jahrzehntelangen zielstrebigen Machtpolitik, gestützt auf die Heerführerfunktion mit ihrer unbeschränkten Befehlsgewalt. Beim Aufbau seiner Einherrschaft ließ sich Chlodwig gegebenenfalls, wie etwa von den Ripuariern, nach germanischem Herkommen zum König wählen. Im übrigen machte er sich, als militärischer Sieger, zum Herrn über die unterworfenen Stämme. Die innere Stabilisierung seines Königtums beruhte entscheidend auf der Kooperation mit der Kirche. Wichtig wurde nicht weniger die Ausstattung seiner Gefolgsleute mit erobertem Krongut und die Übernahme bewährter Verwaltungsmethoden aus dem altrömischen Reich. Die Einrichtung einer königlichen Kanzlei entsprach dem Regierungsstil der spätrömischen Kaiser. Und deren Edikte wurden zum Vorbild für einschlägige Erlasse des Herrschers, aus denen, neben dem überkommenen Gewohnheitsrecht, positives königliches Recht entstand. Im Unterschied zu den anderen Neugründungen der Völkerwanderungszeit – den Verbänden der Goten, Burgunder, Langobarden und Wandalen – war es dem Reich der Franken beschieden, Jahrhunderte zu überdauern.
Anders als in der früheren Stammeszeit herrschte der fränkische König – er nennt sich rex Francorum und nicht etwa rex Franciae – über eine Vielzahl verschiedener Volksstämme. Das Reich der Franken (Regnum Francorum) umschloss kein einheitliches Staatsvolk. Dieses Gebilde war, wenn man spätere Begriffe zu seiner Kennzeichnung verwenden kann, mitnichten ein Nationalstaat, sondern eine Art von Nationalitätenstaat. Zwischen den verschiedenen Volksgruppen bestand in der Merowingerzeit grundsätzlich Gleichberechtigung.
Bereits in vorfränkischer Zeit hatte sich das Königtum – zunächst bei den ostgermanischen, schließlich auch bei den westgermanischen Stämmen – als grundlegende Verfassungsform gefestigt. Nur die Sachsen heben sich durch einen Sonderweg ab. Jener König, neben dem die Großen des Volkes ihre politischen Rechte zu behaupten wussten, war im Frieden wenig mehr als der erste Edelmann seines Herrschaftsverbandes. Er kam aus der adeligsten Sippe, der stirps regia.
Die Dynastie der Merowinger stellte die ersten fränkischen Könige. Im 8. Jahrhundert folgte das Herrschergeschlecht der Karolinger, benannt nach Karl dem Großen, ihrem bedeutendsten Exponenten. Ihm war es gelungen, das Frankenreich erheblich nach Osten auszuweiten und namentlich die heidnischen Sachsen der fränkischen Herrschaft zu unterwerfen. Den langwierigen Kriegen Karls d. Gr. gegen die Sachsen – diese kannten kein Königtum, sondern wählten sich Herzöge für die obersten Führungsaufgaben – schloss sich die christliche Missionierung an. Unter fränkischer Oberhoheit entstand Anfang des 9. Jahrhunderts auch das sächsische Stammesrecht (Lex Saxonum).
Nach dem Ende des weströmischen Reiches hatte sich der traditionelle Großgrundbesitz unter den merowingischen Königen erhalten.
Wie im früheren Kolonat gab es die Domänenwirtschaft, teils mit Sklaven betrieben, teils mit halbfreien, erblich an die Scholle gebundenen Bauern. Fast nur im Süden und Westen des Frankenreiches behaupteten sich die städtischen Gemeinden mit den zeittypischen Formen des Wirtschaftslebens. Von einer Blüte konnte allenfalls beim vereinzelten Fernhandel mit Luxusgütern die Rede sein. Im Ganzen herrschte eine allgemeine Kargheit des Lebens und mancherlei Mangel; Missernten führten leicht zu Hungersnöten.
Wie schon bemerkt, wurde der Frankenkönig Chlodwig um 500 n. Chr. getauft. Sein Übertritt zum katholischen Christentum war ein Schritt, der in der damaligen Welt hochpolitische Bedeutung hatte und in der Folge ein kaum zu überschätzendes Gewicht gewann. Mit der Hinwendung des fränkischen Oberherrn zur römisch-katholischen Kirche brüskierte dieser die damals herrschende arianische Richtung christlicher Lehre und damit zugleich Theoderich als Repräsentanten dieser antirömischen Konfession. Chlodwigs Wende zur römischen Kirche wurde zur entscheidenden staatskirchenpolitischen Zäsur. Sie war der Ausgangspunkt einer besonderen Verbindung zwischen den Franken und dem Bischof von Rom, die jahrhundertelang historisch wirksam blieb.
Bei seinem Aufstieg zur Alleinherrschaft über die Franken verfuhr Chlodwig oft sehr skrupellos. Mehrere seiner Rivalen hatte er sogar ermorden lassen. Als er im Alter von nur 45 Jahren starb (511), kam es zu Diadochenkämpfen zwischen seinen Söhnen. Wie sehr die organisatorischen Grundlagen des fränkischen Königtums mit Strukturen der untergehenden weströmischen Staatlichkeit verwoben waren, wird in Chlodwigs Biographie beispielhaft deutlich. Ausgangspunkt seiner Karriere, die ihn an die Spitze des fränkischen Großreiches führen sollte, war eine leitende Tätigkeit als Beamter der römischen Administration zu Reims. Und den Titel eines Konsuls hatte er, wenige Jahre vor seinem Tod, vom oströmischen Kaiser erhalten.
Wie sich staatliche Grundelemente des Reichs der Franken altrömischen Rechtsstrukturen mannigfach verdanken, so geht das ältere deutsche Reich – dies sei hier schon angemerkt – in Entstehung und Bestand auf fortwirkende politische Gedanken des zerfallenen fränkischen Großreichs vielfältig zurück. Gerade dadurch erweist sich das Regnum Francorum als die weitaus wichtigste germanische Staatshervorbringung der Völkerwanderungszeit. Freilich führte der Untergang des Frankenreichs nicht mit historischer Notwendigkeit zu diesem verfassungsgeschichtlichen Resultat. Doch rückblickend steht die Traditionslinie fest: Vermittelt durch den fränkischen Staat hat das deutsche Reich seinen wesentlichen Wurzelgrund im Germanentum und in der frühen römischchristlichen Zeit.
Ausgehend von seinem Kernland, besonders an Rhein und Mosel, erstreckte sich das Großreich der Franken schließlich vom Atlantik bis zur Elbe, von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Für die politisch-kulturelle Integration zwischen den altfränkischen und den mehr oder weniger unterworfenen Bevölkerungsteilen bildete die gemeinsame christliche Religion eine bedeutsame Klammer. Deren Festigung verdankte sich nicht zuletzt den römisch-katholischen Bischöfen samt dem administrativen Unterbau ihrer Diözesen. Die wachsende enge Verbindung von staatlicher und kirchlicher Herrschaft fand im Jahre 800 ihren mehr als nur symbolischen Höhepunkt, als Karl der Große sich vom Papst zum römischen Kaiser krönen ließ.
Dass es zu keinem nennenswerten Abfall der von den Franken unterworfenen Volksgruppen kam – mochten auch die Eroberungszüge mitunter zu großen Grausamkeiten geführt haben, wie etwa bei den Alemannen und Sachsen –, war eine Folge der grundsätzlich auf Ausgleich bedachten fränkischen Politik. Sie suchte die Eigenart der besiegten Stämme tunlichst zu schonen. So ließ man zum Beispiel deren Volksrechte aufzeichnen und modifizierte sie allenfalls behutsam zur Anpassung an die neue Herrschaftsform. Unter den fränkischen Herzögen stabilisierten sich nach und nach besonders auch die rechtsrheinischen Stämme. Mit ihrem schließlich erreichten festeren politischen Zusammenhalt vermochten sie zur Formierung des späteren deutschen Reiches einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Schon unter den Söhnen König Chlodwigs war es zu Erbauseinandersetzungen gekommen, die man allenfalls als Vorboten von Reichsteilungen bezeichnen kann. Denn immerhin blieb damals und auch bei späteren ähnlichen Vorgängen die Samtherrschaft und damit die Reichseinheit erhalten. Zudem kam es, wenn etwa ein derartiger Teilkönig kinderlos starb, bisweilen zu einer Art von Wiedervereinigung seines Herrschaftsbereichs mit dem Ganzen. Letzten Endes blieb indessen auch dem in einem langen Geschichtsprozess zusammengewachsenen Frankenreich das Schicksal nicht erspart, einst stückweise zu zerfallen und schließlich völlig auseinander zu brechen. Das Verhängnis nahm seinen Anfang in der Teilung des Reiches durch die Enkel Karls d. Gr. im Vertrag von Verdun.
Hintergrund dieses Teilungsvertrags war der Ausgang der Schlacht von Fontenay (841), dem blutigen Höhepunkt einer Art von Bürgerkrieg, in dem sich die Streitkräfte dreier Karlsenkel – Karl der Kahle, Ludwig II. der Deutsche und Lothar I. – bei wechselnden Bündnissen gegenüberstanden. In der höchst verlustreichen Entscheidungsschlacht besiegten Karl und Ludwig ihren Bruder Lothar, der sich dann zu Verhandlungen über eine Teilung des fränkischen Reiches gezwungen sah. Den Teilungsplan – Grundlage war eine umfassende Inventarisierung (descriptio) der Bistümer, Klöster, Grafschaften und Reichsgüter – akzeptierten die drei Brüder schließlich mit Zustimmung ihrer Großen.
Der Vertrag von Verdun (843) sollte einigermaßen gleichwertige, um die Kerngebiete Bayern, Italien und Aquitanien gruppierte Teilreiche schaffen. Dabei erhielt Lothar, der die Kaiserwürde geerbt hatte, zu Italien und der Provence einen Gebietsstreifen von den Alpen bis nach Friesland: im Osten begrenzt durch den Rhein, im Westen durch Maas, Rhône, Schelde und Saône. Die Gebiete westlich bzw. östlich dieses Mittelreichs gingen an Karlbzw. an Ludwig. Letzterer bekam außerdem die linksrheinischen Diözesen Mainz, Speyer und Worms. Der Vertrag von Verdun hatte nicht zum Ziel, die Reichseinheit aufzulösen. Doch er wurde zum Vorboten für den späteren Zerfall des Regnum Francorum in ein westfränkisches und ein ostfränkisches Reich.
Jenem Teilungsvertrag folgten im Laufe der Zeit weitere Teilungen, aber auch neue Vereinigungen kamen gelegentlich vor. Schon bald (855) wurde das mittlere Reich unter den drei Söhnen Lothars aufgeteilt. Fortan traten besonders Burgund und Italien als selbständige Herrschaften auf den Plan. Nach seinem neuen König Lothar II. nannte sich der nördliche Teil des Mittelreichs nun Lotharingen (Lothringen). Doch als der König starb (870), wurde das Gebiet von Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen etwa zu gleichen Teilen übernommen. Andererseits gelang es Karl dem Dicken, dem letzten der Söhne Ludwigs, im ausgehenden 9. Jahrhundert noch einmal, alle Teilreiche zu vereinen.
Bezeichnend für das aus germanischen Stämmen hervorgegangene fränkische Königtum ist der überkommene Gedanke eines göttlichen Ursprungs der Königsfamilie. Dem entsprach die Idee, dass im König göttliche Kräfte wirksam seien, dass seine Person das Königsheil verkörpere. Dieses Heil war, so glaubte man, für die allgemeine Wohlfahrt in Krieg und Frieden die beste Garantie. Für den König konnte diese Vorstellung freilich auch zum persönlichen Unheil ausschlagen, wenn ihm etwa große Misserfolge angelastet wurden. Das ihm dann drohende „Königsopfer“ war ursprünglich Ausstoßung oder gar kultische Tötung. Dergleichen wurde in christlicher Zeit durch Verbannung in ein Kloster abgeschwächt.
Das Sakralkönigtum der Merowinger, wurzelnd in germanisch-heidnischen Vorstellungen und von den Karolingern mit christlich geprägten Prinzipien weitergeführt, entwickelte sich zu einem grundlegenden Strukturelement mittelalterlicher Königsherrschaft. Die Idee vom Gottesgnadentum der Staatsgewalt – im Unterschied zur heutigen demokratischen Legitimität – geht auf jene Epoche zurück. Seit der Karolingerzeit wurde dem Königstitel die Formel „Dei gratia“ (von Gottes Gnaden) beigefügt. Sie drückte das göttliche Mandat des Herrschers aus und seine Unabhängigkeit von jeder irdischen Macht. Dergestalt wurde das Königtum als ein Organ der göttlichen Weltregierung gedacht.
Mochte auch eine geschriebene Verfassung fehlen, so stand es dem fränkischen König keinesfalls frei, etwa wie ein absoluter Fürst zu regieren. Die beweglichen Grenzen seiner Macht wurden von dem jeweiligen Kräfteverhältnis zwischen ihm, den Großen und dem Volke bestimmt. Die Beschränkung der obersten Hoheitsgewalt hing zum Teil auch damit zusammen, dass jedenfalls noch unter den Merowingern eine privatrechtliche Auffassung der Herrschaft überwog.
Bei der – mit einer modernen Wahl nicht zu verwechselnden – fränkischen Königswahl waren traditionale und rationale Grundsätze miteinander vermischt. Die Zugehörigkeit zum königlichen Geschlecht war eine notwendige, aber für sich allein nicht ausreichende Bedingung zur Erlangung der Königswürde. Bei dieser höchsten Standeserhebung (electio) mitsamt der geistlichen Salbung wirkten die Großen des Reiches als eine Art aristokratischer Vertretung des Volkes konstitutiv mit. Zum Ritual der Königswahl gehörten bald auch Akklamation, Schilderhebung und Huldigung durch die vornehmsten Herren (subiectio principum).
Das königliche Geblüt in männlicher Abstammungslinie als Voraussetzung der Thronfolge musste sich unter den Karolingern, christlichen Anschauungen gemäß, grundsätzlich einer ehelichen Geburt verdanken. Mündigkeit des Thronfolgers war nicht erforderlich, weder beim Übergang des Reiches kraft Erbrechts (wie etwa nach Chlodwigs I. Tod) noch bei der Thronerhebung durch Wahl (elevatio). Wenn der König persönlich nicht regierungsfähig war, wurden die Staatsgeschäfte in seinem Namen von den maßgebenden Großen geführt, in der Folge auch vom jeweiligen Hausmeier allein. Eine kirchliche Salbung oder Krönung des Königs war den Merowingern noch unbekannt. Die erste Salbung erfolgte bei der Königswahl des Hausmeiers Pippin (751); die erste Krönung war die Kaiserkrönung Karls des Großen.
Jene geistliche Salbung sollte die Königsherrschaft der Karolinger zusätzlich legitimieren. Der Hausmeier (Maiordomus) war unter den Merowingern in den einzelnen Teilreichen der Vorsteher der königlich-fränkischen Hofhaltung und -kanzlei. Nach und nach entwickelte sich die Funktion zum Führungsamt über die adlige Gefolgschaft, wobei der König als Träger der Herrschaftsgewalt de facto in den Hintergrund geraten konnte. Pippin dem Mittleren aus dem Hause der Karolinger gelang es, die in seiner Familie so gut wie erblich gewordene Hausmeierposition auf alle Teile des Frankenreiches einheitlich zu erstrecken. Und sein Enkel Pippin der Jüngere brachte es fertig, den letzten Merowingerkönig Childerich zu entthronen und sich selbst zum König der Franken wählen zu lassen (751). Er schenkte dem Papst u. a. das Exarchat Ravenna. Diese von Karl d. Gr. bestätigte „Pippinsche Schenkung“ wurde zu einem territorialen Grundstock für die Entstehung des Kirchenstaates.
Der fränkische König der Merowingerzeit führte den Titel eines „Rex Francorum“. Karl d. Gr. nannte sich seit 779 „Rex Francorum et Langobardorum ac patricius Romanorum“. Das letztere Titelelement ersetzte er nach seiner Kaiserkrönung durch „Augustus imperator Romanum gubernans imperium“. Die königlich-merowingischen Insignien – Lanze und Thron – wurden unter den Karolingern ergänzt um Schwert, Krone und Kreuz.
Die verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Königs als Träger der fränkischen Staatsgewalt erstarkten erst allmählich. An ihrer vollen Auswirkung wurden sie vielfach gehindert durch die politischen Gegenkräfte von Adel und Volk.
Der König war oberstes, sakral verankertes Organ der inneren Friedenswahrung. Namentlich die Hochgerichtsbarkeit lag bei ihm. Soweit er nicht persönlich Recht sprach, wurde die Gerichtsbarkeit durch Pfalzgrafen ausgeübt. Der Pfalzgraf (comes palatii), ursprünglich eine Art Referent am königlichen Hofgericht der Merowinger, wurde später aufgewertet zum Statthalter des Königs und entwickelte sich vereinzelt zu einem Gegengewicht der Herzogsgewalt. Unter den Karolingern judizierte der Pfalzgraf als Vertreter des Herrschers selbständig im Königsgericht. Nur besonders wichtige Rechtsfälle der Großen blieben der persönlichen Entscheidung durch den König vorbehalten.
Nach dem Prinzip des Königsfriedens im Inneren stand jedermann unter einem allgemeinen Königsschutz. Einzelnen Personen oder Körperschaften, wie etwa der Kirche, konnte der Herrscher überdies einen besonderen Königsschutz gewähren. Zu den königlichen Rechten gehörte es auch, verhängte Strafen zu mildern oder verurteilte Straftäter zu begnadigen.
Die oberste Militärgewalt lag beim fränkischen König. Er entscheidet über Krieg und Frieden. Von ihm geht das Aufgebot aus, das im Reich verkündet und durchgeführt wird. Er hält die Heerschau ab und ist Oberbefehlshaber im Krieg. Er allein vertritt das Reich nach außen und schließt Frieden aus eigenem Recht.
Zur königlichen Finanzhoheit gehörte das Münzrecht sowie das Recht auf Zölle und andere Verkehrsabgaben. Personensteuern, wie insbesondere die heutige Einkommensteuer, waren damals noch unbekannt.
Der König war auch Inhaber der Kirchenhoheit. Sie wurde mit unterschiedlicher Intensität ausgeübt, namentlich bei der Besetzung von Bischofsstühlen oder der Einberufung von Synoden.
Wie vorstehend schon angedeutet, waren die Hausmeier schrittweise zu den faktischen Trägern der Regierungsgewalt aufgestiegen. Durch den Staatsstreich Pippins II. ging das Königtum der glücklos gewordenen Merowinger auf die neue Dynastie der Karolinger über, was ohne eine enge Verbindung mit der Kirche kaum Bestand gehabt hätte. Indem der Papst die fränkischen Magnaten auf das neue Herrscherhaus verpflichtete und dessen Repräsentanten zum König salbte, verknüpfte er das christliche Charisma mit dem hergebrachten Königsheil. Im Gegenzug garantierte Pippin als patricius Romanus seinen besonderen Schutz der römischen Kirche. Dem Papste überließ er neben dem Exarchat Ravenna auch das Dukat Rom; beide vergrößerten das Kerngebiet des sich entwickelnden Kirchenstaates (patrimonium Petri) ganz erheblich.
Die Spitze der Verwaltung des fränkischen Gesamtreiches war der königliche Hof (aula regis, palatium). Als ausführende Leitungsorgane dienten dem König einzelne Persönlichkeiten (palatini), die er für längere Zeit in seine engste Umgebung gezogen hatte. Bei Bedarf konnte er die weltlichen und geistlichen Großen zu beratenden Versammlungen einberufen. Der karolingische König hielt in seinen Pfalzen abwechselnd Hof; eine feste Residenz kannte man damals noch nicht. Ebenso wenig einen zentralen Beamtenapparat, wie er im späteren fürstlichen Territorialstaat entstand.
Indessen gab es am fränkischen Königshof bestimmte, auf germanische Vorstufen zurückgehende Hausämter. Abgesehen vom schon erwähnten, machtvoll herausragenden, nach der Thronerhebung Pippins II. abgeschafften Amt des Hausmeiers wirkten als höfische Funktionsträger insbesondere der Kämmerer, der Truchsess und der Marschall. Ständige, weniger bedeutsame Ämter hatten ferner auch der Schwertträger, der Quartiermeister und der Zeremonienmeister. Der Kämmerer war eine Art Schatzmeister; dem Truchsess oblag die Verpflegung des Hofes. Der Marschall, ursprünglich nur Pferdebetreuer des Königs, entwickelte sich Jahrhunderte später zum Führer der berittenen Streitkräfte oder gar zum Chef der gesamten Armee. Die wichtigsten Ämter wurden im Allgemeinen von besonders angesehenen Gefolgsleuten des Königs ausgeübt, wie es dem personenbezogenen Charakter der fränkischen Herrschaftsform entsprach.
Schon wegen der weiträumigen Ausdehnung des Reiches waren Volksversammlungen im Stil der germanischen Zeit nicht mehr möglich. Ihrer Abhaltung stand überdies entgegen, dass die fränkische Bevölkerung eine entsprechende stammesmäßige und volksrechtliche Homogenität verloren hatte. Immerhin kam es noch gebietsweise zu vereinzelten Stammesversammlungen. Indessen wurden die Großen des Reiches vom König nach seinem freien Ermessen, in der Regel zweimal jährlich, zu Hoftagen eingeladen. Nach und nach erlangten die Herren sogar einen Anspruch auf Teilnahme an diesen Versammlungen.
Unterhalb der Reichsspitze walten regionale Machthaber ihres Amtes. An der Spitze dieser politisch-administrativen Klasse steht jeweils der Herzog (dux). Er macht mitunter seinen Regierungsauftrag für bestimmte Bezirke oder Stammesverbindungen als Herrschaft aus eigenem Rechte geltend, woraus dann ein Spannungsverhältnis zum König entsteht. Doch ist der Herzog als hochmögender Machtträger der Karolingerzeit nicht in allen Reichsteilen institutionalisiert.
Demgegenüber fungiert der Graf als ein das fränkische Staatswesen durchgängig kennzeichnendes Strukturelement. An der Spitze der jeweiligen Grafschaft, wurzelnd im römischen Regierungsbezirk (civitas), steht der comes, fränkisch auch grafio genannt. Der Graf verfügt über ein ganzes Bündel von Kompetenzen in seinem Gebiet. Militärische Befugnisse bilden die Grundlage seiner Amtsgewalt. Die Grafen wurden vom König installiert, der bei Berufungen den Indigenatsgrundsatz zu beachten hatte: der zu Ernennende musste aus der betreffenden Grafschaft stammen. In karolingischer Zeit wurde das Grafenamt zunehmend erblich. Gestärkt durch großen Grundbesitz, minderten die Grafen mehr und mehr die Macht des Königtums. In der Hand des Grafen vereinigten sich exekutive und richterliche Kompetenzen. Als königlicher Statthalter sorgte er gleichermaßen für den inneren Frieden, die Wahrung des Rechts, das Aufbieten der Heerfolge und die Sicherung des Königsguts.
Eine Sonderstellung zwischen Herzog und Graf nehmen die Markgrafen ein. Der Markgraf (marchio) waltet mit militärischem Oberbefehl in einem – Mark genannten – Grenzgebiet des Reiches. Die Marken wurden nach außen durch Burgen und Wehrbauten geschützt. Karl d. Gr. hatte namentlich eine avarische, bretonische, dänische, sorbische, spanische und wendische Mark errichtet, ferner auch die Mark Friaul, die Mark Meißen und die bairische Ostmark. Im karolingischen Imperium waren die Marken – spätere Großstaatbildungen wie Brandenburg-Preußen und Österreich gingen aus ihnen hervor – gleichermaßen Aufmarschräume für Angriffskriege und Bollwerke für die Reichsverteidigung. Die Markgrafen – einigen von ihnen gelang späterhin der Aufstieg zu Landesherren – verfügten über gewichtige Vollmachten außerhalb der Reichsverfassung.
Im Inneren des fränkischen Reiches gehörte die Wahrung von Frieden und Recht samt der Gewährleistung des Königsschutzes zu den vornehmsten Staatsaufgaben des Königtums. Die Aufzeichnungen der sog. Volksrechte (Leges barbarorum) – wie insbesondere die „Lex Salica“ des Reichsgründers Chlodwig und die „Lex Ribuaria“ der späten Merowingerzeit – sind Zeugnisse dieser Politik. Von Karl d. Gr. wurde die Tradition fortgeführt, namentlich mit den Rechtsbüchern für die Friesen, die Sachsen und die Thüringer.
Neben das auf die Stammesgenossen bezogene Volksrecht traten geschriebene Rechtsnormen mit Geltung für das ganze Reichsgebiet. Sie wurden vom König mal mit, mal ohne die Mitwirkung der Großen oder des Volkes statuiert. Wie alle Rechtsaufzeichnungen der fränkischen Epoche sind auch diese Vorschriften (Kapitularien) in lateinischer Sprache abgefasst. Inhaltlich treten dabei Staatsrecht und Privatrecht gegenüber dem Strafrecht und dem Strafprozess deutlich in den Hintergrund.
In den königlichen Kapitularien fand auch die Kirchengesetzgebung der Karolingerzeit ihren Niederschlag. Die Quellen lassen sich einteilen in Capitularia ecclesiastica oder Capitularia mundana und – wenn sowohl geistliche wie weltliche Angelegenheiten geregelt wurden – in Capitularia mixta. Bei den weltlichen Kapitularien sind drei Arten zu unterscheiden: Capitula legibus addenda betreffen die zustimmungsbedürftige Abänderung von Stammesrechten. Capitula per se scribenda, die vom König allein erlassen werden können kraft seiner Banngewalt, erzeugen stammesübergreifendes Reichsrecht. Capitula missorum enthalten zumeist königliche Direktiven zu den Aufgaben der Königsboten beim Bereisen ihrer Amtsbezirke.
Bedeutsam für die Grundordnung des Frankenreiches ist nicht zuletzt auch das königliche Privileg der Immunität, das Bistümern und Abteien samt ihrem oft ausgedehnten Grundbesitz zugute kam. Rechtlich führte dies zu einer Befreiung von der gräflichen Gerichtsbarkeit im jeweiligen Bereich. Politisch schützte das Immunitätsvorrecht die geistlichen Institutionen vor dem Machtwillen des regionalen Adels; es unterstützte nachhaltig die entstehende Reichskirche und band sie fester an das fränkische Königtum.
2. Strukturen der Lehnsverfassung
Das Lehnswesen, geschichtsträchtige Erscheinungsform des Feudalsystems, ist ein tragender Pfeiler der Staats- und Gesellschaftsordnung des deutschen Mittelalters. Übrigens blieb das Römische Reich Deutscher Nation bis zu seinem Ende 1806 formell ein Lehnsstaat. Erst im 19. Jahrhundert kam der langwierige Prozess allgemeiner Allodifizierung zum Abschluss. Endlich waren auch die letzten Lehen – unter Mitwirkung der Lehnsbeteiligten und gegen Entschädigung der Lehnsherrn – in freies Eigentum transformiert.
Anders als die Grundherrschaft, welche in der römischen Domänenwirtschaft mit hörigen, an die Scholle gebundenen Bauern wurzelte, war das Lehnswesen im Kern hoheitlich strukturiert. Zugrunde lag nicht zuletzt die Vorstellung von drei Ständen – Priester, Krieger und Bauern – mit je verschiedenen Funktionen im politischen Verband. Während es bei der Grundherrschaft hauptsächlich um die Überlassung von Herrenland gegen bäuerliche Dienste ging, schuldete der Lehnsmann (vasallus) dem Lehnsherrn (dominus) als Gegenleistung vor allem militärische Gefolgschaft im Krieg.
Der auf dem Lehnswesen beruhende Feudalstaat des Mittelalters war die politische Ausprägung einer sozialen und wirtschaftlichen Grundordnung. In deren Rahmen wurde, ausgehend vom König als Inhaber der höchsten Gewalt, das Gemeinwesen durch eine fein abgestufte Hierarchie geformt. Dieser Feudalstaat bildete die Vorstufe des späteren Ständestaats. Erst dem fürstlichen Absolutismus gelang es, die überkommenen Privilegien der Feudalherren zu brechen. Im Ständestaat hatten bestimmte Stände (Adel, Klerus, Städte), die sich zunehmend als Vertretungen des ganzen Landes verstanden, entscheidenden Anteil an der Ausübung der Staatsgewalt. Solche ständische Struktur des Gemeinwesens war ein Übergangsstadium von der feudalen Grundordnung zum konstitutionellen Verfassungsstaat.
Das fränkische Lehnswesen, das prägend wurde für das ganze politische Mittelalter, war eine Art Synthese von Elementen des spätrömischen Feudalismus und der feudalen Vorstufen im germanischen Bereich. Seine juristische Ausformung fand dieses hoheitlich-wirtschaftliche System in den Prinzipien des Lehnsrechts. Zu seinem Verständnis sind bestimmte Grundbegriffe kurz zu beleuchten.
Das Lehen (beneficium, feudum), auch Lehnsgut genannt, bildet den Gegenstand des Lehnsvertrags zwischen dem Lehnsherrn (dominus) und dem Lehnsmann (vasallus). Letzterem wird ein Wirtschaftsgut auf Zeit überlassen gegen das Versprechen von Treue und Dienst. Jeder ertragsfähige Vermögenswert kann Objekt eines Lehnsvertrages sein. So vor allem landwirtschaftliche Güter, Burganlagen oder größere Bezirke. Von besonderer Verfassungsrelevanz sind Lehnsverträge, wenn das Lehnsgut aus öffentlichem Vermögen stammt und gegen staatsnotwendige Dienste verliehen wird.
Eine höchstpersönliche und eine sachlich-ökonomische Komponente sind für das Lehnsverhältnis konstitutiv. Wesentliche Staatsziele des fränkischen Königtums, namentlich im militärischen und im Verwaltungsbereich, waren nur auf der Grundlage von Lehnsverträgen zu verwirklichen. Mit dem Grad ihrer Verdichtung wurde jenes monarchische Gemeinwesen mehr und mehr zu einem Lehnsstaat. Dabei entstand eine Art von Lehnspyramide mit dem König als oberstem Lehnsherrn. Diese Spitze ruhte auf einem Fundament vielschichtiger Lehnsketten, die durch Unterlehen miteinander verwoben waren. Die Subvasallen sahen sich im Verhältnis zum König je nach ihrer Stellung in der Lehnshierarchie mehr oder weniger mediatisiert.
Der Lehnsstaat, die feudale Form des Personenverbandsstaats, entfaltete seine Wirksamkeit bis zum Hochmittelalter. Entscheidend für seine Entwicklung wurde die schon in fränkischer Zeit einsetzende Praxis, auch Hoheitsrechte und Ämter zum Gegenstand von Lehnsverhältnissen zu machen. Namentlich das Herzogs- und Grafenamt mit der Möglichkeit, nachgeordnete Ämter innerhalb eines Bezirks weiterzuverleihen, haben den Ausbau des Lehnsverbandes bestimmt. Unbeschadet einer ursprünglich privatrechtlichen Form der Grundleihe war das Lehen öffentlich-rechtlich konzipiert. Es wurde zum Mittel, staatliche Hoheitsgewalt auf Vasallen und Untervasallen zu übertragen.
Bei aller politisch-ökonomischen Bedeutung des Lehnswesens gab es freilich auch in jener Epoche stets – Allod genanntes – lehnsfreies Land. Kennzeichnend für solchen Dualismus des mittelalterlichen Staates sind namentlich die allodialen Grafschaften. Dort wurde zum Beispiel die Hochgerichtsbarkeit aus eigenem, also nicht vom König abgeleiteten Rechte ausgeübt.
Wenn jenes mittelalterliche Gemeinwesen mit einem Monarchen an der Spitze gleichwohl als Lehnsstaat aufgefasst wird, so erklärt sich dies aus der vorherrschenden Form seiner Organisation. Der staatliche Aufbau beruhte nicht etwa auf dem dienstlichen Gehorsam eines königlichen Beamtenapparats, vielmehr auf der persönlichen Treue unmittelbarer oder mittelbarer Vasallen des obersten Lehnsherrn. Innerhalb der Lehnsherrlichkeit des Königs war die Stellung der Herzöge von herausgehobener Bedeutung, seit diese ihr Land als Lehen erhalten hatten. Auch die Verbindung mit der Kirche durch Regalieninvestitur der geistlichen Fürsten vollzog sich schließlich in lehnsrechtlicher Form.
Wie verschieden sich die historische Entwicklung bei wesentlich gleichen Ursprüngen gestalten kann, zeigt ein Blick auf die schließlichen Resultate im europäischen Raum. Schon am Ende der Karolingerzeit hatte es das fränkische Reich mit spürbaren zentrifugalen Tendenzen zu tun. Ähnliche Strömungen gab es auch in England, Frankreich und Spanien. Während sie dort zentral überwunden wurden, haben sie in Deutschland und Italien die staatliche Einung auf lange verhindert. Das Vasallenrecht des mitteleuropäischen Feudalismus verselbständigte sich dabei zu einer zersplitterten Adelsherrschaft. Demgegenüber führte das Lehnssystem Westeuropas mit dem König als Oberlehnsherrn im Ergebnis zum monarchischen Einheitsstaat.
Nachdem sich spätestens seit dem 12. Jahrhundert die Erblichkeit der Amtslehen durchgesetzt hatte, ergaben sich neue Probleme im Machtgefüge der feudalen Staatlichkeit. Nunmehr waren Interessenkollisionen zwischen Amtspflicht und Lehnstreue einerseits und familiärem Eigennutz gleichsam vorprogrammiert. Besonders den großen Vasallen gegenüber konnte der König seine lehnsherrlichen Rechte politisch nicht immer voll durchsetzen. Eine Schwächung seiner Position ergab sich sodann aus dem Institut des Leihezwangs. Danach hatte der König heimgefallene (erbenlose oder verwirkte) Lehen binnen bestimmter Frist wieder auszuleihen. Auch war er politisch zu schwach, der sog. Doppelvasallität, die seit dem 9. Jahrhundert in Erscheinung trat, mit Erfolg entgegenzutreten. Dies hatte zur Lehnshulde einzelner deutscher Fürsten gegenüber ausländischen, namentlich französischen Königen geführt.
3. Kaisertum und Papsttum
„Kaiser“ als oberster weltlicher Herrschertitel geht zurück auf den Beinamen „Caesar“, den die Inhaber höchster Staatsgewalt im römischen Reich der Antike führten. Jenes Kaisertum hieß Prinzipat, nachdem sein Begründer Augustus die Herrschaft als princeps civium, als Erster der Bürger übernommen hatte (27 v. Chr.). Im Unterschied zu Caesar (100–44 v. Chr.) verzichtete er auf eine absolutistische Herrschaftsform, was auch seine Nachfolger zunächst so hielten. Doch nach und nach wurden die kaiserlichen Rechte stark erweitert, die Kompetenzen des Senats entscheidend reduziert. Infolgedessen hatte sich das Dominat mit einem unbeschränkten Alleinherrscher (dominus) in der Verfassungswirklichkeit schon nachhaltig durchgesetzt, als es von Kaiser Diokletian (284–305) auch formell eingeführt wurde. Aus freien Bürgern waren fortan Untertanen (subiecti) geworden.
Karl der Große, Carolus Magnus (747–814), König der Franken, hat die mittelalterliche Kaiserwürde bis zu einem gewissen Grade mit der altrömischen Tradition verknüpft, was im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae) seine Fortsetzung fand. Dies war der letztgültige Name des ersten Deutschen Reiches (911–1806). Es hatte sich zunächst Romanum Imperium, dann Sacrum Imperium, später Sacrum Romanum Imperium genannt. Mit der Bezeichnung „Sacrum Imperium“ betonte es seine sakrale Würde auch gegenüber der Kirche; der Zusatz „Deutscher Nation“ erinnerte nicht zuletzt an den deutschen Anspruch auf das römische Kaisertum. Der vollständige Kaisertitel wandelte sich von „Serenissimus Augustus, magnus imperator“ zu „von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches“. Seit der Erneuerung des Kaisertums durch Otto I. (936–973) besaß der deutsche König die feste Anwartschaft auf die römische Kaiserwürde und Krönung durch den Papst. Die rechtlichen Kompetenzen des Königs veränderten sich durch den Kaiserstatus kaum, doch verlieh er ihm einen Höchstrang an weltlicher Hoheit (dignitas).
Die innere Reichspolitik der deutschen Könige verfolgte naturgemäß das Ziel, die gesamtstaatliche Einung der Stämme zu vertiefen und einem Auseinanderbrechen des Reiches in selbständige Stammesherrschaften zu wehren. Der Erfolg dieses Kurses hing ab von der jeweiligen Stärke der Zentralgewalt. So war es etwa den im 8. Jahrhundert innerpolitisch überwundenen Stammesherzogtümern zeitweise gelungen, einen hohen Grad von Eigenständigkeit zurückzugewinnen. Indessen verstand es Konrad I. (911–918), durch eine Koalition mit der Kirche die Reichseinheit gegenüber der Herzogsgewalt wiederherzustellen.
Die gegen zentrifugale Tendenzen weltlicher Großer betriebene Reichspolitik gewann unter Otto I. einen besonderen Elan. Grundlegend wichtig wurde dabei die Übertragung weltlicher Hoheitsrechte auf die vom König installierten Bischöfe. Diese repräsentierten eine Art nationaler Reichskirche und fundierten die Stellung des Königs wirksam gegenüber den weltlichen Fürsten im Reich. Andererseits wurde die Macht der Bischöfe sowohl durch die Reichsklöster als auch – seit der Kaiserkrönung – durch das Papsttum politisch balanciert.
Indessen gelang es weder Otto I. noch seinen Nachfolgern, das Ziel einer Vorherrschaft gegenüber dem Papsttum zu erreichen. Zwar hatte jener die dauernde Verbindung des Reiches mit Italien bewirkt, sich 962 in Rom zum Kaiser krönen lassen, die karolingischen Schenkungen an die römische Kirche bestätigt und die dauernde Verbindung von deutschem Königtum und römischem Kaisertum ins Werk gesetzt. Doch als mit Ottos III. Tod (1002) die Politik einer Erneuerung des Reiches (Renovatio imperii Romanorum) – anknüpfend an altrömische, karolingische und ottonische Traditionen – ihr Ende fand, wurde der Gegensatz zwischen Papsttum und Kaisertum weithin evident.
Dieser Antagonismus war unausweichlich geworden, nachdem das Papsttum mit Nachdruck begonnen hatte, die Entweltlichung der Kirche als Reformziel zu verfolgen, während doch die politische Macht des Kaisertums nicht zuletzt auf der weltlichen Abhängigkeit der geistlichen Fürsten beruhte. Der Konflikt spitzte sich zu durch den Dictatus Papae Gregors VII. (1073–1085), der das Prinzip der Unterordnung desweltlichen Herrschers unter den Papst vertrat und die Besetzung kirchlicher Ämter durch Laien, die sog. Laieninvestitur, verbot. Zwar wurde dieser Papst durch König Heinrich IV., den er zuvor gebannt hatte, für abgesetzt erklärt (1080) und aus seiner Einschließung in der Engelsburg von Normannen befreit. Doch unbeschadet dieser äußeren Niederlage entwickelten sich die Reformgedanken Gregors VII. zu Leitlinien der folgenden Zeit und sie führten das Papsttum auf die Höhe seiner mittelalterlichen Macht.
Mit dem päpstlichen Verbot der Laieninvestitur kam es zum offenen Ausbruch des Investiturstreites, der fast ein halbes Jahrhundert andauerte. Er führte im Wormser Konkordat (1122) zu einem für die römische Kirche ziemlich günstigen Kompromiss. Danach verzichtete der Kaiser auf die Investitur der Bischöfe und Reichsäbte mit Ring und Stab und er konzedierte freie kanonische Wahl und Weihe. Andererseits erlaubte der Papst dem Kaiser bei den geistlichen Wahlen anwesend zu sein (praesentia regis), bei fragwürdigen Wahlen zu vermitteln sowie in Deutschland und Reichsitalien binnen bestimmter Frist die Regalieninvestitur des Geweihten mit dem weltlichen Symbol des Zepters zu vollziehen und die Lehnshuldigung entgegenzunehmen. Für den Kirchenstaat galt das Wormser Konkordat nicht. Es bedeutete das Ende des ottonisch-salischen Reichskirchensystems.
Zwar wurde der Investiturstreit im Wesentlichen so beigelegt, dass die Verleihung des geistlichen Amtes (Spiritualia) der Kirche vorbehalten war, während dem König die Übertragung der weltlichen Herrschaft (Temporalia) zustand. Doch der Gegensatz zwischen Kaisertum und Papsttum blieb bestehen. Indessen hatte das nach zähem Ringen zustande gekommene Wormser Konkordat, wie sich später zeigen sollte, die Weichen für eine freiheitliche Entwicklung in doppeltem Sinne gestellt: Für die Freiheit des weltlichen Regiments von päpstlicher Oberhoheit und für die Freiheit der Kirche von weltlicher Macht.
Vorerst jedoch war die Position des Papstes zumindest äußerlich gestärkt und die kaiserliche Macht erschien geschwächt. Als zum Beispiel Friedrich II. (1212–1250) die Wahl seines Sohnes zum deutschen König durchsetzen wollte, sah er sich genötigt, das Einvernehmen der geistlichen Fürsten durch Übertragung bedeutender weltlicher Hoheitsrechte zu erkaufen. Das einschlägige Bündnis mit den Kirchenfürsten, die „Confoederatio cum principibus ecclesiasticis“ (1220), wurde in der Folge zu einem Grundstein für die Aufrichtung des fürstlichen Territorialstaats. Wenige Jahre danach erging das „Statutum in favorem principum“ (1232), ein Reichsgesetz zugunsten der weltlichen und geistlichen Fürsten. Diese wurden hier erstmals als Landesherren (domini terrae) bezeichnet. Als Träger der Landesherrlichkeit entwickelten sie sich seit dem späten Mittelalter zu Inhabern einer umfassenden Herrschaftsmacht über ein umgrenztes Gebiet.
Das mittelalterliche Verhältnis von Kirche und Staat war weithin in ständiger Bewegung. Nach und nach hatte sich die frühmittelalterliche Idee eines von Papst und Kaiser gemeinsam regierten christlichen Universalreiches so gut wie verflüchtigt. Statt dessen gab es, offen oder verdeckt, ein dauerndes zähes Ringen zwischen der weltlichen und der geistlichen Macht, zwischen dem imperium und dem sacerdotium. Mochte auch der Herrscher als Kirchenmitglied dem Papst persönlich botmäßig sein, so strebte er doch als König nach Vorherrschaft über den Reichsepiskopat und das Reichskirchengut. Als oberster Repräsentant weltlicher Herrschaft verwahrte sich der Kaiser gegen den Vorrang der geistlichen Gewalt vor dem Staat.
Die Politik der päpstlichen Kurie beruhte maßgeblich auf der scholastischen Theorie des principium unitatis, des Gedankens herrschaftlicher Einheit. Ihr Ziel war die Souveränität des sacerdotium im Sinne einer Oberhoheit der Kirche über den Staat. Die einschlägige Zwei-Schwerter-Lehre fand ihren klassischen Ausdruck in der Bulle Unam sanctam von Bonifatius VIII. (1302). Danach hat Gott beide Schwerter (Gewalten) dem Petrus gegeben. Das geistliche Schwert behält der Papst für sich, das weltliche leiht er dem Kaiser, der es im Dienst der Kirche und nach ihrer Weisung zu führen hat. Hiergegen streitet die kaiserliche Position, derzufolge jedes der beiden Schwerter von Gott unmittelbar an den Papst oder den Kaiser verliehen ist. Beide Gewalten sind somit auf ihrem Gebiet selbständig, unabhängig, souverän.
II. Verfassungsentwicklungen im Heiligen Römischen Reich
Unter dem Kaisertum Karls d. Gr. hieß das Reich „Romanum Imperium“. Bei dieser Bezeichnung blieb es auch in ottonischer Zeit. Die Erweiterung des Reichstitels um das Wort „Sacrum“ begegnet uns erstmals 1157 unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Die deutsche Wendung „Heiliges Römisches Reich“ erscheint in urkundlicher Form kaum vor . (1347–1378). Der Zusatz „Deutscher Nation“ mit seinen oben angedeuteten Implikationen wird seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zunehmend gebräuchlich; ein Gesetz von 1486 verwendet ihn ganz offiziell. Dieses „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ erlosch im Jahre 1806mit der Niederlegung der Kaiserkrone durch den Habsburger .
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!