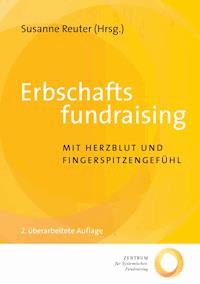
Erbschaftsfundraising E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Susanne Reuter legt als Herausgeberin und Hauptautorin ein ungewöhnliches Handbuch zu einem komplexen Thema vor. Sie untersucht und beschreibt die Ziele, die Methoden und die Praxis des Erbschaftsfundraisings aus systemischer Sicht. Die Struktur des Buches orientiert sich an diesem umfassenden Ansatz. Es werden keine einfachen Rezepte gegeben, sondern kluge Analysen der einzelnen Schritte zu einer Verankerung und Optimierung der Fundraisingpraxis im Ganzen der Non-Profit-Organisationen. „Wer mehr als zwanzig Jahre im Fundraising aktiv ist, mit offenen Augen durch die Szene läuft, sich um Weiterbildung bemüht und sowohl die Organisations- als auch die Beraterperspektive kennt, der rechnet nicht mehr mit großen Überraschungen. Umso erstaunter darf man über die Begegnung mit Susanne Reuter und ihrem Ansatz des Systemischen Fundraising sein. Die Perspektiverweiterung durch den systemischen Ansatz zählt für mich zum Wichtigsten, was mir seit meiner Ausbildung an der Fundraising-Akademie Anfang der 2000er Jahre begegnet ist. Es ist müßig zu spekulieren, warum sich die deutsche Fundraisingszene dem systemischen Ansatz bisher nur zögerlich nähert. Aber dies mag erklären, warum Susanne Reuter die erste Grundlegung ihres Ansatzes gleichsam „undercover“ in einem Buch zu einem speziellen Fundraising-Instrument versteckt hat. Doch das Systemische Fundraising verdient jede Aufmerksamkeit, denn – schlicht und ergreifend – es wirkt!“ Jochen Schiel Susanne Reuter geht davon aus, dass Fundraising nicht nur die Techniken, die Ablauforganisation oder standardisierte Kommunikationsformen einbeziehen darf, sondern bei allen Beteiligten einen Perspektivwechsel erfordert. Im Zentrum stehen die Persönlichkeit aller Beteiligten, ihre innere Haltung und ihre Einstellungen, die den Erfolg des Erbschaftsfundraisings maßgeblich beeinflussen. Wie muss die eigene Organisation beschaffen sein, um erfolgreich Fundraising betreiben zu können? Welche Visionen, Leitbilder und Werte spiele eine Rolle? Wer trägt innerhalb der Organisation diese Leitbilder und treibt ihre Verankerung voran? Entlang dieser Fragen entwickelt Susanne Reuter ihren systemischen, ganzheitlichen Ansatz. Co-Autoren und Praktiker steuern juristisches und organisatorisches Wissen bei. Mit Beiträgen von: Dr. Helmut Blanke, Paul Dalby, Klaus Heil, Dr. Bertold Höcker, Rechtsanwalt Marcus Kreutz, Prof. Dr. Wolfgang Nethöfel, Dr. Martin Thomé
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Geleitwort (
Jochen Schiel, Leiter Inhouse-Fortbildungen im Zentrum für Systemisches Fundraising
)
Vorwort der Herausgeberin (
Susanne Reuter
)
Kommentar aus der Fundraisingpraxis: »Erbschaftsfundraising braucht Wissen und Reflexion« (
Melanie Stöhr
, Greenpeace Deutschland)
1. Orientierung: Worum geht es?
(Susanne Reuter)
1.1 Was heißt Fundraising?
1.2 Was ist Erbschaftsfundraising?
1.3 Theologie des Ebschaftsfundraisings
(Bertold Höcker)
1.4 Die ethische Dimension des Erbschaftsfundraisings
(Martin Thomé)
1.5 Der gesetzliche Rahmen des Erbschaftsfundraisings
(Marcus Kreutz)
1.6 Kommentar aus der Fundraisingpraxis: »Erbschaftsfundraising ist eine echte Herausforderung!«
(Judith Albert
, Fundraiserin)
2. Ein etwas anderer Blick: Auf das Eigene schauen
(Susanne Reuter)
2.1 Systemisches Denken und sein Bezug zum Thema
2.2 (Erbschafts-)Fundraising bewirkt Veränderung
2.3 Der Blick auf die eigene Organisation
2.4 Am Anfang steht die Überzeugungsarbeit
2.5 Exkurs: Authentizität und Persönlichkeit – Glaubwürdigkeit erwerben oder verlieren
(Klaus Heil)
2.6 Kommentar aus der Fundraisingpraxis: »Beteiligung als Schlüssel für den internen Erfolg«
(Matthias Renner
, ASB)
3. Der strategische Blick: Langfristig und systematisch planen
(Susanne Reuter)
3.1 Vision, Leitbild und Werte: Wer sind wir?
3.2 Ist-Analyse: Wovon können wir ausgehen?
3.3 Ziele: Was wollen wir erreichen?
3.4 Strategieplanung: Wie erreichen wir unsere Ziele?
3.5 Kommentar aus der Fundraisingpraxis: »Auf den langen Atem kommt es an«
(Rheinhold Lapp-Scheben
, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)
4. Der Blick nach außen: Mit den Augen der anderen schauen
(Susanne Reuter)
4.1 Profil und Anliegen: Wie werden wir gesehen?
4.2 Zielgruppen: Wer interessiert sich für unsere Anliegen?
4.3 Zielpersonen: Wie identifizieren wir potenzielle Erblasser?
4.4 Methoden und Maßnahmen: Welche Wege führen zum Kontakt?
4.5 Kontaktpflege: Wie gestalten wir die Beziehung sensibel und nachhaltig?
4.6 Exkurs: Zwischen den Stühlen – Seelsorge und Erbschaftsfundraising
(Paul Dalby)
4.7 Exkurs: Dank im neuen Testament
(Helmut Blanke)
4.8 Kommentar aus der Fundraisingpraxis: »Förderer wünschen sich gute Nachrichten«
(Günter A. Menne
, Ev. Kirchenverband Köln und Region)
5. Der Blick in die Zukunft: Lernen und Optimieren
(Susanne Reuter)
5.1 Auf dem Weg: Meilensteine planen
5.2 Das Ziel vor Augen: Evaluieren und Erfolg überprüfen
5.3 Suchen und Finden: Wissen und Erfahrung nachhaltig sichern
5.4 Kommentar aus der Praxis: »Es war einmal ein Jubiläum. Vom möglichen Anfang einer langen Geschichte«
(Wolfgang Nethöfel
, Philipps-Universität Marburg)
6. Ausblick: Wohin führt uns die Reise?
(Susanne Reuter)
6.1 »Erfolg ist eine Reise, kein Ziel«
6.2 Dann leben sie noch heute Eine kleine Geschichte vom großen Erbe
(Wolfgang Nethöfel)
Literatur
Autoren
Geleitwort zur 2. Auflage
Wer mehr als zwanzig Jahre im Fundraising aktiv ist, mit offenen Augen durch die Szene läuft, sich um Weiterbildung bemüht und sowohl die Organisations- als auch die Beraterperspektive kennt, der rechnet nicht mehr mit großen Überraschungen. Wenn, dann vermutet man Innovationen im Fundraising noch am ehesten im Bereich „online“ und „Social Media“ – denn dort liege, so tönt es schon seit vielen, vielen Jahren, schließlich die Zukunft des Fundraising.
Umso erstaunter – oder treffender gesagt: beglückter – bin ich über die Begegnung mit Susanne Reuter und ihrem Ansatz des Systemischen Fundraising. Nun verbietet sich der Begriff der „Offenbarung“, wenn man wie die Herausgeberin dieses Bandes viel in kirchlichen Kontexten unterwegs ist. Und doch zählt die Perspektiverweiterung durch den systemischen Ansatz für mich zum Wichtigsten, was mir seit meiner Ausbildung an der Fundraising-Akademie Anfang der 2000er Jahre begegnet ist. Dieses Buch ist kein Scheck auf die Fundraising-Zukunft, es wirkt im Hier und Jetzt!
Gutes Fundraising-Handwerk ist und bleibt wichtig. Doch ehrlicherweise müssen wir uns eingestehen, dass viele Fundraisingkonzepte in der Umsetzung nicht funktionieren, obwohl sie nach allen Regeln der Handwerkkunst erdacht sind. Warum versanden so viele Beratungsprozesse?
Es menschelt in Organisationen, es geht um Macht und Einfluss, um Angst vor Veränderung, um Widerstand. Es geht um Haltungen, die nicht sein können, weil sie nicht sein dürfen. Dies alles akzeptiert – nein: erwartet Susanne Reuter als selbstverständlich, analysiert es mit gleichgewichtiger Intensität und Aufmerksamkeit, führt die notwendigen Klärungen geduldig herbei, bevor das Handwerk seine Werkzeuge ansetzt und seine Wirkung entfalten kann.
Susanne Reuters Ideal eines Systemischen Fundraising ist deshalb so etwas wie die Synthese aus Konfuzius „Wer schnell ans Ziel will, der gehe langsam“, und dem plattdeutschen „Watt mutt dat mutt“ – die Dynamiken bei der Einführung von Fundraising in eine Organisation oder bei der Einführung eines so sensiblen Instruments wie dem Erbschaftsfundraising kommen ja sowieso, unausweichlich, wie das Amen in der Kirche.
Dabei macht es einen himmelweiten Unterschied, ob man die „Institutional Readiness“ einer Organisation als wichtigen Faktor lediglich benennt, wie es das Handbuch Fundraising schon zu meiner Akademie-Zeit getan hat, oder ob man profundes Wissen, eine manchmal fast unheimliche Intuition und sehr viel Erfahrung mit den passenden Interventionen in die Waagschale werfen kann.
Es ist müßig zu spekulieren, warum sich die deutsche Fundraisingszene dem systemischen Ansatz bisher nur zögerlich nähert. Aber dies mag erklären, warum Susanne Reuter die erste Grundlegung ihres Ansatzes gleichsam „undercover“ in einem Buch zu einem speziellen Fundraising-Instrument versteckt hat. Doch das Systemische Fundraising verdient jede Aufmerksamkeit, denn – schlicht und ergreifend – es wirkt!
Münster, im April 2016
Jochen Schiel
(Leiter Inhouse-Fortbildungen im Zentrum für Systemisches Fundraising)
Jochen Schiel ist seit 2006 freiberuflich beratend tätig. Von 1996–2006 war er Geschäftsführer von Pan y Arte (spanisch: Brot und Kunst), der Hilfsorganisation von Dietmar Schönherr. Mit seinem Ausscheiden als hauptamtlicher GF wurde er in den Vorstand der 2006 gegründeten „Dietmar Schönherr und Luise Scherf Stiftung für Pan y Arte“ berufen. Jochen Schiel ist Fundraising-Manager (FA) mit Zusatzausbildung zum Qualitätsbeauftragten für das Fundraising (TQE) und zum Großspenden-Fundraiser (Major Giving Institut). Er ist Mitglied im Deutschen Fundraisingverband (DFRV), dort Mitgründer der Fachgruppe Kultur (2006) und Mitglied im Beirat des Verbandes (seit 2012). Seit 2015 leitet er die Inhouse-Fortbildungen des Zentrums für Systemisches Fundraising GmbH.
Vorwort der Herausgeberin zur 2. Auflage
Seit 2005 führen wir nun mit einem stetig wachsenden Team das Systemische Fundraising in die deutsche Fundraisinglandschaft ein. Als dieses Buch entstand, galt ich in der Fundraisingszene noch als Expertin für das Erbschaftsfundraising. Aber ich war schon längst von den Grundgedanken der systemischen Sichtweisen „infiziert“ – nicht zuletzt durch meine eigene Fortbildung zur systemischen Organisationsberaterin. So kam die Idee zustande, ein Thema als Vehikel zu nutzen, für das mir die Expertise zugeschrieben und abgekauft wurde. Fast wie nebenbei nutzte ich diese Gelegenheit, um mich auch als Expertin in systemischer Organisationsentwicklung bei der Implementierung von Fundraising einzuführen. So ist das Fachbuch unter Mithilfe eines großen Autoren- und Kollegenkreises in seiner ersten Auflage entstanden.
Was mir in der Auseinandersetzung mit dem systemischen Ansatz so einfach und auf der Hand liegend vorkam, erzeugt erst heute, spürbare Aufmerksamkeit und Neugier bei den Kolleginnen und Kollegen der Fundraisingszene. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Buch noch einmal als E-Book und Book on Demand aufzulegen. Alle Autorinnen und Autoren haben ihr Einverständnis gegeben. Der Abschnitt zum gesetzlichen Rahmen des Erbschaftsfundraisings (Kap. 1) wurde von seinem Autor aktualisiert, das Buch kann auch weiterhin als Fachbuch für Erbschaftsfundraising eine praktische Hilfe sein.
Wichtiger allerdings – und das ist der Grund dafür, dieses Buch weiterhin verfügbar zu machen – ist mir die systemische Perspektive und die darauf zugeschnittenen Vorgehensweisen, die inzwischen nicht nur erprobt sind sondern auch fassbare Erfolge in der Praxis vorweisen können. Alle, die sich in diese Gedankenwelt und die daraus resultierenden Verfahrensweisen beim Auf- und Einbau von Fundraising einlesen wollen, erhalten einen umfassenden Einblick und sicherlich so manchen, hoffentlich konstruktiv irritierenden, aber weiterführenden Impuls.
Aachen und Hamburg im April 2016
Susanne Reuter
Vorwort der Herausgeberin zur 1. Auflage
Erbschaftsfundraising berührt zwei äußerst sensible und persönliche Themen: Tod und Sterben, für viele tabu.
Seit den 90er Jahren beschäftige ich mich mit dem Erbschaftsfundraising. Seitdem haben sich die Organisationen und die Handelnden im Fundraising enorm weiterentwickelt. Die Ansprüche an die Qualität des eigenen Tuns sind gestiegen, und auch die Spenderinnen und Spender erwarten weit mehr Professionalität von Fundraisern als noch vor Jahren. Natürlich ist erfolgreiches Fundraising immer auch eine Frage der Wahl der richtigen Mittel und Strategien. Aber Stichworte wie »Institutional Readiness«, »Zukunftsfähigkeit« oder »Ethik und Werte im Fundraising« haben die Aufmerksamkeit auf tiefer liegende und komplexere Zusammenhänge gelenkt. Diese Fragestellungen und mein systemischer Ansatz haben den Charakter dieses Buches geprägt. Sein Aufbau ist – soweit es ein Fachbuch über Erbschaftsfundraising ist – sehr einfach:
Im ersten Kapitel finden Sie Orientierung und Antworten auf die Frage, worum es beim Erbschaftsfundraising eigentlich geht. Aus meiner Beratungserfahrung heraus weiß ich, dass es wesentlich ist, sich all der verschiedenen Ebenen bewusst zu werden, die dabei zum Tragen kommen.
Das zweite Kapitel betrachtet das Fundraising aus einem besonderen Blickwinkel: Hier führe ich in das systemische Denken ein und übertrage dessen erprobte Instrumente, Herangehensweisen und Erkenntnisse auf das Erbschaftsfundraising. In meinen Kursblöcken bei der Ausbildung angehender Fundraiserinnen und Fundraiser an der Fundraising Akademie ist das Thema »Systemisches Fundraising« inzwischen fester Bestandteil des Curriculums.
Weiter geht es um Strategien und langfristiges Planen. Viele Fundraiser und Fundraiserinnen wissen inzwischen, dass das Werben um Erbschaften einen langen Atem verlangt. Wie Sie es schaffen können, dass Ihnen die Kraft auf der Langstrecke nicht ausgeht und die Begeisterung in der Organisation nicht der Frustration weicht, erfahren Sie im dritten Kapitel.
Dann ist es im vierten Kapitel Zeit, den Blick nach außen zu richten – auf die potenziellen Zielgruppen. Wer könnte denn ein potenzieller Erblasser sein? Welche Aspekte spielen für die Identifikation eine Rolle? Wie erreichen wir unsere Zielpersonen und wie binden wir sie an unsere Organisation? Was müssen wir leisten, damit diese Menschen schließlich »ja« zu unserem Anliegen sagen?
Und im fünften Kapitel schauen wir mit Ihnen in die Zukunft: Wir fragen nach der Entwicklungs- und Lernfähigkeit einer Organisation. Wie lernen wir Neues (z. B. das Erbschaftsfundraising), wie sichern wir nachhaltig unser erworbenes Wissen und unsere Erfahrungen, wie gehen wir mit Erfolg und Misserfolg um? Welche Möglichkeiten haben wir, unser Handeln zu optimieren?
Den Schluss (im sechsten Kapitel) bildet ein überraschender Ausblick, der mehr ist als ein Resüme der besprochenen Planungs- und Handlungsoptionen.
In diesem Buch versuche ich Fundraising nicht einfach als ein Bündel von mehr oder weniger erfolgreichen Methoden fürs Sammeln von Spenden zu beschreiben, sondern als ein System, dessen Struktur und wesentlichen Elemente ein Ganzes bilden, eine Art Organismus, der mehr ist als die Summe seiner einzelnen Elemente. Eine solche systemische Betrachtungsweise hat natürlich umfassende Konsequenzen für die Herangehensweise ans Erbschaftsfundraising.
Das Wissen meines Buches stammt aus der Praxis. Und die »Berichte aus der Fundraisingpraxis« sind nicht »schmückendes« Beiwerk und Auflockerung, sondern notwendige Erdung. Die Erfahrung der klugen und erfahrenen Praktiker muss der Prüfstein für das Nachdenken über Fundraising sein!
Der fundierte und umfassende Beitrag von Markus Kreutz (Kapitel 1.5 Der gesetzliche Rahmen des Erbschaftsfundraisings) zu den rechtlichen Grundlagen des Erbschaftsfundraisings basiert ebenso auf einer (in der juristischen Praxis erworbenen) erfahrungsgesättigten Kenntnis wie Klaus Heils Nachdenken über Authentizität und Persönlichkeit – Glaubwürdigkeit erwerben oder verlieren (Kapitel 2.5).
Das Buch ist also auch ein nützliches Handbuch für eine systemische Praxis des Erbschaftsfundraisings. Ich will aber noch etwas mir viel Wichtigeres anstoßen: Dieses Buch soll helfen, ethisch-moralische Standards für die sehr sensible Praxis des Erbschaftsfundraisings zu definieren. Deshalb habe ich Co-Autoren gesucht, die einerseits diese Praxis gut (und aus eigenem Tun) kennen und andererseits ein profundes theologisches Wissen und analytische Schärfe mitbringen, um klare Orientierungen geben zu können.
Und so liefern die wunderbaren Beiträge von Helmut Blanke, Paul Dalby, Berthold Höcker, Wolfgang Nethöfel und Martin Thomé wichtige Bausteine für eine Theologie des Erbschaftsfundraisings:
In seinem gleichnamigen (für diesen Kontext zentralen) Beitrag (Kapitel 1.3) begründet Bertold Höcker seine These, dass Spenden ein Akt der Liebe sei, mit dem Hinweis darauf, dass mit der Spende dem dreifachen Liebesgebot Christi (Gott, das Eigene und den Anderen zu lieben) dadurch gefolgt wird, dass sie an einer gerechteren Welt mitzubauen hilft.
Martin Thomé zeigt, dass die Verantwortung für uns selbst und für die Welt durch die Spende über unseren Tod hinaus wahrgenommen wird: uns sozusagen überlebt. Die ethische Dimension des Erbschaftsfundraisings (Kapitel 1.4) entwickelt diesen Gedanken.
Paul Dalby warnt eindringlich vor der Verwischung der elementaren Unterschiede zwischen (absichtsloser) Seelsorge und (zielgerichtetem) Erbschaftsfundraising. Sein Aufsatz Zwischen den Stühlen – Seelsorge und Erbschaftsfundraising (Kapitel 4.6) artikuliert aus guten Gründen eine Skepsis gegen eine allzu glatte ethische Überhöhung des Erbschaftsfundraisings.
Helmut Blanke schließt seine Untersuchung über den Dank im Neuen Testament (Kapitel 4.7) mit drei Fragen ab: 1.) »Feiert eine Gemeinde Gott oder ihre Gönner?« 2.) »Wie kommt im Umgang mit Gönnern das Anliegen des Evangeliums zum Ausdruck, dass die ersten Adressaten der frohen Botschaft ›die Armen‹ dieser Welt sind, denen besondere Ehre zu geben ist?« 3) Entwickelt sich eine finanzielle und moralische Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gönnern?
In seinem literarisch-philosophischen Essay Dann leben sie noch heute. Eine kleine Geschichte vom großen Erbe (Kapitel 6.2) entfaltet Wolfgang Nethöfel das Panorama einer Landschaft, durch die wir seit Anbeginn suchend uns bewegen. Wir sind Erben der Früchte der Arbeit und der gebündelten Erfahrungen vieler Generationen. Aber was ist das für ein Erbe? Die Großen Erzählungen sind zu Ende erzählt. Sie werden uns nicht erlösen. Aber was dann? Dann beginnt (vielleicht) eine neue Geschichte…
Dieses Buch spricht Herz und Kopf an, ermuntert dazu, den Dingen auf den Grund zu gehen, sich seiner eigenen Gedanken und Vorstellungen, Bilder und Meinungen und insbesondere seiner inneren Haltung bewusst zu werden. Den Blick auch auf die Kollegen und Kolleginnen in der Organisation zu richten, um zu verstehen, welche Einstellungen und Gedanken sie bewegen (oder eben nicht). Aber auch auf die Anliegen und Bedürfnisse der potenziellen Förderer zu schauen, sie als Menschen wahrzunehmen, als komplexe Wesen mit sinnvollen Zielen, statt einer zu öffnenden Geldbörse.
Das Buch zeigt zudem Wege auf, die Dynamik und Prozesse in der eigenen Organisation verstehen zu lernen; Widerstände oder Blockaden, Unterstützung und Gleichgesinnte zu erkennen und mit beidem – mit Hemmendem wie Förderlichem – konstruktiv umzugehen. Wer die Zusammenhänge erkennt, die den Erfolg oder Misserfolg beeinflussen, und sie in seine Strategien und Maßnahmen integrieren kann, statt gegen sie zu agieren, der wird erfolgreich sein.
Lassen Sie sich neugierig machen auf neue Herangehensweisen, ungewöhnliche Blickwinkel und überraschende Erkenntnisse.
Aachen im Mai 2007
Susanne Reuter
Kommentar aus der Fundraisingpraxis:
»Erbschaftsfundraising braucht Wissen und Reflexion«
Melanie Stöhr, Fundraiserin, Greenpeace e. V.
»Als die Herausgeberin mich bat, einen Beitrag zu diesem Buch zu leisten, dachte ich: ›Interessant, ein Buch zum Thema Erbschaftsfundraising zu schreiben.‹ Ein Novum – in dieser Form gibt es so etwas nicht am Markt. Man findet Abhandlungen über Techniken und Fundraising-Instrumente, aber die Ausführlichkeit, mit der hier die ethische, emotionale, gar philosophische Dimension des ›Testamentsspendens‹ betrachtet wird, ist einmalig. – Und dringend notwendig!
Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, schon den Start eines Erbschaftsprogramms in der Organisation gut vorzubereiten. Deshalb ist es mir ein Anliegen, Ihnen hier einige meiner Erfahrungen weiterzugeben: Die Berührungsängste mit dem Thema Tod sind mehr oder weniger in jedem Ihrer Mitarbeiter vorhanden. Holen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen dort ab, wo sie stehen. Schaffen Sie Transparenz, indem Sie Ihre Ideen vorstellen, diskutieren Sie, in welcher Form ein Erbschafsprogramm zu Ihnen passt, bzw. was nötig ist, um es glaubhaft für Ihre Organisation zu machen. Halten Sie Ihre Kolleginnen über die Entwicklung und natürlich besonders über die Erfolge auf dem Laufenden. Es ist ganz wichtig, dass alle akzeptieren oder besser noch, es selbst wichtig finden, dass die Organisation auch Erbschaften annimmt und dafür Fundraising betreibt.
Prüfen Sie die ›Institutional Readiness‹ Ihrer Organisation kritisch: Wer kann die juristische Beratung machen? Wer ist der richtige Fundraiser, die richtige Fundraiserin, die den engen menschlichen Kontakt mit den Ratsuchenden pflegt? Ist Ihre Organisation überhaupt in der Lage, professionell eine Erbschaft abzuwickeln? Die nötigen Kontakte zu Behörden zu pflegen, die Wohnung aufzulösen oder das Haus zu verkaufen, mögliche Haustiere in gute Hände zu vermitteln, Vermächtnisse zu erfüllen, Grabpflege zu organisieren usw.
Die Definition von Erfolg ist in einem solchen Programm vielschichtig. Einnahmensteigerung ist natürlich das Hauptziel. Aber es dauert mindestens fünf Jahre, bis Sie ein signifikantes Einnahmeplus verzeichnen werden. Realistischer sind zehn Jahre. Definieren Sie realistische Zwischenziele. Das könnten zum Beispiel eine bestimmte Anzahl verteilter Broschüren sein oder persönliche Gespräche und Beratungen, natürlich vor allem konkrete zukünftige Testamentsspenden, also das Versprechen, Ihre Organisation im Testament zu bedenken. Sie haben die Chance, mit Ihrem Programm viele Ihrer Spenderinnen gut zu beraten und zufriedenzustellen. Es gibt kaum ein besseres Mittel, Ihre Unterstützer an sich zu binden. Erkennen Sie die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Ihr Gegenüber hat, und werden Sie ihnen gerecht.
Um diese Bedürfnisse besser kennenzulernen, empfiehlt es sich, Vertreter der Generation 50 + beratend zur Konzeptentwicklung dazuzuholen. Testen Sie neue Broschüren mit einer Focus-Gruppe. So erfahren Sie, ob die Texte verstanden werden, die Lesbarkeit gewährleistet ist und vor allem, ob das Layout und die Ansprache Ihre Botschaft mitten ins Herz der Leserinnen und Leser transportiert. Diese Tipps aus meinen Erfahrungen und meiner Fundraisingpraxis möchte ich Ihnen ans Herz legen. Und Ihnen Mut machen, denn das Handwerk zu erlernen ist für jeden möglich.
Aber eigentlich geht es mir um mehr: Als ich den Auftrag bekam, das Erbschaftsfundraising bei Greenpeace aufzubauen, wurde ich sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Ich wusste damals noch nicht viel darüber, wie man das am besten angeht. Was aber viel schwerer wog und wiegt, ist die Auseinandersetzung mit den Menschen, ihrer Persönlichkeit, ihren Geschichten und ihren Wünschen. Und damit kam ich zugleich auch in die Auseinandersetzung mit mir selbst und mit dem, wofür meine Organisation steht.
Deshalb finde ich Reflexion so wichtig. Wissen ist das eine, eine gestandene Persönlichkeit zu sein oder zu werden, die eine authentische Beziehung zu den (potenziellen) Erblasserinnen und Erblassern pflegt, ist etwas ganz anderes. Ich bin deshalb froh, dass nun ein Buch vorliegt, das beides vermitteln will: das Wissen zum Handwerk und Gedankenanstöße für die Reflexion. Erst wenn wir als Fundraiserinnen und Fundraiser bereit sind, beides zu beherzigen, werden wir erfolgreich sein.«
Melanie Stöhr, Jahrgang 1959, ist geschäftsführender Vorstand der 1999 errichteten Umweltstiftung Greenpeace. Als hauptamtliche Fundraiserin ist sie bei Greenpeace e. V. verantwortlich für den Bereich Großspenden und Erbschaftsfundraising. Melanie Stöhr ist Dozentin und Studiengangsleiterin an der Fundraising Akademie und Referentin bei Fachveranstaltungen, wie z. B. beim Deutschen Fundraising Kongress und der Deutschen Stiftungsakademie. Sie ist Autorin von diversen Artikeln und Buchbeiträgen.
Orientierung:
Worum geht es?
Kapitel 1
1. Orientierung: Worum geht es?
Susanne Reuter
1.1 Was heißt Fundraising?
Fundraising wird verstanden als die umfassende Mittelbeschaffung einer Organisation (Finanz- und Sachmittel, Rechte und Informationen, Arbeits-, Zeit- und Dienstleistungen, Kontakte, Beziehungen), wobei der Schwerpunkt meist auf der Einwerbung finanzieller Mittel liegt. Deshalb wird der Begriff häufig mit »Spendenwerbung« übersetzt.
Gemeint ist jedoch mehr: Das Wort stammt aus dem Englischen und ist zusammengesetzt aus »to raise« und »funds«. Das heißt im übertragenen Sinne »Quellen erschließen«, aber das englische Verb hat vielfältige Bedeutungen wie z. B. etwas heben, lüften, hervorrufen, erwecken, auf- oder großziehen, erhöhen, steigern oder beschaffen. Sie alle umschreiben sehr anschaulich, was die Aufgabe von Fundraiserinnen und Fundraisern ist.
Fundraising ist Kommunikation – ganz im Sinne des altbekannten Mottos: Tue Gutes und rede darüber. Ohne fundierte Öffentlichkeitsarbeit, ohne strategische Kommunikation nach außen und nach innen führen auch die ambitioniertesten Bemühungen nicht zum Erfolg. Dabei bedeutet der Begriff »Kommunikation« mehr als die Herausgabe gut gestalteter Faltblätter, Broschüren oder Mailings.
1.2 Was ist Erbschaftsfundraising?
Das Erbschaftsfundraising gilt als »Königsdisziplin« des Fundraising, denn nach dem Modell der Spender-Pyramide stehen Erblasser und Stifter ganz oben an ihrer Spitze – sie »krönen« die Bemühungen der Fundraiser um Spendergunst, Vertrauen und Bindung. Kontaktpflege, Kommunikation und Betreuung dieser besonderen Zielgruppe erfordert große Aufmerksamkeit, Sensibilität und Intensität. Schließlich geht es beim Erbschaftsfundraising darum, potenzielle Förderer um Vermächtnisse (Legate), Erbschaften, (Zu-)Stiftungen und sonstige Zuwendungen zu Lebzeiten und von Todes wegen zu bitten. Oft werden Erbschafts- und Stiftungsfundraising in einem Atemzug genannt, weil sie sehr ähnliche Ziele und Verfahrensweisen verfolgen.
Hintergrund dieser Fundraisingdisziplin ist die aktuelle Entwicklung auf dem »Erbschaftsmarkt« in Deutschland: Es werden immer höhere Vermögensvolumina hinterlassen, und dieser Trend hält schon seit Jahren an. Im ersten Jahrzehnt werden vermutlich zwei Billionen (2 000 000 000 000!) Euro vererbt, bis 2015 nochmals 1,47 Billionen Euro. Neu hinzugekommen sind Veränderungen bei der Besteuerung des Erbes. Da gemeinnützige Organisationen jedoch von der Erbschaftssteuer befreit sind, eröffnen sich in diesem Zusammenhang neue strategische Spielräume.
Viele gemeinnützige Einrichtungen und Verbände haben schon frühzeitig reagiert und zum Beispiel eigene Stiftungen gegründet. Beinahe jeder Spender hat inzwischen eine der Hochglanzbroschüren in Händen gehalten oder die Freianzeigen und Faltblätter zum Thema »Erben und Vererben« gesehen. Aber die Fundraiser haben inzwischen erkannt, dass sich allein mit perfekt gestalteten Printmedien noch keine Zustifter oder Erbschaften gewinnen lassen. Und: Es gibt keine Patentrezepte für das Einwerben von Erbschaften oder Zustiftungen.
Was Erfolg bringt, ist die persönliche Kontaktaufnahme und die Pflege der Kontakte zu den Menschen, die sich möglicherweise als Erblasser oder Zustifter engagieren könnten. Dazu gehört, sich auf diese Menschen ganz einzulassen. Auch auf die Themen oder Anliegen, die damit verbunden sind: Sich als Fundraiser selbst mit Tod, Sterben, Trauer und der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Zu erkennen, dass diese Aspekte bei den meisten Menschen viele Fragen hervorrufen. Zu wissen, welche Fragen beantwortet werden können und welche vielleicht immer offen bleiben. Sich seiner persönlichen Werte bewusst zu sein, aber auch der Wertehaltung der eigenen Organisation, für deren Anliegen geworben wird. Den ethischen, moralischen und theologischen Rahmen zu kennen, innerhalb dessen sich das eigene Bemühen und die entstehenden Beziehungen bewegen. Erbschaftsfundraising ist also mehr als das Anwenden von Methoden und Instrumenten für das Einwerben finanzieller Unterstützung.
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gerät die eigene Organisation stark in Bewegung, wenn verantwortliche Personen für diese Form des Fundraising gesucht, überzeugt und gewonnen werden sollen. Das Thema »Erbschaften und Zustiftungen« berührt Tabuthemen, was zunächst Befürchtungen und Skepsis hervorruft (Stichwort »Erbschleicherei«). Für viele Mitarbeitende bilden diese Themen einen Kontrast zum »eigentlichen« Anliegen der Organisation, weshalb sie das Erbschafts- und Stiftungsfundraising nicht selbstverständlich unterstützen oder gar aktiv betreiben.
Was bedeutet dies für das Erbschafts- und Stiftungsfundraising? Wer erfolgreich Erbschaften oder Zustiftungen für seine Organisation einwerben will, sollte den Blick nicht nur nach außen richten – auf die potenziellen Erblasser, Spenderinnen und Stifter –, sondern auch nach innen, auf sich selbst und auf die potenziellen Unterstützer innerhalb des eigenen Umfeldes. Ziele, Strategien und notwendige Maßnahmen müssen klar formuliert und intern ausreichend kommuniziert werden und somit für alle Beteiligten verstehbar sind. Erst wenn die internen Hemmnisse und Stolpersteine erkannt und gebannt worden sind, wenn Rahmenbedingungen und Wege geklärt sind, kann die Organisation Kontakte zu potenziellen Erblassern und Stiftern knüpfen.
1.3 Theologie des Erbschaftsfundraisings
Bertold Höcker
»Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk.« (2. Kor. 9, 8)
> Theologische Sensibilisierung
Ist mit dem Tod alles aus? Wer immer sich mit Stiftungen und Erbschaften beschäftigt, wird sich diese Frage stellen müssen, denn die Beantwortung dieser Frage entscheidet in der Regel über die Bereitschaft, Vermögen oder Teile davon abzugeben.
Handlungen gemeinnütziger Organisationen und Stiftender sowie die Beschaffung von Unterstützungsleistungen (Fundraising) beruhen auf Werteentscheidungen, denen eine bestimmte Deutung von Wirklichkeit zugrunde liegt. Diese Deutung bestimmt bewusst oder unbewusst alle Handlungen von Stiftenden und Fundraisern. Hinzu tritt eine die eigene Endlichkeit überschreitende Dimension der Beziehung zu Gott und den Menschen, die in jeder Erbschaft eine Rolle spielt.
Es lohnt sich daher, sich der Deutung von Wirklichkeit zu vergewissern, die die Dimensionen Gott, Mensch und Sinn reflektiert und daraus Entscheidungen ableitet, weil diese Deutungen für Erbschaftsfundraising relevant sind. Eine Theologie des Fundraisings beschäftigt sich mit den Grundlagen christlicher Welt- und Lebensdeutung sowie den in unserem Kontext notwendigen biblischen Voraussetzungen. Von diesen leitet sie Maximen theologisch verantworteten Fundraisings ab. Damit zielt sie auf eine konstruktive Sensibilisierung aller in diesem Bereich Handelnden.
> Es gibt keine Sicherheit
Grundsatz theologischer Wirklichkeitsdeutung ist die Erkenntnis, dass es auf Erden keine Sicherheit gibt.1 Alle Planungen und Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt, dass sie sich in der Zukunft als falsch, ihr Ziel verfehlend oder als vergeblich herausstellen können. Sie können auch gelingen. Aber niemand kann sicher wissen, welche Auswirkungen seine Entscheidungen in der Zukunft haben werden. Bereits der reiche Kornbauer, der seine Ernte endlich nach bester Planung auch genießen möchte, wird als Narr bezeichnet, da das Bewusstsein der Endlichkeit seines Daseins sein Leben nicht prägt und alle seine Bemühungen in Hinsicht auf seine Zukunft nur fruchtlos waren.2 Allerdings kennt die Bibel auch das Gegenteil: »Der Reiche arbeitet und kommt dabei zu Geld, und wenn er ausruht, kann er´s auch genießen.«3 So kann an diesem Beispiel bereits verdeutlicht werden, dass der Grundsatz, dass es keine Sicherheit gibt, auch auf biblische Aussagen zutrifft. Sowohl den Reichtum länger zu genießen als auch diesen Genuss nur als Moment des Glücks zur Verfügung zu haben, sind erfahrungsgesättigte biblische Erkenntnisse.
Aus der Bibel ist keine »Theologie des Reichtums« ableitbar. Alles steht unter Vorbehalt der Endlichkeit menschlicher Existenz und Erkenntnismöglichkeit. Ich kann nicht sicher wissen, ob mein Wille so umgesetzt wird, wie ich möchte. Ich kann nicht sicher wissen, ob der gute Zweck, für den ich etwas bestimmt habe, auch gut ist. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Das klingt zunächst trivial, deutet jedoch eine Dimension an, die bei Entscheidungen über die Verwendung von Vermächtnissen integriert werden muss.
> Jedes Handeln ist eine Entscheidung
Ich muss entscheiden, was mit meinem Vermögen geschieht, denn ich kann nicht nicht entscheiden. Jede Entscheidung aber kann meinem ganzen Willen letztlich entgegenarbeiten. Jede Entscheidung kann auch genau die Konsequenzen haben, die ich mir wünsche. Dieses so gut wie möglich abzusichern, ohne die Begrenztheit dieser Absicherung zu verneinen, ist Kriterium seriösen Erbschaftsfundraisings. Hier gilt es für alle Stiftenden und Fundraiser mit der einzigen Sicherheit umzugehen, die es gibt, nämlich der, dass es aus theologischer Sicht keine gibt.
Es bleibt immer ambivalent: Meine Entscheidung kann von seriösen Vertretenden auch nach dem Tode respektiert und ausgeführt werden oder mit Ränken und Rankünen anderen Absichten unterworfen werden. Für diese Ambivalenz alle Beteiligten zu sensibilisieren, nimmt die Bemühungen ernst, diese Grundkonstante aller menschlichen Handlungen in allen Überlegungen zu berücksichtigen und mit Versprechen überaus vorsichtig zu sein. Die Zusage, eine Willensentscheidung durchzusetzen, ist umso glaubwürdiger, je mehr sie die beschriebenen Grundvoraussetzungen allen Handelns integrieren kann.
> Menschen können gut oder böse handeln, sie sind es aber nicht
Eine weitere Konstante theologischer Wirklichkeitsdeutung und biblischen Menschenbildes ist die Erkenntnis, dass Menschen verführbar sind, aber auch selbstlos handeln können. Der Mensch kann sich frei zum Guten oder zum Bösen verhalten.4 Kain hätte Abel nicht zu erschlagen brauchen; Eva den Apfel von Baum des Paradieses nicht zu essen nötig gehabt. Fast jeder Mensch kann dazu verführt werden, seine Interessen über die der anderen oder Gottes zu stellen.
> Freiwilligkeit und Ausgleich als biblische Grundaussagen zur Geldsammlung
Dieses zu wissen und die Durchsetzung der eigenen Entscheidung gegenüber allen anderen so gut wie möglich abzusichern, nimmt diese biblische Erkenntnis ernst. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber und ich selbst verführbar sind, gilt es, dieser Versuchung wechselseitig zu widerstehen. Dadurch entsteht ein grundlegendes Vertrauen, das Unterstellungen und Unsicherheiten im Vererben und Erben abzubauen hilft. Ein Fundraiser kann einen möglichen Erblasser oder Erben zur Spende verführen. Aber der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Die Verpflichtung, den freien Willen eines Erblassenden herauszufinden und umzusetzen, gründet in der Anerkennung der Würde (und der daraus erwachsenen Freiheit) jeder Person.5 Diese theologische Voraussetzung zu benennen und in ihrer Wertigkeit zu verdeutlichen, wird einerseits dem Anspruch seriösen Vorgehens gerecht und andererseits der Achtung vor der Willensentscheidung aller Beteiligten. Schon Paulus räumte der Freiwilligkeit bei seiner Geldsammlung Priorität ein: »Ein jeder, wie er´s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb« (2. Kor 9, 7).
Der Versuchung, selbst mit bester Absicht, den freien Willen eines möglichen Erblassers zu umgehen, ist zu widerstehen. Das Beispiel des Paulus kann helfen, theologische Motive für eine Spende potenziellen Erblassenden nahezubringen. Paulus sammelte Geld für einzelne Gemeinden, die er besuchte. Sein Eintreten für den wirtschaftlichen Ausgleich unter diesen Gemeinden wurde kritisiert. Davon legen die Kapitel 6 und 7 des 2. Korintherbriefes Zeugnis ab. Doch durch die Angriffe gegen die Geldsammlung ausgelöst, formulierte Paulus Sinn und Zweck seines Tuns: »Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat. Nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme.« (2. Kor 8, 12 f) Ziel war der freiwillige finanzielle Ausgleich zwischen Reichen und Armen. Dabei sagte Paulus nichts dazu, ob dieser Ausgleich durch Spende oder Vermächtnis geschehen sollte. Alle Menschen, die freiwillig Unterstützungsleistungen im weitesten Sinne, ob zu Lebzeiten oder danach, für den Ausgleich zwischen Arm und Reich geben, handeln damit in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift selbst. Erbschaftsfundraising hilft damit dem Ziel, einen Ausgleich herzustellen und damit zumindest partielle Verteilungsgerechtigkeit als Teil allgemeiner Gerechtigkeit durchzusetzen.
Freiwilligkeit und Freude auf der Seite des Gebenden sowie Willkommenheit der Spende bei den Nehmenden sind biblische Voraussetzungen allen Tuns, das dem Ziel des wirtschaftlichen Ausgleichs unter den Beteiligten eines Gemeinwesens dient. Einen solchen Grundsatz Erblassenden oder Erben gegenüber zu vertreten, entspricht dem Verkündigungsauftrag der christlichen Kirchen. Es schränkt den freien Willen von Erblassenden nicht ein, an diese mit neuen Ideen oder Erkenntnissen heranzutreten. Auf der einen Seite gebietet sowohl der Verkündigungsauftrag Christi als auch die Redlichkeit, potenzielle Erblassende über mögliche Handlungsmotive aufzuklären. Auf der anderen Seite gilt es der Verführung zu wehren, eigene Wertvorstellungen auch mit unredlichen Mitteln zu realisieren.
Alle Bemühungen, einen Ausgleich herzustellen, bei dem alle Beteiligten freiwillig handeln und die übertragenen Leistungen willkommen geheißen werden, entsprechen dem biblischen Zeugnis. Eine solche Freude am Geben zu vermitteln, ist eine theologisch sachgemäße Art und Weise, Fundraising als Erbschaftsfundraising zu betreiben. Dieses entspricht der Definition von Fundraising als »the gentle art of teaching the joy of giving«.6 Die genannten Bemühungen können sich neben dem deutlichen Befund in den paulinischen Briefen auch auf die Überlieferung Jesu Christi berufen. Die eigene Entscheidung zum guten Handeln und dessen Entsprechung im dreifachen Liebesgebot sind Grundlagen des Evangeliums.7 Wo diese beim Erbschaftsfundraising beachtet werden und die Erben oder Vermögensgebenden danach handeln, kann der Eindruck von »Erbschleicherei« gar nicht aufkommen. Bei Erblassern ohne Angehörige gelten dieselben Gesetzmäßigkeiten. Immer geht es um Vermächtnisse (Legate), Erbschaften, (Zu-)Stiftungen und sonstige Zuwendungen zu Lebzeiten oder von Todes wegen, die freiwillig gegeben werden und zu einem Ausgleich zwischen Arm und Reich beitragen.
> Deutung des Sinns des Lebens als Grundlage aller Entscheidungen
Neben den bisher genannten Kriterien entscheidet über die Gabe eines Vermächtnisses der grundlegende Sinn, den Erblassende ihrem Leben und ihrem Vermögen geben. Wer sein Leben mit dem Tod als ausgelöscht betrachtet, muss vor diesem in seiner Lebenszeit möglichst viel und alles tun und genießen. Verzicht erscheint als Defizit. »Nach mir die Sintflut« – mit diesem Deutungsansatz werde ich schwer von Erbschaftsfundraisern ansprechbar sein. Dieses Beispiel möge dazu sensibilisieren, sich im Erbschaftsfundraising mit den grundlegenden Werte- und Deutekategorien von Lebenssinn zu beschäftigen, die letztlich auch die Verwendung eines Vermögens bestimmen.
> Wechselseitiger Respekt und Aufrichtigkeit als Basis des Verstehens
An dieser Stelle kann nicht die Sinnfrage in ihren unendlichen Dimensionen erörtert werden; ein Vorschlag von Sinnstiftung aufgrund biblischer Einsichten soll jedoch als eine Möglichkeit vorgetragen werden. Sie möge helfen, sich der eigenen Deutung zu versichern, da eine Auseinandersetzung damit das verborgene Thema zwischen Fundraisern und Erblassern sein kann. Sich gegenseitig über die eigentlichen handlungsleitenden Motive auszutauschen, schafft wechselseitig Vertrauen. Die eigene Sinndeutung vorzutragen, unterstützt das Gegenüber darin, sich auch zu öffnen und wahrhaftige Motive des Handelns vorzustellen. Beide Seiten zeigen damit, dass Respekt und Aufrichtigkeit Basis der Beziehung sind und ermöglichen so, einander zu verstehen. Theologisch ist dieses Thema unter dem Leitbegriff der »impliziten Axiome« aufgearbeitet worden.
> Der christliche Sinn des Lebens
Sinn christlichen Lebens ist, zu lieben und geliebt zu werden. Dieses gründet im dreifachen Liebesgebot Christi, mit der er das »ganze Gesetz und die Propheten«8 zusammenfasst: Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst.9
Gott liebt mich, obwohl ich so bin, wie ich bin. Wenn mein Geliebtsein aber ohne individuelle Antwort auf diese Liebe bleibt, war die Liebe Gottes zu mir vergeblich. Meine Selbstliebe als Antwort auf das Geliebtsein spiegelt sich in meiner Nächsten- und Gottesliebe wider. Nun wirkt in jedem Menschen eine natürliche Angst, nicht geliebt zu sein oder zu lieben. Diese äußert sich in der Regel dadurch, dass ich mich mit anderen vergleiche. Das ist eine Grundkonstante des Lebens. Diese Angst, die sich durch Vergleich ausdrückt, jedoch nicht auszuhalten und sie zu verschieben10, nennt das neue Testament Sünde.11 Sünde heißt in der Grundbedeutung, das Ziel verfehlen. Damit ist das Ziel christlichen Lebens, zu lieben und geliebt zu werden, gemeint. Ich verfehle es, wenn ich die Angst, nicht geliebt zu sein oder zu lieben, verschiebe. Diesen Vorgang beschreibt das Wort »sündigen« (hamartia). Das geschieht in drei möglichen Strukturen:
Ich verschiebe meine Angst und gebe sie einem Menschen oder einer Struktur, die ich als mächtiger anerkenne als mich. Dann passe ich mich an, lebe nach den Bildern, die mir andere vorgeben, mache mich klein und lebe ein Leben, das ich nach den Vorgaben anderer entwerfe.
Ich nehme meine Angst und verschiebe sie zu einem Menschen oder einer Struktur, die scheinbar schwächer ist als ich. Dann muss ich mich groß machen, auf andere herabsehen, mit moralischen Urteilen mich besser machen als andere.
Beide Strukturen verschränken sich ineinander.
12
Grundlegende Einsicht dieser biblischen Deutung ist, dass es keinen Menschen gibt, der nicht seine Angst verschiebt, nicht geliebt zu sein oder genug zu lieben. Damit stehen sie theologisch gesprochen unter der Macht der Sünde. Ihr erstes Opfer war Kain. Er fühlte sich von Gott nicht so geliebt, wie der scheinbar seinen Bruder liebte. Das nicht ertragen zu können war Kains Sünde. Die Sünde gewann Herrschaft über ihn und so erschlug er Abel.13 Dadurch dass ein Mensch von Gott ins Dasein gerufen wurde, ist er geliebt. Diese Liebeszusage Gottes bestätigt ein Mensch durch die Taufe. Als Mensch ist er, obwohl er so ist, wie er ist, d. h. sich der Sünde immer wieder hingibt, von Gott geliebt.14
So gibt es keinen Grund, sich dieses Geliebtwerden durch wie auch immer geartete Handlungen verdienen zu müssen. Diese Liebeszusage Gottes endet nicht mit dem Tod, sondern reicht über den Tod hinaus. In der Liebesbeziehung Gottes spiegelt sich alle persönliche Individualität wieder. Durch die Liebe Gottes geprägt, wird der Mensch nach seinem Tod als neuer Mensch auferstehen.15 Der Tod ist auf Erden das Ende aller Handlungsmöglichkeiten, und der Mensch als Erdenwesen ist ganz tot. Es ist keine biblische Vorstellung, dass eine unsterbliche Seele zum Himmel fährt, sondern Gedankengut der griechischen Antike. Nach biblischer Vorstellung ist der Mensch Seele, er hat aber keine. Wer aber auf Erden ins Dasein gerufen ist, wird durch sein Geliebtsein durch Gott auch auferstehen. Die einzige Analogie, mit der diese Auferstehung verglichen werden kann, ist daher die Schöpfung aus dem Nichts, wie sie biblischen Berichte überliefern.16
Diese Beschreibung eines aus der Heiligen Schrift erhobenen Sinnganzen lässt erkennen, wie wichtig die Sinnfrage überhaupt für das Fundraising ist. Wenn ich denke, dass mit dem Tod alles vorbei ist, dann werde ich anders mit meinem Erbe umgehen, als wenn ich zur





























