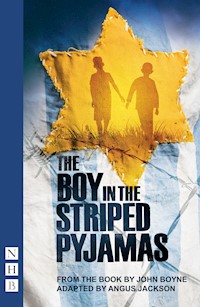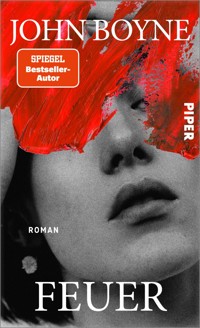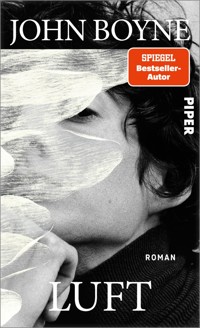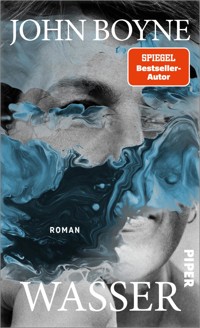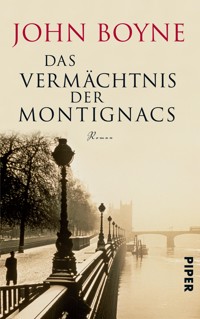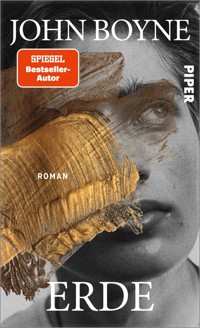
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn die Schuld bestimmt, wer wir sind? – John Boynes »Die Elemente« Eigentlich hat Evan Keogh alles. Als gefeierter Fußballprofi lebt er ein glanzvolles Leben in der Londoner High Society. Ein Leben, von dem viele träumen. Doch dann muss er sich vor Gericht in einem Missbrauchsskandal verantworten. Und der Prozess fördert in Evan zutage, was er am liebsten längst vergessen hätte: die eigene Vergangenheit. Er realisiert, dass er vor Jahren nicht nur vor der Enge seiner Heimatinsel geflohen ist, sondern vor sich selbst... »Erde« erzählt die Geschichte eines einsamen Jungen, der von seinem Ruhm nichts wissen will, und den die Ansprüche anderer zu einem Menschen gemacht haben, den er selbst nicht ausstehen kann. »Absolut fesselnd« Sunday Independent »Erde« ist Teil 2 von John Boynes großem Erzählprojekt »Die Elemente«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner
© John Boyne 2023
Titel der englischen Ausgabe:
»Water«, Doubleday, ein Imprint von Transworld Publishers, London 2023
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: XXXX
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Larry Finlay
1
Im Traum träumte ich von der modrigen grauen Erde auf der Insel und ihrem süßlichen Duft, nachdem es geregnet hatte. Eine doppelte Entfremdung von einem Ort, an den ich niemals zurückkehren werde. Meine Mutter hat mir mal erklärt, der Geruch habe mit einem Gemisch aus Chemikalien und Bakterien zu tun, die bei Nässe Fäden bilden und Sporen freisetzen. Und wir empfänden den Geruch als angenehm, weil wir uns weismachen wollen, dass die Erde eine willkommene Ruhestätte sei, wenn wir erst mal darin begraben liegen.
Ich bin seit fast einer Stunde wach, als auf meinem Handy eine Nachricht aufleuchtet. Ich ignoriere sie, bis kurz darauf eine zweite kommt. Ich nehme das Handy vom Ladegerät und sehe, dass sie wie erwartet von Robbie stammt. Die erste lautet:
Ich zähl heute auf dich, Bro. Enttäusch mich nicht.
Dann die zweite:
Lösch das, ok?
Ich frage mich, wie er so dumm sein kann, mir überhaupt zu schreiben. Wegen genau solcher Nachrichten haben wir doch den ganzen Ärger. Sein Geprahle in der WhatsApp-Gruppe über jene Nacht, und dann die Antworten darauf, die alle öffentlich gemacht wurden, wegen denen wir aussehen wie die letzten Tiere. Er denkt, gerade das würde unsere Unschuld beweisen, weil wir bestimmt nicht damit angeben würden, wenn wir tatsächlich etwas verbrochen hätten. Mag schon sein, aber ihm sollte zumindest klar sein, dass es nichts bringt, sie zu löschen. Alles ist irgendwo in der Hardware gespeichert oder in der Cloud oder auf einem anonymen Server in einem riesigen Lagerhaus unter der Mojave-Wüste.
Nichts verschwindet. Nichts wird vergessen. Alles, was wir heute sagen und tun, bleibt für immer an uns hängen.
Ich schwinge die Beine aus dem Bett und stelle die Füße auf den Teppich. Diese Füße, die mehr draufhaben als die der anderen Jungs. Mit der Anmut eines Rudolf Nurejew über ein Spielfeld rennen und dabei menschlichen Hindernissen ausweichen. Einen Ball aufnehmen und ihn mühelos auf den kräftigen Zehen balancieren. Ihn im perfekten Bogen aus der Ecke herausspielen, sodass der anvisierte Stürmer ihn reinköpft, oder ihn direkt über die aufspringenden Verteidiger, die ihre Hände vor dem Schritt kreuzen, in die obere rechte Ecke setzen. Wie oft haben sie mich an die Seitenlinie getragen, wo ich dann vor einem Heer unserer Fans auf die Knie ging, die Arme ausbreitete und so tat, als würde mir ihre Verehrung etwas bedeuten. Meine Füße können das, seitdem ich denken kann, so wie andere Kinder malen, singen oder Stimmen imitieren können. Dabei wollte ich gar nicht Fußballer werden, sondern Maler. Nur leider sitzt mein Talent in den Füßen statt in den Augen oder Händen.
Ich ziehe den Vorhang auf und blicke hinunter auf den Anwohnerparkplatz. Mein gelber Audi R8 schillert in der Sonne. Vor einem Jahr habe ich ein Vermögen dafür ausgegeben, nach meiner Rechnung acht Wochengehälter, dabei fahre ich damit nur zum Trainingsplatz und zurück. Mit dem Taxi wäre es billiger.
Das vierzehnstöckige Haus, in dem ich wohne, liegt am Stadtrand in der Nähe des Flusses. Jedes Stockwerk besteht aus einer einzigen zweihundertdreißig Quadratmeter großen Wohnung, meine liegt im zwölften. Gegenüber, auf der anderen Seite eines kreisrunden Blumenbeets mit einem Springbrunnen in der Mitte, steht ein identisches Haus, in dem Robbie in einem Penthouse mit zwei Etagen lebt. In den Stockwerken unter mir wohnen zwei bekannte Schauspieler, ein halbwegs erfolgreicher Popstar und ein ehemaliger Innenminister. Bei Robbie im Haus wohnen noch drei andere Fußballer und ein in Ungnade gefallener Tennistrainer. Unsere Wohnungen haben mehr Platz, als irgendwer von uns braucht. In jedem Zimmer stehen HomePods, wenn ich ein Lied hören möchte, muss ich nur den Titel sagen, schon erklingt es. Per Sprachbefehl steuere ich Raumtemperatur, Wasserhähne und Fußbodenheizung. Es gibt sechs Fernseher, einen im Wohnzimmer, einen in jedem der drei Schlafzimmer, einen in der Küche und einen über der Badewanne. Ich hätte gern etwas Schlichteres gehabt, aber der Verein bestand darauf, weil sie gern mal die Klatschpresse vorbeischicken, um uns mit unseren Freundinnen abzulichten, und die Fans erwarten nun mal so was. Nicht, dass ich eine Freundin hätte. Allerdings organisierten sie mir eine, als die Hello! ein paar Wochen nach meinem Einzug vorbeikam. Sie war nett, wollte danach sogar noch was mit mir trinken gehen, aber ich lehnte unter dem Vorwand ab, dass ich am nächsten Morgen zum Training müsste.
»Keine Angst«, meinte sie. »Ich will wirklich nur was trinken. Ich lebe seit drei Jahren mit einer Frau zusammen.«
Ich lehnte trotzdem ab.
»Dann machen wir jetzt wohl Schluss«, sagte sie und küsste mich zum Abschied auf die Wange. »War nett mit dir, Evan.«
Als ich ins Bad gehe, klingelt mein Handy. Ich seufze, weil ich schon wieder Robbie vermute, aber dann sehe ich, dass Dad anruft. Mum und er sind vor vier Tagen angekommen, sie wohnen in einem Hotel in der Innenstadt. Mir wäre es lieber, wenn sie nicht gekommen wären, aber ich konnte sie nicht davon abhalten. Ich überlege, nicht ranzugehen, aber so wie ich ihn kenne, versucht er es so lange, bis ich es irgendwann doch tue.
»Hi«, sage ich.
»Du bist schon wach.«
»Klar bin ich wach.«
Er atmet schwer. Dieses Leben, dieses schreckliche Leben, das ich lebe, war sein Traum, nicht meiner. Seit ich die Insel vor vier Jahren verlassen habe, bin ich genau das geworden, was er sich gewünscht hat, aber er hat mich noch immer unter seiner Fuchtel.
»Nicht in dem Ton«, sagt er leise. Der Geruch von Lehm steigt mir in die Nase, wie immer, wenn ich Angst habe oder wenn ich daran denken muss, warum ich damals weggelaufen bin.
»Tut mir leid«, sage ich.
»Fährst du mit dem Taxi?«
»Ja.«
»Hat der Verein dir eins bestellt?«
»Nein. Die dürfen da nicht mit reingezogen werden.«
»Soll ich ein Wörtchen mit ihnen reden?«
Ich unterdrücke ein Lachen. Er denkt tatsächlich, sie würden auf ihn hören. Der Verein ist zwischen drei- und vierhundert Millionen Pfund schwer. Mit seinem Hof und den Anteilen an einem Lebensmittelladen und einem Boot ist er auf der Insel vielleicht eine Nummer, aber hier ist er ein Nichts. Sie würden ihn nicht mal durch die Tür lassen.
»Lass mal lieber«, sage ich. »Ich rufe mir eins über die App, das ist einfacher.«
»Gut.« Pause. Ich überlege, ob ich jetzt auflegen kann, aber er kommt mir zuvor. Ich werfe das Handy aufs Bett, dusche erst mal lange und heiß, rasiere mich sorgfältig und föhne mir die blonden Locken. Warum sollte ich mir nicht zunutze machen, wie unschuldig ich damit aussehe? Außerdem habe ich ein eher kindliches Gesicht und wirke auf jeden Fall jünger als meine zweiundzwanzig Jahre. Wenn ich in der Stadt nicht so bekannt wäre, bekäme ich in den meisten Bars wahrscheinlich nichts zu trinken. Tatsächlich komme ich kaum dazu, mir selbst mal einen Drink zu kaufen. Wenn ich ausgehe, machen die Mädchen sich an mich ran, und die Jungs wollen mit mir befreundet sein. Als ich noch ausgegangen bin, meine ich. Das hat sich fürs Erste erledigt. Der Einzige, den ich noch regelmäßig sehe, ist Wojciech, und selbst der scheint unsere Beziehung zu überdenken. Ab und zu gehen wir in einen Pub hier in der Nähe, wo die Leute sich nicht für Fußball interessieren, da sitze ich dann mit dem Rücken zum Raum und ziehe mir meine Baseballcap tief ins Gesicht. Meistens kommt er aber zu mir, wir schauen einen Film, und ich lege meinen Kopf in seinen Schoß. Ich mag es, wenn er mir über den Kopf streichelt. So wie Mum früher, wenn ich auf dem Sofa lag und mir zum hundertsten Mal Toy Story ansah. Cormac und ich kannten die Dialoge auswendig, wir spielten die Szenen unseren Eltern vor, die sich vor Lachen bogen, sogar Dad, der sonst nur ein paarmal im Jahr lächelt, als könne er sich mehr nicht leisten. Cormac und ich standen uns schon immer sehr nah, einerseits, weil wir uns praktisch von Geburt an kannten, andererseits, weil ich keine Geschwister hatte und sein nur wenig älterer Bruder bei einem Unfall starb, als wir sieben waren. Er war nie so richtig über Ronans Tod hinweggekommen, und in seiner Trauer hatte er sich an mich geklammert.
Ich öffne den Schrank und starre die Anzüge darin an. Die meisten kenne ich gar nicht, weil ich mir die Sachen nicht selbst kaufe. Darum kümmert sich Lucy, die vom Verein damit beauftragt wird. Sie hat unsere Maße auf dem Laptop – Kragenweite, Schuhgröße, Hosenlänge – und scheint instinktiv zu wissen, was wem am besten steht. Jeden Monat kommen zwei Pakete, eins von Nike, weil sie mein Sponsor sind, beziehungsweise waren, und eins von einer der bekannteren Luxusmarken. Wenn ich darin fotografiert werde und die Bilder in der Zeitung erscheinen, bekomme ich je nach Zeitschrift ein entsprechendes Honorar auf meinem Konto gutgeschrieben. Boxershorts und Strümpfe wasche ich gar nicht erst, sie wandern nach dem ersten Tragen direkt in den Müll. In der Schublade warten sowieso immer ein paar Dutzend neue. Man hat mir genaue Anweisungen gegeben, wie ich mich heute anziehen soll: bodenständig, aber doch bemüht. Ich muss so aussehen, als wäre ich mir des Ernstes der Lage bewusst, würde aber auch zu sehr unter den ungerechten Anschuldigungen leiden, um mir groß Gedanken um mein Auftreten zu machen. Am Ende entscheide ich mich für einen dunkelblauen Armani-Anzug, ein weißes Hemd von Balenciaga und eine blaue Krawatte von Tom Ford. Die dunkelbraunen Schuhe von Ted Baker drücken. Wenn ich sie lange genug trage, nehmen meine kostbaren Füße womöglich dauerhaft Schaden, und ich werde freigestellt.
Bevor ich mich anziehe, betrachte ich mich im Schlafzimmerspiegel. Mein linker Arm ist ein bisschen steif, was ab und zu vorkommt, wenn ich gestresst bin. Ich habe ihn mir vor ein paar Jahren gebrochen – besser gesagt brechen lassen –, und seitdem ist er nicht mehr ganz der Alte. Ansonsten bin ich immer noch gut in Form, schließlich trainiere ich fast jeden Tag im hauseigenen Gym und schwimme im Pool, wobei meine Bauchmuskeln nicht mehr ganz so definiert sind. Weder Robbie noch ich dürfen uns derzeit auch nur in der Nähe des Vereins blicken lassen, ich kann also nicht in der Spielerkantine essen, wo sie auf einen besonders ausgewogenen Speiseplan achten, und meine Ernährung leidet darunter. Dreimal pro Woche kommt ein Personal Trainer, der vom Verein gestellt wird, was aber niemand wissen darf. Robbie ist mehr als zehn Millionen Pfund wert, ich werde auf etwas mehr als die Hälfte geschätzt, der Verein muss sein Kapital also schützen. Wenn das Ganze vorbei ist und für uns gut ausgeht, erwartet man uns so schnell wie möglich zurück auf dem Platz. Geht es schlecht aus, wird man nie wieder von uns sprechen. Wir werden aus den Unterlagen gelöscht, als hätten wir nie existiert. Wahrscheinlich kommt dann die Versicherung ins Spiel.
Gegen Viertel nach neun bin ich fertig angezogen, kehre zum Fenster zurück und warte darauf, dass Robbie aufbricht. Nach wenigen Minuten fährt ein Taxi vor, und er tritt durch die Eingangstür. Erst als es losfährt, bestelle ich selbst eins. Ich hätte natürlich mit ihm fahren können, aber unsere Anwältin Catherine meinte, es würde einen besseren Eindruck machen, wenn wir getrennt kämen.
Als mein Taxi kommt, stehe ich neben einer kleinen überwucherten Grasfläche, dem lächerlichen Beitrag unseres Gebäudekomplexes zur Artenvielfalt. Sie soll Vögeln und Insekten einen Nistplatz bieten. Vor allem aber birgt die raue Schönheit ein Geheimnis, in dem ich mich so sehr verliere, dass der Fahrer hupen muss, um mich aus meinen Gedanken zu reißen. Ich öffne die hintere Tür und steige ein. Mein Ziel habe ich schon eingegeben, ein Gespräch sollte mir also erspart bleiben. Ich halte den Kopf gesenkt und tue so, als würde ich durch mein Handy scrollen. Erst nach einer ganzen Weile fällt mir auf, dass der Fahrer mich im Rückspiegel mustert.
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagt er.
Ich antworte nicht.
»Heute geht’s los, oder?«
Ich nicke.
»Ich bin Fan«, erklärt er mit einem breiten Lächeln. »Das Tor, das Sie gegen …«
»Danke.« Ich habe keine Lust, hier die Highlights meiner kurzen Karriere durchzugehen.
»Und? Wie lange soll das dauern?«, fragt er.
»Ein paar Wochen angeblich.«
»Wenn Sie wollen, hole ich Sie jeden Morgen ab. Und warte dann draußen vor der Tür, wenn Sie fertig sind. Macht das Ganze vielleicht leichter.«
Er hat nicht unrecht. Es wäre angenehmer, während der ganzen Tortur denselben Fahrer zu haben. Nach ein, zwei Tagen hätte er bestimmt keine Lust mehr, mich auszufragen.
»Okay«, sage ich.
»Wann soll ich Sie heute abholen?«
»Um vier.«
»Und morgen früh wieder um halb zehn?«
»Ja.«
»Bezahlen können Sie dann am Ende.«
»Gut.«
»Also, nicht ins Gefängnis gehen.«
Ich presse die Lippen aufeinander.
»Soll ich Evan oder Mr Keogh sagen?«
»Evan ist okay.«
»Ich bin Max.« Er greift in die Mittelkonsole, holt ein paar Visitenkarten hervor und reicht mir eine nach hinten. »Da steht alles drauf. Aber keine Sorge. Ich werde da sein.«
»Danke«, sage ich.
Als er um die Ecke biegt, sehe ich das Gedränge der Medienleute vor dem Gerichtsgebäude. Ich hätte vor Robbie losfahren sollen. Dann wäre ich längst drinnen gewesen, wenn er kommt, und sie hätten sich auf ihn gestürzt. Er ist immer noch der größere Star. Jetzt konzentrieren sie sich auf mich.
Wir halten, ich greife nach dem Türgriff.
»Mach sie fertig, Junge«, sagt Max und grinst mich an. Er hat gelbe Zähne und trockene Lippen. Haare sprießen unter seinem Hemdkragen und aus Nase und Ohren hervor. Ein verwilderter Wald von einem Mann. »Denk dran, ein Mädchen, das sich mit zwei Männern gleichzeitig einlässt, ist nichts anderes als ein billiges kleines Flittchen, und die Jury wird das genauso sehen. Glaubst du, ich hab so was noch nicht erlebt? Ein Mädchen, das Nein sagt und eigentlich Ja meint? Schon tausendmal passiert.«
Ich stelle mir vor, seinen Kopf zu packen und zwischen den Sitzen hin und her zu schlagen, ihn so lange gegen die billige Innenausstattung zu donnern, bis er keinen Laut mehr von sich gibt. Stattdessen nicke ich nur, öffne die Tür und steige aus. Das Blitzlichtgewitter der Kameras und das Gebrüll der Reporter überwältigen mich. Als käme ich zu einer Filmpremiere und nicht zu einem Vergewaltigungsprozess. Ich frage mich, ob Max sieht, wie ich seine Visitenkarte in der Faust zerdrücke und dann ins Gebüsch schnippe. Soll er gern um vier zurückkommen, ich warte bestimmt nicht auf ihn.
Ein Polizist kommt auf mich zu. Ich gehe davon aus, dass er mich ins Gebäude bringen will, aber nein, er verwarnt mich und sagt, ich soll die Karte aufheben, während die Fotografen knipsen und die Journalisten meinen Namen brüllen. An der Karte klebt Erde, ich will sie aber nicht am Anzug abwischen, also warte ich, bis ich in der Eingangshalle bin, wo die Leute sich nach mir umdrehen. Ich werfe sie in den nächsten Mülleimer und halte die Hand unter einen Spender mit Desinfektionsmittel, ein Überbleibsel aus der Pandemie, als wir alle zu Hause bleiben und in unserer Einsamkeit die Welt völlig ausblenden konnten.
2
Zwölf Stunden nachdem ich die Insel verlassen hatte, fuhr ich an Bord einer Fähre von Dublin nach Holyhead und dann per Anhalter nach Südwales, wo ich Arbeit auf einem Bauernhof fand, der Weizen und Gerste anbaute. Ich hatte schon früher auf dem Feld gearbeitet und war es gewohnt, früh aufzustehen und lange zu arbeiten, also passte ich dort gut hin. Wir wohnten zu acht in einem Haus, jeweils zu zweit in einem der vier Schlafzimmer. Mein Zimmergenosse war ein Junge mit dem Spitznamen Buddha, weil er dick und kahl war, wenn auch nur ein paar Jahre älter als ich. Er hatte eine On-off-Beziehung mit Joanna, einer Kanadierin, die im Zimmer gegenüber schlief. Buddha und ich verstanden uns nicht besonders gut. Er hatte das Zimmer zwei Monate lang für sich allein gehabt und war genervt, dass ich jetzt dort einzog. Er war ein vulgärer Mensch und sprach von Frauen in einer Weise, die mir unangenehm war. Wenn Joanna und er Sex haben wollten, schickte er mich runter auf das Sofa im Erdgeschoss, wo mir die Federn in den Rücken drückten. Als ich irgendwann protestierte, drohte er mir Gewalt an, also fügte ich mich.
Ich fragte Joannas Mitbewohnerin, ob ich stattdessen in Joannas Bett schlafen könnte, aber sie sagte Nein. Ich erklärte, dass ich schwul sei und sie sich keine Sorgen wegen irgendwelcher Annäherungsversuche machen müsste, aber meine sexuelle Orientierung war ihr völlig egal, sie wollte nur nicht mit einem Jungen in einem Zimmer schlafen.
»Magst du keine Jungs?«, fragte ich. Im Gegenteil, sagte sie, das sei ja das Problem, sie möge Jungs so gern, dass ich nicht sicher vor ihr sei. Ich muss ziemlich komisch geguckt haben, denn sie prustete los und meinte, ich solle mir bloß nichts einbilden.
Als ich mich einigermaßen eingelebt hatte, schrieb ich Mum und Dad, dass es mir gut ginge und ich einen Job gefunden hätte, gab ihnen aber nicht meine Adresse. Dafür allerdings meine neue Handynummer. Ein paar Tage darauf rief mein Vater an, um mir zu erzählen, was für ein dämlicher Idiot ich sei, ich hätte das Zeug dazu, einer der größten Fußballer der Welt zu werden – besser als Pelé und Georgie Best –, und warf es einfach so weg.
»Ich will aber kein Fußballer werden«, sagte ich zum ungefähr tausendsten Mal. »Ich hab nicht mal Lust, mir ein Spiel anzusehen, geschweige denn selbst zu spielen.«
»Was hat das damit zu tun?«, brüllte er. »Du bist ein Naturtalent, dafür hätte ich getötet. Weißt du, bei wie vielen Probetrainings ich in deinem Alter war?«