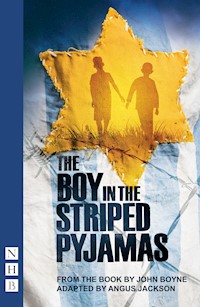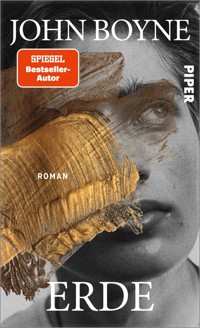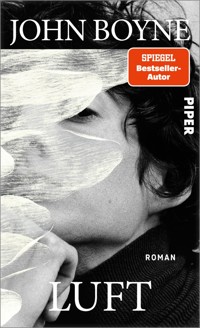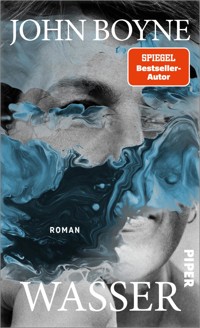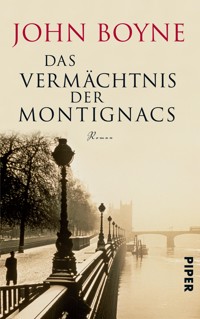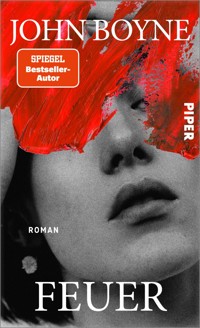
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn die Schuld bestimmt, wer wir sind? – John Boynes »Die Elemente« Als Chirurgin an einer Londoner Klinik rettet Freya täglich Leben. Die Spezialistin für Hauttransplantationen hilft Brandopfern, engagiert sich für Nachwuchsmediziner und genießt ihren gesellschaftlichen Status. Doch hinter der Fassade der erfolgreichen Einzelgängerin schwelt eine düstere Vergangenheit. Tag für Tag fürchtet Freya, entdeckt zu werden. Denn seit sie als Kind einem üblen Streich zweier Spielkameraden zum Opfer gefallen ist, führt sie einen Rachefeldzug gegen die Unschuld. Mitreißend und klug erkundet John Boyne in »Feuer« die Abgründe der menschlichen Natur und stellt die unbequeme Frage, was Schuld bedeutet, wenn Opfer zu Tätern werden. »Eindringlich und unvergesslich« Irish Times »Feuer« ist Teil 3 von John Boynes großem Erzählprojekt »Die Elemente«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Englischen von Maria Hummitzsch
Quellenangabe: IT STARTED WITH A KISS
Musik & Text: Errol Brown© Universal Music Publishing MGB Ltd. / Musik Ed. Discoton Musik GmbH
© John Boyne 2023
Titel der englischen Ausgabe:
»Fire«, Doubleday, ein Imprint von Transworld Publishers, London 2024
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: Studio Hamza/Stocksy.com und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1.
Als ich zwölf Jahre alt war, wurde ich lebendig auf einer Baustelle begraben.
Seitdem habe ich panische Angst vor geschlossenen Räumen, weshalb ich Aufzüge in der Regel meide. Heute Morgen sind im Krankenhaus allerdings Handwerker zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock am Werk, sodass ich keine andere Wahl habe, als den Fahrstuhl in die Abteilung für Verbrennungen zu nehmen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, bin ich nicht allein.
In der Ecke steht ein Junge, kaum älter als vierzehn, und wippt mit dem rechten Fuß nervös auf und ab. Ich versuche, an seinem Verhalten abzulesen, ob er Verwandte besucht oder selbst einen Termin hat, und entscheide mich für Ersteres. Neben ihm steht ein übergewichtiger Mann mit stoppeligem Doppelkinn, der bestimmt sein Vater ist. Er erhascht meinen Blick, hält ihn kurz und senkt seinen dann auf meine Brüste. Während wir in der Wirbelsäule des Krankenhauses in die Höhe fahren, glotzt er weiter, ehe er aufschaut und mein Gesicht taxiert, als würde er überlegen, ob er mit mir schlafen würde oder nicht. Da er kurz darauf wegsieht und gähnt, schlussfolgere ich, dass ich seinen hohen Ansprüchen nicht gerecht geworden bin.
Vater und Sohn verlassen den Fahrstuhl im vierten Stock – Nieren –, ich fahre hingegen weiter bis in den sechsten und atme erleichtert auf, ein leichtes Kitzeln von zartem Schweiß am Rücken, als sich die Türen endlich öffnen. Vor mir steht Louise Shaw, ranghöchste Krankenschwester der Station und von allen hier noch am ehesten so etwas wie eine Freundin, daneben Aaron Umber, ein Medizinstudent, der den ungewöhnlichen Schritt gewagt und eine dreimonatige Assistenz in meinem Team angetreten hat. Ich trage die Verantwortung für ihn, aber irgendetwas an ihm irritiert mich schon seit dem ersten Tag. Er ist sowohl gewissenhaft in seiner Arbeit als auch höflich im Umgang mit unseren Patienten, er gibt mir also keinen Anlass, ihn derart abzulehnen, aber trotzdem reagiere ich jedes Mal gereizt, sobald er den Mund aufmacht.
»Guten Morgen«, sagt Louise, die nicht nur ein Dutzend Akten balanciert, sondern auch den Styroporbecher mit Kaffee und das KitKat bereithält, mit denen sie mich jeden Morgen begrüßt. Wer auch immer sie ersetzt, wenn sie demnächst in den Ruhestand geht, wird wohl leider nicht halb so aufmerksam auf meine Bedürfnisse eingehen wie sie. »Kurze Nacht gehabt?«
»Nein«, sage ich. »Warum?«
»Du siehst müde aus.«
»Danke. Es gibt doch nichts Schöneres, als gleich am Morgen gesagt zu bekommen, dass man fertig aussieht.«
»Ich habe nicht gesagt, dass du fertig aussiehst«, erwidert sie, und ihr irischer Akzent schimmert hindurch. »Ich habe gesagt, dass du müde aussiehst. Das ist was anderes.«
»Tja, zufällig war ich um zehn im Bett«, sage ich zu ihr, was stimmt, auch wenn ich nicht alleine war, was womöglich der Grund für meine offensichtliche Erschöpfung ist. Ich drehe mich zu Aaron um, der mich auf diese beunruhigende Art ansieht, als würde er mich nicht für einen Menschen, sondern einen Besucher von einem anderen Planeten halten, und zwar keinen besonders freundlichen. Gut möglich, dass er auf mich steht. Ich bin gerade mal sechsunddreißig, und von dem, was mir die Medien weismachen wollen, sind junge Männer in seinem Alter heutzutage ganz wild auf ältere Frauen. Doch selbst wenn ich nicht seine Vorgesetzte wäre, hätte er keine Chance, denn er ist nicht einmal annähernd mein Typ. Er ist zwar nicht unattraktiv, genau genommen sieht er sogar ziemlich gut aus, wenn man auf Männer wie ihn steht steht – dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz und auf dem Kopf länger, durchdringende graue Augen –, aber er ist dreizehn Jahre jünger. Mit einem Dreiundzwanzigjährigen habe ich zuletzt vor zehn Jahren geschlafen, und ich habe nicht vor, das je zu wiederholen.
»Was sagst du dazu, Aaron?«, frage ich ihn. »Sehe ich fertig aus?«
»Sie sehen gut aus, Dr. Petrus«, sagt er und errötet leicht, weil ich ihn so geradeheraus frage.
»Nur gut?«
»Nein, Sie sehen toll aus. Ich meine …« Er verstummt, die Art der Befragung ist ihm sichtlich unangenehm. Es ist doch eine gute Sache an der heutigen Welt, in der jeder in der ständigen Hoffnung lebt, eine Bemerkung zu hören zu bekommen, die eine Beschwerde bei der Personalverwaltung rechtfertigt, dass Gespräche zwischen Kollegen, vor allem unterschiedlichen Geschlechts, in der Regel professionell bleiben. Mir ist das nur recht.
»Ignorier sie einfach«, rät Louise Aaron mit mütterlichem Lächeln, bevor sie sich mir wieder zuwendet. »Hier. Die wirst du haben wollen«, sagt sie dann und fächert den Stapel Akten auf ihrem Arm auf. »Das Übliche. Untersuchungsergebnisse, Gutachten, Neuzugänge et cetera.«
»Leg sie doch schon mal auf meinen Schreibtisch, Aaron«, sage ich, schnappe mir den Kaffee und das KitKat und schaue ihm hinterher, als er über den Korridor davoneilt. Seine Turnschuhe haben schon bessere Tage erlebt, und da er ziemlich groß ist, legt die schlecht sitzende Krankenhauskleidung seine Knöchel frei. Vielleicht ist das heutzutage ja angesagt.
»Wie lange muss ich ihn noch ertragen?«, frage ich, als er außer Hörweite ist.
»In etwa so lange wie mich«, sagt sie. »Aber wenn er weg ist, wird natürlich ein anderer wie er auftauchen. Zusammen mit einer anderen wie mir. Wir sind alle austauschbar.«
»Noch eine wie du wäre toll. Noch einer wie er allerdings …«
»Sei nett«, ermahnt sie mich scharf, wie nur sie es sich traut. »Du schüchterst ihn ein, das ist alles. Du siehst aus wie ein Supermodel, sprichst wie ein Fischweib, und obendrein bist du noch seine Chefin. Für Jungen in seinem Alter ist das eine beängstigende Kombi.«
»Er ist kein Junge«, sage ich zu ihr. »Er ist ein Mann. Das ist ein Unterschied.«
Wir besprechen noch ein paar Details einer Hauttransplantation, die ich am Nachmittag bei einer jungen Frau durchführe. Sie hat sich eine Verbrennung dritten Grades zugezogen, als sie aufgrund einer Herzrhythmusstörung zusammenbrach und auf das Halogenheizgerät fiel, das ihre Wohnung beheizt, weil sie sich nichts anderes leisten kann. Danach mache ich mich auf den Weg in mein Büro und hoffe, dass ich Aaron nicht mehr begegne. Meine Gebete werden erhört. Er hat sich dorthin verkrümelt, wo er sich offenbar immer aufhält, wenn ich ihn nicht gerade herumkommandiere. Die Sorgfalt, mit der er die Akten auf meinem Schreibtisch ausgebreitet hat, nervt mich, und dass es mich nervt, nervt mich auch. Wie albern, dass mich sein Ehrgeiz dermaßen aufregt.
Ich sichte meine Mails und antworte kurz auf alles, was dringend klingt. Eine Konferenz in Paris lädt mich ein, ein Paper über die moralischen Aspekte der gestielten Hauttransplantation von verstorbenen Spendern einzureichen. Ein medizinisches Fachmagazin fragt an, ob ich einen Artikel gegenlesen würde, der die Häufigkeit von Ödemen bei Patienten über fünfundsechzig behandelt, die eine Verletzung der oberen zwei Schichten der Dermis erlitten haben. Es folgen verschiedene administrative Krankenhausangelegenheiten, einschließlich der Vorgaben zu einem Meeting, bei dem ich doch bitte vortragen soll, welche weiteren Kürzungen ich in meiner Abteilung vornehmen werde, um sicherzustellen, dass das staatliche Gesundheitssystem mit einem Budget von knapp drei Pfund pro Patienten auskommt. Eine Stunde vergeht, und bevor meine tägliche Visite gegen elf Uhr dreißig ansteht, angle ich eine Zigarette samt Feuerzeug aus meiner Tasche und haste zurück zu dem gefürchteten Aufzug. Dabei komme ich an Aaron vorbei und sage ihm, dass er mich gleich nach meiner Pause begleiten wird und sich schon mal bereithalten soll.
Es ist ein warmer Vormittag, und eigentlich habe ich vor, mich an meinen üblichen Platz direkt in den Schatten des Vordachs zu stellen. Aber nur fünf Meter weiter, neben der Statue des Krankenhausgründers – der im neunzehnten Jahrhundert am Sklavenhandel beteiligt war, wovon bislang niemand Wind bekommen hat, sodass er bis auf Weiteres an Ort und Stelle bleibt – sitzt auf einer Bank der Junge aus dem Fahrstuhl. Er ist allein, hat die Ellbogen auf die Knie gestützt, den Kopf in die Hände gelegt und schaut zu Boden. Ich weiß, dass ich mich wegdrehen, in Ruhe meine Zigarette rauchen und mich auf die anstehende Operation konzentrieren sollte, aber wenn ich einen Jungen in seinem Alter sehe, der so offensichtlich leidet und verletzlich wirkt, kann ich nicht anders.
»Ist neben dir noch frei?«, frage ich, als ich mich ihm nähere, und er zuckt kurz zusammen, ehe er aufschaut und nickt. Seine glatten, dunklen Haare fallen ihm über die Augenbrauen, ein wenig wie die Beatles in ihren Pilzkopf-Zeiten. Seine Haut ist gnädigerweise pickelfrei, aber seine Nägel sind der reinste Horror. An denen knabbert er offensichtlich herum wie ein zahnender Welpe an einem Kauspielzeug. Und tatsächlich hebt er, während ich mich setze, die linke Hand zum Mund und geht genüsslich auf seinen Zeigefinger los, sodass ich sanft dagegenschlage. »Lass das lieber«, sage ich lächelnd, damit er weiß, dass ich es nicht böse meine. »Man kann nie wissen, was für Bakterien man sich dabei einfängt.«
»Das sagt auch meine Mum«, erwidert er. »Sie sagt auch, dass man Krebs kriegt, wenn man raucht.«
Ich drehe mich zu ihm um und ziehe die Augenbrauen hoch.
»Süß«, sage ich, nehme den ersten Zug, puste den Rauch in seine Richtung, und er wedelt ihn weg. Kurz halte ich das Feuerzeug geöffnet und genieße die lilablaue Pracht der Flamme, ehe ich den Deckel zuschnappen lasse. Ich biete ihm auch eine an.
»Ich bin vierzehn«, sagt er vorwurfsvoll. Seit wann sind Teenager eigentlich so übertrieben streng? In seinem Alter hätte ich mir eine genommen und mir eine zweite für später hinter das Ohr geklemmt.
»Ich erzähl’s auch keinem.«
»Nein, danke«, sagt er.
Eine Weile sitzen wir schweigend da, und als deutlich wird, dass er zu schüchtern ist, um etwas zu sagen, übernehme ich. Das passt schon. Zwar bin ich keine Kinderärztin, aber ich weiß, wie ich mit Jungen in seinem Alter reden muss. Ich habe daraus quasi eine Wissenschaft gemacht.
»Wir haben uns doch vorhin im Fahrstuhl gesehen, oder?«, frage ich ihn. »Du sahst ein bisschen besorgt aus. War das dein Dad, der neben dir stand?«
»Ja.«
»Bist du krank? Ich frage nicht aus Neugier. Ich bin Ärztin. Ich arbeite hier.«
»Nein, mir geht’s gut«, sagt er. »Mein Freund ist krank. Es geht ihm nicht besonders.«
»Wie heißt dein Freund?«
»Harry Cullimore. Kennen Sie ihn?«
Ich schüttle den Kopf und ziehe erneut an meiner Zigarette. Der Name sagt mir nichts, aber das Krankenhaus hat auch hundertachtzig Betten, und ich komme selten aus der Verbrennungsabteilung oder der Notaufnahme heraus. Er erzählt mir, dass Harry vor drei Monaten eine Nierentransplantation gehabt, sein Körper die Niere aber nicht angenommen habe und er jetzt wieder Dialyse brauche und darauf warte, dass irgendwer Pech habe und mit dem Motorrad stürze oder unter die Räder eines Busses komme. Seit fünf Tagen behalte man ihn jetzt hier, wegen einer Blasenentzündung und den damit verbundenen Komplikationen, und es sehe nicht so aus, als ob er bald wieder rauskäme. Bei dem Wort »Blasenentzündung« wird er rot und guckt weg, was ich niedlich finde.
»Lieb von dir, dass du ihn besuchst«, sage ich.
»Er ist mein bester Freund«, antwortet er schulterzuckend. »Wir kennen uns, seit wir klein sind.«
Der Junge ist kurz davor zu weinen, und mich berührt seine Hilflosigkeit.
»Und du?«, frage ich. »Wie heißt du?«
»George«, sagt er.
»George? Und weiter?«
»George Eliot.«
Ich lache auf, unsicher, ob er mich auf den Arm nimmt.
»Was?«, fragt er.
»George Eliot?«, frage ich nach. »Im Ernst?«
»Jepp«, erwidert er, die Frage offenbar schon gewohnt. »Wie die Schriftstellerin. Aber die war ja eine Frau. Und ich bin’s nicht.«
»Du heißt wirklich so?«
Er nickt, und ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Wäre schon ziemlich schräg, so was zu erfinden.
»Na dann, ich bin Freya«, sage ich und strecke ihm die Hand entgegen. Er schüttelt sie, auch wenn ihm diese Art von Erwachsenenkodex sichtbar unangenehm ist. Er hat feuchte Hände, und ich bemühe mich um Diskretion, als ich mir die Hand am Rock abwische. »Wo ist dein Dad? Holt er dich später wieder ab?«
»Nein, er muss arbeiten. Er hat mich nur hergebracht und Harry kurz Hallo gesagt. Ich nehme dann den Bus nach Hause. Sie arbeiten aber nicht in der Nierenabteilung, oder?«
»Nein«, sage ich. »In der für Verbrennungen.«
»Sie meinen Menschen, die in ein Feuer geraten sind?«
»Unter anderem, ja.«
Er verzieht das Gesicht, wie Leute es oft tun, wenn ich ihnen mein Fachgebiet nenne. Krankheiten sind das eine, aber Körper, die durch Brände entstellt wurden, lösen Unbehagen bei anderen aus. Die Opfer tun ihnen natürlich leid, aber mit Deformierungen wollen sie lieber nicht konfrontiert werden.
»Gibt es Dinge, die die Ärzte ihm nicht verraten?«, fragt er. »Harry, meine ich. Könnten Sie das rausfinden und mir dann sagen?«
»Nein, leider nicht«, sage ich. »Das darf ich nicht.«
»Warum nicht? Er ist mein bester Freund«, wiederholt er.
»Das verstehe ich. Aber ich bin an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Du wirst deinen Freund selbst fragen müssen. Oder seine Eltern. Ich bin mir sicher, dass er dir erzählen wird, was er von seinen Ärzten weiß.«
Er nickt. Er hat genügend Krankenhausserien gesehen, um die ethischen Grundsätze zu kennen, die für den Arztberuf gelten. Ich bemerke, wie sein Blick zu meinen Beinen wandert. Wenn es ums Begaffen geht, ist er nicht viel diskreter als sein Vater, nur weniger geübt. Seine Zunge ragt aus dem Mund, und ich weiß, dass er in diesem Moment nicht an Harry denkt. Er denkt an Sex. Doch dann beginnt er überraschenderweise zu weinen.
»Hey«, sage ich, trete die Zigarette aus und rücke näher an ihn heran. »Alles okay?«
»Ja«, sagt er und wischt sich die Tränen von der Wange. »Tut mir leid. Es ist nur …«
»Ja?«
»Ich will nicht, dass er stirbt.«
Starke Emotionen lasse ich in der Regel nicht an mich heran. Ich bleibe lieber sachlich in meinem Umgang mit Patienten und ihren Familien und bevormunde sie weder, noch mache ich ihnen falsche Hoffnungen. Ich sage ihnen die Wahrheit und weigere mich, schlechte Diagnosen herunterzuspielen. Wenn ich mit den Emotionen von Kindern konfrontiert bin, die Verbrennungen erlitten haben, deren Haut Blasen wirft, deren Gesichtszüge entstellt sind und deren Nervenenden entweder durchtrennt sind oder die in unerträglichem Schmerz aufschreien, tue ich das in Anwesenheit ihrer Eltern und einer Krankenschwester – in der Regel Louise –, zusammen mit einer der Kinderpsychologinnen des Krankenhauses, und bleibe dabei stets gefasst und professionell. Darum überrascht es mich, dass Georges Tränen ungewohnterweise und, wenn ich ehrlich bin, auch eher unerwünschterweise Mitgefühl in mir auslösen.
»Die Ärzte, die deinen Freund betreuen, tun ganz sicher alles, was in ihrer Macht steht«, sage ich.
»Kommt es oft vor, dass Menschen an Nierenversagen sterben?«, fragt er.
»Es kommt vor«, gebe ich zu. »Es ist eine schwere Krankheit. Aber meistens trifft es alte Menschen. Dein Freund hat einen jungen, starken Körper, das spricht für ihn. Sein Körper wird sich wehren.«
»Er kommt mir aber überhaupt nicht stark vor. Er ist grau im Gesicht und ganz schwach. Im Moment kommt er nicht mal allein aus dem Bett.«
Ich kann nicht viel sagen, was ihm Mut machen würde. Tatsächlich ist es so: Wenn Harry bereits eine Niere abgestoßen hat, wird er wahrscheinlich auch die nächste abstoßen. Mehrfachtransplantationen verursachen außergewöhnliche Traumata, und Körper, die so jung sind wie seiner, sind für derartige Eingriffe einfach nicht gemacht. Wenn seine Niere nicht funktioniert, werden seine übrigen Organe das irgendwann nicht mehr ausgleichen können und versagen. Selbstverständlich sage ich George nichts von alledem. Er braucht Trost, keine professionelle Meinung.
»Es ist schön, dass dir dein Freund so wichtig ist«, sage ich zu ihm. »Es ist sehr lieb von dir.«
Angestrengt meidet er meinen Blick. Jungs in seinem Alter wollen vor Mädchen oder Frauen nie zerbrechlich wirken. Wenn sie mit ihren Freunden über uns reden, können sie rücksichtslos und abschätzig sein, uns einfach nur auf unsere Körper reduzieren, die sie zu ihrem Vergnügen benutzen oder mit denen sie herumexperimentieren wollen, doch wenn sie mit dem anderen Geschlecht allein sind, zeigen sich ihre intrinsische Angst und ihre völlige Rückgratlosigkeit. Sie sind Monster, jeder Einzelne von ihnen, frei von jeglichem Anstand.
»Manchmal behandle ich Patienten, die so alt sind wie Harry und du«, erzähle ich ihm und lege meine Hand auf seine, vorsichtig, um ihn nicht zu verschrecken. Seine Haut ist unfassbar weich. »Und sie alle fühlen sich besser, wenn sie wissen, dass andere für sie da sind. Du könntest gerade mit deinen anderen Freunden zusammen sein, um die Häuser ziehen und Spaß haben. Aber stattdessen bist du hier. Harry kann von Glück reden, dass er dich hat.«
Es gibt da etwas, das ich ihn gern fragen würde, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mir selbst das Versprechen gegeben, dass ich diese Frage nie wieder stellen werde. Wenn ich dieses Versprechen nur wenige Stunden später breche, wäre das der Beweis für meinen vollkommenen Mangel an Selbstbeherrschung. Deshalb werfe ich einen kurzen Blick auf meine Uhr und stehe auf. Ich muss gehen. Die Visite ruft.
»Pass auf dich auf, George Eliot«, sage ich. Kaum habe ich ihm den Rücken zugedreht, spüre ich, wie sein Blick mir folgt. Er ist aufgewühlt, besorgt um den Zustand seines Freundes, aber er ist trotz allem ein vierzehnjähriger Junge und somit dauerhaft seinen Hormonen ausgeliefert. Vor mir sind die Schiebetüren, die ins Innere führen, und ich ermahne mich selbst, weiterzugehen und einzutreten, erneut in den Fahrstuhl zu steigen und George seinem Tagesablauf zu überlassen.
Doch dann muss ich an Arthur und Pascoe denken, an die vielen Höhlen entlang der Küste von Cornwall, an die Nacht, in der ich fast gestorben wäre, und bin wehrlos. Ich bleibe stehen, schaue einen kurzen Moment zu Boden, schließe die Augen und erlaube mir einen resignierten Seufzer. Als ich sie wieder öffne und mich umdrehe, schaut George ertappt weg, und ich gehe erneut auf ihn zu.
Er hat nichts zu befürchten. Wenn überhaupt, bin ich es, die Angst haben sollte. Schließlich sollte eine Chirurgin der Verbrennungsmedizin wissen, dass man nicht mit dem Feuer spielt.
2.
Ich habe den Namen Vidar noch nie gehört und bitte Aaron, ihn zu googeln, als wir gerade auf dem Weg nach unten sind. Kurz hantiert er mit seinem Handy und erzählt mir dann, dass Vidar der nordische Gott der Rache ist, was irgendwie zu dem Gespräch passt, das ich gleich mit den Eltern des eben behandelten Vierjährigen führen will.
»Kannst du gut mit Kindern?«, frage ich.
»Ja und nein«, antwortet er. »Ich mag sie. Aber ich ertrage es nur schwer, sie verletzt zu sehen.«
»Wenn sie nicht verletzt wären, wären sie nicht hier«, erwidere ich. »Sie kommen schließlich nicht, weil man hier so viel Spaß hat. Wir sind nicht Disneyland.«
Er wirft mir einen Blick zu, der eine ebenso sarkastische Antwort vermuten lässt, aber er traut sich noch nicht, tatsächlich zu kontern.
Auf dem Weg in den zweiten Stock gebe ich ihm einen Abriss über die letzten beiden Male, die der Junge vorstellig war. In den vergangenen zwölf Monaten ist er zweimal in der Notaufnahme behandelt worden, einmal wegen eines gebrochenen Handgelenks (links), weil er vom Dreirad gefallen war, und einmal wegen eines perforierten Trommelfells (rechts), da er sich einen Bleistift so tief in den Gehörkanal geschoben hatte, dass er sein Trommelfell durchstieß. Dieses Mal, nur zwölf Wochen später, ist er mit einer tiefen dermalen Verbrennung der rechten Hand zurück, nachdem er sie angeblich auf eine Elektroherdplatte gedrückt hat. Laut Patientenakte gab es nach dem zweiten Vorfall keine Begutachtung zum Kindeswohl, und dass es nach so kurzer Zeit zu einem dritten kommt, lässt sämtliche Alarmglocken schrillen.
»So was machen Kinder eigentlich nicht«, sagt Aaron. »Sie suchen Schmerzen nicht. Sie laufen davor weg.«
»Die meisten«, sage ich.
»Alle«, entgegnet er bestimmt.
»Du hast recht«, räume ich ein. Versehentlich eine Hand auf die heiße Herdplatte zu legen, kann jedem passieren, aber die natürliche Aversion des Körpers gegen Traumata macht es physisch unmöglich, sie dort liegen zu lassen, genauso wie wir uns auch nicht selbst erwürgen oder dazu zwingen können, in einer Badewanne unter der Wasseroberfläche zu bleiben. »Bei einer so tiefen Verbrennung muss ihn jemand festgehalten haben.«
»Ach du Scheiße«, sagt er, sichtlich angewidert, und seine Abscheu ist nicht gespielt. »Fragen Sie sich nicht, was das für Menschen sind, die Kindern Schmerzen zufügen?«
»Deine Assistenz in der Pädiatrie hast du offenbar noch vor dir«, sage ich. »Wenn es so weit ist, wirst du erleben, was für Menschen das sind. In der Regel die Eltern.«