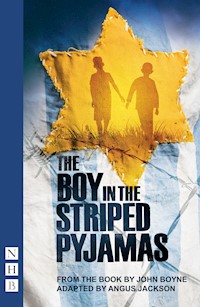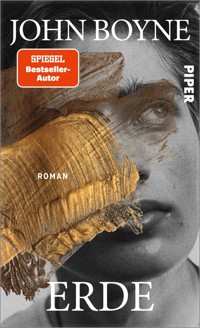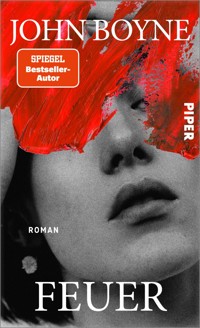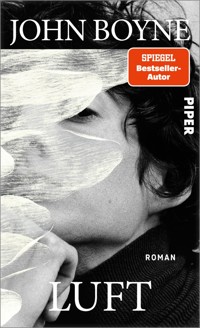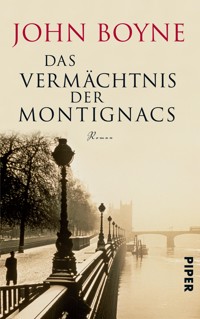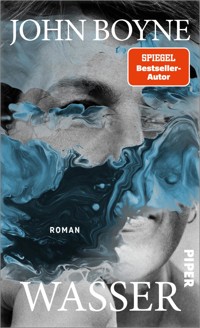
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn die Schuld bestimmt, wer wir sind? Vanessa Carvin ist auf der Flucht vor ihrem alten Leben. Mit kurz geschorenen Haaren und neuem Namen will sie auf der kleinen Insel vor der irischen Küste noch einmal neu anfangen. Zu Hause in Dublin kannte die Presse über Monate kein anderes Thema als die missbräuchlichen Taten ihres Mannes. Hier, in der Abgeschiedenheit zwischen tosendem Ozean und ihrer einsamen Hütte, drängt sich Vanessa nun die Frage auf, die nur sie beantworten kann – wo liegt die Grenze zwischen Unwissen und Mitschuld? Kompromisslos und doch voller Empathie erzählt John Boyne in »Wasser« von einer Frau und ihrer Suche nach der eigenen Schuld. Eine fesselnde Lektüre über die Tiefen und Untiefen des Menschen. »Subtil, intelligent und menschlich« Sunday Telegraph »Wasser« ist Teil 1 von John Boynes großem Erzählprojekt »Die Elemente«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner
© John Boyne 2023
Titel der englischen Ausgabe:
»Water«, Doubleday, ein Imprint von Transworld Publishers, London 2023
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: Studio Firma/Stocksy.com und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
In Gedenken an Michael Grimley,und für Carmel
1
Nach meiner Ankunft auf der Insel ändere ich als Erstes meinen Namen.
Achtundzwanzig Jahre lang war ich Vanessa Carvin, aber davor war ich immerhin vierundzwanzig Jahre lang Vanessa Hale. Es ist überraschend tröstlich, meinen Mädchennamen wieder anzunehmen, denn manchmal fühlt es sich an, als wäre er mir gestohlen worden, auch wenn ich daran selbst nicht ganz unschuldig war.
Ein paar Minuten später ändere ich ihn erneut, diesmal in Willow Hale. Willow ist mein zweiter Vorname, und es erscheint mir ratsam, noch einen Schritt weiterzugehen, um die Frau, die ich mal war, von der zu trennen, die ich jetzt bin, damit niemand hier eine Verbindung herstellt. Meine Eltern gehörten zur ganz normalen Mittelschicht – er Lehrer, sie Verkäuferin –, und es gab durchaus Leute, die es anmaßend fanden, dass sie ihre Tochter Vanessa Willow nannten, zumal man bei dem Namen eher an eine Schriftstellerin oder die blasse Muse eines Malers denkt, aber ich mochte ihn eigentlich immer ganz gern. Damals hatte ich wahrscheinlich selbst ein bestimmtes Bild von mir. Das habe ich inzwischen nicht mehr.
Als Nächstes schneide ich mir die Haare ab. Solange ich denken kann, hatte ich schulterlanges blondes Haar, aber vor meiner Abreise aus Dublin habe ich mir einen Rasierer gekauft und lade ihn auf, ehe ich mir damit über den Kopf fahre und mit fiebrigem Vergnügen beobachte, wie die Büschel ins Waschbecken oder um meine Füße herum zu Boden fallen. Während meine Weiblichkeit Strähne für Strähne an mir hinuntersegelt, beschließe ich, mir keine Glatze zu schneiden, das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen, außerdem habe ich nicht den Kopf dafür, im Gegensatz zu der berühmten Sängerin damals, die aussah wie ein Engel, als sie zum ersten Mal auf unseren Fernsehern erschien. Stattdessen verpasse ich mir den unkomplizierten Kurzhaarschnitt einer einfachen Bäuerin, die viel zu beschäftigt ist, um sich Gedanken um ihr Äußeres zu machen. Das Blond ist einem dunklen Grau gewichen, das wie ein gutartiger Krebs die ganze Zeit in mir geschlummert haben muss. Ich frage mich, wie ich wohl aussehen werde, wenn es nachwächst, und hoffe ein bisschen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Am praktischsten wäre es tatsächlich, wenn es einfach ausfiele, unaufhaltsam grausam, wie bei einem Mann.
Das Cottage hat alles, was ich brauche. Es ist genauso schmucklos eingerichtet, wie auf den Fotos im Internet zu sehen war. Durch die Eingangstür betritt man ein Wohnzimmer mit integrierter Küche. Oder auch eine Küche mit integriertem Wohnzimmer. Außerdem hat es ein Schlafzimmer mit einem schmalen Bett – es wird sich seltsam anfühlen, wieder wie ein Kind zu schlafen – und ein kleines Bad ohne Dusche. Über den Wasserhahn ist ein unansehnlicher Gummiaufsatz gestülpt, den ich in den Schrank unter der Spüle lege. Das Dach ist offenbar dicht, auf dem Steinboden sind jedenfalls keine feuchten Stellen zu sehen. Die Schlichtheit, der klösterliche Charakter gefallen mir. Es ist so ganz anders, als ich es gewohnt bin.
Als ich mit dem Besitzer sprach, einem Mann namens Peader Dooley, und ihn fragte, wie es mit WLAN aussieht, sagte er, es gäbe auf der Insel eine Kneipe mit Internet, davon abgesehen hätten nur wenige Häuser einen Zugang, und seins gehöre nicht dazu.
»Ich schätze, dann kommt es für Sie nicht infrage?« Er klang enttäuscht, da er wahrscheinlich nicht oft Anfragen für sein Cottage bekam und schon gar nicht auf unbegrenzte Zeit.
»Im Gegenteil«, sagte ich. »Das macht es für mich sogar noch attraktiver.«
Als ich die Hähne aufdrehe, kommt braunes Wasser, dann räuspern sich die Rohre einmal kräftig, und es wird klar. Ich halte die Hand drunter, es ist eiskalt. Ich nehme ein Glas aus dem Regal, fülle es und trinke. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine solche Reinheit geschmeckt habe. Noch ein Schluck und in mir erwacht etwas zum Leben. Ob man von diesem Wasser betrunken werden kann?
Zimmer für Zimmer überprüfe ich die Lichtschalter und bin froh, dass sie funktionieren. Nachts ist es auf der Insel bestimmt dunkler als an jedem anderen Ort, an dem ich bisher gewesen bin. Die Tapete ist ausgeblichen und scheint nur noch aus Gewohnheit zu hängen, wahrscheinlich muss man nur einmal kräftig dran ziehen, und sie käme freiwillig runter. Irgendwas fehlt, und es dauert ein bisschen, bis mir klar wird: Es gibt keinen Fernseher. Ich bin nicht enttäuscht. Wenn ich schon in so hermetischer Abgeschiedenheit leben soll, dann am besten ohne störende Ablenkung. Was für ein seltenes Privileg, die Außenwelt mit all ihrem Unsinn ignorieren zu können.
Allerdings gibt es ein altes Radio. Als ich es anschalte, kommt nur Rauschen. Ich ziehe die Antenne raus, ändere die Frequenz, und im nächsten Moment höre ich, wie Joe Duffy auf RTÉ Radio 1 mit bewundernswerter Geduld eine Hörerin interviewt, die davon erzählt, welche Demütigung sie neulich über sich ergehen lassen musste. Jahrelang habe ich Joes Sendung gehört, jeden Tag, aber jetzt schalte ich aus. In den letzten zwölf Monaten waren Brendan und ich regelmäßig Thema bei ihm, und masochistisch, wie ich bin, habe ich mir natürlich jedes Mal angehört, wie irgendwelche Leute anriefen und über uns herzogen.
»Und was sie betrifft«, erklärten sie, berauscht von der eigenen moralischen Überlegenheit, »man muss sich die Frau doch nur ansehen, um zu wissen, dass sie die ganze Zeit mit drin hing. Gleich und gleich gesellt sich gern.«
Ich habe mir geschworen, diesen Schwätzern keine Beachtung mehr zu schenken, also nehme ich die Batterien raus und vergrabe sie an verschiedenen Stellen im Garten, sodass ich sie später nicht mehr finden werde.
Essen. Das könnte ein Thema werden. Der Taxifahrer, der einzige auf der Insel, ein Mann namens Mícheál Óg Ó’Ceallaigh, der mich und meinen Koffer vom Hafen hergebracht hat, erzählte mir von einem »tollen kleinen Laden« zwischen Pub und Kirche, nur zwanzig Gehminuten von meiner Unterkunft entfernt. Der alte Pub, fügte er hinzu, nicht der neue. Der Spaziergang wird mir guttun. Angeblich ist Bewegung ja gut für die Psyche, und die lässt bei mir definitiv noch zu wünschen übrig. Im Moment habe ich allerdings keinen Hunger, und selbst wenn, Mr Dooley hat offenbar eine Art Verwalter in der Nähe, jedenfalls liegt auf dem Tisch ein frisches Brot, im Kühlschrank sind Butter, Schinken, Eier und Käse, und neben der Haustür steht, in sich zusammengesunken wie ein müder Reisender, ein kleiner Sack Kartoffeln.
Beim Auspacken entdecke ich zu meiner Überraschung einen Kulturbeutel mit Make-up, zum Bersten gefüllt mit dem Versuch, die Wahrheit zu überdecken. Ich erinnere mich nicht, ihn eingesteckt zu haben. Vielleicht unbewusst, nachdem ich jahrelang für unsere Urlaube und Brendans Geschäftsreisen packen musste. Ich breite den Inhalt auf dem Bett aus. Das Versprechen von Jugend abgefüllt in weiße Tuben, Fläschchen und Plastikdöschen, wahrscheinlich an die tausend Euro wert. Ich stopfe das ganze Zeug zurück in den Beutel und werfe alles in den Müll. Rebecca, meine jüngere Tochter, würde ausrasten. Vor ein paar Jahren, sie war gerade vierzehn, wurde sie zur Öko-Aktivistin und schimpfte jedes Mal mit mir, wenn ich etwas wegwarf, das noch völlig in Ordnung war, so wie Männer ihre ersten Frauen. Wie auch immer, ich brauche das Zeug nicht mehr, da ich nicht vorhabe, mich hier zu schminken. Ich werde mir das Gesicht mit Seife waschen, es mit einem rauen Handtuch abtrocknen und mich der Gewalt der Elemente überlassen.
Ich hab nicht viele Sachen mitgenommen, es dauert also nicht lange, sie in den Schrank zu räumen. Ein paar Jeans. T-Shirts. Unterwäsche. Mehrere dicke Wollpullover. Ich hab mich auf die Kälte am Atlantik eingestellt, außerdem gefiel mir die Vorstellung, wie eine Schauspielerin in einer Werbung an den Klippen entlangzulaufen, aufs Meer zu blicken und über die Trümmer meines Lebens nachzudenken. Nur zwei Paar Schuhe. Die, die ich gerade trage, bequeme Turnschuhe, und ein zweites Paar, im Grunde nicht viel besser. Wahrscheinlich hätte ich Wanderschuhe mitnehmen sollen. Hoffentlich kann man hier irgendwo welche kaufen, ich habe nämlich nicht vor, während meines selbst auferlegten Exils aufs Festland zurückzukehren. Sonst muss ich eben mit dem klarkommen, was da ist. Mussten die Menschen schon immer. Viele bis heute.
Die Haustür steht einen Spalt offen, eine Katze schleicht herein, bleibt überrascht stehen, die rechte Vorderpfote noch in der Luft. Sie starrt mich an, als wäre nicht sie, sondern ich der Eindringling.
»Ich habe einen Mietvertrag«, erkläre ich ihr. Sie kneift pikiert die Augen zusammen. »Willst du ihn sehen?«
Ich bin keine große Tierfreundin und hoffe, dass meine Übergriffigkeit sie dazu bringt, wieder zu verschwinden, aber nichts da, sie miaut nur resigniert, marschiert zum Sessel, hüpft drauf und schläft sofort ein. Emma, meine ältere Tochter, hatte sich als Kind einen Hund gewünscht, aber Brendan sagte, er wäre allergisch, noch so eine Behauptung, die ich ihm nie wirklich abgenommen habe. In Wirklichkeit liebte er Ordnung und glaubte, dass Haustiere in der Wohnung zwangsläufig zu Chaos führten. Überall Spielzeug. Körbchen. Wassernäpfe. Urin auf den Fliesen. Heute bedaure ich das. Man hat seine Kinder nur für kurze Zeit bei sich. Es erscheint mir kleinlich, ihnen ihre Wünsche nicht zu erfüllen, vor allem wenn es etwas ist, das ihnen womöglich bedingungslose Liebe schenkt.
Ich lasse meine Gedanken zu meinem Ex-Mann schweifen. Tja, jetzt hat er sein Chaos. Ich frage mich, ob ich über diese Ironie des Schicksals lächeln soll, kann es aber nicht. Streng genommen ist er noch gar nicht mein Ex-Mann. Das ist er nur für mich. Eines Tages werde ich die Kraft aufbringen, mit einem Anwalt zu sprechen, aber im Moment habe ich erst mal genug vom Rechtssystem, und wer weiß, vielleicht stirbt er ja oder wird umgebracht, es würde mir sowohl die Mühe als auch die Kosten ersparen.
In der Hütte gibt es nichts mehr zu tun, also gehe ich nach draußen und sehe mich um. Es ist ein schöner Tag, weder kalt noch warm, nicht mal der Hauch einer Brise weht. In einiger Entfernung stehen ein paar Häuser. Ein gutes Dutzend Rinder und Schafe sprenkeln die Felder meines Nachbarn, dessen Hof auf einem Hügel steht, vielleicht zehn Minuten zu Fuß von meiner Haustür entfernt. »Hier wohne ich jetzt«, sage ich laut. Meine Stimme kommt mir fremd vor. Vielleicht liegt es an der Akustik der Insel, dem dissonanten Zusammenspiel von Wasser, Erde, Feuer und Luft. Kaum zu glauben, dass ich hier gelandet bin.
Vorhin habe ich aus einer Laune heraus auf dem Handy nachgesehen, wo ich vor genau einem Jahr war, und wie sich herausstellte, war es der Morgen, an dem Brendan und ich eine Audienz bei Papst Franziskus in Rom hatten. Der irische Botschafter am Heiligen Stuhl hatte uns vorgestellt und Seiner Heiligkeit erklärt, dies sei der große Brendan Carvin, der im ganzen Land bewundert werde, und wäre Brendan ein Pfau gewesen, hätte er in diesem Moment ein Rad geschlagen und uns alle unter sein buntes Gefieder genommen. Und das ist seine Frau, fügte der Botschafter noch hinzu, ohne mich eines Namens zu würdigen, woraufhin ich eine Art Knicks machte in meinem schwarzen Kleid, das ich extra für diesen Anlass bei Brown Thomas gekauft hatte und das mir fast bis zu den Knöcheln reichte. Auch mein Gesicht war hinter einem Schleier verborgen, vermutlich um den Papst vor jeglicher Versuchung zu schützen.
Franziskus war nicht der erste Papst, dem Brendan und ich die Hand gereicht haben, er war schon der dritte, aber mit Sicherheit der letzte.
Es ist gerade mal drei, und ich weiß jetzt schon nicht, was ich mit dem Rest des Tages anfangen soll. Ich habe ein paar Bücher dabei – in erster Linie Klassiker –, bin aber nicht in der Stimmung zu lesen. Vielleicht gehe ich mir den Laden ansehen. Die Gegend erkunden. Ein bisschen den Appetit anregen und gucken, was es im Pub gibt, sofern sie überhaupt eine Speisekarte haben. Vielleicht betrinke ich mich und tanze auf dem Tisch. Das wär doch mal was, gleich am ersten Abend in einer der beiden Kneipen auf der Insel Hausverbot zu bekommen.
Ich gehe wieder rein, um mein Handy aus der Handtasche zu holen. Als ich das Display berühre, sehe ich zu meinem Erstaunen fünf volle Balken. Also kein WLAN, aber top Empfang. Ich öffne den Chat mit Rebecca und lese mir noch mal durch, was wir zuletzt geschrieben haben, vor über einer Woche. Ohne Rücksicht auf ihre Privatsphäre sagt mir das Handy, dass sie online ist.
Bin angekommen, schreibe ich. Ich bin auf der Insel. Und dann, auch wenn ich keinen Grund zu der Annahme habe: Ich glaube, es würde dir hier gefallen.
Ich schicke die Nachricht ab und beobachte, wie daneben ein graues Häkchen erscheint und dann noch eins. Im nächsten Moment werden sie blau. Sie liest sie also. Es kommt nicht oft vor, dass ich weiß, was meine Tochter gerade macht.
Darunter erscheint das Wort schreibt …
Sie antwortet.
Dann verschwindet es wieder.
Sie hat es sich anders überlegt.
Ihr Profilbild verschwindet ebenfalls. Ich weiß, was das bedeutet. Sie hat mich blockiert. Zumindest vorübergehend. Das macht sie regelmäßig, meistens direkt, nachdem ich sie kontaktiere, aber normalerweise ist das Foto am nächsten Morgen immer wieder da.
Ich lege das Handy auf den Tisch. Eine Sache fehlt noch, bevor ich ins Dorf gehe. Ich muss das kleine gerahmte Foto von Emma, Rebecca und mir aus dem Koffer holen und auf den Tisch stellen, sodass man es vom Sofa aus sehen kann. Es ist schon ein paar Jahre alt, die Mädchen sind darauf zehn und acht. Brendan ist natürlich nicht mit drauf. Ansonsten hätte ich es verbrannt. Aber in gewisser Weise ist er trotzdem da, wahrscheinlich hat er das Foto ja gemacht. Ich überlege, den Rahmen auf den Boden zu werfen, das Bild in Stücke zu reißen und Brendans gespenstischer Gegenwart ein Ende zu bereiten, aber dann hätte ich gar kein Foto von meinen Töchtern mehr. Okay, Rebeccas ist morgen früh wieder da, aber von Emma wird es in diesem Leben keins mehr geben. Mein Versagen als Mutter hat dafür gesorgt.
»Was denkst du?«, frage ich die Katze, die träge ein Auge öffnet und dann, als würde sie ihre anfängliche Furchtlosigkeit noch mal überdenken, vom Sessel springt und durch die Tür nach draußen spaziert. Ich folge ihr in einigem Abstand.
2
Es dauert nicht lange, bis die Inselbewohner auf mich aufmerksam werden. Wahrscheinlich begegnen sie selten Fremden, außer den Touristen in den Sommermonaten, eine Vorstellung, die mich jetzt schon beunruhigt. Zumindest Urlauber aus Dublin könnten mich erkennen, ich werde mich also in Acht nehmen müssen. Natürlich ist es arrogant zu glauben, auf diesem kleinen Atoll würde mich niemand erkennen, andererseits bin ich doch ziemlich überzeugt davon.
Offenbar geht das Gerücht um, eine Frau vom Festland, womit normalerweise Galway, Mayo oder Clare gemeint ist, habe Peader Dooleys Cottage gemietet, und in jedem Laden fragt man mich, ob ich das sei. Wenn ich dann Ja sage, begrüßt man mich mit einer Mischung aus Aufregung und Sorge, vor allem um meine Sicherheit. Allgemein ist man der Ansicht, mein neues Zuhause sei nicht ausreichend isoliert und dass ich, sollte ich dort wohnen bleiben, bestimmt an Unterkühlung sterbe.
»Eigentlich ist es recht warm«, antworte ich der fünften oder sechsten Inselbewohnerin, die mein Ableben prophezeit, und als meine Kassandra mir gerade widersprechen und mir versichern will, dass ich in spätestens einem Monat tot bin, unterbricht ihr Mann sie und sagt, nein, Dooleys Cottage sei aus guten Ziegeln gebaut.
»Die meisten aber nicht«, bemerkt er und kratzt sich an seinem stoppeligen Kinn. Ihm wachsen mehr Haare in den Ohren, in der Nase und an den Augenbrauen als auf dem Kopf, ein befremdlicher Anblick. »Nicht mehr. Und billige Steine lassen die Kälte rein. Aber ein Cottage aus guten Ziegeln wird Sie schützen. Kennen Sie ihn persönlich?«
»Wen?«, frage ich.
»Na, Dooley.«
»Nein.« Ich schüttele den Kopf. »Wir haben bisher nur E-Mails geschrieben. Soweit ich weiß, wohnt er nicht hier.«
»Da drüben.« Er nickt in Richtung Festland. »Sein Vater, Shay Dooley, der hat das Haus gebaut. Mit seinen eigenen Händen. Hat man noch so gemacht, damals. Jetzt weiß ja niemand mehr, wie das geht. Das alte Handwerk stirbt aus.«
Ich versuche mir vorzustellen, wie viel Arbeit in dem Haus steckt. Woher kamen die Ziegel überhaupt? Oder der Mörtel? Wie tief ist das Fundament? Und wo er schon mal dabei war, wäre es so schwer gewesen, eine Dusche einzubauen?
»Sie sind bestimmt Schriftstellerin«, sagt die Frau und lächelt zuversichtlich. »Jede Wette.«
»Wie kommen Sie darauf?«, frage ich.