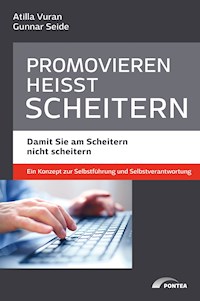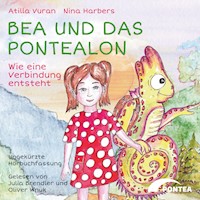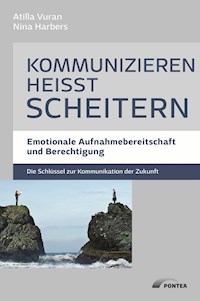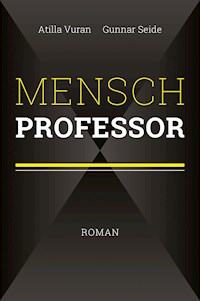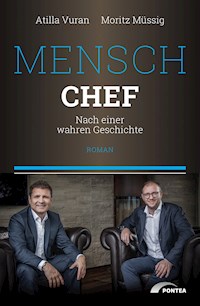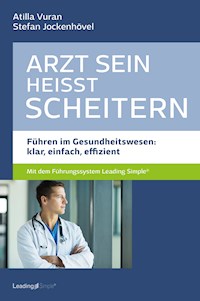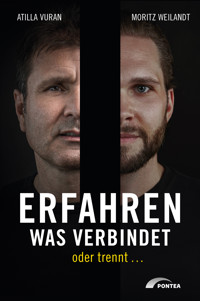
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GABAL Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Dein Erfolg
- Sprache: Deutsch
Eine Beziehung zu haben, bedeutet nicht automatisch, in Verbindung zu sein, und eine Verbindung zu haben, bedeutet nicht automatisch, in einer Beziehung zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der das Verständnis von menschlicher Verbundenheit oft oberflächlich bleibt. Doch wir glauben, dass gerade darin ein ungeahntes Potenzial für ein gelingenderes Leben liegen kann. Vielleicht werden Menschen in 300 Jahren erstaunt auf unsere heutigen Vorstellungen von Beziehungen zurückblicken und sich wundern, wie wenig wir die Möglichkeiten der Verbindung genutzt haben. Dieses Buch soll Sie mit der Freiheit und dem Wissen ausstatten, selbst zu entscheiden, welche der Anregungen Sie in Ihr Leben einfließen lassen möchten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die unsichtbaren Fäden, die uns Menschen verbinden, bewusst steuern – die Beziehungen zu anderen vertiefen und die Nähe spüren, die wir uns meistens wünschen, aber oft nicht erreichen. Wir laden Sie ein, Ihr Leben und das von anderen aus neuen Blickwinkeln wahrzunehmen, um so noch bewusster zu erfahren und zu erleben, was alles verbinden oder trennen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Atilla Vuran
Moritz Weilandt
Erfahren, was verbindet – oder trennt …
Für Nora und Eva
Damit wir immer in Verbindung bleiben.
Atilla Vuran Moritz Weilandt
ERFAHREN, WAS VERBINDET – ODER TRENNT …
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Externe Links wurden bis zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches geprüft. Auf etwaige Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt haben die Autoren keinen Einfluss. Eine Haftung der Autoren ist daher ausgeschlossen.
Ein Hinweis zu gendergerechter Sprache: Bitte beachten Sie: Bei der Beschreibung sämtlicher Inhalte dieses Buches sind stets Personen allen Geschlechts gleichermaßen gemeint. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jedoch oftmals nur die männliche Form verwendet (z. B. Mitarbeiter).
ISBN Buchausgabe: 978-3-96739-242-5
ISBN ePUB: 978-3-96740-540-8
Im Vertrieb von: GABAL Verlag GmbH, Schumannstraße 155, D-63069 Offenbach, [email protected]
Textredaktion: Dr. Nina Harbers, PONTEA AG
Umschlaggestaltung: Martin Zech Design, Bremen, www.martinzech.de
Lektorat: Anja Hilgarth, Herzogenaurach
Autorenfotos: module+ GmbH, Flurlingen, www.moduleplus.ch
Layout und Satz: ZeroSoft, Timisoara
© 2025 GABAL Verlag GmbH, Offenbach
Das E-Book basiert auf dem 2025 erschienenen Buchtitel "Erfahren, was verbindet – oder trennt …" von Atilla Vuran und Moritz Weilandt.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Inhalt
Warum dieses Buch
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil 1: Das Konzept der Verbundenheit
Beziehung und Verbindung
Das Wichtigste in Kürze
Komplexität und Verbindung
Das Wichtigste in Kürze
Verbindung durch Emotionale Aufnahme bereitschaft und Berechtigung
Aufnahmebereitschaft als Kompetenz
Filter der Aufnahmebereitschaft
Individuelle Filter
Soziale Filter
Physiologische Filter
Verschiedene Richtungen von Verbindungen
Verbindung zu uns selbst
Verbindung von anderen zu uns
Verbindung von uns zu anderen
Führung und Kommunikation in vier Quadranten
Interesse
Ignoranz
Dominanz
Entwicklung
Das Wichtigste in Kürze
Emotionale Stabilität als Voraussetzung
Das Wichtigste in Kürze
Teil 2: Verbundenheit in verschiedenen Lebensbereichen
Verbundenheit im Bereich „Arbeit“
„Am Tisch sitzen“
Wertekonflikte im Integrationsprozess
Wertekonflikt „Ergebnis – Status“
Wertekonflikt „Verantwortung – Beliebtheit“
Wertekonflikt „Klarheit – Sicherheit“
Wertekonflikt „Auseinandersetzung – Harmonie“
Wertekonflikt „Vertrauen – Unverwundbarkeit“
Transformation der Wertekonflikte
Verbundenheit in der beruflichen Praxis fördern
Der Dreiklang „Aufnehmen – Annehmen – Transformieren“
Auswirkungen bei Störung des Dreiklangs
Konkrete Anwendungsfälle für Verbundenheit im Bereich „Arbeit“
Anwendungsfall 1: Neue Mitarbeiter
Anwendungsfall 2: Neue Führungskraft
Anwendungsfall 3: Familiennachfolge
Anwendungsfall 4: Kündigungen
Anwendungsfall 5: Integration von HR
Gängige Fallen und Stolpersteine im Bereich „Arbeit“
Falle 1: Beteiligung wünschen, aber nicht wollen
Falle 2: Überzeugen wollen
Falle 3: Davon ausgehen, dass Menschen von selbst aufnahmebereit sind
Ausblick: Zukunft der Führung in Organisationen
Das Wichtigste in Kürze
Verbundenheit im Bereich „Familie und Alltag“
Selbstwertgefühl
Wissenschaftlicher Hintergrund
Die verschiedenen Arten des Selbstwertgefühls
Quellen für ein authentisches Selbstwertgefühl
Das Selbstwertgefühl im Wandel der Zeit
Verbundenheit im Alltag fördern
Selbstwertmomente nutzen
Bewusst wahrnehmen
Sich innerhalb der Familie „an den Tisch setzen“
Am Tisch sitzen, bevor Sie Eltern werden
Am Tisch sitzen, wenn das erste Kind da ist
Immer wieder am Tisch sitzen, während die Kinder heranwachsen
Am Tisch sitzen, wenn die Kinder ausziehen
Am Tisch sitzen, wenn die Kinder eine eigene Familie gründen
Am Tisch sitzen, bevor Sie sich vom Partner trennen
Gängige Fallen und Stolpersteine im Bereich „Familie und Alltag“
Falle 1: Das Selbstwertgefühl von überzogenem Ideal abhängig machen
Falle 2: Sich vom Grundbedürfnis der Beachtung lossagen wollen
Falle 3: Sich nicht selbst beachten
Das Wichtigste in Kürze
Verbundenheit im Bereich „Partnerschaft“
Kognitive Unterscheidungen
Motivationale Merkmale
Merkmale der Informationsverarbeitung
Verbundenheit in der Partnerschaft fördern
Kognitive Unterscheidungen erkennen und anwenden
Eine Beziehungskultur entwickeln
Praktische Konzepte für eine gelingende Beziehung im Alltag
Konzept 1: Bitten Sie um das, was Sie brauchen
Konzept 2: Nehmen Sie an, was Sie bekommen
Konzept 3: Zeigen Sie Dankbarkeit für das, was Sie erhalten
Konzept 4: Zeigen Sie Ihre Verletzbarkeit
Konzept 5: Sorgen Sie für Ausgleich
Konzept 6: Halten Sie Wort
Konzept 7: Lösen Sie Konflikte konstruktiv
Kränkungen in der Partnerschaft überwinden
Gängige Fallen und Stolpersteine im Bereich „Partnerschaft“
Falle 1: Mangelndes Interesse am Partner
Falle 2: Eine Kränkung als „Kriegserklärung“ sehen
Falle 3: Die Instabilität des Partners beseitigen wollen
Das Wichtigste in Kürze
Verbundenheit im Bereich „Freundschaften“
Vertrauen, Vertrautheit und Glaubwürdigkeit
Vertrauen und Vertrautheit
Vertrauen und Glaubwürdigkeit
Aspekte der Verbundenheit in Freundschaften
Aspekt 1: Glaubwürdigkeit
Aspekt 2: Andersartigkeit und Vielfalt
Aspekt 3: Unabhängigkeit
Aspekt 4: Verhalten in schwierigen Zeiten
Aspekt 5: Umgang mit Trennungen
Aspekt 6: Freundschaft zu sich selbst
Verlorene Verbundenheit gezielt wiederherstellen
Gängige Fallen und Stolpersteine im Bereich „Freundschaften“
Falle 1: Dem anderen die Welt erklären wollen
Falle 2: Zwingende Konstanz erwarten
Falle 3: Nicht loslassen können
Das Wichtigste in Kürze
Ausblick in die Zukunft und Fazit
Schlusswort
Literatur- und Quellenverzeichnis
Die Autoren
Warum dieses Buch
Kennen Sie diese Momente? Wenn ein kleines Kind zum ersten Mal mit seinen winzigen Fingern ins Essen greift und es – vielleicht noch unbeholfen – in den Mund befördert, dann leuchten die Augen der Eltern. Ein strahlendes Lächeln, voller Stolz und Freude. „Schau nur, unser Kind isst ganz allein!“ Kurze Zeit später, wenn das Kind seine ersten wackeligen Schritte macht, stockt der Atem. Jeder kleine Schritt fühlt sich an wie ein riesiger Meilenstein. „Unser Kind kann laufen!“ Und wenn aus seinem Mund zum allerersten Mal ein zögerliches „Ma-ma“ oder „Pa-pa“ kommt, gibt es kein Halten mehr. Dieser Moment wird gefeiert, als hätte das Kind soeben die Welt verändert.
In diesen Augenblicken entwickeln und zeigen die meisten Eltern ein tiefes Vertrauen in das Kind, einen Glauben an seine Fähigkeiten. Eltern reagieren in der Regel intuitiv, sie stellen eine tiefe, bedingungslose Verbindung her. Sie bringen sich ein, oft spielerisch – mit einem Löffel, der zum Flugzeug wird, das sanft im offenen Mund des Kindes landet. Aber warum tun sie das? Weil sie mehr wollen als nur lehren. Sie möchten Nähe, sie möchten diese magische Bindung spüren, die im Hintergrund all dieser kleinen großen Momente schwingt. Es ist die Verbindung zu ihrem Kind, die alles verändert. Und genau diese Verbindung lässt uns als Menschen wachsen – nicht nur in den ersten Lebensjahren, sondern ein Leben lang.
Jeder Mensch erblickt das Licht der Welt mit vier emotionalen Grundbedürfnissen – Nähe, Freiheit, Entwicklung und Selbstwert.1 Ein Kind sucht intuitiv den Kontakt zu seinen Eltern und will das Gefühl von Nähe. Zudem möchte es frei sein und Einfluss gewinnen, manchmal sogar so stark, dass man den Eindruck gewinnen könnte, es sei kurzzeitig nicht mehr an einer gemeinsamen Verbindung interessiert. Es möchte jeden Tag lernen und neue Dinge entdecken. Und während es sich in diesem Spannungsfeld bewegt, möchte es zudem ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln und aufrechterhalten. Dass zwischen diesen wichtigen Bedürfnissen Konflikte vorprogrammiert sind, ist verständlich.
Seit mehr als 20 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Prinzip „eine Verbindung aufbauen“ – sowohl durch intensive Reflexion als auch durch das tagtägliche Erleben in der Arbeit mit unseren Kunden. Unsere Erfahrungen und Erkenntnisse daraus haben wir in diesem Buch zusammengetragen. Die Lektüre kann Sie dabei unterstützen, ein (noch) höheres Bewusstsein dafür zu bekommen, wie Menschen über verschiedene Lebensbereiche hinweg bewusst oder auch unbewusst miteinander Verbindungen aufbauen oder verlieren können. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die unsichtbaren Fäden, die uns Menschen verbinden, bewusst steuern – die Beziehungen zu anderen vertiefen und die Nähe spüren, die wir uns meistens wünschen, aber oft nicht erreichen. Wir laden Sie ein, Ihr Leben und das von anderen aus neuen Blickwinkeln wahrzunehmen, um so noch bewusster zu erfahren und zu erleben, was alles verbinden oder trennen kann.
Wir leben in einer Zeit, in der das Verständnis von menschlicher Verbundenheit oft oberflächlich bleibt. Doch wir glauben, dass gerade darin ein ungeahntes Potenzial für ein gelingenderes Leben liegen kann. Vielleicht werden Menschen in 300 Jahren erstaunt auf unsere heutigen Vorstellungen von Beziehungen zurückblicken und sich wundern, wie wenig wir die Möglichkeiten der Verbindung genutzt haben.
Dieses Buch soll Sie mit der Freiheit und dem Wissen ausstatten, selbst zu entscheiden, welche der Anregungen Sie in Ihr Leben einfließen lassen möchten. Wir erheben dabei keinen Anspruch auf Allwissenheit oder Vollständigkeit, sondern möchten Ihnen Impulse geben, damit Sie selbst herausfinden, wie Sie Ihre Verbindungen stärken können. Und vielleicht auch, wo es sinnvoll ist, Distanz zu wahren. Denn nicht jede Beziehung muss zwingend vertieft werden.
Mit diesem Buch möchten wir Sie hierzu einladen – nicht belehren. Es wird Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle herausfordern, Ihre bisherigen Überzeugungen zu hinterfragen oder sogar ganz neue Wege in Ihren Beziehungen zu gehen.
1
Grawe, 2004, Häusel, 2012
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Der erste Teil dieses Buches untersucht, was genau es eigentlich bedeutet, wirklich in Verbindung zu sein. Warum verlieren wir so oft den Kontakt zu anderen, obwohl wir uns nach Nähe sehnen? Und was genau ist der Unterschied zwischen einer Verbindung und einer Beziehung? Auf anschauliche Weise führt Sie dieser Teil näher an das Konzept der Verbundenheit heran und lässt Sie die Dynamiken erkennen, die zwischen uns allen wirken.
Im zweiten Teil tauchen wir noch tiefer ein und nehmen vier zentrale Lebensbereiche – Beruf, Familie und Alltag, Partnerschaft und Freundschaften – unter die Lupe. Hier erfahren Sie anhand echter Situationen, wie das Prinzip von Verbindung und Beziehung Ihr Leben positiv verändern kann. Sie finden keine starren Regeln, sondern Empfehlungen, die Sie befähigen können, Ihre eigene Richtung zu finden. Jeder Mensch ist einzigartig, jede Beziehung anders. Aber genau darin liegt der Reiz: Sie lernen Prinzipien kennen, wie Sie mehr Verbundenheit in Ihrem Leben schaffen können – ohne dass wir Ihnen vorschreiben, wie Sie handeln müssen.
Vielleicht werden Sie an manchen Stellen Fragen haben, sich irritiert fühlen oder auf provokative Aussagen stoßen. Das ist beabsichtigt. Dieses Buch soll Ihnen keine fertigen Lösungen anbieten – es soll Sie dazu anregen, nachzudenken und Ihre Differenzierungsfähigkeit (mehr dazu gleich im Teil 1 im Kapitel „Beziehung und Verbindung“) weiterzuentwickeln.
Jedes Kapitel zu den Lebensbereichen beginnt mit einer Beispielgeschichte, die eine Identifikation mit dem Thema schaffen soll. Die Geschichten basieren auf Erlebnissen und wahren Geschichten aus unserer persönlichen Erfahrung und täglichen Arbeit mit unseren Kunden. Aus Vertraulichkeitsgründen wurden hier die Namen der Beteiligten geändert. Vielleicht erkennen Sie sich oder Menschen in Ihrem Umfeld in diesen Erzählungen wieder. Anschließend bieten wir Ihnen hilfreiche Theorien und Überlegungen, die das Thema Verbindung und Beziehung vertiefen. Schließlich gibt es noch praxisnahe Anregungen für mehr Verbundenheit im Alltag, und wir weisen auf häufige Fallen hin.
Teil 1 Das Konzept der Verbundenheit
Beziehung und Verbindung
Haben Sie schon einmal eine Situation erlebt wie die folgende? Sie haben sich monatelang bemüht, Ihren Partner, einen guten Freund oder vielleicht sogar ein Familienmitglied von etwas zu überzeugen, das Ihnen wirklich am Herzen liegt. Vielleicht ging es um eine Idee, ein politisches Argument, die Veränderung einer alten Gewohnheit oder eine neue, gemeinsame Aktivität. Sie haben sich die besten Argumente zurechtgelegt, vielleicht sogar emotionale Appelle genutzt, um Ihr Gegenüber zu bewegen – doch nichts hat sich geändert. Es schien, als ob Sie gegen eine unsichtbare Mauer redeten.
Und dann passiert es: Eines Abends erzählt Ihr Gesprächspartner Ihnen, strahlend vor Begeisterung, dass er sich endlich entschieden hat, seine Einstellung zu ändern. Sie hören zu, verwundert, wie er plötzlich all die Argumente und Ideen wiederholt, die Sie ihm schon so oft vorgetragen haben. Doch er schreibt diese Inspiration nicht Ihnen zu, sondern erzählt, dass ein Kollege oder ein Freund ihm beim gemeinsamen Abendessen „plötzlich die Augen geöffnet“ hat. Genau das, was Sie immer wieder versucht haben zu vermitteln, wird nun als völlig neue Erkenntnis gefeiert.
Was ist hier geschehen? Trotz Ihrer guten Beziehung gab es in diesem Punkt keine echte Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber und der andere war nicht aufnahmebereit für Ihre Idee. Stattdessen war es der besagte Kollege oder der Freund, der die Brücke zu Ihrem Gesprächspartner bauen konnte.
An dieser Stelle möchten wir präzisieren, was wir unter „Beziehung“ verstehen:
„Beziehung“ wird im Duden definiert als „Verbindung, Kontakt zwischen Einzelnen oder Gruppen, ein innerer Zusammenhang oder wechselseitiges Verhältnis“2. Diese Definition möchten wir wie folgt ergänzen: Wenn wir von „Beziehung“ sprechen, meinen wir damit das Vorhandensein von gemeinsamen Werten und Zielen. Eine Beziehung bildet sich über geteilte Erfahrungen und kann einen großen Einfluss darauf haben, ob, und wenn ja, welche Art von Verbindung daraus aufgebaut werden kann. Beziehungen entstehen über die Zeit und tendieren dazu, sich in gewohnten Bahnen zu verfestigen. Sie können auch zur Routine werden.
Zur Veranschaulichung dient folgendes Beispiel:
Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag, die Luft ist warm, und im Lieblingspark zweier Rentner blüht das Leben. Wie jede Woche treffen sich die beiden um 15 Uhr, setzen sich nebeneinander auf ihre gewohnte Bank und blicken in die Weite des Parks. Der eine beginnt zu sprechen – über den letzten Arztbesuch, über die neusten Beschwerden, vielleicht auch über ein aktuelles politisches Thema. Der andere hört zu, zumindest scheint es so. Doch während die Worte an ihm vorbeiziehen, schweifen seine Augen ab, wandern zu den vorbeigehenden Passanten, zu den Vögeln, die zwischen den Bäumen umherschwirren. Gelegentlich bringt er ein zustimmendes Brummen hervor, doch es ist mechanisch, fast automatisch. Keine Fragen werden gestellt, kein echtes Interesse am Gegenüber bekundet. Dann ist er an der Reihe und erzählt, auch mehr für sich selbst. Es ist ein Ritual, eine eingespielte Choreografie der Gespräche, die die beiden seit Jahren pflegen. Nach genau 60 Minuten, als ob eine unsichtbare Uhr sie steuern würde, stehen beide auf, lächeln freundlich, bedanken sich für das „Gespräch“ und vereinbaren ihr Treffen für die nächste Woche.
Die beiden pflegen ihre Beziehung, indem sie sich regelmäßig sehen und miteinander Zeit verbringen, doch eine echte Verbindung entsteht nicht. Jeder kreist nur um seine eigenen Themen, gefangen in seiner eigenen Welt. Es ist fast, als ob sie sich gegenseitig Gesellschaft leisten, ohne wirklich präsent zu sein. Die Tiefe, das aufrichtige Interesse an der Perspektive des anderen – all das ist nicht vorhanden.
Im Gegensatz zu einer Beziehung geht es bei einer Verbindung darum, sich vollständig auf den Gesprächspartner zu konzentrieren und zu versuchen, dessen Gefühle und Gedanken wirklich zu verstehen. Es geht darum, nicht nur die Worte zu hören, sondern auch die dahinterliegenden Emotionen und Absichten wahrzunehmen. Dies wird durch eine (gute) Beziehung zueinander zwar erleichtert, eine Verbindung ist aber auch ohne eine gegenseitige Beziehung möglich und stark an den Moment, das Hier und Jetzt, geknüpft.
Unser Gehirn bevorzugt den „Energiesparmodus“. Daher läuft ein Großteil der mentalen Prozesse, z. B. automatisierte Abläufe wie etwa Gewohnheiten, aber auch die Art, wie Menschen Verbindungen aufbauen und verlieren, meist unbewusst ab. Um hier Entwicklung zu ermöglichen, ist es entscheidend, das eigene Bewusstsein zu schärfen. Da jedoch nur solche Informationen in das Bewusstsein eines Menschen dringen, die mit bereits bestehendem Wissen und Erfahrungen assoziiert werden können, braucht es qualitative Differenzierungen, damit sich die Wahrnehmung und damit die Haltung verändern kann und so Raum ist für neue Verbindungen.
Stellen Sie sich zur Verdeutlichung gerne ein Kind vor, das ein Auto sieht. Bevor es versteht, was ein Auto ist, unterscheidet es nur, ob es sich zu Fuß oder auf vier Rädern bewegt. Später erst erkennt es, dass ihm eine spezifische Kompetenz fehlt, nämlich, das Auto auch selbst steuern zu können. Durch diese neue Art der Wahrnehmung entsteht auch ein anderes Empfinden (womöglich Interesse am Autofahren), wodurch eine neue Erkenntnis entstehen kann (Ich möchte auch mal ein Auto fahren können!). Durch diese neue Erkenntnis verändert sich das Bewusstsein, und dieses beeinflusst unmittelbar, welche innere Haltung das Kind später zum Autofahren einnehmen wird (z. B. mit Engagement Fahrunterricht nehmen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen).
Das Gleiche gilt für verschiedene Differenzierungen, die Sie hier im Buch kennenlernen werden. Es ändert sich vielleicht Ihre Wahrnehmung und Sie betrachten Situationen aus einem neuen Blickwinkel. Dadurch ändert sich womöglich Ihr Empfinden der Situation (z. B. von Frustration zu Verständnis). Durch dieses andere Empfinden könnten Sie neue Erkenntnisse gewinnen und im Anschluss Ihre Haltung ändern – und auf eine andere Art Verbindungen herstellen.
In der Qualität Ihrer Differenzierung liegt demnach eine wichtige Grundlage, um Menschen anders zu begegnen. Falls Sie Ihre eigene Differenzierungsfähigkeit in der Kommunikation reflektieren, erweitern oder auf den Prüfstand stellen möchten, empfehlen wir Ihnen die Lektüre des Buches „Kommunizieren heißt scheitern“ von Atilla Vuran und Nina Harbers.3
Das Wichtigste In Kürze
□
Eine
Beziehung
entsteht durch gemeinsame Werte, Ziele und geteilte Erfahrungen und verfestigt sich über die Zeit. Die Art der Beziehung beeinflusst dabei die Möglichkeit und Art der
Verbindung
zu einem Gegenüber.
□
Eine
Verbindung
erfordert die vollständige Konzentration auf den Gesprächspartner und zielt darauf ab, dessen Gefühle und Gedanken zu verstehen. Eine Verbindung kann auch ohne eine Beziehung zueinander entstehen und ist stark im Hier und Jetzt verankert.
□
Die Fähigkeit zur
Differenzierung
ist grundlegend für den Aufbau von Verbindungen.
2
Duden online, 2025
3
Vuran, Harbers, 2020
Komplexität und Verbindung
Empfinden Sie die Bedienung Ihres Smartphones als komplex? Oder ist es doch eher kompliziert? Komplizierte Systeme bestehen aus vielen Einzelteilen und sind daher ohne Fachwissen nur schwer begreifbar. Alles, was nicht lebt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eher kompliziert als komplex. Denken Sie etwa an Ihr Auto, an Ihre Steuererklärung oder an Ihren Laptop. Mit genügend Fachwissen lassen sich alle komplizierten Probleme lösen. Dafür lässt sich auch gut auf Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder auf den Rat von Experten zurückgreifen.
Komplex ist ein System dann, wenn es vielfältige Teile enthält, die untereinander auf verschiedenste Arten verknüpft sind und in unbekannten Wechselwirkungen stehen können. Dies gilt in erster Linie für „lebende Systeme“: Wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, können sie nie genau wissen, was das Ergebnis sein wird. Somit lässt sich auch nie wirklich vorhersagen, wie sich Ihr Gegenüber im nächsten Moment verhalten wird.
Als Analogie kann Ihnen Folgendes dienen: Ein Pilot lernt alles über einen bestimmten Flugzeugtyp. So ist er in der Lage, die Technik zu verstehen und das Flugzeug zu fliegen. Wenn er während des Fluges jedoch in ein Unwetter gerät, kann es herausfordernd für ihn werden, denn das Wetter lässt sich nicht beherrschen. Es gibt zwar Checklisten für solche Situationen, jedoch keine pauschale Schritt-für-Schritt-Anleitung, um jedes Unwetter unbeschadet zu überstehen. Was dem Piloten jetzt hilft, sich zu orientieren und mit den Turbulenzen erfolgreich umzugehen, sind sein Differenzierungsvermögen und seine Erfahrung.
Genauso verhält es sich, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu Menschen aufzubauen.
Dies eröffnet folgende Betrachtung menschlicher Kommunikation: Einschlägige grobe Differenzierungen wie Typologien, Persönlichkeitsmodelle oder Ähnliches können zwar für eine grundlegende Orientierung sorgen, missachten dabei aber gleichzeitig oftmals die menschliche Komplexität. Sie führen in Versuchung, sich im Umgang mit der Unvorhersehbarkeit an starre Rezepte zu halten, und lassen die Anwender nach einiger Zeit nicht selten frustriert zurück.
Es gilt: Wer komplexe Systeme kontrollieren oder beherrschen möchte, zerstört damit ihre Natur.
Eine grobe Vereinfachung ist zwar wirksamer als keine Differenzierung, wird jedoch dem Menschen nicht gerecht. Allzu einfache Kategorien wie „richtig und falsch“, „schwarz und weiß“ sind wenig wirksam im Umgang mit Komplexität. Da jede Bearbeitung von Komplexität immer Selektion benötigt, ist es entscheidend, mit welchem Bewusstsein selektiert wird.
Angenommen, Sie haben Probleme mit Ihrer Kniescheibe und sollen operiert werden. Kurzfristig werden Sie von Zimmer 7 in Zimmer 9 verlegt, doch der leitende Pfleger hat die Kollegen noch nicht informiert. Während Sie im Krankenhausbett liegen und auf die Visite warten, hören Sie die Ärztin auf dem Gang sagen: „Hat jemand die Kniescheibe aus Zimmer 7 gesehen?“ Würden Sie sich jetzt als Mensch mit all Ihren Möglichkeiten und Facetten gesehen und anerkannt fühlen? Vermutlich nicht.
Es wird deutlich, dass in der Kommunikation eine höhere Differenzierungsfähigkeit erforderlich ist, um die Komplexität des Lebens gerecht abzubilden. Der Versuch, diese Komplexität zu reduzieren oder Vereinfachungen vorzunehmen, um Menschen begreifbarer zu machen, kann also nicht der Schlüssel sein. Vielmehr geht es darum zu lernen, die Komplexität zu führen.
Um mit Komplexität wirkungsvoll umzugehen, benötigt es nicht nur zahlreiche, sondern auch qualitativ hochwertige Unterscheidungen. Des Weiteren braucht es Übung darin, Beobachtungen bei sich selbst und dem Gegenüber nicht sofort zu bewerten, sondern zunächst präziser zu beschreiben. Dieser Ansatz kann Ihnen mit der Zeit tiefere Einblicke in (komplexe) Zusammenhänge eröffnen und Ihre Spielräume erweitern, um Einfluss auszuüben. Es geht also darum, kontinuierlich zu üben, auch mal zu scheitern, zu reflektieren und weiter zu üben, um die Komplexität menschlicher Kommunikation langfristig führen zu können.
Jeder, der sich ernsthaft mit Komplexität auseinandersetzen möchte, sollte auch die Fähigkeit entwickeln, Kontingenzen auszuhalten.4 Eine Kontingenz beschreibt das Zusammenfallen von Umständen oder eine unsichere Möglichkeit, die weder notwendig noch unmöglich ist. Ein Ereignis (z. B. ein Lottogewinn) ist kontingent, da es eintreten kann, aber nicht zwingend eintritt.
Sie sitzen in einem Restaurant und schauen auf eine Speisekarte voller Möglichkeiten. Ein vertrautes Pasta-Gericht, das Sie bereits in- und auswendig kennen, steht neben einem verlockenden exotischen Curry, das Sie noch nie probiert haben. Beide Optionen stehen Ihnen offen; keine ist zwingend notwendig oder ausgeschlossen. In diesem Moment müssen Sie entscheiden: Wählen Sie das Pasta-Gericht, das Ihnen Sicherheit gibt, oder wagen Sie den Sprung ins Unbekannte mit dem Curry? Diese Entscheidung ist kontingent und hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Fähigkeit, mit Kontingenz umzugehen, bedeutet, Unsicherheiten zu akzeptieren und sich darauf einzulassen, dass beide Entscheidungen unterschiedliche Ergebnisse bringen könnten.
In der Praxis bedeutet dies, dass Sie in der Kommunikation die Flexibilität besitzen sollten, auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren und kreative Lösungen zu entwickeln, ohne sich von Unsicherheiten lähmen zu lassen. Diese Denkweise kann Ihnen neue Horizonte für Innovation eröffnen, indem sie Raum für alternative Lösungswege und frische Ideen schafft. Sie kann Sie ermutigen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und das Potenzial in der Vielfalt der Möglichkeiten zu erkennen, anstatt in der Enge des Gewohnten festzustecken.
Wenn Sie verstehen und akzeptieren, dass jede Situation auch anders sein könnte, werden Sie offener für neue Perspektiven. Diese proaktive Haltung kann es Ihnen ermöglichen, aktiv an der Gestaltung Ihrer Zukunft mitzuwirken und Ihre Fähigkeit zur Verbindung mit anderen Menschen erheblich zu erweitern.
Das Wichtigste In Kürze
□
Das menschliche Gehirn neigt dazu, im „Energiesparmodus“ zu arbeiten, sodass viele Prozesse, wie Gewohnheiten und zwischenmenschliche Verbindungen, unbewusst ablaufen. Um das Bewusstsein zu schärfen und die Fähigkeit, Verbindungen aufzubauen, zu fördern, ist es entscheidend, die eigene Differenzierungsfähigkeit zu verbessern.
□
Komplizierte Systeme bestehen aus vielen Einzelteilen, die mit Fachwissen verständlich werden (z. B. Autos, Steuererklärungen). Komplexe Systeme, wie die menschliche Kommunikation, sind unvorhersehbar und bestehen aus vielfältigen Wechselwirkungen. Komplexität kann nicht einfach reduziert, sondern muss geführt werden.
4
Luhmann, 1984
Verbindung durch Emotionale Aufnahme bereitschaft und Berechtigung
Noch nie gab es so viele Ressourcen zum Thema „Kommunikation“ wie heute. Bücher, Seminare, Online-Kurse – das Angebot ist schier endlos. Überall gibt es Texte, Ratgeber und Videos, die versprechen, uns zu besseren Kommunikatoren zu machen. Und doch: Die Missverständnisse zwischen uns Menschen scheinen nicht weniger, sondern mehr zu werden. Wie kann das sein? Warum verstehen wir einander oft weniger, obwohl uns so viel Wissen zur Verfügung steht? Ein teilweise mangelndes Bewusstsein für nonverbale Signale, starre Annahmen und vorgefertigte Denkmuster verstellen uns den Weg zu echter Verbindung. Wir hören nicht wirklich hin, sehen nicht wirklich, was unser Gegenüber uns zu sagen versucht – nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit Gesten, Blicken und seiner Haltung.
Nach unserer Einschätzung ist das kollektive Bewusstsein der Menschheit zur Differenzierung in zwischenmenschlichen Interaktionen, insbesondere in westlich geprägten, hochentwickelten Ländern, derzeit noch ausbaufähig. Ein Grund hierfür ist, dass der Fokus in der gesellschaftlichen Ausbildung und Entwicklung bisher vorrangig auf den Erwerb von inhaltlicher Kompetenz gelegt wird. Zudem wird oftmals versucht, kommunikative Kompetenz nur auf Basis von möglichst schnell erlernbaren Techniken und Wissen zu entwickeln. Dies ist per se nicht grundsätzlich negativ zu bewerten, da somit oftmals kurzzeitig die eigene kommunikative Wirkung erweitert wird. Entscheidend innerhalb der Kommunikation ist jedoch, ob Sie eine echte Verbindung zu Ihrem Gegenüber aufbauen können, indem Sie gegenseitige Aufnahmebereitschaft herstellen. Wenn Sie lernen, die Nuancen des Gesprächs zu erkennen und die subtilen Signale der Verbindung wahrzunehmen, können Sie Ihre Kommunikationsweise erheblich verbessern und somit die Grundlage für eine erfolgreiche Interaktion schaffen – gleichzeitig reduzieren Sie eine Menge unnötigen Frust.
Wie wurden Sie bisher in dem Bewusstsein entwickelt, eine Verbindung zu Ihrem Gegenüber wahrzunehmen und aufzubauen? Haben Sie dies vielleicht bereits in der Schule gelernt? Oder haben Sie hier zum ersten Mal davon gehört, dass Verbindung und Beziehung sich voneinander unterscheiden?
Aufnahmebereitschaft als Kompetenz
Die meisten Menschen streben in der Kommunikation zwar grundsätzlich danach, eine Verbindung zu ihrem Gegenüber herzustellen. Doch oft sind sie dabei so sehr mit sich selbst oder ihrem eigenen Inhalt beschäftigt, dass sie entweder nur rein zufällig eine Verbindung aufbauen – oder gar keine. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die gegenseitige emotionale Aufnahmebereitschaft. Sie können sich diese wie eine Brücke vorstellen: Wenn sie stark und stabil ist, entsteht im Gespräch Resonanz. Ihr Gegenüber hört Ihnen zu, versteht Ihre Botschaft und lässt sich darauf ein. Doch fehlen einige Bretter oder ist die Brücke beschädigt, wird es schwierig, die andere Person wirklich zu erreichen.
Es gibt entscheidende Faktoren, die bestimmen, ob diese Brücke stabil und tragfähig wird:
Wenn Ihnen nicht völlig klar ist, WAS Sie vermitteln wollen, wird es fast unmöglich, sich auf den Prozess – also auf die Art und Weise, WIE Sie es sagen – zu konzentrieren. Sie übersehen vielleicht wichtige Signale wie die Körpersprache Ihres Gegenübers oder andere subtile Hinweise.
Gleichzeitig sind nicht nur das WAS und WIE entscheidend, sondern auch das WANN. Manchmal ist einfach der falsche Zeitpunkt, und die Brücke baut sich gar nicht erst auf.
Von außen betrachtet wirken diese Faktoren oft einfach und logisch. Doch ein besonders faszinierender Aspekt ist, ob Sie überhaupt die BERECHTIGUNG haben, Ihr Gegenüber zu „führen“ – ob Sie also den nötigen Einfluss in der Beziehung besitzen, dass Ihre Worte Gewicht haben. Diese Berechti gung entscheidet darüber, wie sehr Ihr Gegenüber Ihre Meinung schätzt und Ihre Rückmeldungen annimmt.
Ihre Fähigkeit, sich dieser Faktoren bewusst zu sein und sie zu steuern, bestimmt maßgeblich Ihre kommunikative Kompetenz. Diese wiederum beeinflusst direkt die emotionale Aufnahmebereitschaft Ihres Gegenübers – also die Intensität, mit der Ihre Botschaft beim anderen ankommt. Eine hohe gegenseitige Aufnahmebereitschaft entspricht einer tiefen, stabilen Verbindung zwischen zwei Menschen. Die Brücke ist stark, und die Chance, dass Ihr Gegenüber Ihre Ideen nicht nur hört, sondern auch verinnerlicht und umsetzt, steigt deutlich.
Die Aufnahmebereitschaft wird zusätzlich stark durch die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber geprägt. Je größer das Vertrauen und der Respekt in dieser Beziehung sind, desto mehr Stabilität erhält die Brücke. Ihre Beziehung beeinflusst, wie tief und nachhaltig Sie mit der anderen Person in Kontakt treten können.
Vielleicht haben Sie selbst schon einmal folgende Szene erlebt: Zwei Erwachsene stehen vertieft im Gespräch, als plötzlich ein Kind dazukommt. Es schaut neugierig auf, versucht still, die Aufnahmebereitschaft des Elternteils zu erlangen. Doch die Erwachsenen reagieren nicht. Also beginnt das Kind ungeduldig am Bein des Elternteils zunächst zu zupfen, dann immer heftiger zu zerren und schließlich lautstark den Namen zu rufen. Aber was will das Kind in diesem Moment wirklich?
Es geht dem Kind in dem Moment nicht nur darum, einfach gehört zu werden. Vielmehr hat es intuitiv etwas unglaublich Wichtiges verstanden: Bevor es überhaupt seine Wünsche äußern kann, sucht es nach einer Verbindung – es will sicherstellen, dass es die Aufnahmebereitschaft hat, bevor es seinen „Inhalt“ mitteilt. Diese tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit ist der Schlüssel, um miteinander in Resonanz zu treten.
Doch was passiert, wenn diese Versuche des Kindes immer wieder ignoriert werden? Es lernt, dass es sich andere, vielleicht lautere oder auffälligere Strategien ausdenken muss, um eine Verbindung zu bekommen.
Und genau hier zeigt sich, was wirkliche kommunikative Kompetenz bedeutet: Bevor wir Inhalte teilen, sollten wir immer nach einer Verbindung suchen und eine Brücke der emotionalen Aufnahmebereitschaft zu unserem Gegenüber bauen, die diesem das Gefühl gibt, gehört und verstanden zu werden.
Filter der Aufnahmebereitschaft
Um mit der immensen Informationsflut umzugehen, die das Gehirn in jedem Moment erreicht, besitzen wir Wahrnehmungsfilter. Diese wirken wie eine Art Türsteher, der entscheidet, welcher Teil der Wirklichkeit in unser bewusstes Erleben dringt. Dies geschieht dabei nicht zufällig, sondern beruht auf unseren bisherigen Erfahrungen, Überzeugungen, Erwartungen und Emotionen. Wahrnehmungsfilter sind lebensnotwendig, um uns im Alltag orientieren und angemessen auf Situationen reagieren zu können. Zusammengefasst bestimmen unsere Wahrnehmungsfilter, was wir wahrnehmen, worauf wir uns konzentrieren und wie wir Situationen interpretieren. Sie entscheiden, was wir vergessen oder woran wir uns erinnern, beeinflussen unsere Gedanken, Emotionen und letztlich unser Verhalten.
Oft übersehen wir durch diese Filter wichtige Aspekte, was zu Missverständnissen und Konflikten führen kann. Zwar helfen sie uns, die Welt zu verstehen, doch können sie auch verzerrte Erinnerungen und voreilige Urteile erzeugen. Dabei gibt es drei wichtige Prozesse, die wirken: Tilgung, Verzerrung und Generalisierung. Diese sind nachfolgend anhand von einfachen Beispielen kurz beschrieben.
Tilgung: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem wichtigen Vortrag. Der Sprecher präsentiert beeindruckende Zahlen, teilt spannende Fallstudien und zeigt interessante Grafiken. Später, im Gespräch mit einem Kollegen, fällt Ihnen auf, dass Sie sich vor allem an die Fallstudien erinnern, während Ihr Kollege von den Statistiken schwärmt. Sie beide haben den gleichen Vortrag gehört, aber Ihr Gehirn hat unbewusst Teile des Gesagten „gelöscht“ – Informationen, die es als weniger wichtig eingestuft hat. Das passiert uns ständig, auch in Gesprächen. Wenn Ihr Gegenüber plötzlich wichtige Teile Ihrer Aussagen tilgt, kann dies zu Missverständnissen führen – Ihre Botschaft kommt einfach nicht vollständig an.
Verzerrung: Sie und Ihr Partner sprechen über die Aufgabenverteilung im Haushalt. Was als sachliches Gespräch beginnt, wird plötzlich emotional – weil Sie, basierend auf früheren Erfahrungen, die Worte Ihres Partners durch Ihren eigenen Filter hören. Vielleicht klingt ein harmloser Vorschlag wie eine versteckte Aufforderung, Ihnen mehr Arbeit aufzubürden. Ihre eigenen Erfahrungen lassen Sie die Worte anders interpretieren, als sie gemeint waren. So entstehen Missverständnisse, die nicht nur das Gespräch erschweren, sondern auch die Verbindung zwischen Ihnen schwächen können.
Generalisierung: Vielleicht haben Sie erlebt, wie schnell das geht: Ihr Kind räumt sein Zimmer nicht auf, und nach dem dritten Mal denken Sie: „Es ist immer unordentlich!“ Ein kleines, wiederholtes Verhalten wird plötzlich zu einer festen Überzeugung. Generalisierung, umgangssprachlich auch „Schubladisierung“ genannt, bedeutet, dass Sie anhand von wenigen Erlebnissen eine übergeordnete, allgemeine Regel abstrahieren. Generalisierung hilft dem Gehirn, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und so die Komplexität, die Sie umgibt, begreifbarer zu machen. Andererseits sehen Sie im Beispiel Ihr Kind nicht mehr als die vielseitige Persönlichkeit, die es ist, sondern stecken es in die Schublade des „unordentlichen Kindes“. Und was passiert dann? Sie verlieren die Neugier auf die wahren Gründe, warum das Zimmer unaufgeräumt ist. Die Möglichkeit einer echten Verbindung verblasst, weil Sie nicht mehr bereit sind, genauer hinzuschauen.
Diese drei Mechanismen – Tilgung, Verzerrung und Generalisierung – sind ständig am Werk, beeinflussen jede Interaktion und prägen unsere Kommunikation tiefgreifend. Und oft geschieht all das, ohne dass wir es merken. Um die Missverständnisse, die dadurch entstehen, zu verringern, sollten wir beginnen, die Filter zu erkennen, durch die wir die Welt sehen – und auch die, durch die unser Gegenüber die Welt wahrnimmt. Je mehr wir uns bewusst machen, wie wir selbst und andere Informationen filtern, desto besser können wir echte Verbindungen aufbauen. Und echte Verbindungen sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kommunikation – zu Beziehungen, die auf Verständnis und Offenheit basieren anstatt auf Missverständnissen und Vorurteilen.
Stellen Sie sich folgendes Bild vor: Es gibt Frösche, die sofort zuschnappen, wenn eine Fliege in ihr peripheres Sichtfeld gerät. Sie reagieren reflexartig auf alles, was klein, dunkel und in Bewegung ist. Doch die gleichen Frösche ignorieren tote Fliegen, die direkt vor ihnen liegen – selbst wenn sie verhungern. Ihre Wahrnehmungsfilter entscheiden, was für sie „relevant“ ist.
Ähnlich funktionieren auch unsere menschlichen Wahrnehmungsfilter. Sie bestimmen, ob wir bereit sind, eine Verbindung aufzubauen oder nicht. Wenn diese Filter nicht erkannt oder falsch angesprochen werden, bleibt die Botschaft oft oberflächlich, eine echte Resonanz entsteht nicht. Es ist, als ob wir versuchen, jemanden zu erreichen, der uns einfach nicht hören kann.
Möchten Sie eine tiefe Verbindung zu jemandem herstellen, sollten Sie die relevanten Filter dieses Menschen verstehen und gezielt ansprechen. So schaffen Sie die Basis für eine intensive Begegnung, bei der Ihr Gesprächspartner nicht nur Ihre Worte hört, sondern auch emotional aufnahmebereit für sie wird. Dieses Gefühl von Resonanz, dieses emotionale „Einschwingen“ aufeinander, ist der Schlüssel zu echter, nachhaltiger Kommunikation.
Die Wahrnehmungsfilter, die darüber entscheiden, ob jemand bereit ist, eine Botschaft aufzunehmen, lassen sich in drei Kategorien unterteilen: individuelle, soziale und physiologische Filter. Jeder dieser Filter beeinflusst auf seine eigene Weise, wie Menschen auf das Was, Wie, Wann und die Berechtigung in der Kommunikation reagieren. Diese Faktoren entscheiden darüber, ob eine echte Verbindung entsteht – oder ob die Botschaft womöglich im Rauschen der alltäglichen Reize untergeht.
Individuelle Filter
Individuelle Filter werden vorrangig durch persönliche Erfahrungen und die eigene Erziehung geprägt. Dazu zählen die persönlichen Werte, Stärken, Grundüberzeugungen und die kognitiven Unterscheidungen.
Werte sind innere Orientierungspunkte, die uns wichtig sind. Sie motivieren uns, zeigen uns, woran wir glauben und auch, was wir brauchen, um uns führen zu lassen.
Stärken sind jene besonderen Fähigkeiten, die uns von anderen unterscheiden. Sie sind wie ein Licht, das uns den Weg zeigt, ein Ausdruck dessen, was wir auf unserem Gebiet meistern und mit außergewöhnlicher Hingabe leisten.
Grundüberzeugungen sind unsichtbare Regeln, die unser Leben leiten. Diese Überzeugungen sind tief verwurzelte subjektive Wahrheiten, die sich aus Wissen, Annahmen, Ergebnissen, intensiven Emotionen und Vorstellungen geformt haben.
Kognitive Unterscheidungen sind wie unsichtbare Steuerungsmechanismen in unserem Gehirn – sie formen die Art und Weise, wie wir denken, handeln und sprechen. Sie bestimmen, welche Muster wir in der Welt sehen, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir auf unsere Umwelt reagieren.
Soziale Filter
Soziale Filter entstehen primär durch Prägungen innerhalb verschiedener Kulturen und Gesellschaften, in denen Menschen sich bewegen. Zu ihnen zählen die eigene Wirkung (innerhalb von Gruppen), die manifestierte Kultur, Umgangsformen und das Erscheinungsbild.
Wirkung beschreibt in diesem Zusammenhang das, worauf sich ein Mensch gerade innerlich ausrichtet – ob es die Beziehung zu anderen Menschen ist oder das Erreichen bestimmter Ergebnisse. Dieser Fokus prägt seine Gedanken, seine Worte und die Art, wie er sich bewegt, spricht und sogar, wie er seine Stimme moduliert.
Kultur hingegen ist wie der unsichtbare Rahmen, in dem wir uns bewegen. Es sind die unausgesprochenen Regeln und Gewohnheiten, die unser Miteinander prägen. Sie formen, wie wir leben, arbeiten und uns verhalten – und sie gliedern uns zugleich in verschiedene Gruppen, die durch diese unsichtbaren Codes verbunden oder getrennt sind.
Umgangsformen spiegeln wider, wie ein Mensch mit seiner Umgebung umgeht. Es ist nicht nur die Art, wie er jemanden begrüßt, sondern auch, wie er soziale Situationen gestaltet und welche Atmosphäre er schafft.
Das Erscheinungsbild eines Menschen ist das Erste, was an ihm ins Auge fällt – seine äußere Gestalt, die mehr als nur Kleidung und Frisur umfasst. Es sind die Haltung, die Art, wie er sich bewegt, seine Mimik, Gestik und auch seine Stimme.