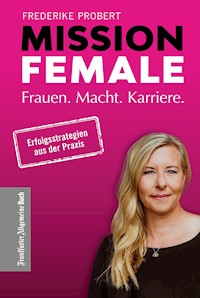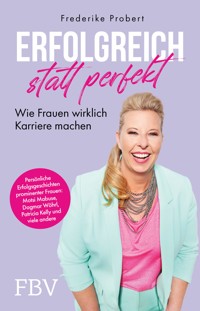
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Machen wir Frauen nicht alle schon genug? Arbeiten gehen, uns um die Familie – mit Kindern oder ohne – kümmern, den Haushalt schmeißen und immer schön lächeln? Wird es nicht mal Zeit, dass wir dafür anerkannt werden, was wir leisten, und allein dafür bewertet werden? Dieses Buch beleuchtet auf Basis von Fakten, wie es in Deutschland, Europa und der Welt zum Thema Gleichberechtigung und Diversität in Führungsetagen bestellt ist. Es zeigt, dass die mangelnde Repräsentanz von Frauen in Führungsetagen wenig mit mangelnder Qualifikation zu tun hat, aber viel mit veralteten gesellschaftlichen Erwartungen. Darüber hinaus geht es hier auch um konkrete Lösungsansätze, und es wird klar, dass Frauen vor allem eines lernen müssen: netzwerken. Aus der Praxis ihres Karriere-Netzwerks Mission Female zeigt die Autorin, wie Frauen ihren Forderungen mehr Nachdruck verleihen, sich gegenseitig stärken und sich beim Aufstieg in machtvolle Positionen unterstützen können. Die Geschichten von über 40 weiblichen Führungskräften und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Unterhaltung, die sich einen Weg nach oben gebahnt haben, machen Mut. In sehr persönlichen Beiträgen berichten sie über ihre Erfolge, aber auch Misserfolge, und teilen Erfahrungen aus ihrem Leben, wie sie Gleichberechtigung und Diversität eingefordert haben. Allen gemein ist, dass die Vernetzung mit Gleichgesinnten und die gegenseitige Förderung maßgeblich dazu beigetragen haben, dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Nämlich ganz oben auf der Karriereleiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frederike Probert
ERFOLGREICHstatt perfekt
Frederike Probert
ERFOLGREICHstatt perfekt
Wie Frauen wirklich Karriere machen
FBV
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe, 1. Auflage 2023
© 2023 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Anne Büntig-Blietzsch
Korrektorat: Anne Horsten
Umschlaggestaltung: Manuela Amode
Umschlagfotos: © Helen Fischer
Satz: Zerosoft
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-95972-669-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-287-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-288-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1: Wo stehen wir?
Immerhin in den Top Zehn – von unten
No Excuses: Wie sich Unternehmen vor Diversity in den Führungsetagen drücken
Aus dem echten Leben
Dagmar Wöhrl: Scheitern und wieder aufstehen
Alina Bähr: Müssen Frauen überall perfekt und erfolgreich sein?
Jennifer Alves: Meine Vorbilder sind Frauen, meine größten Supporter sind Männer
Mirijam Trunk: Mein persönlicher Weg zum Erfolg
Kapitel 2: Warum ist es überhaupt wichtig, dass Frauen Karriere machen?
Soziale Gerechtigkeit und kulturelle Notwendigkeit
Wirtschaftlicher Erfolg und maximaler Profit für Unternehmen
Aus dem echten Leben
Isabella Erb-Herrmann: Warum paritätische Vorstände so wichtig sind – für die Gesellschaft und für Unternehmen
Stevie Schmiedel: Spielt dein Geschlecht eine Rolle bei der Karriere?
Angelika Alt-Scherer: Diverse Organisationen sind wirtschaftlich erfolgreicher
Christina Bösenberg: Leadership-Tipps für mehr Diversity in Unternehmen
Jenny Gruner: Frauenkarrieren sind wichtig – für Frauen, Unternehmen und Gesellschaft
Kathrin Rienecker: Mehr als »nice to have«: Warum Frauen in Führungspositionen dringend notwendig sind
Lisa Hassenzahl: Von dunkelblauen Anzügen, blinden Flecken und rosa Finanzen
Kapitel 3: Gleich ist nicht gleich gleich
Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Mehr Arbeit für weniger Anerkennung
Kinder als Karrierehemmer
Aus dem echten Leben
Kasia Mol-Wolf: Karriere, Aussehen, Beziehung – Warum verspüren viele Frauen den Druck, perfekt sein zu müssen?
Nina Michahelles: Finde dein ganz eigenes »Perfekt«
Motsi Mabuse: Gleichbehandlung im Showbusiness
Julia Neuen: Warum Vereinbarkeit ein gesellschaftliches Thema ist
Britta Heer: Wie überzeugt man Männer, Frauen im Job zu stärken?
Renate Prinz: Kind oder Karriere? Wie wir dafür sorgen, dass sich diese Frage in Zukunft nicht mehr stellt!
Tatjana Kiel: Mein Weg ist bunt, unkonventionell und erfüllt
Kapitel 4: Warum Frauen keine »Männer« sein müssen, um Karriere zu machen
Mehr Sichtbarkeit, Disziplin und Durchsetzungsfähigkeit – Stop fixing the women!
Aus dem echten Leben
Lore Maria Peschel-Gutzeit: So bleiben Frauen authentisch und setzen sich durch
Meike Finkelnburg: Eine Einladung zu mehr Selbstüberschätzung
Laura-Marie Geissler: Was es für mich bedeutet, Karriere zu machen
Susanne Harring: Ein Führungsteam und mittleres Management ohne Stefans und Thomasse: Absicht oder Zufall?
Anna Pütz: Warum weiterkommen wichtiger als aufsteigen ist
Josephine Gerves: Aufstehen, Krone richten, weitermachen! Warum echter Erfolg darin besteht, mit Misserfolgen umzugehen
Kapitel 5: Als Frau erfolgreich Karriere machen – inspirierende Lebenserfahrungen
Jasmin Beshir: Passion statt Perfektion
Annette Kluger: Meine ganz persönliche Female-Empowerment-Taktik
Bettina Tietjen: Auch ich wurde schonmal unterschätzt
Carola Ferstl: So habe ich mich in einer Männerdomäne durchgesetzt
Christin Siegemund: Was mir gesagt wurde, was ich alles nicht kann, und wie ich es doch geschafft habe
Maria von Scheel-Plessen: Deine Karriere ist planbar – doch auch Chancen muss man sich erarbeiten
Kapitel 6: Gemeinsam stärker – Netzwerken im echten Leben
Corina Kurscheid: Mein perfekt unperfekter Weg nach vorn
Patricia Kelly: Ein Vergleich: Männer und Frauen im Showbusiness
Miriam van Straelen: Mut ist ein Muskel, der trainiert werden kann
Silke Reuter: Mein Erfolgsprinzip: »Jetzt erst recht!«
Anke Renz: Wie ich aus meiner Leidenschaft eine erfüllende Karriere geformt habe – ein erfolgreicher Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
Stefanie Tannrath: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht
Kapitel 7: Die Zukunft ist gleichberechtigt – und alle machen mit
Lunia Hara: Wir brauchen eine Diversitätsquote und nicht nur eine Frauenquote
Anaïs Cosneau: Paritätische Elternzeit für paritätische Karrieren!
Friederike Hohenstein: Frauen in Führungspositionen: Immer noch ein Problem?
Daniela Bojahr: Wie ich Thomas und Co. auf die Seite der Frauen bekommen habe
Jumana Al-Sibai: Stay female: Warum sich Frauen nicht in Männer verwandeln sollten, sobald sie in Führungsgremien sitzen
Linda Kurz: So ist es als Führungskraft in einer männlich dominierten Branche
Sigrid Nikutta: Gemeinsam für mehr Gleichberechtigung sorgen
Fazit und Dank
Über Frederike Probert
Anmerkungen
Bildnachweise
Vorwort
Oh, noch ein Karriereratgeber? Keine Sorge, hier handelt es sich nicht um ein weiteres Werk der Kategorie »Guck mal, wie toll ich bin. Hier meine 25 Tipps, die für alle funktionieren«.
Ich weiß, das ist gemein, aber meiner Ansicht nach ist es leider wahr. Wo man hinsieht, ob in die Ratgeberregale der Buchhandlungen, in Zeitschriften oder in Online-Medien: Überall wird - besonders - Frauen erzählt, was sie alles nicht können, was sie alles können sollten und warum es ihre Schuld ist, dass die Beförderung ausbleibt oder generell die Karriere im Sande verläuft. Da gibt es »5 Tipps how to dress for success« und »Mit diesen Argumenten gibt Ihnen Ihr Chef garantiert mehr Geld«.
Bullshit.
Warum ich das so krass sage? Weil es Unsinn ist, Frauen einzureden, dass sie perfekt sein müssen, um sich eine »Karriere zu verdienen«. Machen wir nicht alle schon genug? Arbeiten gehen, uns um die Familie - mit Kindern oder ohne - kümmern, den Haushalt schmeißen, hübsch aussehen und immer schön lächeln? Wird es nicht mal Zeit, dass wir dafür anerkannt werden, was wir leisten, und allein dafür bewertet werden? Ohne Tricks und doppelten Boden?
Ja, dafür ist es längst Zeit. Aber es gibt auch einen Grund, warum Frauen bis jetzt gesamtgesellschaftlich nicht genug wertgeschätzt werden. Deswegen werden wir in diesem Buch auch niemandem erzählen, was sie oder er - dieses Buch lässt sich nämlich auch prima von Männern lesen - tun oder lassen soll.
Vielmehr beleuchten wir auf Basis von Fakten, also wissenschaftlichen Studien, wie es in Deutschland, Europa und der Welt zum Thema Gleichberechtigung und Diversität in Führungsetagen bestellt ist. (Spoiler: Nicht so gut, wie man es 2023 erwarten würde.)
Gleichzeitig machen wir auch Mut und inspirieren - mit Geschichten von über 40 Frauen aus Unterhaltung und Wirtschaft, die sich einen Weg nach oben gebahnt haben. In sehr persönlichen Beiträgen berichten sie über ihre Erfolge, aber auch Misserfolge, und teilen Erfahrungen aus ihrem Leben, wie sie Gleichberechtigung und Diversität eingefordert haben.
Warum wir gleich so viele Frauen gefragt haben? Weil kein Mensch wie der andere ist - alle sind einzigartig. Genauso wie es jede Karriere ist. Daher finde ich, dass es auch nicht »den einen« Tipp für eine gelungene Karriere geben kann. Das Team von Mission Female sowie die Beiträgerinnen dieses Buchs sehen das genauso.
Wenn wir uns aber alle, egal welchen Geschlechts, gemeinsam für Diversität in der Arbeitswelt, faire Maßstäbe bei der Bewertung von Leistungen, mehr Vereinbarkeit von Karriere und Familie - kurz gesagt: für ein reales Abbild der Gesellschaft - sowohl im Alltag als auch in den Chefetagen einsetzen, gewinnen wir gemeinsam. Wir zeigen in diesem Buch verschiedene Wege, wie mehr Diversität gelingen kann - und an vielen Stellen schon gelingt.
Mich würde es freuen, wenn es wenigstens ein bisschen dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen für dieses Thema begeistern - und wir die (Arbeits-)Welt so gestalten, dass wir die Erfolge erzielen, die wir uns wünschen. Ganz ohne perfekt sein zu müssen.
Viel Spaß beim Lesen!Ihre Frederike Probert
Kapitel 1 Wo stehen wir?
Wenn das Thema Gleichberechtigung in Gesprächen aufkommt - egal ob es um Führungsgremien oder im Alltag geht -, begegnet mir bei männlichen Teilnehmern eine Reaktion, die sich mit »Oha, was wollt ihr denn noch?« zusammenfassen lässt. Dabei entsteht bei mir der Eindruck, dass Frauen nach Meinung dieser Personen etwas fordern, das über ein normalverständliches Maß hinausgeht. Ungefähr so wie Kinder nerven, die an der Kasse im Supermarkt nach Schokolade und Lutschern quengeln.
Nun ist es aber so, dass Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau immerhin seit 1957 in den Verfassungen der, damals noch beiden, deutschen Staaten steht. Es handelt sich also keineswegs um eine Sache, die ebenso optional ist wie Schokolade oder Lutscher. Im Gegenteil, es handelt sich um ein Recht, dass allen Frauen in Deutschland zusteht und von dem wir fast 70 Jahre später immer noch weit entfernt sind.
Natürlich sind es nicht alle Männer, die so reagieren, und selbst wenn, ist es oft nicht »böse« gemeint. Ihre Wahrnehmung der Sachlage ist anders, nämlich, dass man(n) Frauen in vielen Bereichen schon entgegengekommen und jetzt alles prima sei. Abgesehen davon, dass die Faktenlage dem widerspricht, bleibt diese Reaktion unabhängig von ihrer Intention für Betroffene - also alle Frauen - verletzend, demotivierend und abwertend. Wir reden nicht ständig über Gleichberechtigung, weil es uns so viel Spaß macht. Nein, wir sind es auch leid, die ganze Zeit eine Sache einzufordern zu müssen, die eigentlich seit rund 70 Jahren selbstverständlich sein sollte. Aber: Die Lage ist nun einmal nicht so, wie sie sein sollte - nicht im Alltag und erst recht nicht in Führungsgremien. Daher fordern wir ein, worauf wir ein Recht haben, auch wenn es nervt.
Frauen begegnen dieser kaum verhohlenen Form der Abwertung ihrer Interessen jeden Tag - und das seit Generationen. Wenn wir einen kurzen Blick in die jüngere Geschichte werfen, wird klar, woher bei Männern die fixe Idee kommt, dass man(n) uns ja schon »so sehr entgegengekommen« sei.
Ein kurzer Blick zurück
Während Frauen aus wirtschaftlicher und infrastruktureller Notwendigkeit im Zweiten Weltkrieg arbeiten mussten und sich als »Trümmerfrauen« einen legendären Status erwarben, wurden sie nach der Rückkehr der Männer von der Front wieder ins traute Heim zurück verbannt. Obwohl in der BRD und der DDR beide Verfassungen die Gleichberechtigung von Mann und Frau postulierten, sah die Umsetzung sehr unterschiedlich aus. Während in der DDR verschiedene Gesetze Frauen zum Beispiel das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit sicherten, waren Frauen bis 1977 in der BRD nicht einmal geschäftsfähig. Stattdessen legte der Gesetzgeber eine klare Rollenaufteilung fest: Der Mann war für das Einkommen und die Frau für den Haushalt zuständig. Empfanden Ehemänner oder Väter, dass der Haushalt nicht darunter leiden würde, konnte Frauen erlaubt werden, arbeiten zu gehen. Das änderte sich erst 1977 mit der Reform des Bürgerlichen Gesetzbuches: Frauen waren nun geschäftsfähig, konnten selbst Arbeitsverträge unterzeichnen und zum Beispiel ein Bankkonto eröffnen.
Ich finde, hier müssen wir mal einen Moment innehalten, um uns die Bedeutung dieser Sätze klarzumachen: Frauen, die 1977 volljährig wurden, gehen aktuell in Rente. Diese Frauen, die sich in Führungsgremien hochgearbeitet haben, sind die Ersten, die ohne Zustimmung ihres Vaters oder ihres Mannes entscheiden durften, ob sie einer Arbeit nachgehen möchten oder nicht. Viele von ihnen hätten vielleicht gerne früher eine Ausbildung gemacht oder erinnern sich an die Kämpfe ihrer Mütter - so etwas hinterlässt Spuren.
Außen vor bleibt bei reiner Betrachtung der Gesetzeslage aber der psychologische, soziale und wirtschaftliche Druck, der bis heute auf Frauen ausgeübt wird. In den späteren Kapiteln gehen wir genauer darauf ein, aber auch heutzutage müssen Frauen deutlich mehr als Männer zurückstecken, wenn sie gleichzeitig eine Karriere und eine Familie haben wollen. Ende der 1970er war dieser Druck noch stärker und machte es unseren Müttern und Großmüttern nicht leichter, ihre neuen Rechte in die Tat umzusetzen. Wer das nicht glaubt, kann sich ja mal umhören, wie alleinstehende Frauen um ihre Existenz zu kämpfen hatten. Die Stigmata rund um Alleinerziehende waren damals noch schlimmer als heute. Obwohl es ihnen eigentlich zugestanden hätte, ist es daher wenig verwunderlich, dass viele unserer Großmütter, Mütter und Tanten lieber mit dem Plan mitgingen, den ihre Väter und Männer für sie hatten. Studien zeigen, dass 1968 nur 36,6 Prozent der Frauen in der BRD berufstätig waren und sich diese Zahl bis 1989 auf nur 50 Prozent erhöhte. Wie die Mehrheit der Männer zur weiblichen Berufstätigkeit stand, ist damit klar.
In der DDR sieht die Geschichte etwas anders aus, hier war es aus wirtschaftlicher Sicht notwendig, einen möglichst großen Teil der arbeitstauglichen Bevölkerung einzusetzen. Als Folge dessen hatten 1970 rund 71 Prozent der Frauen in der DDR eine abgeschlossene Berufsausbildung. Obwohl 1968 circa 80 Prozent der Frauen arbeiteten, nur 25 Prozent davon in Teilzeit, blieb es auch hier ihre Aufgabe, sich um den Haushalt und die Kinder zu kümmern. Bis 1989 stieg der Anteil der berufstätigen Frauen in der DDR auf 92,4 Prozent. Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick gut aussehen, gab es in der DDR ebenso wie in der BRD eine deutliche Trennung zwischen »Frauenberufen« zum Beispiel als Erzieherinnen, im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie im Handel, die allesamt schlechter bezahlt wurden als die Berufe in Industrie, Handwerk sowie im Bau- und Verkehrswesen, in denen mehrheitlich Männer arbeiteten. Die Wiedervereinigung bedeutete für viele der berufstätigen Frauen aus der ehemaligen DDR hinsichtlich ihrer Berufstätigkeit einen Rückschritt, wobei aber 81 Prozent der Befragten einer Studie aus dem Jahr 1996 die Situation trotzdem besser als in der DDR empfanden.1
Obwohl seit der Wiedervereinigung über 30 Jahre ins Land gegangen sind und sich viele Missstände gebessert haben, wird sich im Vergleich mit dem aktuellen Zustand zeigen, dass sich die grundsätzliche Haltung, was berufstätige Frauen angeht, noch recht gleich ist: Geld nach Hause bringen? Ja, gerne. Unternehmen führen? Überlass das mal den Männern, Schätzchen.
Augenmerk aufs Jetzt
Zu wissen, wie weit wir bereits seit den 1950er-Jahren gekommen sind, zeigt mir persönlich zweierlei Dinge: Es ist großartig, wie weit sich Frauen bereits emanzipiert haben, und daher umso wichtiger, dass wir nicht aufhören, für die Dinge, die uns zustehen, zu kämpfen. Damals ging es darum, eigenständig Verträge abschließen und aus eigenem Willen arbeiten gehen zu dürfen. Heute stehen diese beiden Punkte - zumindest in Europa - nicht infrage, aber es gibt immer noch genug Bereiche, in denen Frauen benachteiligt werden.
Auch 2023 müssen Frauen mehr Einschränkungen als Männer in Kauf nehmen, um Karriere zu machen, und trotz der 2016 eingeführten Frauenquote sind wir sechs Jahre später noch weit von einer paritätischen und diversen Besetzung deutscher Führungsgremien entfernt. Gleichzeitig stehen wir sowohl im europäischen als auch globalen Vergleich weit abgeschlagen da. Dabei sind paritätisch besetzte Führungsetagen heute kein Luxusthema mehr, sondern entscheiden in einer globalen, diversen Welt über den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen und Gesellschaften.
Wenn Männer also das Thema Gleichberechtigung nicht ernst nehmen, realisieren sie nicht, dass sie gleichzeitig willentlich in Kauf nehmen, dass unsere Unternehmen und unsere gesamte Gesellschaft hinter anderen, fortschrittlicheren Nationen zurückbleiben. Was für ein unnötiger und leicht zu behebender Grund!
Da sich Gleichberechtigung, wie die meisten Themen, aus mehreren Blickwinkeln betrachten lässt - die »eine« Wahrheit gibt es schließlich nicht -, werfen wir in diesem Buch immer wieder einen detaillierten Blick auf möglichst aktuelles Zahlenmaterial und lassen gleichzeitig Frauen zu Wort kommen, die es trotz aller Widrigkeiten nach oben geschafft haben. Seit den 1950ern mag sich zwar vieles getan haben, aber bis wir nicht bei kompletter Gleichberechtigung angekommen sind, gehe ich Männern gerne mit stichhaltigen Argumenten weiter auf die Nerven.
Immerhin in den Top Zehn - von unten
Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von über 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 20212 stellt Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt dar. Im Vergleich der EU-Mitgliedsstaaten liegt Deutschland damit auf dem ersten Platz. Wenn es uns wirtschaftlich so gut geht, werden wir sicherlich auch hinsichtlich paritätischer Führungsetagen vorangehen, oder?
Die Antwort ist leider enttäuschend: Allein im EU-Vergleich liegt Deutschland weit abgeschlagen auf Platz 9 - von unten. Während der durchschnittliche Anteil von Frauen in Führungspositionen 2019 in den - damals noch mit Großbritannien - 28 EU-Mitgliedsstaaten bei 34,4 Prozent lag3, bringt Deutschland nur magere 29,4 Prozent zustande. Damit liegen wir auf ähnlicher Höhe mit Malta (30 Prozent Frauenanteil, Platz 24 im BIP-Vergleich der EU4), Griechenland (28 Prozent, Platz 18 im BIP-Vergleich der EU) und Italien (27,8 Prozent, Platz 4 im BIP-Vergleich der EU).
Währenddessen zeigen besonders die skandinavischen Länder, wie es geht: Lettland übertrifft mit 45,8 Prozent deutlich den Durchschnitt und auch Polen (43 Prozent), Schweden (40,3 Prozent) und Slowenien (40,1 Prozent) liegen weit vor Deutschland. Liest man die Statistik etwas genauer, fällt auf, dass rund 13 der 28 Mitgliedsstaaten den Durchschnitt übertreffen - das Schlusslicht dieser Gruppe bildet Frankreich ganz knapp mit 34,6 Prozent. Erst die Slowakei mit 33,7 Prozent liegt erstmals unter dem EU-Durchschnitt und befindet sich selbst damit noch vor uns. Immerhin können wir uns damit trösten, dass noch acht Länder schlechter als wir abschneiden und Schlusslicht Zypern mit 21,3 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen deutlich hinter uns ansteht.
Es stellt sich allerdings die berechtigte Frage, warum der Frauenanteil in Deutschland viel zu langsam wächst, obwohl vor sieben Jahren die Frauenquote und Selbstverpflichtungen von Unternehmen in Kraft traten. Schließlich lag 2016 der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 25 Prozent. Heute stehen wir bei 29,4 Prozent. Bei dem aktuellen Tempo, mit dem sich die paritätische Besetzung von Führungspositionen bewegt, dauert es laut AllBright Stiftung also nur noch rund 26 Jahre, bis eine Frauenquote unnötig wird5 - wenn das mal keine Perspektive ist!
Wo die Frauenquote wirkt
Ein Grund für die langsam steigende Anzahl von Frauen in Führungspositionen findet sich in der Ausgestaltung der Frauenquote. Die rechtlichen Vorgaben und damit verbundenen Sanktionen des Ersten Führungspositionen-Gesetzes galten nämlich bis 2021 nur für Aufsichtsräte und nicht für Vorstände. Während Verstöße gegen die Frauenquote in Ersteren mit Sanktionen geahndet wurden, galt für Vorstände nur eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Dass aber scheinbar nur Sanktionen wirken - und Selbstverpflichtungen nicht das Papier wert sind, auf dem sie stehen -, zeigt die aktuelle FidAR-Studie6: Diese untersucht die Anzahl von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen der 160 im DAX, MDAX und SDAX notierten sowie von den 23 paritätisch mitbestimmten, im Regulierten Markt notierten Unternehmen, für die die Frauenquote gilt. So liegt der Frauenanteil in Aufsichtsräten Anfang 2022 bei durchschnittlich 33,48 Prozent, während nur 14,72 Prozent der Vorstandssitze in den untersuchten Unternehmen von Frauen besetzt werden.
Gerade wegen dieser Diskrepanz war es so wichtig, mit dem Zweiten Führungspositionen-Gesetz die Lücke hinsichtlich der Vorstände zu schließen. So sind unter anderem seit dem 12. August 2021 Vorstände von börsennotierten oder paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern künftig verpflichtet, ein weibliches Mitglied zu haben. Unter dieses Mindestbeteiligungsgebot für Vorstände fallen 62 der 101 von der FidAR-Studie untersuchten Unternehmen. 16 dieser 62 Unternehmen - über 25 Prozent - verzeichnen aktuell keine einzige Frau im Vorstand. Streben sie eine »Zielgröße Null« hinsichtlich der Beteiligung von Frauen an, müssen sie dies nun begründen und werden sanktioniert, wenn sie keine Zielgröße oder Begründung melden - aktuell gilt dies für 3 der 16 Unternehmen. Es wäre sicher interessant zu sehen, welche Argumente hier ins Feld geführt werden.
Familienunternehmen in Not
Nach den bisherigen Daten scheint es so, als ob mangelnde Diversity nur DAX-Unternehmen betrifft. Aber auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft hat ein Problem - und es ist komplett selbstgemacht. Wie eine aktuelle Studie von Russel Reynolds Associates zeigt, machen Familienunternehmen »90 % aller Unternehmen aus, sind für 58 % der Beschäftigten verantwortlich und erwirtschaften mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung - und stehen trotzdem meistens im Schatten der DAX-Unternehmen«.7
Wie kommt das? Ein Grund ist sicherlich die deutliche Underperformance deutscher Familienunternehmen, wenn es um den Anteil von Frauen im Aufsichtsrat geht: Während die 160 in DAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen auf einen Anteil von 14,3 Prozent weiblicher Führungskräfte in ihren Geschäftsführungen oder Vorständen kommen, sieht es bei den 100 größten Familienunternehmen düster aus: Der Frauenanteil liegt hier nur bei 8,3 Prozent.8 Bei den Familienunternehmen dieser Gruppe, die sich komplett in Familienbesitz befinden, sind es sogar nur 4,9 Prozent. Nur zwei von 100 deutschen Familienunternehmen vertrauten die Leitung des Unternehmens einer Frau aus der Familie an - B. Braun Melsungen und Trumpf.9
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Hier geht es nicht um irgendwelche kleinen Familienbetriebe, sondern um große Namen wie Aldi, Fielmann, Bertelsmann, Otto oder Axel Springer. Das sind allesamt Unternehmen mit großem Einfluss, die - gerade, wenn man sich die darunter vertretenen Medienunternehmen ansieht - die öffentliche Diskussion in vielen Bereichen prägen. Und gerade diese Unternehmen verweigern sich angemessener Diversität in ihren Aufsichtsgremien. Die Problematik des Frauenanteils stellt hier aber nur einen Aspekt dar, denn gleichzeitig fehlt es in den Aufsichtsräten auch an internationalen Einflüssen: In Familienunternehmen liegt der Anteil von Mitgliedern mit deutscher Nationalität bei 92 Prozent, in DAX-Unternehmen bei 71 Prozent und bei DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen zusammen bei 75 Prozent.10
Alles besser im Start-up?
Progressiv, agil, modern - und einen Bürohund plus Obstschale gibt es noch obendrauf! Deutsche Start-ups verkaufen sich gerne als die besseren Unternehmen. Kratzt man allerdings an der Oberfläche, ist der Lack schnell ab: Bei kritischer Betrachtung sieht es in den Führungsetagen der 30 Börsenneulinge, die seit 2016 in DAX, MDAX oder SDAX aufgenommen wurden, genauso aus wie bei ihren etablierten Kollegen. Genauso? Nein, nicht ganz: Statt Thomas heißt hier die überwältigende Mehrheit der Vorstandsmitglieder Christian.
Gerade bei Unternehmen, die jünger als zehn Jahre sind, wird Homogenität überraschenderweise besonders großgeschrieben: So sind die Vorstandsmitglieder in den zehn Jungunternehmen (unter 15 Jahre, notiert in DAX, MDAX oder SDAX) im Vergleich zu den regulären Börsenmitgliedern der gleichen Indizes noch häufiger männlich (95 Prozent zu 87 Prozent) und noch häufiger Wirtschaftswissenschaftler (59 Prozent zu 52 Prozent). Auch bei den anderen Faktoren bleibt alles beim Alten - obwohl, wie bereits erwähnt, die Vornamen abweichen und das Führungspersonal rund sechs Jahre jünger ist11.
International im unteren Mittelfeld
Natürlich steht Deutschland nicht allein mit seinen Problemen hinsichtlich der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen da. Allerdings zeigt sich gerade im internationalen Vergleich, dass es Nationen gibt, die bei diesem Thema deutlich größere Fortschritte gemacht haben - und wirtschaftlich in einer ähnlichen Liga spielen wie wir. Das zeigt der BoardEx Global Gender Balance Report 2021,12 in dem Forschende für jedes Land die im jeweiligen Leitindex - zum Beispiel für Deutschland der DAX - gelisteten Unternehmen hinsichtlich des Anteils von Frauen mit Board-Positionen verglichen.
Dabei fällt auf, dass Europa zur Zeit der Datenerhebung Ende 2020 deutlich in Führung lag: Der EU-Durchschnitt - hier ausgewertet anhand des Eurotop-Index - befand sich bei 36 Prozent, und Frankreich belegte in dieser Studie mit einem Frauenanteil von 44 Prozent sogar den ersten Platz. Als erstes nicht europäisches Land folgt auf Platz 11 Australien mit 34 Prozent, gefolgt von Kanada auf Platz 14 mit 31 Prozent. Erst auf Platz 15 taucht auch Deutschland mit 30 Prozent Frauen in Board-Positionen auf.
Auch wenn Deutschland im europäischen Vergleich recht abgeschlagen dasteht, sind paritätische Vorstände für andere große Wirtschaftsmächte ebenfalls eine Herausforderung: Mit 29 Prozent Frauenanteil liegen die USA auf Platz 17, Indien mit 17 Prozent auf Platz 23 und Russland bildet mit nur 12 Prozent das Schlusslicht dieses Vergleichs.
Besondere Aufmerksamkeit verdient an dieser Stelle aber Japan, das, seit die Studie 2014 zum ersten Mal erhoben wurde, sonst immer den letzten Platz belegte. Innerhalb eines Jahres konnte sich die asiatische Wirtschaftsnation um vier Plätze im Ranking von nur 8,8 Prozent Frauenanteil im Jahr 2019 auf 14 Prozent in 2020 verbessern. Grund dafür ist eine Empfehlung der japanischen Regierung, 30 Prozent der Executive- und Board-Positionen mit Frauen zu besetzen. Diese basiert - im Gegensatz zur deutschen Frauenquote - auf Freiwilligkeit und nicht auf Sanktionen, wirkt aber trotzdem besser.
Generell zeigt die vorliegende Studie trotz aller Zahlen, die zu wünschen übrig lassen, wie viel sich seit 2014 - als die Studie erstmals erhoben wurde - auf internationaler Ebene für Frauen geändert hat. Während 2014 noch 75 Prozent der in den ausgewerteten Indizes gelisteten Unternehmen Vorstände und Aufsichtsräte mit weniger als 25 Prozent Frauenanteil verzeichneten, hat sich die Situation seitdem in der Mehrheit der untersuchten Länder deutlich verbessert. Besonders beeindruckt dabei Irland, das 2014 mit 12 Prozent Frauenanteil startete und heute eine Verbesserung von 19 Prozent auf 31,3 Prozent verzeichnet. Ähnlich sieht es für Portugal mit 15,6 und Malaysia mit 15,2 Prozent Anstieg aus - und auch Deutschland verbesserte sich um 11,7 Prozent von 18 auf 29,7 Prozent. Mit nur 9,8 Prozent Steigerung haben sich beispielsweise die USA deutlich schwerer getan, und mit nur 6,4 Prozent Unterschied zu 2014 belegt Russland auch in diesem Bereich der Studie den letzten Platz.
Ähnlich wie in Deutschland zeigt sich auch auf internationaler Ebene eine große Schere zwischen dem Anteil von Frauen in Aufsichtsrats- und in Vorstandspositionen. Während nämlich der Frauenanteil in Aufsichtsräten bis zu über 48,5 Prozent ausmacht, sind weibliche Vorstände mit maximal 17,4 Prozent weiterhin deutlich in der Unterzahl. Es scheint also, dass viele Unternehmen versuchen, eine Balance zwischen männlichen und weiblichen Führungspersonen herzustellen, indem sie Frauen in Kontrollgremien positionieren und für Unternehmen wichtige Entscheidungen immer noch mehrheitlich von Männern treffen lassen.
No Excuses: Wie sich Unternehmen vor Diversity in den Führungsetagen drücken
Es scheint ein Rätsel: Während Unternehmen in den letzten zehn Jahren Lösungen für Herausforderungen wie globale Wirtschaftskrisen, Pandemien und sogar zusammenbrechende Lieferketten gefunden haben, scheint Diversity in Führungsgremien ein unlösbares Problem darzustellen. So wirkt es zumindest, denn schließlich ist die Frauenquote schon so lange im Gespräch und trotzdem haben viele deutsche wie internationale Unternehmen keinen Plan, wie sich paritätische Führungsgremien umsetzen lassen. Oder besser gesagt: wirklich paritätisch aufgestellte Aufsichtsräte und Vorstände. Wie das vorige Unterkapitel zeigte, erreichen viele Unternehmen die Quote, indem sie Frauen in scheinbar »unkritische« Kontrollgremien befördern und Männern weiterhin die Zügel in die Hand geben.
Sind wir aber mal ehrlich: So wirklich rätselhaft ist daran gar nichts, denn ganz nach der Prämisse »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg« mangelt es in vielen Unternehmen offensichtlich an besagter Entschlossenheit. Untersuchungen haben mehrere Barrieren identifiziert, mit denen Unternehmen sich - und vor allem Frauen - im Weg stehen13:
1. Passivität
Auch nach über zehn Jahren verfolgen Unternehmen beim Thema »Paritätische Vorstände« eine »Kopf-in-den-Sand«-Strategie: Anstatt Gleichstellung in Führungsgremien als Chance zu begreifen, wird einfach abgewartet. Vielleicht erledigt sich das lästige Thema ja von allein? Natürlich tut es das nicht! Und so wird der Spielraum für Unternehmen, gerade in Anbetracht des neuen Führungspositionen-Gesetzes II und der damit verbundenen Sanktionen, immer enger.
Wo Selbstverpflichtungen jahrelang nicht gewirkt haben, sorgen Sanktionen nun für Bewegung - das bestätigt auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung14: Bei der Untersuchung ließ sich deutlich nachweisen, dass in Ländern, die die Frauenquote mithilfe einer Kombination von präzisen Vorgaben und Sanktionen durchdrücken, schneller paritätisch aufgestellte Führungsgremien zustande kamen als in Ländern, die beispielsweise auf Selbstverpflichtungen der Wirtschaft setzten. Dass die Bundesregierung zum gleichen Schluss kam, zeigt das Führungspositionen-Gesetz II - und plötzlich tut sich etwas. Wie die Justus-Liebig-Universität Gießen bei einer Untersuchung sämtlicher DAX-40-Unternehmen, 50 MDAX-Unternehmen und 70 SDAX-Unternehmen feststellte, liegt der Frauenanteil in den Vorständen der DAX-40-Unternehmen nur bei 20 Prozent. Wären es 40 Prozent weniger, so die Zahl der Frauen, die allein 2021 aufgrund des Führungspositionen-Gesetzes II in diese Positionen gerückt sind, läge der Anteil sogar nur bei 11 Prozent.15
2. Verweigerung
Klassischerweise ist Verweigerung ein Verhalten, das eher bei trotzigen Kindern als bei erwachsenen Personen mit Führungsverantwortung zu vermuten wäre. Allerdings sprechen Handlungen lauter als Worte - und die Verweigerungshaltung vieler Unternehmen in Fragen der Gleichstellung spricht nicht mehr, sondern schreit förmlich. So verfügen 2022 49 Prozent der DAX-Unternehmen über keine einzige Frau im Vorstand - und bei den Unternehmen, die schon etwas weiter sind, existieren deutliche Unterschiede. So gehen DAX-40-Unternehmen mit gutem Beispiel voran, indem bei 85 Prozent von ihnen mindestens eine Frau im Vorstand sitzt. Bei SDAX-Unternehmen sind es dagegen nur noch 41 Prozent und bei MDAX-Mitgliedern sogar nur 38 Prozent.
Ist die Verweigerungshaltung jedoch einmal gebrochen, überzeugen die Ergebnisse wohl selbst hartnäckige Gegner: Wie die Forschenden aus Gießen feststellten, unterscheiden sich die Frauenanteile bei Unternehmen, die einmal angefangen haben, weibliche Vorstandsmitglieder zu berufen, nur noch marginal voneinander.16
3. Unconscious Bias
Auch Führungspersonen sind Menschen - mit Stärken, Schwächen und Vorurteilen. So weit, so normal. Problematisch entwickelt es sich allerdings, wenn diese Eigenheiten nicht reflektiert werden und Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen. Das passiert besonders dann, wenn den einzelnen Personen nicht bewusst ist, dass bei ihnen Vorurteile vorliegen - ein »Unconscious Bias«. Gerade in Bezug auf paritätische und diverse Führungsetagen tritt ein Bias besonders häufig auf, nämlich die Annahme »typischer« Talente bei Frauen und Männern: Demnach könnten Frauen gut mit Menschen, seien kommunikativ, nicht gut mit Zahlen und scheuten eher vor harten Entscheidungen zurück. Männer dagegen seien energisch, könnten durchgreifen, seien allerdings nicht so stark in der Kommunikation und täten sich mit »soften« Themen wie Unternehmenskultur oder Personal schwer.
Wer solchen Geschlechterrollen zustimmt, findet es absolut nachvollziehbar und sinnvoll, weiblichen und männlichen Vorständen bestimmte Zuständigkeitsbereiche zuzuweisen. Die sich kümmernden, sozial talentierten Frauen zum Beispiel machen sich nach dieser Logik perfekt als Chief Human Resources Officer (CHRO), Männer dagegen sind förmlich zum CEO geboren. Natürlich möchte man 2023 sagen, dass so ein Denken vollkommen überholt und bestimmt nicht verbreitet ist. Ist es aber doch, wie Abbildung 1 zeigt.
Abbildung 1: Frauenanteil ausgewählter Vorstandspositionen der DAX-40-Unternehmen. Quelle: Haas, Alexander und Melina Luisa Marasek, Warum Frauen nicht in die Vorstände kommen, Diskussionspapier der Professur für Marketing und Verkaufsmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen, November 2022, Gießen.17
So liegt der Frauenanteil in den Vorständen von DAX-40-Unternehmen für den Bereich Personal bei sagenhaften 63 Prozent - und als Chief Executive Officer (CEO) bei nur 3 Prozent. Auch die Jobs als Chief Operations Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO) liegen mit nur 17 Prozent respektive 18 Prozent weiblicher Führungskräfte fest in männlicher Hand. Dass immerhin 30 Prozent der Chief Sales Officers (CSO) Frauen sind, lässt sich vielleicht so verargumentieren, dass Vertrieb schon wieder mit Menschen zu tun hat und daher in das scheinbar weibliche Rollenbild passt. Eine positive Überraschung gibt es bei den DAX-40-Unternehmen aber auch: Die Position des Chief Technology Officer (CTO) teilen sich Frauen und Männer paritätisch auf. Das ist - gerade in Anbetracht der anderen Zahlen und dahingehend, dass CTOs je nach Branche großen Einfluss sowohl auf die Ausstattung des Unternehmens als auch auf Forschung, Entwicklung und das endgültige Produkt haben - positiv überraschend.18
In MDAX- und SDAX-Unternehmen sieht die Lage schon wieder etwas anders aus (siehe Abbildung 2). Während hier bei MDAX-Unternehmen eine Steigerung von 1 Prozent bei den CEO zu verzeichnen ist und bei SDAX-Unternehmen sogar von 4 Prozent, sinkt der Frauenanteil bei allen anderen Führungspositionen rapide. Unter den COO machen Frauen nur 6 Prozent (MDAX) und 7 Prozent (SDAX) aus, und bei den CSO fällt ein sattes Minus von bis 22 Prozent auf - bei CTO sogar bis zu 44 Prozent. Sogar in der »Frauendomäne« Human Resources liegt der Frauenanteil von MDAX- und SDAX-Unternehmen deutlich unter denen der DAX 40. In MDAX-Unternehmen haben weibliche Board-Member nur 38 Prozent der CHRO-Posten inne und in SDAX-Unternehmen sogar nur 33 Prozent.19
Abbildung 2: Frauenanteil ausgewählter Vorstandspositionen der MDAX- und SDAX-Unternehmen. Quelle: Haas, Alexander und Melina Luisa Marasek, Warum Frauen nicht in die Vorstände kommen, Diskussionspapier der Professur für Marketing und Verkaufsmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen, November 2022, Gießen.20
Auch wenn die vorgestellten Zahlen nur für deutsche Unternehmen sprechen, zeigen internationale Studien wie eine Untersuchung der International Labor Organization (ILO), dass Unconscious Biases gegenüber Frauen der am häufigsten genannte Grund war, der sie am Aufstieg in eine Führungsposition hindere. Viele Teilnehmerinnen erwähnten auch, dass ihnen immer wieder die Haltung begegne, dass Management-Positionen »Männersache« seien und dass sich Gender-Stereotype auch bei der Einstellung neuer Mitarbeitenden und bei Beförderungen deutlich zeigten.21 Eine Studie von McKinsey and Company bestätigt, dass solche veralteten Rollenbilder in den Köpfen von Führungspersonen unsichtbare Barrieren bilden, die Frauen am meisten von allen Faktoren - sogar noch vor offenem Sexismus - am Weiterkommen hindern.22
4. Scheinargumente
Eng mit Gender-Stereotypen verbunden sind einige Scheinargumente, die immer noch viel zu häufig gegen paritätische Führungsgremien ins Feld geführt werden:
Vorstände müssen eine bestimmte Größe haben, um Frauen aufnehmen zu können.Unternehmen müssen in »frauenspezifischen« Feldern agieren, um weibliche Vorstandsmitglieder sinnvoll einzusetzen.Die »Opt-out«-These: Frauen scheiden in einem gewissen Alter eh freiwillig aus, weil sie der Doppelbelastung von Führungsrolle und Familie nicht gewachsen sind.Schauen wir uns diese Argumente einmal genauer an.
Vorstandsgröße
Lange dienten kleine Vorstände als ein Argument, die Zielgröße Null in Hinblick auf die Frauenquote zu rechtfertigen. Seit Inkrafttreten des Führungspositionen-Gesetzes II sind Unternehmen aber bereits ab einer Vorstandsgröße von drei Personen verpflichtet, mindestens eine Frau zu berufen. Dass dies ohne Probleme selbst bei Zwei-Personen-Vorständen funktioniert, zeigen DAX-Unternehmen wie die Hornbach Holding, das Software-Unternehmen SUSE, der Geschäftsausstattungs-Händler TAKKT und besonders der Maschinenbaukonzern Pfeiffer Vacuum, den eine weibliche CEO und Aufsichtsratsvorsitzende leiten.
»Frauenspezifische« Felder
Wer sich die DAX-Unternehmen mit dem größten Frauenanteil ab 40 Prozent ansieht, wird bemerken, dass keines davon in »typisch weiblichen« Bereichen wie Mode, Kosmetik oder anderen Konsumgütern agiert. Wie bereits erwähnt, tummeln sich hier vielmehr Aktiengesellschaften, die Vorurteile eher als »männlich« verorten, zum Beispiel Software (SUSE), Maschinenbau (Pfeiffer Vacuum), Medizintechnik und Pharma (Siemens Healthineers, Dermapharm, Fresenius Medical Care) oder Automobilteile wie Reifen und Fahrzeugsysteme (Continental).
»Opt-out«-These: »Die gehen ja eh, sobald sie Kinder bekommen«
Unter den geschlechtsspezifischen Vorurteilen hält sich besonders eine Annahme besonders hartnäckig: Dass Frauen freiwillig ihre Karriere aufgäben, sobald sie Kinder bekämen. Daher lohne es sich nicht, sie überhaupt in Führungsgremien aufzunehmen.
Nun ist es zum einen fraglich, ob überhaupt alle Frauen Kinder möchten. Aber selbst wenn dem so wäre, lässt sich diese Annahme beweisen? Wenn ja, worin liegt dieses Verhalten begründet?
Tatsächlich lässt sich die sogenannte »Opt-out«-These nicht statistisch nachweisen, sondern ist, wenn überhaupt, nur rein anekdotisch zu begründen. Das liegt unter anderem daran, dass Unternehmen keine Daten vorlegen (können), warum Frauen oder Mitarbeitende generell gehen. Meistens gibt es sowieso nicht »den einen« Grund, sondern eine Gemengelage aus vielen persönlichen und wirtschaftlichen Faktoren.
Besonders fällt bei der »Opt-out«-These der Begriff »freiwillig« auf. Der Duden definiert »freiwillig« als »aus eigenem Willen geschehend; ohne Zwang ausgeführt«.23 Ob Frauen »ohne Zwang« ihre hart erarbeiteten Karrieren verlassen, wenn ihnen Unternehmen und Gesellschaft zeitgemäße Arbeitszeitregelungen, angemessene Gehälter und die notwendige Kinderbetreuung verweigern, ist mehr als fraglich. Erschwerend kommt hinzu, dass auch eine faire Aufteilung der familiären Aufgaben innerhalb der Beziehungen immer noch von vielen Arbeitgebern untergraben wird. So zeigt sich in den letzten Jahren, dass Männer, die mehr als ein Minimum an Elternzeit nehmen möchten, häufig mit Diskriminierung zu kämpfen haben.24 Es ist also wenig verwunderlich, dass es manche Frauen einfach leid sind, sich für Unternehmen zu engagieren, die ihnen nicht einmal bei einem so grundlegend menschlichen Wunsch wie dem nach einer Familie entgegenkommen.25
Dass es trotz aller Hürden möglich ist, den Traum von der eigenen Karriere zu realisieren, und wie das in der Praxis gelingt, zeigen die folgenden Beiträge prominenter Frauen aus Wirtschaft, Politik und Entertainment.
Aus dem echten Leben
Dagmar Wöhrl: Scheitern und wieder aufstehen
Dagmar G. Wöhrl ist Unternehmerin und seit 2017 Investorin in der TV-Show Die Höhle der Löwen, nachdem sie von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags für die CSU war. Von 2005 bis 2009 war die Rechtsanwältin Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Wöhrl ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Bayerischen Verdienstordens. Neben verschiedenen Ämtern als Aufsichtsratsmitglied ist sie ehrenamtlich stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes von Unicef Deutschland und Vorstandsmitglied für die TUI Care Foundation sowie Kuratoriumsmitglied für die Bayerische Aids-Stiftung. Ferner ist sie Stiftungsrätin der von ihr ins Leben gerufenen Emanuel-Wöhrl-Stiftung. Dagmar G. Wöhrl ist verheiratet und hat zwei Söhne.
Hinfallen und wieder aufstehen. Das lernen wir Menschen bereits mit ein paar Monaten Lebenserfahrung. Die ersten Schritte in unserem Leben sind geprägt von der Erkenntnis, dass nichts auf Anhieb gelingt. Und dennoch ist in uns der unaufschiebbare Drang, es immer wieder zu versuchen. Einfach noch einmal, mit Schwung, Balance und dem richtigen Tempo. Denn jedes Mal, wenn es mit den ersten Schritten wieder nicht geklappt hat, verbinden sich im Gehirn Synapsen, die uns verstehen lassen, was es für den aufrechten Gang braucht.
Und obwohl wir wissen, dass wir für jeden großen Entwicklungsschritt meist mehrere Anläufe brauchen, vergessen wir als Erwachsene oft, wie wertvoll Scheitern ist. Mit zunehmendem Alter wird es immer verpönter, Fehler zu machen. Sehr zum Leidwesen der jungen Menschen, die mehrere Anläufe brauchen, um zum Beispiel eine Kletterstange hochzukommen, später eine komplizierte Mathematikaufgabe zu verstehen und noch später, um im Berufsleben bestimmte Arbeitsabläufe zu verinnerlichen.
Anstatt mit ermutigenden Worten auf diese Menschen zuzugehen, ist das Häufigste, was sie bekommen, Spott, Hohn und Unverständnis. Und noch schlimmer, sie lernen, das Scheitern gleichbedeutend mit Versagen ist. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Nur, wer Fehler im Leben macht, kann aus diesen Fehlern lernen und sich weiterentwickeln. Wenn ich an meine ersten Schritte als Unternehmerin denke, erinnere ich mich durchaus an den einen oder anderen Misserfolg. Damals, unmittelbar nach der Wiedervereinigung, wollte ich mit meinem Unternehmen expandieren und in einem anderen Bundesland aktiv werden. Der Erfolg blieb aus. Bei meiner selbstkritischen Analyse stellte ich fest, dass ich den Markt nicht richtig eingeschätzt hatte. In meiner Vorstellung machte es keine Unterschiede, ob ich in den alten oder neuen Bundesländern eine Firma unterhalte. Doch bei genauerer Kundenanalyse wäre mir aufgefallen, dass die Einwohner in den neuen Bundesländern eben doch eine andere Mentalität in Bezug auf ihre Kaufentscheidungen zeigten. Ein zweites Mal ist mir dieser Fehler nicht passiert.
Wichtig ist, dass wir nach dem Scheitern nicht den Mut verlieren, neue Dinge zu wagen, neue Herausforderungen anzunehmen.
Dies gilt nicht nur für das Berufsleben. Gerade wir Frauen stehen oft vor der Entscheidung, ob wir eine Familie gründen oder lieber die Karriereleiter emporschreiten wollen. Ich möchte alle darin bestärken, sich nicht zwischen beidem zu entscheiden. Warum soll Frau nicht Familie und Beruf unter einen Hut bekommen? Ja, es ist kein Zuckerschlecken, und es wird viele Tage in eurem Leben geben, in denen ihr an euch zweifelt. Doch glaubt mir, keine Frau vor euch hat das nur mit einem Lächeln auf den Lippen geschafft. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als meine Kinder noch kleiner waren und ich als Bundestagsabgeordnete unter der Woche häufig in Bonn war. Oft habe ich mich gefragt, ob ich als Mutter überhaupt so weit weg von meinen Jungs sein sollte. Warum ich mir den Trennungsschmerz jedes Mal wieder antat. Doch wenn ich politisch dann etwas bewegen konnte, wenn ich wusste, dass mein Tun dazu beigetragen hat, dass zum Beispiel der Tierschutz im Grundgesetz verankert wurde, waren diese Zweifel beseitigt, und ich wusste, dass es für mich die richtige Lebensentscheidung war. Zurück in Nürnberg konnte ich als Mutter die Zeit mit meinen Kindern genießen und ihnen zu 100 Prozent meine Aufmerksamkeit schenken. Rückblickend weiß ich, dass ich auch durch Scheitern die Frau wurde, die ich heute bin: optimistisch, zielstrebig, mit dem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen.
Alina Bähr: Müssen Frauen überall perfekt und erfolgreich sein?
Alina Bähr ist Chefredakteurin von BUNTE.de, der Online-Ausgabe von Deutschlands größter People-Marke. Die studierte Publizistin begann ihre Karriere als Kulturreporterin bei Axel Springer, ging nach ihrer Ausbildung an der Burda Journalistenschule als leitende Unterhaltungs-Redakteurin zu FOCUS online und verantwortete später als stellvertretende Nachrichtenchefin mit die Politik- und Unterhaltungsberichterstattung des Portals. Heute erreicht die gebürtige Berlinerin mit der BUNTE.de-Redaktion monatlich über 48 Millionen Visits und baut das Angebot in den Bereichen Female Empowerment, Health und Politainment weiter aus.
Gerade in Führungspositionen müssen Frauen häufig mehr leisten als ihre männlichen Kollegen, um erfolgreich zu sein - bist du dem auch begegnet, und wie bist du damit umgegangen?
Mittlerweile weiß ich, was ich kann, und bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Das war nicht immer so. Früher habe ich berufliche Erfolge oft unter den Teppich gekehrt oder abgetan - was dafür gesorgt hat, dass ich weniger gesehen wurde. Als eine erfahrene Kollegin dies einmal zufällig mitbekam, hat sie mich dazu ermutigt, es »wie die Männer« in der Redaktion zu tun - Anerkennungen einfach dankend anzunehmen, ohne sie im gleichen Satz abzuschwächen.
Heute bin ich sehr froh, dass in meinem derzeitigen Berufsumfeld die Fähigkeiten der Personen zählen und nicht das Geschlecht. Aber ich musste früher auch gegenteilige Erfahrungen machen. Besonders ernüchternd war die mit einem Kollegen, als ich Anfang 20 war. Ein Journalist, der mir fachlich viel beigebracht hat, schrieb in meine Abschiedskarte, ich solle zukünftig besser ein längeres Kleid anziehen - damit mich die Leute »ernst nehmen«. Hätte er einem männlichen Kollegen zu längeren Hosen geraten? Wohl kaum. Heute ist es mir eine Herzensangelegenheit, junge Kolleginnen zu unterstützen und sie dazu zu ermutigen, ihre Erfolge zu feiern, und ihnen zu vermitteln, dass die Kleiderlänge in keinerlei Zusammenhang mit ihren Leistungen steht.
Woher kommt deiner Meinung nach diese Forderung an Frauen, in vielen Bereichen ihres Lebens »perfekt« und in allem »erfolgreich« sein zu müssen?
Wir scrollen online durch abertausende Bilder von wunderschönen Frauen, die auf einem Daybed in Dubai loungen, Kleinkind vor die Brust geschnallt, Laptop auf dem Schoß. Andere geben im Powersuit den mittlerweile dritten TED-Talk des Jahres. Was wir nicht sehen, ist die Arbeit, die hinter diesen vermeintlich mühelosen Aufnahmen steckt. Nicht vergessen: Instagram zeigt nie die ganze Realität. Ich erwische mich auch immer wieder selbst dabei, wie derlei Input ein falsches Streben nach Perfektion entfacht. Ein ewiges Vergleichen war noch nie gut für die Seele. Zielführender ist, sich zu fragen: Was kann ich selbst aus mir heraus erreichen - und nicht: Wie werde ich zur Frau in Dubai?
Wie können Frauen für sich selbst definieren, was für sie persönlich »perfekt« und »erfolgreich« bedeuten?
Von meiner Oma Annemarie habe ich früh gelernt, nach meinen eigenen Überzeugungen zu leben. Sie hat bis zur Rente gearbeitet und in der Ehe mit meinem Großvater, den sie sehr geliebt hat, auf ein eigenes Konto bestanden. Es war schließlich ihr Geld, von dem sie sich kaufen wollte, was ihr gefiel. Für die damalige Zeit war das ein recht progressiver Ansatz. Sie hat gern Nerz getragen und im Restaurant Wodka pur bestellt - beides Dinge, für die sie kritisch beäugt wurde. Die Frage ist doch eher: Lebe ich nach den Maßstäben von anderen - oder meinen eigenen? Sie wollte niemandem gefallen, außer sich selbst. Und das ist es, was zählt.
Jennifer Alves: Meine Vorbilder sind Frauen, meine größten Supporter sind Männer
Jennifer Alves, 49 Jahre, verheiratet und die erste Tochter von fünf Kindern, ist seit Juli 2021 Associated Partner bei der MHP Management- und IT-Beratung GmbH. Ihre Aufgabe liegt darin, den Unternehmensbereich der Customer-Relationship-Management-Lösung »Salesforce« in puncto People, Kompetenz, Sichtbarkeit und Kunden wachsen zu lassen. Sie bezeichnet sich selbst als »durch und durch Gutmensch«, ist Gründerin von Team BUNT, welches sich dafür einsetzt, Vielfalt, Motivation und Mitarbeiterbindung zu fördern, und engagiert sich für die Organisationen Net-4tec und PLAN International. Außerdem ist sie mit viel Leidenschaft und Herz bei Mission Female.
Mein beruflicher Werdegang bestand aus Glück, Chancen und ganz viel harter Arbeit, um ein gutes Ergebnis zu liefern. Nichts wurde mir geschenkt!
Dass ich heute da bin, wo ich bin, war nicht mein Plan, dies hat sich so ergeben. Nur, dass ich die bin, die ich bin, daran habe ich jeden Tag gearbeitet. Ich darf sagen, ich hatte viel Glück auf meinem Weg. Aber Glück allein reicht nicht – ich musste das Glück als solches erkennen und die Chancen annehmen und ausfüllen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie das Glück zu mir findet, und mit der Zeit die Antwort dazu bei mir selbst gefunden: Es liegt an meiner Person.
1. Learning: Bleib dir selbst treu.
Wenn man mich kennt und mit mir arbeitet, stellt man sehr schnell fest, dass man sich auf mich als Person verlassen kann. Ich halte meine Versprechen, bin zu oft zu ehrlich, stelle mein Wohlsein niemals über das der anderen und bin hilfsbereit. Ich setze mich für Schwächere ein, entdecke Talente und fördere diese. Versuche Menschen, die Gutes tun, dazu zu motivieren, über das Gute zu reden, nicht länger leise zu sein. Und wenn es gewünscht ist, teile ich mein Wissen, damit andere aus meinen Erfahrungen lernen. Würde man heute meine Familie, Freunde, Kollegen und Kunden fragen, wie sie mich beschreiben, würden diejenigen, die mich gut kennen, sicher antworten: »Jennifer kümmert sich um alles, was nötig ist, und alle, die es wünschen.«
2. Learning: Lass dich nur von konstruktiver Kritik beeinflussen.
Was ich in der Vergangenheit oft erleben durfte, war, dass wenn mir ein Vorgesetzter eine Chance gab, dann gab es oft eine beobachtende Person, die der Meinung war, sie hätte eine Chance, Aufgabe oder Sichtbarkeit mehr verdient beziehungsweise könnte die Aufgabe, Rolle oder Position besser ausfüllen als ich. Dabei vergessen Beobachtende oft, dass diejenigen, die eine Chance bekommen, damit scheitern könnten. Es ist mit viel Arbeit verbunden, und am Ende bekommt niemand etwas geschenkt. Diese Momente, in denen man auf solche Art beobachtet wird, sind meiner Meinung nach mit die schlimmsten, die einem im Unternehmen begegnen können - leider aber auch die, die einem am häufigsten begegnen. Sie kosten Kraft, Motivation, bedürfen viel Fingerspitzengefühl, machen manchmal traurig - und machten mich stärker. Bis ich dies verstand, ist sehr viel Zeit vergangen. Es hat mitunter Jahre gedauert.
3. Learning: Nicht alles, was andere über dich sagen, ist wichtig. Wichtig ist, was du selbst von dir hältst.
Aber zurück zum Glück und zu meinen beruflichen Anfängen, was die IT-Branche angeht. Ich bin eine klassische Quereinsteigerin. Zuvor war ich selbstständig im Finanzdienstleistersektor unterwegs. Habe dann 1997 für mich entschieden: »Ich mach jetzt was mit Computern.« Da stand ich nun, in Essen, meiner Geburtsstadt und meinem damaligen Wohnort. Hatte die WAZ