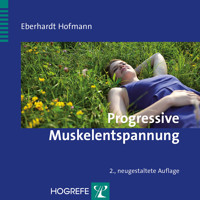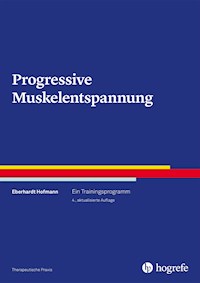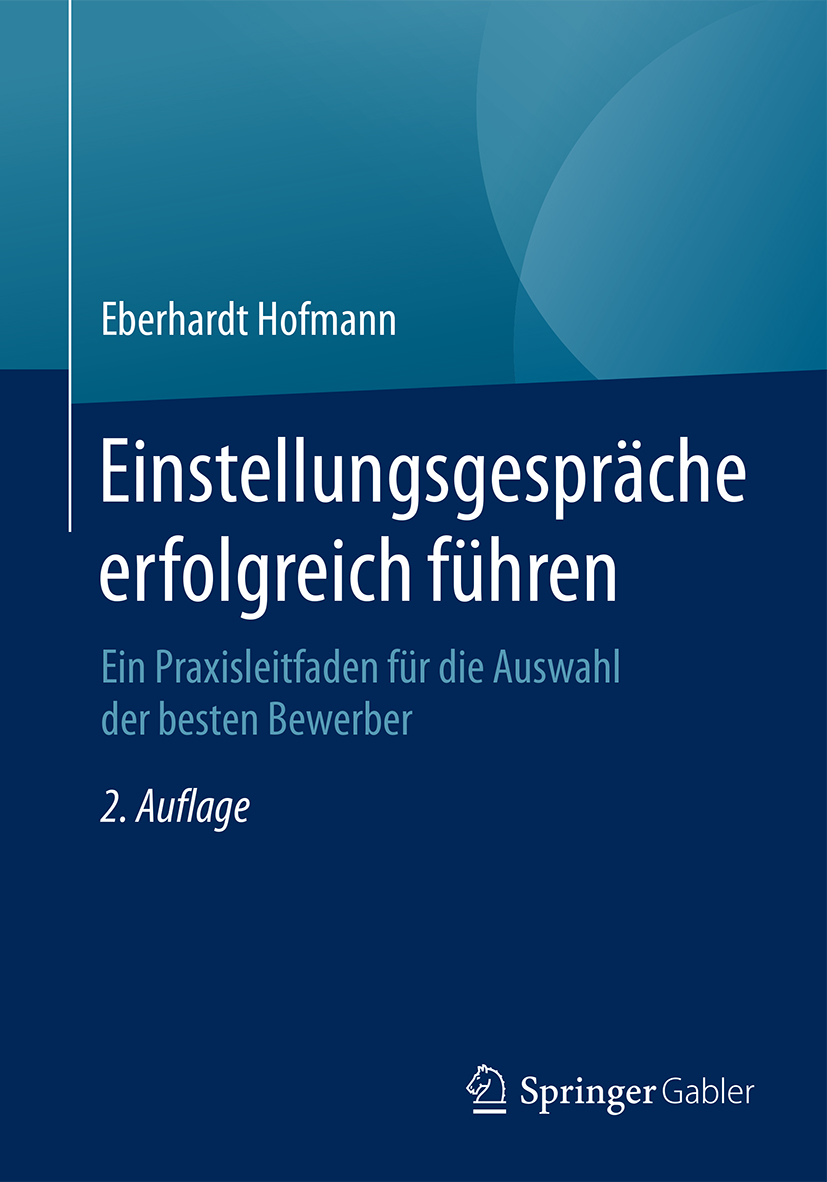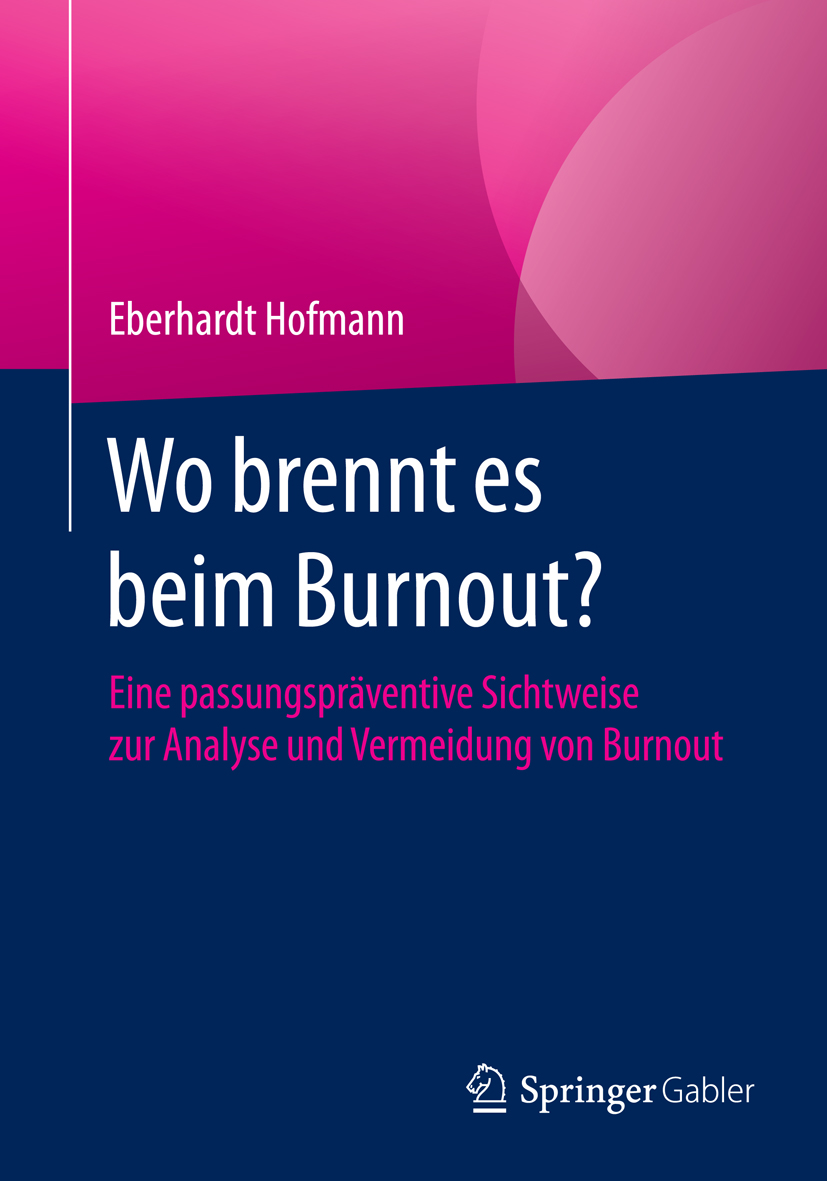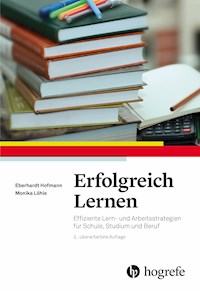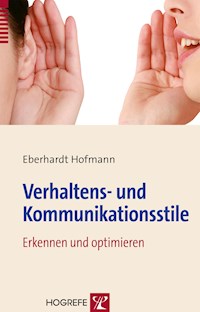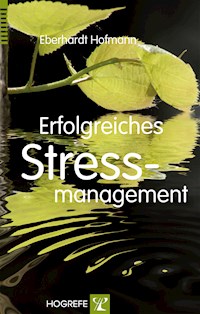
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Stress ist heute ein Alltagsphänomen. Viele Menschen suchen daher nach Möglichkeiten, im Privatleben und im Berufsalltag erfolgreich mit Stress umzugehen. Der Band beschäftigt sich zunächst mit den physiologischen und psychologischen Aspekten der Stressreaktion, ihren kurz- und langfristigen Auswirkungen sowie mit der Entstehung von Stressquellen. Anschließend werden Techniken der kurzfristigen Kontrolle des Stressgeschehens sowie Methoden, die längerfristig zur Bewältigung von Stress eingesetzt werden können, beschrieben. Es handelt sich dabei beispielsweise um Techniken der Atmungskontrolle, der muskulären An- und Entspannung sowie der Veränderung von Gedanken, die sehr schnell wirken und dazu eingesetzt werden können, die Stressreaktion in akuten Situationen »abzubremsen«. Entspannungsverfahren, die Veränderung von Einstellungen und Überzeugungen sowie von Verhaltensgewohnheiten können langfristig der Stressbewältigung dienen. Schließlich wird auf die Bedeutung körperlicher Bewegung für unser Denken und Erleben eingegangen und ein Ausdauertraining zur Prävention und Kompensation des Stressgeschehens vorgestellt. Die vorgestellten Methoden zum Stressmanagement sind alle in ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich untermauert. Die zahlreichen Übungen erleichtern die Umsetzung der Methoden im Alltag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Erfolgreiches Stressmanagement
von
Eberhardt Hofmann
Dipl.-Psych. Eberhardt Hofmann, geb. 1959. Studium der Psychologie in Tübingen. Klinischer Hypnosetherapeut (ESH). Tätigkeit in der Personal- und Führungskräfteentwicklung in verschiedenen Großbetrieben. Lehraufträge an mehreren Hochschulen. Sachbuchautor zu Themen der Angewandten Psychologie.
© 2013 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Göttingen • Bern • Wien • Paris • Oxford • Prag • Toronto • Boston
Amsterdam • Kopenhagen • Stockholm • Florenz
Merkelstraße 3, 37085 Göttingen
http://www.hogrefe.de
Aktuelle Informationen • Weitere Titel zum Thema • Ergänzende Materialien
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Umschlagabbildung: © Gerhard Seybert – Fotolia.com
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
EPUB-ISBN 978-3-8444-2490-4
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung – Das Stressgeschehen
1.1 Eine Analogie für das Stressgeschehen
1.2 Aufbau des Buches
2 Die Auswirkungen der Stressreaktion
2.1 Wie verändert sich unser Körper bei Bedrohungen?
2.2 Bedrohungen früher und heute
2.3 Kurz- und langfristige Konsequenzen der Nichtpassung
2.4 Welche Ereignisse wirken als Stressoren?
2.5 Ansatzpunkte zur Veränderung
3 Die Atmung als Ansatzpunkt zur Veränderung der Anspannung
3.1 Funktion der Atmung
3.2 Sinn der Atmungskontrolle
3.3 Techniken zur Veränderung der Atmung
3.4 Kombinationen
3.5 Anwendung der Techniken in Alltagssituationen
4 Die Veränderung der Aktivierung durch muskuläre An- und Entspannung
4.1 Das Prinzip der muskulären Abreaktion
4.2 Standardübungen zur muskulären Abreaktion
4.3 Der Einsatz muskulärer Techniken in Realsituationen
5 Die Bedeutung der Gedanken für die Anspannung
5.1 Die Wirkung von Gedanken
5.2 Praktische und emotionale Probleme
5.3 Identifikation von Stressgedanken
5.4 „Positives Denken“
5.5 Strategien zur Veränderung von Stressgedanken
5.6 Praktische Anwendung
6 Die Kombination von Atmung, muskulären Techniken und der Veränderung von Gedanken in realen Stresssituationen
6.1 Auswahl der beabsichtigten Techniken
6.2 Kombinationen der ausgewählten Techniken
6.3 Ein Beispiel für die Kombination der Techniken in einer Realsituation
7 Balance zwischen Anspannung und Entspannung – Belastungsausgleich
7.1 Die physiologische Basis für die Balance zwischen Anspannung und Entspannung
7.2 Strategie: Vegetative Umschaltung (Entspannung)
7.3 Kurzcharakterisierung von Entspannungstechniken
7.4 Strategie: Positive Erlebnisse
8 Die eigene Persönlichkeit als Stressquelle
8.1 Was ist ein Persönlichkeits- bzw. Verhaltensstil?
8.2 Die psychologischen Kalküle der einzelnen Persönlichkeitsstile
8.3 Soziale Konstellationen
9 Einstellungen, Überzeugungen, Bewertungen – ihre Bedeutung und ihre Veränderung
9.1 Leitideen können als interne Stressoren wirken
9.2 Was sind Leitideen?
9.3 Zu verändernde Leitidee und Wunschleitidee
9.4 Methoden zur Erreichung der Wunschleitidee
9.5 Anwendung der Methoden
9.6 Das Finden spezieller Leitideen
10 Die Bedeutung der Bewegung für unser Denken und Erleben
10.1 Das Grundmuster unseres Denkens besteht aus körperlichen Erfahrungen
10.2 Bewegung und Nervensystem
10.3 Kompetenz- und Kontrollerleben
10.4 Handlungsfluss
10.5 Schaffung von Erlebnishöhepunkten
10.6 Erweiterung des Handlungs-/Bewegungs-/„Spiel“-Raumes
10.7 „Grenz“-Erfahrungen
10.8 Kluger und weniger kluger Hedonismus
10.9 Bewegung und Schlaf
11 Ausdauertraining zur Prävention und Kompensation des Stressgeschehens
11.1 Die Bedeutung des Ausdauertrainings
11.2 Physiologische Effekte des Ausdauertrainings
11.3 Psychologische Effekte des Ausdauertrainings
11.4 Trainingsgesetzmäßigkeiten
11.5 Energiegewinnung
11.6 Trainingsstrategien
11.7 Praktischer Trainingsaufbau
12 Veränderungsziele klären und die Zielerreichung wahrscheinlicher machen
12.1 Produktive Formulierung von Zielen
12.2 Techniken zur Erleichterung des Zielerreichungsverhaltens
12.3 Prüfung der Ziele auf Selbstkonkordanz
12.4 Methoden der systematischen Zielfindung
13 Hinweise zur Umsetzung
Literatur
Anhang
1 Einführung – Das Stressgeschehen
Stress ist heute ein Alltagsphänomen, zumindest eine Alltagsbezeichnung. Je häufiger der Begriff dabei gebraucht wird, desto weniger präzise wird er verwendet. Im vorliegenden Buch soll daher der Stressbegriff zunächst möglichst präzise gefasst werden. Anschließend wird dann ein Erklärungsmodell vorgestellt. Danach werden verschiedene Methoden aufgezeigt, mit denen man Einfluss auf das Stressgeschehen nehmen kann. Diese Methoden stammen hauptsächlich aus der Physiologie, der Verhaltenstherapie und der Sportwissenschaft. Ihnen allen ist dabei gemein, dass es sich ausschließlich um Methoden handelt, deren Wirksamkeit empirisch nachgewiesen ist.
1.1 Eine Analogie für das Stressgeschehen
Das in Abbildung 1 vorgestellte Modell eignet sich zur Verdeutlichung des Stressgeschehens und gibt zudem einen Überblick über den Aufbau des Buches. Stress entsteht durch Stressquellen, die man Stressoren nennt. Diese Stressoren können von außen kommen (Arbeitsbelastung, Lärm, Zeitdruck etc.) oder in der Person selbst liegen (Einstellungen, Überzeugungen, psychologische Kalküle etc.). Eine Quelle für Stressoren kann auch die Passung der Person zu der (z.B. beruflichen) Situation sein. Person und Situation sind in der Abbildung in Form von Wolken dargstellt, aus denen Regen (Stress) fallen kann. Der Regen kann dabei aus einer Wolke fallen oder in Form eines Gewitters durch die Wechselwirkung zweier Wolken (Person und Situation) entstehen. Genauso wie in der Natur ist dieser Regen (Stress) an sich nichts Schlimmes, sondern ein ganz normaler Vorgang. Die Frage ist nur, was mit dem Regen passiert. Sofern dieser Regen ungehindert fallen kann und nicht abgeleitet wird, sammelt er sich in einem Gefäß und hebt dessen Pegel. Ab einem gewissen Pegel entsteht ein Missempfinden, das subjektiv unangenehm ist, körperliche Schwierigkeiten erzeugen und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Dem kann man entgegenwirken, indem man gezielt Wasser aus dem Behälter entfernt. Dies kann durch gezielte Entspannung und durch einen gezielten Ausgleich durch positiv bewertete Aktivitäten geschehen. Man kann auch versuchen, die individuelle Schwelle zu erhöhen, ab der die negativen Wirkungen der Belastungen greifen, indem man die Stressresistenz erhöht.
Abbildung 1: Analogie für das Stressgeschehen
Es gibt jedoch auch verschiedene Möglichkeiten, diesen Regen „umzuleiten“ und dadurch zu verhindern, dass der Pegel erhöht wird. Ein „Ventil“ entscheidet darüber, ob das Wasser in den Behälter kommt oder nicht. Der Schalter, der das Ventil bedient, entspricht sozusagen der Frage, ob man auf das Stressgeschehen Einfluss hat oder nicht, es geht also um die subjektive Kontrollüberzeugung. Je größer dabei die subjektive Kontrollüberzeugung ist, desto weiter ist das Ventil geöffnet. Ideal ist es also, über möglichst viele Kontrollmethoden zu verfügen. Zusätzlich dazu kann man versuchen, auf die Situation Einfluss zu nehmen, indem man sie so verändert, dass sie möglichst wenig Stress (Regen) erzeugt. Ebenso kann man auf der Seite der Person Veränderungen vornehmen, die den Ausfall von Regen (die Entstehung von Stress) unwahrscheinlicher machen. In der Vermeidung von Gewittern (der Nichtpassung von Person und Situation) besteht ein weiterer Ansatzpunkt, um die Niederschlagsmenge zu verringern. Die Situation kann dabei aus strukturellen Gegebenheiten oder aus anderen Personen bestehen.
1.2 Aufbau des Buches
Der Aufbau des Buches lehnt sich eng an dieses Bild des Stressgeschehens an. Im zweiten Kapitel werden die körperliche Funktion der Stressreaktion sowie die kurz- und langfristigen Folgen dieser Reaktion beschrieben.
Anschließend werden kurzfristige Einflussmöglichkeiten auf das Stressgeschehen vorgestellt. Dazu beschäftigen sich die Kapitel 3 bis 6 mit der Veränderung akuter Stresssituationen. Dabei ist es wichtig, dass die beschriebenen Techniken ohne Hilfsmittel und auch in Gegenwart anderer Menschen unbemerkt eingesetzt werden können. Im Kapitel 3 werden die zentrale Rolle der Atmung sowie die Einflussmöglichkeiten, die man mittels der Atmung auf das Stressgeschehen hat, thematisiert. Ein weiterer physiologischer Parameter, der einen wesentlichen Einfluss auf die Stressphysiologie hat, nämlich die Muskelspannung, wird im vierten Kapitel erörtert. Das fünfte Kapitel hat die Rolle der Gedanken und deren gezielte Veränderung zum Thema. Im Kapitel 6 werden dann die drei Elemente Atmung, Muskelspannung und Gedanken kombiniert und es wird beschrieben, wie man mit ihrer Hilfe in aktuellen Stresssituationen Einfluss auf die körperliche und psychische Anspannung nehmen kann.
In den weiteren Kapiteln des Buches geht es um die längerfristigeren Veränderungen des Stressgeschehens. Dazu werden im siebten Kapitel systematische Erholungsmöglichkeiten vorgestellt und es wird beschrieben, wie sich die systematische Schaffung von Entspannungsphasen auswirkt. Im Kapitel 8 geht es um die Rolle der eigenen „Persönlichkeit“, die unter gewissen Umständen selbst zu einer Stressquelle werden kann. Um diesen Mechanismus zu erklären, werden prototypische psychologische Kalküle beschrieben, die auf „bewährte“ Weise Stress erzeugen können. Zusätzlich wird der Blickwinkel dann auf Konstellationen erweitert, in denen zwei Personen eine Rolle spielen (soziale Situationen). Die Qualität dieser Konstellationen kann untersucht werden, um sie daraufhin zu bewerten, inwieweit die jeweilige Konstellation (soziale Situation) zu einem vorhersehbaren Stressor werden kann. Gegenstand des neunten Kapitels sind Einstellungen, Überzeugungen und Bewertungen. Ihre Bedeutung bei der Stressentstehung sowie ihre Veränderung werden beschrieben. Die Bedeutung der Bewegung für unser Wohlbefinden wird im Kapitel 10 thematisiert. Dem Ausdauertraining als eine spezielle Art der Bewegung kommt eine besondere Rolle bei der Prävention und der Modifikation des Stressgeschehens zu, da es den physiologischen Parametern, die bei der Stressreaktion negative Folgen haben können, genau entgegenwirkt. Im Kapitel 11 geht es um die Gesetzmäßigkeiten, die bei diesem Prozess eine Rolle spielen. Gegenstand des zwölften Kapitels ist der Umgang mit Zielen. Es ist eine allgemeine Lebenserfahrung, dass man nicht immer die Ziele realisiert, die man hat. Es besteht eine „Intentions-Realisierungslücke“. Die Gründe hierfür werden im zwölften Kapitel untersucht und es werden Wege aufgezeigt, auf denen die Realisierung von Zielen wahrscheinlicher gemacht werden können.
Das Buch ist als Arbeitsbuch gedacht. Es enthält daher in zahlreichen Kapiteln neben den jeweiligen Informationen auch Anregungen für Übungen. Die vorgestellten Übungen können natürlich nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn sie in der Praxis ausprobiert und regelmäßig angewandt werden.
2 Die Auswirkungen der Stressreaktion
In diesem Kapitel wird ein Modell dargestellt, mit dessen Hilfe man sich den Ablauf der physischen, psychischen und emotionalen Veränderungen in Stresssituationen erklären kann. Die nachfolgenden Kapitel bauen auf diesen Grundüberlegungen auf. Zuerst werden dazu die Reaktionen auf physisch reale Bedrohungen aufgezeigt, die im Prinzip genauso auch in physisch nicht oder nicht unmittelbar bedrohlichen Situationen ablaufen. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, die Gesundheit und die Befindlichkeit sowie Ansatzpunkte zur Veränderung werden dargestellt. Doch zunächst soll anhand eines Fallbeispieles die Entstehung und die Auswirkungen von Stress erläutert werden.
Fallbeispiel:
Herr A. muss am nächsten Tag eine Präsentation vor einem Entscheidungsgremium durchführen. Von der Entscheidung dieses Gremiums hängt viel ab. Da er noch dringend einige andere ungeplante Arbeiten erledigen muss, hat er nicht genügend Zeit, sich intensiv vorzubereiten. Er denkt: „Ich schaffe das alles nicht rechtzeitig“ und spürt eine innere Unruhe. Er nimmt einen Teil der Arbeit mit nach Hause. Die für den Abend geplante Verabredung mit Bekannten muss er absagen. Das bringt ihm auch noch Ärger mit seiner Frau ein, die sich auf den gemeinsamen Abend gefreut hat. Herr A. fühlt sich von allen Seiten bedrängt. Bei der Vorbereitung der Präsentation unterlaufen ihm dann Leichtsinnsfehler, die er mit hohem Zeitaufwand wieder korrigieren muss. In der Nacht schläft er schlecht, ihm fallen dabei noch zusätzlich unaufgearbeitete Probleme mit seinen Kollegen ein.
Herr A. würde in dieser Situation wahrscheinlich sagen: „Ich bin im Stress“. Wenn man sich mit dem Thema „Stress“ beschäftigt, werden oft unscharfe und uneindeutige Begriffe verwendet. Daher soll anhand des obigen Beispiels zunächst eine Begriffserklärung erfolgen. Umgangssprachlich wird der Begriff „Stress“ einerseits als Beschreibung eines Zustandes gebraucht („Ich bin im Stress“), andererseits wird er als Beschreibung für die stressauslösenden Situationen benutzt („Das macht mir Stress“). Der Begriff „Stress“ stammt ursprünglich aus der Materialforschung und bedeutet dort „Anspannung“, „Verbiegung“, „Belastung“. Um das Jahr 1950 herum hat dann der Pionier der Stressforschung Hans Selye den Stressbegriff auf die Biologie übertragen. Er bedeutet hier ebenfalls „Anspannung“, „Belastung“. Heutzutage ist das Wort „Stresstest“ in Mode gekommen, es wird immer dann gebraucht, wenn man die Robustheit von irgendetwas bestimmen will. Das Wort „Stresstest“ wird dabei jedoch sehr unpräzise und eher im politischen Umfeld gebraucht. Im Weiteren soll daher Stress den Zustand der Anspannung und Belastung bedeuten. Die jeweiligen Situationen, die Stress auslösen, werden in Abgrenzung dazu „Stressoren“ genannt. Im obigen Beispiel sind die Präsentation, die Zeitnot, die Zusatzarbeiten und der Ärger mit seiner Ehepartnerin die Stressoren. Stressoren können rein physische Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze oder Kälte, Schmerzen, physische Verletzungen oder chemische Substanzen, sein. Sie können aber auch aus dem Leistungsbereich stammen, wie z.B. aus Überforderung oder Unterforderung resultieren, aufgrund von anstehenden Prüfungen oder Bewertungssituationen oder durch Leistungsdruck, Frustration etc. entstehen Auch aus dem sozialen Bereich können Stressoren wie Isolation, Trennung, Menschenmassen, Konkurrenz, Aggressionen usw. wirksam sein.
Die innere Unruhe, der Gedanke „Ich schaffe das alles nicht rechtzeitig“, die Schlafstörung, die Leichtsinnsfehler und die Gedanken an die Probleme mit den Kollegen sind im obigen Beispiel die individuellen Reaktionen von Herrn A. auf diese Stressoren. Natürlich kann auch die Stressreaktion selber zu einem Stressor werden. In unserem Beispiel führte die Stressreaktion bei Herrn A. dazu, dass er Leichtsinnsfehler machte, die dann korrigiert werden mussten und so die Zeitnot noch verstärkten.
Welche Ereignisse nun als Stressoren wirken und welche nicht, kann man dabei nicht allgemeinverbindlich sagen. Schon die Alltagserfahrung lehrt, dass manche Menschen beispielsweise eine Achterbahnfahrt, eine Klettertour oder einen Vortrag vor vielen Zuhörern zu halten als eine Quelle der Freude, andere dagegen als einen Stressor empfinden. Ob eine Situation zu einem Stressor werden kann hängt neben den objektiven Gegebenheiten unter anderem auch stark von der individuellen Lern- und Lebensgeschichte sowie von individuellen Bewertungen des Stressors und der Einschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten ab.
Definition von Stress:
Stress ist eine unspezifische Aktivierungsreaktion des gesamten Organismus auf Stressoren, wenn diese als Gefährdung wahrgenommen werden.
2.1 Wie verändert sich unser Körper bei Bedrohungen?
Um die Reaktion unseres Körpers und unseres Gehirns in Stresssituationen (Bedrohungen/Belastungen) verstehen zu können, ist es hilfreich, uns in die Welt unserer Vorfahren vor ca. 100.000 Jahren zu versetzen. Stellen wir uns folgende Situation vor: Ein Mensch vor 100.000 Jahren hört Gebrüll. Er hört Tritte im Wald und glaubt, einen Schatten gesehen zu haben. Was wird dieser Mensch tun? Er wird wahrscheinlich versuchen, blitzschnell davonzulaufen. Wenn ihm dies nicht mehr möglich ist, oder wenn er glaubt, stärker zu sein als das Tier, das wahrscheinlich die Geräusche verursacht hat, so wird er sich zum Kampf mit dem Tier bereit machen. Er hat also prinzipiell zwei Möglichkeiten, um auf die potenzielle Bedrohung zu reagieren, entweder mit Kampf oder mit Flucht. Um bei realen physischen Bedrohungen entweder kämpfen oder flüchten zu können, müssen im Körper einige physiologische Veränderungen ablaufen, die letztendlich der schnellen Bereitstellung großer Mengen von Energie dienen. Die wichtigsten dieser physiologischen Veränderungen und deren Funktion bei physisch realen Bedrohungen werden in Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 1: Automatisch ablaufende physiologische Veränderungen bei physisch realer Bedrohung
Erhöhung der Herzfrequenz
Das Herz schlägt in Bedrohungssituationen schneller, dadurch wird die Durchblutung der Muskulatur erhöht, mehr Sauerstoff, der zur Energiegewinnung benötigt wird, wird in die Zellen transportiert. Mit einer Erhöhung der Herzfrequenz geht auch eine Erhöhung des Blutdrucks einher. Die Erhöhung der Herzfrequenz ist wohl die am deutlichsten spürbare Komponente der Stressreaktion.
Beschleunigung der Atmung
Durch eine schnellere Atmung wird dem Körper mehr Sauerstoff zur Verfügung gestellt, der zur vermehrten Energieerzeugung notwendig ist.
Bereitstellen von Blutfetten
Der Körper stellt der Muskulatur Fette zur Verfügung, um aus deren Abbau Energie zu gewinnen, diese Fette werden über die Blutbahnen zu der Muskulatur transportiert.
Hemmung der Verdauung
Das Blut wird aus den inneren Organen in die Muskulatur umverteilt. Dadurch wird die Verdauung gehemmt, der Körper scheint sich zu sagen: „Erst der Gefahr entgehen, dann weiter verdauen, es gibt im Moment wichtigere Dinge (Kampf oder Flucht) als Verdauung“. Der Körper konzentriert seine ganzen Kräfte auf diejenigen Funktionen, die akut zum Überleben wichtig sind. Das Blut wird hauptsächlich von Magen, Darm, Leber und Nieren abgezogen und statt dessen der Muskulatur zugeleitet.
Hemmung der Sexualfunktion
Hier gilt das gleiche wie bei der Verdauung: Die Sexualfunktion ist in dem Moment der realen physischen Bedrohung unwichtig für das Überleben und wird daher blockiert.
Erhöhung der Muskelspannung
Durch das Vorspannen der Muskulatur ist es möglich, Bewegungen schneller ausführen zu können. Die Vorspannung der Muskulatur ermöglicht ihr bildlich gesprochen einen „fliegenden Start“, man ist durch die Vorspannung der Muskulatur „auf dem Sprung“, um sofort reagieren zu können. Diesen Effekt kann man z.B. gut bei Tennisspielern beobachten, die einen gegnerischen Aufschlag erwarten, der ganze Körper ist in Anspannung und in Bewegung, um aus der Anspannung und Bewegung heraus schneller reagieren zu können. Besonders stark verspannt sich die Muskulatur in Stresssituationen im Hals- und Schulterbereich. Dies geschieht vermutlich deshalb, weil durch das Hochziehen der Schultern die großen Arterien, die im Normalzustand relativ ungeschützt am Hals entlang laufen, geschützt werden sollen.
Erhöhung der Blutgerinnungsfähigkeit
In Situationen physischer Bedrohung wird die Gerinnungsfähigkeit des Blutes reflexhaft erhöht. Bei erhöhter Blutgerinnungsfähigkeit ist es wahrscheinlicher, im Falle einer Verletzung zu überleben, da die Wunde dann weniger stark blutet, bzw. sich schneller wieder schließt.
Senkung des elektrischen Hautwiderstandes
Der Grund für diese physiologische Veränderung ist noch nicht genau bekannt. Der „kalte Schweiß“ tritt auf. Mit der Absonderung von Schweiß geht eine Verringerung des elektrischen Hautwiderstandes einher. Die Schweißabsonderung kann jedoch nicht den ganzen Effekt der Verringerung des Hautwiderstandes erklären. Diese Reaktion des Körpers in Stresssituationen wird auch „Psychogalvanischer Reflex“ genannt.
Aufmerksamkeitseinengung auf die Gefahrenquelle
Die ganze Aufmerksamkeit wird in physischen Bedrohungssituationen auf die tatsächliche oder vermutete Bedrohung gerichtet. Es bleibt keine Aufmerksamkeit für Wahrnehmungen übrig, die nichts mit der Bedrohung zu tun haben. Aus anekdotischen Kriegsberichten ist bekannt, dass die momentane Aufmerksamkeitseinengung bei einem Feindangriff so stark sein kann, dass selbst der Verlust des eigenen Beines kurzzeitig nicht bemerkt werden kann.
Erhöhung der Wachheit, Aktivierung
Es kommt zu einer Erhöhung der Wachheit. Dies zeigt sich darin, dass die elektrischen Gehirnwellen hochfrequent und niederamplitudig werden. Niederfrequente und hochamplitudige Gehirnwellen, wie sie für Entspannungszustände charakteristisch sind, werden dagegen blockiert.
All diese körperlichen Reaktionen laufen blitzschnell und „unbewusst“ ab. „Unbewusst“ bedeutet dabei, dass wir die Veränderungen nicht willentlich herbeiführen. Der Begriff „unbewusst“ wird in diesem Buch immer im Sinne von „ungewusst“ gebraucht und hat keinen Bezug zu psychoanalytischen Begriffen wie Triebe, Verdrängung etc.
Einige der Reaktionen des Körpers in physischen Bedrohungssituationen, wie z.B. die Beschleunigung der Atmung oder die Erhöhung der Herzfrequenz, sind zumindest prinzipiell gut bewusst wahrnehmbar. Andere Abläufe, wie z.B. die Veränderung der Gehirnwellen oder das Ausschütten von Blutfetten, sind unserer Wahrnehmung dagegen ohne Hilfsmittel nicht unmittelbar zugänglich.
Im Laufe der Evolution haben sich die oben beschriebenen Reaktionen herausgebildet und durchgesetzt, weil sie zu einer überhöhten Lebensfähigkeit in einer Welt realer physischer Bedrohungen geführt haben. Diejenigen, die nicht über diesen Reaktionsmechanismus verfügten, hatten keine Chance, unsere Vorfahren zu werden. Sie wurden im Staub der Evolution zurückgelassen. Im Laufe der Evolution wurden die körperlichen Reaktionen ausgebildet, die dabei behilflich waren, die Alltagsprobleme der Jäger und Sammler zu lösen. Wir verfügen auch alle heute noch über diese grundlegenden Überlebensmechanismen aus der Urzeit, obwohl sich unsere Umwelt und unsere Lebensbedingungen drastisch geändert haben.
2.2 Bedrohungen früher und heute
Die Kampf-/Fluchtreaktion hatte für unsere Vorfahren unmittelbar lebensrettende Bedeutung, in der heutigen Welt geht es glücklicherweise immer weniger darum, realen physischen Gefahren (z.B. wilden Tieren, physischen Angriffen) zu begegnen. Auch heute noch ist die Kampf-/Fluchtreaktion jedoch in Ausnahmefällen durchaus sinnvoll, z.B. um sich mit einem gezielten Sprung vor einem mit überhöhter Geschwindigkeit herannahenden Auto zu retten. In solch einer Situation zu lange zu zögern und nachzudenken, wäre im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Die Mehrzahl der Gefahren, denen wir uns in unserem heutigen Leben und insbesondere in der Arbeitswelt gegenübersehen, sind meist jedoch eher mittelbarer und häufig psychischer Natur (z.B. Zeitdruck, Kritik, schwierige Verhandlungen, Probleme mit Mitarbeitern oder Kollegen). Die körperliche Reaktion auf diese mittelbaren und psychischen „Gefahren“ ist jedoch genau die gleiche wie diejenige, mit der der Körper auf eine unmittelbare physisch reale Gefahr reagieren würde. Für unseren Körper ist es völlig egal, ob die Bedrohung aus einem wilden Tier oder beispielsweise aus dem alltäglichen Ärger mit einem Lieferanten besteht, er reagiert physiologisch genau gleich, indem er sich zum Kampf oder zur Flucht vorbereitet. Entwicklungsgeschichtlich ist der Weg von heute aus zurück in die Zeit, in der der Mensch als Jäger und Sammler lebte und in der sich unsere physiologischen Überlebenstechniken und Denkgewohnheiten entwickelt haben, nur ein Katzensprung. Mit der Entwicklung vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer und Viehzüchter haben sich jedoch die Lebensbedingungen des Menschen drastisch verändert. Der Mensch begann, die Umwelt, mit der er bis dahin eins war, nach seinem eigenen Willen zu gestalten. Diese willentliche Veränderung der Lebenswelt des Menschen hat sich seither immer mehr beschleunigt.
Wir haben uns insbesondere in den letzten Jahrhunderten eine Umwelt geschaffen, in der reale Bedrohungen immer seltener wurden, psychische Belastungen und Bedrohungen, wie z.B. Leistungsdruck, Konkurrenz und Hektik, haben dagegen immer mehr zugenommen. Diese Entwicklung hat sich noch mehr beschleunigt, je näher wir der heutigen Zeit kommen. In den letzten 200 Jahren war die Veränderung unserer Lebensbedingungen besonders groß. Unser Verhalten hat sich mit dieser veränderten Umgebung ebenfalls stark verändert, jedoch nicht unsere körperliche Reaktion auf physisch unmittelbar reale oder „nur“ vorgestellte Bedrohungen und Belastungen. Nach wie vor reagiert der Körper auf diese Stressoren mit der Kampf-/Fluchtreaktion.
Die Kampf-/Fluchtreaktion wird größtenteils von dem sogenannten Stammhirn, einem entwicklungsgeschichtlich sehr alten Gehirnteil gesteuert. Das Stammhirn steuert alle lebenswichtigen Funktionen, wie z.B. die Atmung, die Verdauung, Hunger, Immunabwehr, und eben auch die Kampf-/Fluchtreaktion.
Unser Großhirn, mit dem wir uns unsere heutige Umwelt gestaltet haben, hat sich dagegen entwicklungsgeschichtlich erst relativ spät ausgebildet. Das Stammhirn wurde im Laufe der Evolution nicht prinzipiell „umgebaut“ (indem z.B. die funktionalen Zusammenhänge hätten geändert werden können), es wurde dagegen durch das Großhirn gewissermaßen „überbaut“, indem neue Funktionen dazukamen, die alten aber auch noch bestehen blieben. Dies hat dazu geführt, dass unser Verhalten förmlich von zwei Gehirnteilen gesteuert wird, die uns in manchen Situationen sogar gegensätzliche Impulse geben können. Unsere heutige Lebens- und Arbeitssituation hat (zum Glück) nichts mehr oder nur noch sehr wenig mit der Urwelt zu tun.
Unser Stammhirn reagiert jedoch auch in der heute drastisch veränderten Lebens- und Arbeitssituation genauso wie vor Tausenden von Jahren. Von der Veränderung unserer Lebensbedingungen der letzten Jahrhunderte (die durch unser Großhirn erst möglich wurden) weiß unser Stammhirn nichts. Wir haben noch genau die gleiche genetische Ausstattung wie vor einigen tausend Jahren. Käme einer unserer Vorfahren aus der Jäger- und Sammlerzeit mit einer Zeitmaschine in die heutige Zeit, so könnten wir ihn wahrscheinlich in seinen körperlichen Reaktionen nicht von uns heutigen Menschen unterscheiden. Nur die Kleidung des Menschen hat sich in den letzten Jahrtausenden verändert, seine biologische Grundausstattung blieb die selbe. Unser Großhirn hat uns in die Lage versetzt, unsere Umwelt in einem immer stärkeren Ausmaß und immer schneller durch technische Errungenschaften zu verändern. Mit unserem Körper tragen wir daher heute ein historisches Fossil mit uns herum, das in seiner biologischen Funktionalität nicht mehr unserer heutigen Lebensweise entspricht. Der Mensch hat ca. 99 % seiner Existenz als Jäger und Sammler verbracht. Für diese Art des Lebens ist unsere biologische Ausstattung gemacht, nicht jedoch für die Welt in der wir heute leben. Dies kann im heutigen Leben zu widersprüchlichen Handlungstendenzen führen.
Wird man beispielsweise in einer Besprechung verbal angegriffen, so reagiert der Körper wie seit Urzeiten wie auf eine physische Bedrohung mit der Reaktion, die ihn für Kampf oder Flucht vorbereitet. Nun wird man natürlich nicht auf den Diskussionspartner losgehen und man wird auch nicht aus dem Besprechungsraum rennen, sondern in aller Regel physisch eher regungslos in der Situation verharren. Innerlich jedoch wird man noch einige Zeit die Unruhe spüren, die aus der freigesetzten Energie herrührt, die einem der Körper für Kampf oder Flucht bereitstellt. Diese Energie wird also nicht in die Kampf-/ Fluchtreaktion umgesetzt und ist daher noch einige Zeit lang im Körper in Form von Unruhe zu spüren.
2.3 Kurz- und langfristige Konsequenzen der Nichtpassung
Die Tatsache, dass uns unser Körper als Reaktion auf Stressoren auf Kampf oder Flucht vorbereitet, wir aber im heutigen Leben weder physisch kämpfen noch flüchten, führt zu einer Reihe von Konsequenzen, die Auswirkungen auf die Lebensqualität und langfristig auch auf die Gesundheit haben können.
2.3.1 Unmittelbare Folgen
Die unmittelbaren Folgen dieser Diskrepanz zwischen der Kampf-/Fluchtreaktion, für die uns unser Stammhirn als Reaktion auf Stressoren vorbereitet und unserem tatsächlichen Verhalten (meist körperliche Regungslosigkeit) sind in jeder Stresssituation ohne Zeitverzug zu spüren:
• Es entsteht ein subjektiv unangenehmes Gefühl (vgl. Kapitel 2.3.1.1).
• Die Verhaltenseffektivität verringert sich (vgl. Kapitel 2.3.1.2).
• Es kommt zu einem Aufschaukelungsprozess: Die Aktivierung verstärkt sich selbst (vgl. Kapitel 2.3.1.3).
• Und langfristig besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer chronischen Erkrankung (vgl. Kapitel 2.3.2).
2.3.1.1 Subjektiv unangenehmes Gefühl
Die erste, sehr leicht und unmittelbar spürbare Folge von Stresssituationen ist ein subjektiv unangenehmes Körpergefühl. Während und nach Situationen, die für uns bedrohlich und belastend sind, fühlen wir uns unwohl, wir fühlen zusätzlich im Körper eine mehr oder weniger starke Unruhe. Der Körper hat uns wie seit Tausenden von Jahren reflexhaft Energie für die Ausführung der Kampf-/ Fluchtreaktion bereitgestellt. Da die Energie jedoch nicht in Kampf oder Flucht umgesetzt wird, äußert sie sich als körperliche Unruhe, die wir je nach den konkreten situativen Gegebenheiten als Unzufriedenheit, Gehetztsein, Hilflosigkeit, Angst, Hass, Aggression oder anderen negativen Emotionen spüren.
2.3.1.2 Verringerung der Verhaltenseffektivität
Die zweite unmittelbare Folge ist eine verringerte Verhaltenseffektivität für Handlungen, die nicht zur Kampf-/Fluchtreaktion gehören. Das Verhalten wird dann hektisch, konfus, man reagiert aggressiv usw. Der Zusammenhang zwischen Aktivierung/Anspannung und der Effektivität des Verhaltens ist im sogenannten Yerkes-Dodson-Gesetz (Yerkes & Dodson 1908) beschrieben (vgl. Abbildung 2). Der Zusammenhang hat die Form einer umgekehrten U-Funktion. Schon am Ende des 19. Jahrhunderts wurden ähnliche Zusammenhänge von Wilhelm Wundt, einem Urvater der Psychologie, als Wund-Kurve aufgezeigt. Diese Beschreibung ist jedoch weniger bekannt. Berlyne (1974, S. 73) hat diese umgekehrte U-Kurve in zwei Teilkurven zerlegt. Charmandary (2005) hat die Rezeptoren und die Transmitter beschrieben, die für das Zustandekommen der Kurve von Bedeutung sind.
Abbildung 2: Anspannung und Verhaltenseffektivität
Hat die Aktivierung eine mittlere Intensität, ist die Verhaltenseffektivität am höchsten; ist die Aktivierung höher oder niedriger als der Idealwert, so ist die Verhaltenseffektivität relativ gering. Das Ziel muss es daher sein, die Aktivierung so zu kontrollieren, dass sie sich im mittleren Bereich befindet und das Verhalten somit möglichst effektiv wird. Unter Aktivierung wird im Folgenden der Zustand der körperlichen und auch psychischen Anspannung verstanden, der durch die weiter oben beschriebenen Symptome gekennzeichnet ist. Aktivierung ist dabei gleichbedeutend mit „Stress“, „Anspannung“, „Nervosität“, „Unruhe“, „Aufregung“, etc.
Verhaltenseffektivität:
Unter Verhaltenseffektivität versteht man die Fähigkeit, die Handlungsalternativen, über die man prinzipiell verfügt, voll zur Verfügung zu haben und sie auch situationsangemessen einsetzen zu können.
Das Gehirn arbeitet zwar bei hoher Aktivierung optimal, um uns auf Kampf oder Flucht vorzubereiten, aber beide Reaktionen sind in der Prüfungssituation, einem Streitgespräch, unter Zeitdruck oder ähnlichen Situationen natürlich nicht sinnvoll. Für Reaktionsweisen jenseits der Kampf- oder Fluchtreaktion ist unser Gehirn in Situationen, die zu einer starken Aktivierung führen weitgehend blockiert. Ist der Körper andererseits zu wenig aktiviert, so ist unser Verhalten ebenfalls nicht sehr effektiv. Dies ist uns beispielsweise durch den Zustand kurz nach dem Aufwachen vertraut. Der Körper ist quasi noch nicht „warmgelaufen“. Das Problem, von einer zu geringen Aktivierung in den Bereich einer mittleren Aktivierung zu kommen, ist jedoch für die meisten Menschen eher unbedeutend. Das weitaus größere Problem ist für die meisten Menschen, vom Bereich der zu großen Aktivierung in den Bereich der mittleren Aktivierung zu gelangen.
Will man den rechten Endpunkt der umgedrehten U-Kurve erlebbar machen, wäre es dazu notwendig, eine sehr starke Aktivierung zu erzeugen, die dann einem Blackout gleichkommen würde. Man könnte dies beispielsweise durch die Arbeit mit starken Grundängsten, wie z.B. der Angst vor Höhe und der Angst vor Wasser (prepared stimuli) erreichen. Wenn man beide Ängste mit entsprechender Intensität kombiniert, kommt man sehr weit auf der Aktivierungsachse. Eine solche Situation könnte man beispielsweise in Form einer Klettersituation an einem Wasserfall herstellen (vgl. Abbildung 3). Relativ einfache Dinge, die vorher eingeübt wurden (einfache Verhaltensweisen, räumliche Orientierung, die Beherrschung einfacher Knoten etc.), sind dann plötzlich wie verschwunden.
Abbildung 3: Die „Urängste“ Wasser und Höhe (© doep – Fotolia.com)
Wo genau der mittlere und somit effektivste Bereich der Aktivierung liegt, kann für verschiedene Menschen physiologisch bedingt unterschiedlich sein (vgl. Tabelle 2). Manche Menschen werden sich schon bei geringerer Aktivierung im mittleren Bereich befinden, andere brauchen mehr Aktivierung. Die Lage der Kurve kann von Person zu Person oder von Situation zu Situation verschieden sein. Die Kurve an sich bleibt jedoch immer die gleiche. Weiterhin sind es ganz unterschiedliche Dinge, die bei verschiedenen Menschen eine Veränderung der Aktivierung erzeugen. Was für einen Menschen eher entspannend (desaktivierend) ist, kann für einen anderen Menschen sehr stark bedrohlich (aktivierend) sein. Zum Beispiel kann das Überwinden einer bestimmten schwierigen Kletterstelle für einen Könner eine sehr interessante, positive Tätigkeit sein, für den Anfänger hingegen kann dies hochgradig angsterregend sein. Wie eine Situation eingeschätzt wird, hängt sehr stark von dem Ausmaß der Kontroll- oder Einflussmöglichkeiten ab, das man in der Situation hat, oder zumindest glaubt zu haben.
Tabelle 2: Wie kann man erkennen, in welchem Bereich der Kurve man sich befindet?
Linker Teil der Kurve (zu wenig Aktivierung)
– Man fühlt sich unwohl
– Leichtsinnsfehler treten auf
– Geringe Verhaltenseffektivität
– Langeweile
Mittlerer Teil der Kurve (Optimale Aktivierung)
– Man fühlt sich wohl
– Keine Stresssymptome (vgl. Kapitel 2.1)
– Hohe Verhaltenseffektivität
Rechter Teil der Kurve (zu viel Aktivierung)
– Man fühlt sich unwohl
– Stresssymptome treten auf (vgl. Kapitel 2.1)
– Toleranz gegen Störungen ist gering
– Man fährt leicht aus der Haut
– Geringe Verhaltenseffektivität
Ein kleiner Exkurs zum Thema Rauchen:
Nikotin bewirkt duch seine „biphasische Wirkung“, dass sich der Anspannungsgrad bei Zuführung von Nikotin immer auf das optimale Niveau einpendelt, egal, ob vorher zu viel oder zu wenig Anspannung herrscht. Das Nikotin erzeugt „automatisch“ den richtigen Aktivierungspegel. Ein Raucher besitzt damit einen höchst wirksamen Selbstregulationsmechanismus, den er nur sehr schwer hergeben möchte. Dies ist ein Grund dafür, warum Therapien zur Entwöhnung von Nikotin in der Regel sehr schlechte Erfolgsquoten haben.
2.3.1.3 Aufschaukelung: Die Aktivierung verstärkt sich selbst
Die dritte negative Wirkung, die Stressoren auslösen können, ist die Entstehung eines Aufschaukelungsprozesses, bei dem sich die Aktivierung praktisch selbstständig erhöhen kann. Dabei kann die Wahrnehmung der körperlichen Reaktion auf einen Stressor selbst zu einem Stressor werden. Wenn man z.B. kurz vor einem Vortrag steht und bemerkt, dass das Herz schneller schlägt, so kann diese Wahrnehmung dazu führen, dass man denkt „Ich bin nervös“, „Die Zuhörer werden merken, dass ich nervös bin“, „Ich bin der Situation hilflos ausgesetzt“ o.Ä. Diese Art von Gedanken steigern die Anspannung und somit die körperliche Reaktion noch mehr – ein Teufelskreis kann entstehen.
2.3.2 Langfristige Folgen
Wenn der Stress über lange Zeit andauert, besteht ein erhöhtes Risiko eine chronische Erkrankung zu entwickeln. Tritt Stress nur sporadisch auf, so klingen die körperlichen Folgen mehr oder weniger schnell wieder ab, „nur“ die bisher beschriebenen unmittelbaren Folgen werden dann wirksam. Wenn auf einzelne Stresssituationen ausreichend lange Zeiten der Regeneration folgen, so wirken sich diese Stresssituationen gesundheitlich nicht weiter problematisch aus. Hält die Anspannung dagegen lange an und gibt es nicht ausreichende Phasen der Regeneration, so kann es leicht zu chronischen Symptomen kommen. Kein Organismus hält es über längere Zeit hinweg aus, ständig in einem erhöhten Anspannungszustand zu bleiben.