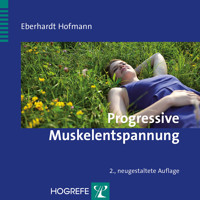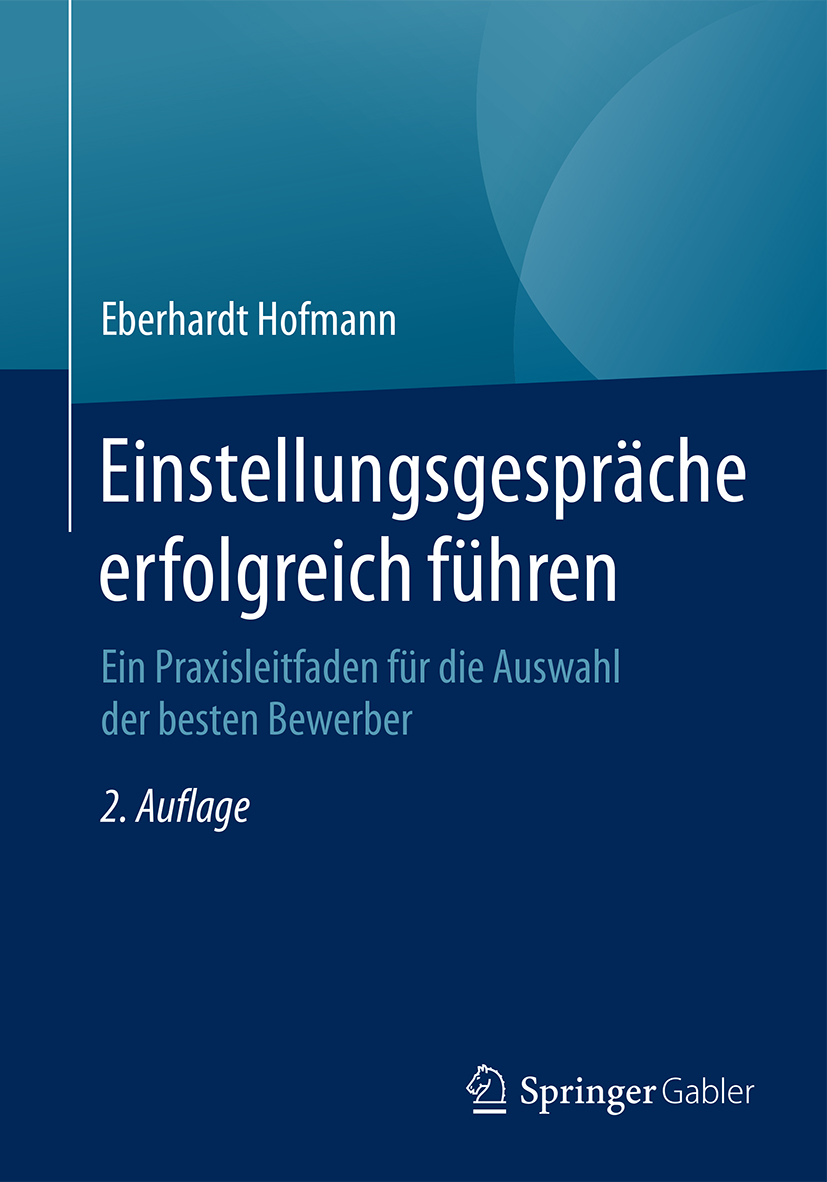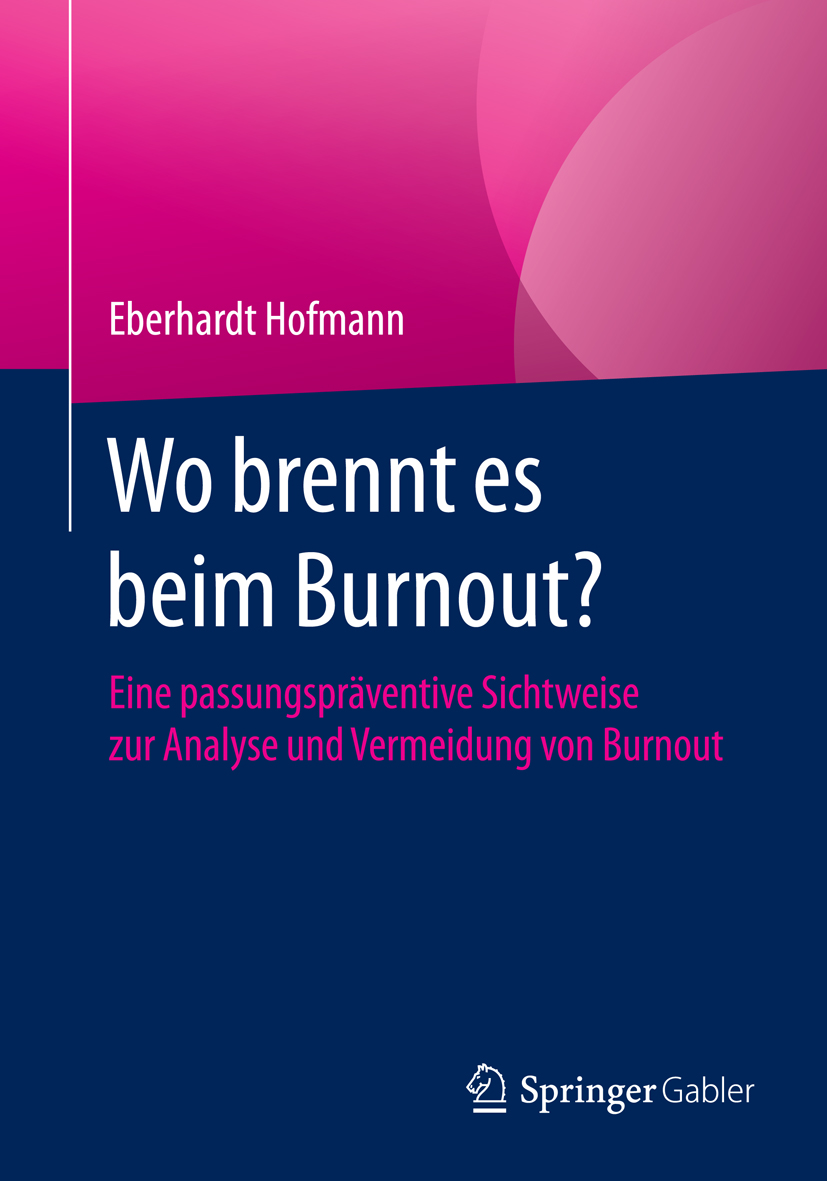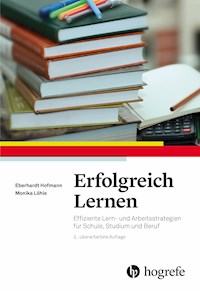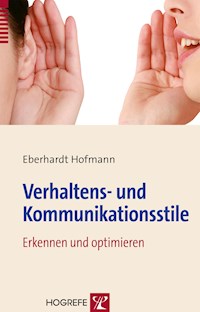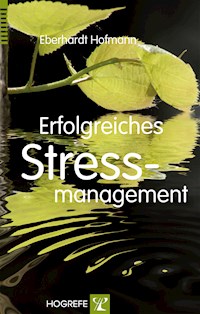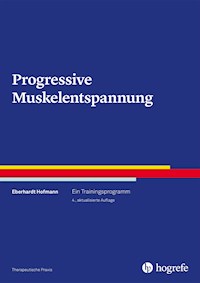
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Progressive Muskelentspannung kann in zahlreichen Bereichen der Psychotherapie und Gesundheitsprävention eingesetzt werden. In diesem Band wird ein vierzehn Sitzungen umfassendes Trainingsprogramm zur Progressiven Muskelrelaxation vorgestellt, bei dem die rein muskuläre Entspannung mit speziellen Konditionierungen und Visualisierungsübungen erweitert wird. Der Kursaufbau und die einzelnen Kurseinheiten werden detailliert beschrieben. Zunächst wird die muskuläre An- und Entspannung erlernt, diese anschließend an ein individuelles Entspannungssignal und an die Veränderung der Atmung gekoppelt. Spezielle Visualisierungsübungen verstärken die Entspannung. Der muskuläre Anteil der Übungen wird mit dem Ziel einer hauptsächlich mental-konzentrativen Entspannung zunehmend gekürzt. Die Instruktionen zur muskulären Entspannung und zur Visualisierung erfolgen in Form hypnotischer Induktionen. Sämtliche für die Durchführung des Trainings notwendigen Texte für die Entspannungs- und Visualisierungsübungen sowie weitere Arbeitsmaterialien sind im Manual enthalten. Zusätzlich zum Manual ist eine Audio-CD mit Entspannungstexten lieferbar (ISBN 978-3-8017-2560-).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Eberhardt Hofmann
Progressive Muskelentspannung
Ein Trainingsprogramm
4., aktualisierte Auflage
Dipl.-Psych. Eberhardt Hofmann, geb. 1959. Studium der Psychologie in Tübingen. Klinischer Hypnosetherapeut (ESH). Tätigkeit in der Personal- und Führungskräfteentwicklung in verschiedenen Großbetrieben. Lehraufträge an mehreren Hochschulen. Sachbuchautor zu Themen der Angewandten Psychologie.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Zu diesem Manual ist zusätzlich eine Audio-CD mit Entspannungstexten lieferbar (Hofmann: Progressive Muskelentspannung. Entspannungs-CD, 2., neugestaltete Auflage 2013, ISBN 978-3-8017-2560-0).
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: ARThür Grafik-Design und Kunst, Weimar
Format: EPUB
4., aktualisierte Auflage 2020
© 1999, 2003, 2012 und 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3024-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3024-0)
ISBN 978-3-8017-3024-6
https://doi.org/10.1026/03024-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Für Alisa
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur vierten Auflage
Kapitel 1 Beschreibung der vorgestellten Methode und Unterschiede zu anderen Verfahren
1.1 Die Methode der „Progressiven Muskelrelaxation“
1.2 Unterschiede zu anderen Formen der „Progressiven Muskelrelaxation“
1.3 Unterschiede zum Autogenen Training (AT)
1.4 Unterschiede zur Meditation
Kapitel 2 Trainingsaufbau
2.1 Erster Schritt: Muskuläre An- und Entspannung
2.2 Zweiter Schritt: Muskuläre An- und Entspannung – Entspannung auf ein Entspannungssignal
2.3 Dritter Schritt: Muskuläre An- und Entspannung – Entspannung auf ein Entspannungssignal und Synchronisation mit der Atmung
2.4 Vierter Schritt: Visualisierung im Anschluss an die muskuläre An- und Entspannung mit Entspannungssignal und synchronisierter Atmung
2.5 Fünfter Schritt: Verkürzungen und Übungen im Sitzen
2.6 Sechster Schritt: Übertragung in alltägliche Situationen
Kapitel 3 Hinweise zur Durchführung
Kapitel 4 Anwendungsbereiche des Verfahrens
Kapitel 5 Verwendung der Sitzungsbeschreibungen
Kapitel 6 Beschreibung der Sitzungen
6.1 Erste Sitzung Lernschritt: Muskuläres An- und Entspannen
6.2 Zweite Sitzung Lernschritt: Muskuläres An- und Entspannen
6.3 Dritte Sitzung Lernschritt: Koppelung des Entspannungssignals an die muskuläre Entspannungsphase
6.4 Vierte Sitzung Lernschritt: Koppelung des Entspannungssignals an die muskuläre Entspannungsphase
6.5 Fünfte Sitzung Lernschritt: Koppelung der Atmung an das Entspannungssignal und an die muskuläre Entspannungsphase
6.6 Sechste Sitzung Lernschritt: Koppelung der Atmung an das Entspannungssignal und an die muskuläre Entspannungsphase
6.7 Siebte Sitzung Lernschritt: Koppelung der Atmung an das Entspannungssignal und an die muskuläre Entspannungsphase, danach Visualisierung
6.8 Achte Sitzung Lernschritt: Koppelung der Atmung an das Entspannungssignal und an die muskuläre Entspannungsphase, danach Visualisierung
6.9 Neunte Sitzung Lernschritt: Verkürzung der Übungen, Zusammenfassen von Muskelgruppen, Üben im Sitzen
6.10 Zehnte Sitzung Lernschritt: Verkürzung der Übungen, Zusammenfassen von Muskelgruppen, Reduzieren der muskulären Übungsteile, Ausweitung der Atmungs- und Imaginationsanteile
6.11 Elfte Sitzung Lernschritt: Verkürzung der Übungen, Zusammenfassen von Muskelgruppen, Reduzieren der muskulären Übungsteile, Ausweitung der Atmungs- und Imaginationsanteile
6.12 Zwölfte Sitzung Lernschritt: Weitere Verkürzung der Übungen, Zusammenfassen von Muskelgruppen, Reduzieren der muskulären Übungsteile, Ausweitung der Atmungs- und Imaginationsanteile
6.13 Dreizehnte Sitzung Lernschritt: Anwendung in Realsituationen
6.14 Vierzehnte Sitzung Lernschritt: Anwendung in Realsituationen
Literatur
Anhang
Ergänzende Texte
Informationen für die Kursteilnehmer
Übersicht über die Materialien auf der CD-ROM
Materialien auf CD-ROM
|9|Vorwort zur vierten Auflage
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Methode der „Progressiven Muskelentspannung“ auch im deutschen Sprachraum erfreulicherweise immer weiter etabliert. Dieses beständige Interesse an der „Progressiven Muskelentspannung“ spiegelt sich auch darin wider, dass dieses Buch nun in der vierten Auflage erscheint.
Das vorliegende Buch entstand aus der eigenen langjährigen Erfahrung mit der Methode der „Progressiven Muskelrelaxation“ in der „Urform“, d. h., in Form der reinen muskulären An- und Entspannung sowohl aus der Perspektive des Übenden als auch aus der Perspektive des Kursleiters. Dieser „Urform“ lagen Texte von Echelmeyer und Zimmer (1977) zugrunde. Ausgehend von der reinen Form der muskulären An- und Entspannung habe ich dann verschiedene darüber hinausgehende Elemente aus anderen Entspannungsverfahren, insbesondere der Hypnose eingebaut wie die Verwendung eines Entspannungssignals, die Synchronisation mit der Atmung oder eine spezielle Form der Visualisierung mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und das Verfahren dadurch effizienter zu machen. Dadurch können Kursteilnehmer häufig den Entspannungseffekt schneller und intensiver erleben, was sich natürlich besonders auf die Motivation zur kontinuierlichen Kursteilnahme bzw. zum selbstständigen Üben positiv auswirkt.
Das vorgestellte Trainingsprogramm ist systematisch aufgebaut mit dem Ziel, die Trainingseinheiten immer mehr zu verkürzen und dabei die Menge der angespannten Muskulatur schrittweise zu verringern. In der Endform kann das Entspannungsverfahren direkt in Realsituationen, z. B. in der Mittagspause am Schreibtisch, während man mit dem Auto im Stau steht oder während einer Zahnbehandlung angewandt werden.
Die Instruktionen sind so gewählt, dass die Gefahr sehr gering ist, mit den Instruktionen und Kommentaren in Widerspruch zu den Empfindungen der Kursteilnehmer zu geraten. Dies geschieht hauptsächlich durch die Verwendung hypnotischer Sprachmuster. Formulierungen zum inneren Erleben, die direkt falsifizierbar sind (wie z. B. die Verwendung vorgegebener Bilder), werden vermieden.
Der theoretische Teil dieses Buches ist sehr kurz gehalten, Zielsetzung ist es nicht, eine theoretische Abhandlung über die Progressive Muskelentspannung vorzulegen, da es wohl genügend Literatur dazu gibt. Das vorliegende Buch ist vielmehr ein unmittelbar anwendbares Manual für Kursleiter und Therapeuten zur konkreten Durchführung des Verfahrens im Rahmen eines Kurses. Dazu existiert zu jeder Kursstunde eine Beschreibung des Vorgehens sowie die Texte, die in der Stunde verwendet werden. Die Texte sind im Kurssetting als Vorlage zum Vorlesen durch den Kursleiter gedacht. Bei dem vorliegenden Aufbau der Übungen handelt es sich um eine intensiv erprobte und bewährte Systematik, von der bei Bedarf abgewichen werden kann. Sollte dies gewünscht sein, sollte jedoch auf jeden Fall die Abfolge der ersten vier Lernschritte eingehalten werden, da diese die Basis für alle anderen Varianten bilden.
Mein besonderer Dank gilt Walter Bongartz für die anregende Diskussion und die Hinweise zur Weiterentwicklung der Methode sowie den ehemaligen Kursteilnehmern für die vielfachen Rückmeldungen aufgrund denen die Weiterentwicklung der Methode erst möglich gewesen ist.
Zusätzlich zu diesem Manual ist auch eine Audio-CD erhältlich (Progressive Muskelentspannung, Entspannungs-CD, 2., neugestaltete Aufl. 2013, ISBN 978-3-8017-2560-0), auf der sich einige der in diesem Manual vorgestellten Übungen in gesprochener Form befinden. Für das selbstständige Üben der Kursteilnehmer zu Hause ist eine CD sehr hilfreich, da die jeweiligen Übungsschritte vorgegeben werden und sie sich so ganz auf die jeweiligen Empfindungen konzentrieren können.
Friedrichshafen, März 2020
Eberhardt Hofmann
|10|Kapitel 1Beschreibung der vorgestellten Methode und Unterschiede zu anderen Verfahren
Das in diesem Buch vorgestellte Verfahren soll zunächst kurz charakterisiert und von anderen Entspannungsverfahren sowie anderen Varianten der Progressiven Muskelrelaxation abgegrenzt werden.
1.1 Die Methode der „Progressiven Muskelrelaxation“
Die Entspannungsmethode der „Progressiven Muskelrelaxation (PMR)“ (fortschreitende Muskelentspannung), entstand in den 30er Jahren (Jacobson, 1934). Sie wurde von dem amerikanischen Physiologen Edmund Jacobson entwickelt, und wird daher auch vielfach „Jacobson-Training“ genannt. Die Methode der PMR ist im angelsächsischen Sprachraum sehr verbreitet. In Deutschland wurde sie erst mit dem Aufkommen der Verhaltenstherapie in den 70er Jahren bekannt und verbreitet.
Eine Folge der Reaktion auf Stress, Angst etc. ist neben vielen anderen physiologischen Veränderungen (Anstieg der Herzfrequenz, Beschleunigung der Atmung, Erhöhung des Blutdrucks, Senkung des elektrischen Hautwiderstandes, …) ein reflexhafter Anstieg der Muskelspannung. Im Umkehrschluss dazu kann man durch muskuläre Entspannung dem Stresserleben entgegenwirken, dies ist der Ansatzpunkt der PMR. Jacobson fand heraus, dass bei intensiver muskulärer Entspannung unter anderem die Atmung gleichmäßiger wird, die Herzfrequenz abnimmt, die Verdauung zunimmt, mentale und emotionale Aktivität minimiert werden etc. Die Beeinflussung der Stressreaktion durch die Veränderung der Muskelspannung hat den Vorteil, dass die Wahrnehmungsfähigkeit für den Zustand der Muskulatur sowieso relativ gut ausgeprägt ist, jeder Mensch hat ein mehr oder weniger gut entwickeltes Gefühl für den Spannungszustand seiner Muskulatur. Für andere körperliche Parameter, die sich bei Stress ändern, ist dagegen die Wahrnehmungsfähigkeit nur sehr gering oder überhaupt nicht ausgeprägt. So wird es z. B. nur schwer möglich sein, Aussagen über die Höhe des Blutdrucks oder die Höhe des elektrischen Hautwiderstandes treffen zu können.
Das Vorgehen der PMR zur Erreichung des Entspannungszustandes mutet dabei auf den ersten Blick paradox an. Man spannt verschiedene Muskelgruppen zunächst stark an. Danach lässt man die Muskulatur wieder locker und konzentriert sich auf den Übergang von der Anspannung zur Entspannung. Mit diesem Vorgehen fällt es jedoch vielen Menschen leichter, den Entspannungszustand zu erzeugen, da ja zunächst nur die reflexhafte muskuläre Anspannung verstärkt wird, die sowieso bei Anspannungen vorhanden ist. Zusätzlich wird ein Kontrasteffekt zwischen Anspannung und Entspannung erzeugt, der umso höher ist, je höher die vorhergehende Anspannung war. Die Entspannung wird dadurch – zunächst auf rein muskulärer Ebene – unmittelbar spürbar.
Dieser Sachverhalt kann mit Abbildung 1 verdeutlicht werden.
Die erlebte Differenz im Anspannungsniveau ist nach vorherigem Anspannen größer (Differenz als nach dem reinen Entspannen vom Niveau der Grundanspannung aus (Differenz 1).
Eine weitere Analogie für diesen Effekt stellt die Pendelanalogie dar.
Die Entspannung wird dabei mit einer Art „Pendeleffekt“ verglichen: um ein Pendel in eine Richtung (z. B. in Abbildung 2 nach links) zu bewegen (Bewegung A), kann man es in die gewünschte Richtung (nach links) anstoßen oder zunächst in die Gegenrichtung (nach rechts) anheben und dann loslassen (Bewegung B). Die PMR wählt die zweite Vorgehensweise. Die Entspannung wird in einem „fliegenden Start“ erzeugt.
Abbildung 1: Vorgehen bei der PMR
Abbildung 2: Pendelanalogie
Ziel des Trainings ist es, die Wahrnehmung für die Anspannung der Muskulatur zu schärfen, Jacobson spricht von einer „Kultivierung der Muskelsinne“. In der Regel halten wir wesentlich mehr Muskulatur angespannt, als wir notwendigerweise müssten. Sie können dies überprüfen, indem Sie sich z. B. auf einen Stuhl setzen und im ersten Schritt versuchen wahrzunehmen, welche Muskulatur im Moment in Ihrem Körper angespannt ist. Im zweiten Schritt können Sie versuchen, möglichst viele Muskelgruppen zu lockern und nur noch die Muskeln angespannt zu halten, die Sie brauchen, um nicht vom Stuhl zu fallen. Sie werden feststellen, dass dazu nur ein Bruchteil der vorher angespannten Muskulatur notwendig ist. In diesem Sinne sind wir in vielen Situationen unseres Lebens viel angespannter, als wir es eigentlich sein müssten. Wir verbrauchen dann zu viel muskuläre Energie, was in Form von Anspannung spürbar wird.
1.2 Unterschiede zu anderen Formen der „Progressiven Muskelrelaxation“
Systematischer Aufbau und Integration
Das vorgestellte Verfahren stellt eine Erweiterung und eine Kombination von bewährten Methoden dar (reine Muskelentspannung: Jacobson, 1934; Bernstein & Borcovec, 1973/2018; Brechtel, 1977/2014; Olschewski, 1992/2011; Atementspannung: Olschewski, 1995; Arbeit mit inneren Bildern: Lang, 1979; subtile Suggestionen: Araoz, 1985/1989; Bongartz & Bongartz, 2000; Bandler & Grinder, 1975/2011). Diese wurden in fünf verschiedenen Schritten aufeinander aufgebaut. Das vorgestellte Verfahren ist eklektisch orientiert. Die Wirksamkeit der einzelnen Komponenten und der Kombination sowie der Abfolge der Schritte wurde in verschiedenen Kursen an mehreren hundert Personen entwickelt und erprobt. Der systematische Aufbau der Übungen ist im Kapitel 2 „Trainingsaufbau“ beschrieben. Die ersten Sitzungen lehnen sich an den Text von Echelmeyer und Zimmer (1977) an.
Konditionierungen
Die Entspannungsphase wird klassisch an verschiedene Signale konditioniert. Dadurch wird der Einsatz der Entspannung in Alltagssituationen, in denen keine reale An- und Entspannung mehr erfolgt, vorbereitet. Die konditionierten Auslöser werden somit zum Signal für die Entspannungsreaktion (Russel & Sipich, 1973). In den Texten erfolgt die Konditionierung dadurch, dass immer auf das Wort „jetzt“ angespannt wird, auf das Wort „nun“ entspannt wird. Weitere Konditionierungen erfolgen auf das individuelle Entspannungssignal (zweiter Lernschritt) und auf das Ausatmen (dritter Lernschritt). Die in den Texten angewandte Konditionierung der Entspannung an das Wort „nun“ kann auch für das individuelle Entspannungssignal genutzt werden, indem der Übende das Wort „nun“ als individuelles Entspannungssignal benutzt. Diese Konditionierungen dienen später als Vehikel, um die Entspannung mit immer weniger realer muskulärer An- und Entspannung zu erzeugen. In den ersten Sitzungen wird somit die Saat ausgebracht, die in den späteren Sitzungen geerntet werden kann. Die Konditionierung der Anspannung auf das Wort „jetzt“ wird in der Rücknahmeinstruktion genutzt, indem dort sämtliche Instruktionen das Wort „jetzt“ enthalten.
|12|Verzicht auf die Kommentierung von Schwere
Nach meiner Erfahrung empfinden ca. 10 bis 15 % aller Personen unter Entspannung keine Schwere, sondern Leichtigkeit. Würde Entspannung mit Schwere kommentiert (wie beim Autogenen Training), so würde dies bei den erwähnten 10 bis 15 % dazu führen, dass die Instruktionen des Kursleiters im Widerspruch zum Erleben der Teilnehmer stehen würden.
Verzicht auf die Anspannung der Bauchdecke
Das Anspannen der Bauchdecke durch das Anheben der Beine wird in einigen Verfahren der PMR praktiziert. Aufgrund krankengymnastischer Überlegungen sowie den auffällig häufigen negativen Rückmeldungen von Teilnehmern zu dieser Übung wird sie weggelassen.
Erinnerung an die Entspannung
Ab der fünften Sitzung erfolgt die Aufforderung, sich an die zurückliegenden Entspannungssitzungen zu erinnern. Die Formulierung hierfür lautet:
„Nun kann es interessant sein, sich an die vorausgegangenen Entspannungssitzungen zu erinnern und sich dabei ins Gedächtnis zu rufen:
wo Sie die Entspannung am deutlichsten wahrgenommen haben,
(...............................................)
wie sich die Entspannung dabei anfühlt,
(................................................)
wie es sich anfühlen würde, wenn dieses Entspannungsgefühl jetzt wieder da sein kann.
(.......................................).“
Diese Erinnerungsphase gestattet es dem Übenden, sich seine speziellen subjektiv bedeutsamen Empfindungen bei der Entspannung zu vergegenwärtigen. Durch diese kognitive Aktivitiät erfolgt zusätzlich eine Bindung und Fokussierung der Gedanken in Richtung Entspannung. Zusätzlich kann dabei evtl. bereits eine Veränderung der zeitlichen Orientierung und Fraktionierungseffekte (Kossak, 1993, 2013) auftreten.
Spezielle sprachliche Muster
Es wurden solche Formulierungen gewählt, die es dem Übenden erleichtern, das Gesagte aufzunehmen. Der Kursleiter hat die ja fast hellseherische Aufgabe, die Empfindungen und körperlichen Reaktionen der Übenden zu kommentieren und die Wahrnehmung der Übenden auf diese zu lenken, obwohl er erstens nicht sicher sein kann, was genau der Übende empfindet und zweitens im Gruppensetting bei unterschiedlichen Personen sehr unterschiedliche körperliche Reaktionen und Empfindungen auftreten können. Durch die Wahl entsprechender Formulierungen kann diese Aufgabe gelöst werden (Araoz, 1985/1989, Bongartz & Bongartz, 2000).
Übereinstimmung mit der Erfahrungswelt des Übenden hat Priorität
Um mit den Aussagen und Beschreibungen des Kursleiters nicht in Widerspruch zu dem Erleben des Übenden zu geraten – was den Rapport stören könnte –, wurden Formulierungen gewählt, die keine unmittelbar falsifizierbaren Aussagen über das Erleben des Übenden enthalten. Dies geschieht hauptsächlich durch den Gebrauch der Modalform.
Grammatisch zweideutige Formulierungen „s(S)ie“ und „i(I)hnen“
Diese grammatisch doppeldeutige Formulierung tritt immer im Anschluss an eine Pluralbildung auf. Sie lässt dabei offen, ob mit der Beschreibung die Elemente des Plurals („sie“) oder die angesprochene Person („Sie“) gemeint ist. Bei der Formulierung „die Arme und Hände können sich immer mehr entspannen, bis s(S)ie ganz locker sind“, kann sich das „sie“ auf die Arme und Hände beziehen oder auf die ganze Person „Sie“.
Abgeschwächte direkte Suggestionen
Am Schluss der jeweiligen Sitzung erfolgt eine sogenannte abgeschwächte direkte Suggestion (Bongartz & Bongartz, 2000). Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der indirekten Suggestion. Sie lautet:
|13|Manchen Menschen kann dieses Gefühl der Entspannung wie eine Garantie sein, die i(I)hnen sagt: „s(S)ie sind vollkommen entspannt und gelassen, s(S)ie fühlen sich wohl und tanken in diesem Zustand der Entspannung neue Energien auf.“
Bei Bedarf kann diese Suggestion modifiziert und weiter fortgesetzt werden. Wichtig dabei ist es, dass sie nicht die Form einer plumpen Behauptung enthält, die sehr schnell vom Übenden falsifiziert werden kann. Die Struktur dieser abgeschwächten direkten Suggestionen nach Bongartz und Bongartz (2000) lautet:
Die (Entspannung, Ruhe, Gelöstheit, …), die Sie jetzt empfinden, kann wie eine (Garantie, Basis, Versprechen, Fundament, …) sein, die Ihnen sagt: (entsprechende spezielle Suggestion).
Sensorische Konfusion
Die Wahrnehmung wird immer wieder von der Muskulatur weggelenkt, mit der gerade gearbeitet wird. Sie wird auf die Atmung und auf andere Muskelgruppen gelenkt, dadurch kann es zu den Effekten der Informationsüberlastung und der sensorischen Konfusion kommen, die die Aufnahmewahrscheinlichkeit der indirekten Suggestionen erhöhen können.
Pacing
Ein Pacing (Grinder & Bandler, 1981/2016) erfolgt durch das Ansprechen der Atmung. Die typische Formulierung lautet: „beim Einatmen wölbt sich die Bauchdecke nach außen, beim Ausatmen fällt sie nach innen ein“. Zusätzlich zum Pacing enthält diese Formulierung auch die o. g. Effekte der Aufmerksamkeitslenkung und der sensorischen Konfusion.