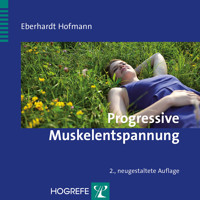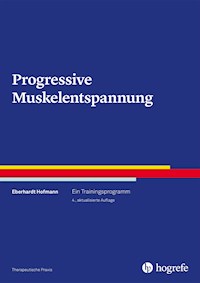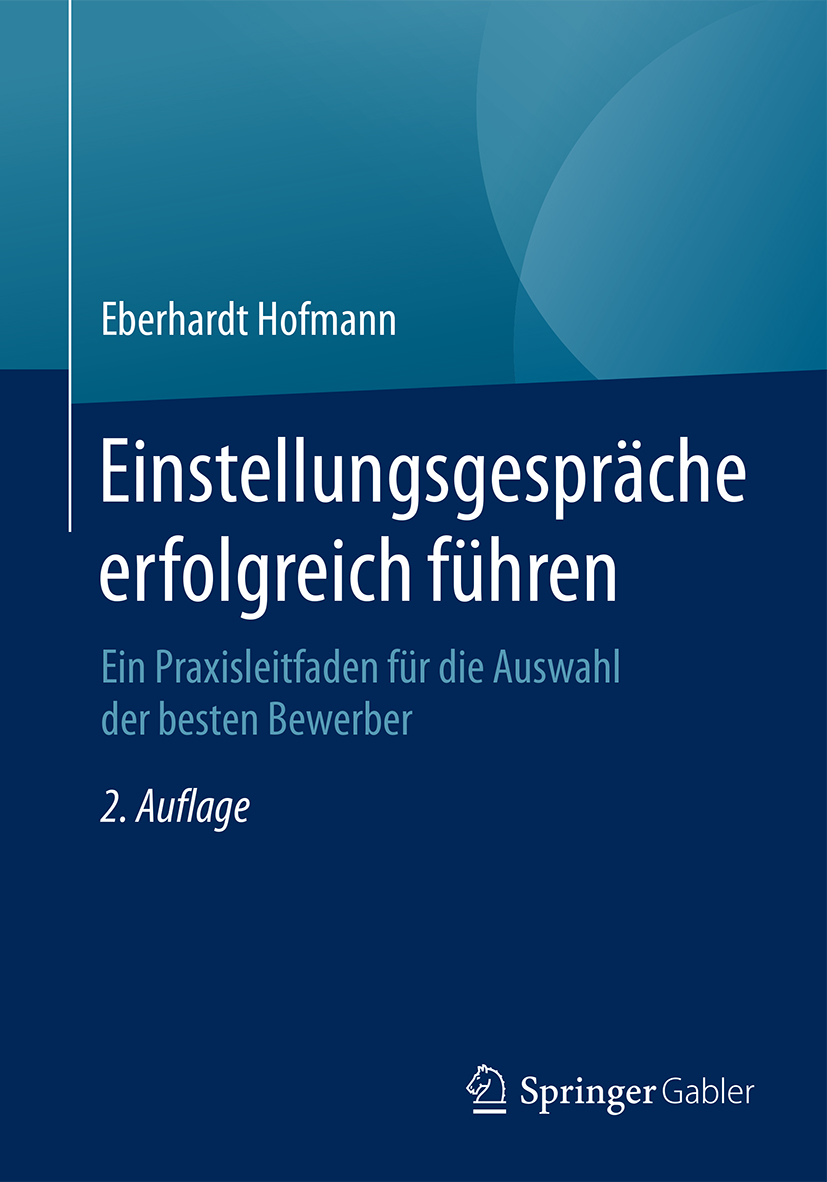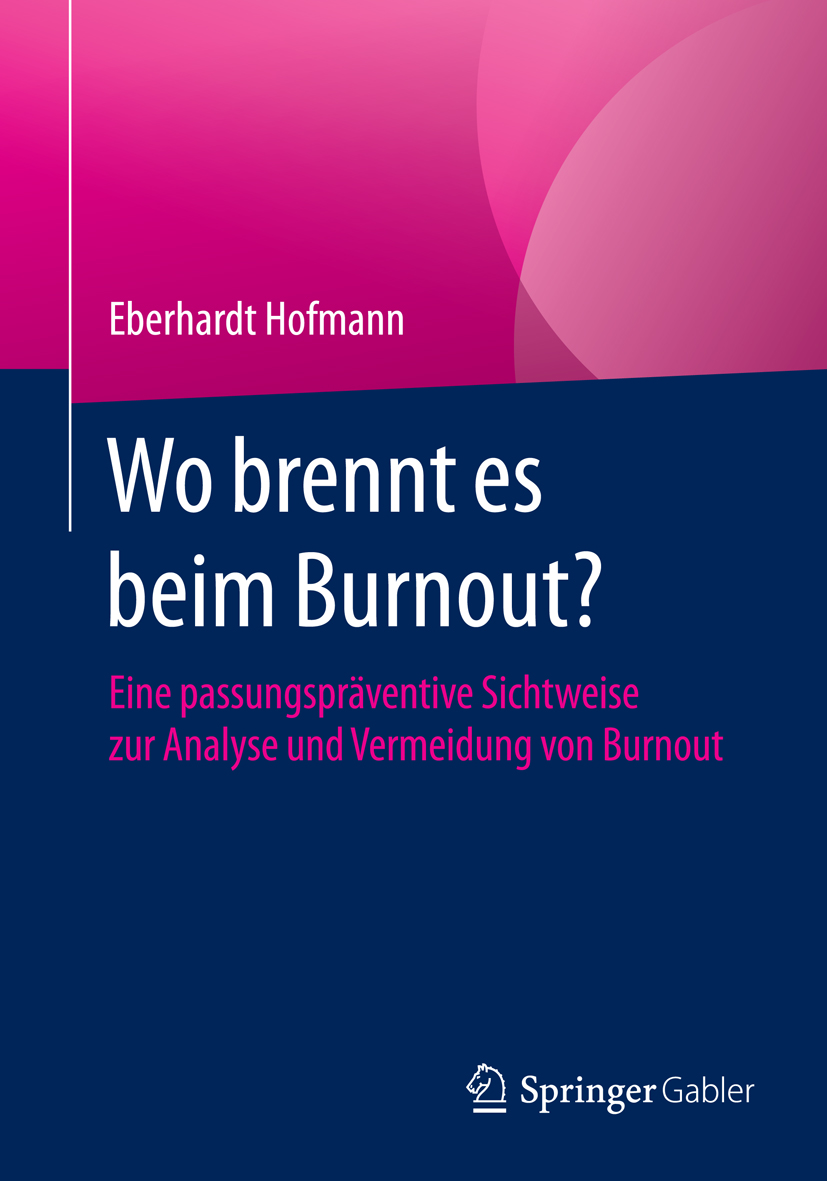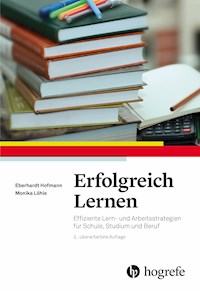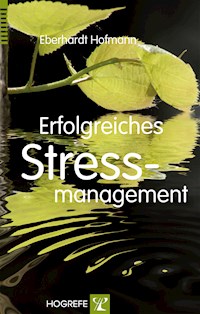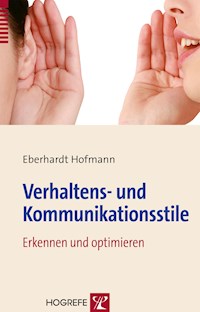
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen stolpern in zwischenmenschlichen Situationen immer wieder über die gleichen Schwierigkeiten, sie zeigen dann einen für sie typischen Verhaltens- und Kommunikationsstil. Insbesondere in Stresssituationen werden unser Verhalten und unsere Kommunikation stark von Automatismen geprägt, die uns oftmals selbst verborgen bleiben. Wir folgen einer »Notfallregel«, die wir sehr früh im Leben entwickelt und später nicht mehr angemessen korrigiert haben. Das Buch liefert eine Anleitung zur Identifizierung der eigenen wie auch der Notfallregel von Interaktionspartnern. Ist man sich seiner individuellen wiederkehrenden Interaktionsmuster einmal bewusst, können diese auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüft und, falls notwendig, optimiert werden. Die Optimierung geschieht am besten mit Hilfe von Verhaltensexperimenten, also dem Ausprobieren verschiedener Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen Situationen. Wie solche Verhaltensexperimente und spezielle kommunikative Übungen im Alltag durchgeführt werden können, wird ausführlich dargestellt. Das Buch liefert damit zahlreiche Anregungen, wie der eigene Handlungsspielraum erweitert, zwischenmenschliche Beziehungen positiver gestaltet und interpersonelle Konflikte besser gelöst werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Verhaltens- und Kommunikationsstile
Verhaltens- und Kommunikationsstile
Erkennen und optimieren
von
Eberhardt Hofmann
Dipl.-Psych. Eberhardt Hofmann, geb. 1959. Studium der Psychologie in Tübingen. Tätigkeit in verschiedenen Groβorganisationen im Bereich der Personalentwicklung. Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Wohnhaft in Friedrichshafen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat für die Wiedergabe aller in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) mit Autoren bzw. Herausgebern große Mühe darauf verwandt, diese Angaben genau entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abzudrucken. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handele.
© 2011 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Göttingen • Bern • Wien • Paris • Oxford • Prag • Toronto
Cambridge, MA • Amsterdam • Kopenhagen • Stockholm
Rohnsweg 25, 37085 Göttingen
http://www.hogrefe.de
Aktuelle Informationen • Weitere Titel zum Thema • Ergänzende Materialien
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Umschlagabbildung: © Faber Visum – Fotolia.com
Satz: Grafik-Design Fischer, Weimar
Format: EPUB
EPUB-ISBN: 978-3-8444-2346-4
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1 Verschiedene Mechanismen der Verhaltenssteuerung
1.1 Die Funktionssysteme der Psyche
1.2 Zusammenspiel der Funktionssysteme
1.3 Verhaltenssteuerung unter Stress
2 Erfassung der individuellen Notfallregel undErstellung der Optimierungsregel
2.1 Erfassung der Notfallregel
2.1.1 Erfassung des zentralen Bedürfnisses in Beziehungen
2.1.2 Erfassung der zentralen Angst in Beziehungen
2.1.3 Erfassung des bevorzugten Verhaltensstils
2.1.4 Erste Formulierung der Notfallregel
2.1.5 Überprüfung der Notfallregel
2.1.6 Eventuelle Umformulierung der Notfallregel
2.1.7 Prototypische Notfallregeln
2.2 Von der Notfallregel zur Optimierungsregel
3 Verhaltens- und Kommunikationsstile
3.1 Was ist ein Verhaltens- und Kommunikationsstil?
3.2 Die Bedeutung der Kommunikation
4 Die sieben relevanten Verhaltens- undKommunikationsstile
4.1 Der selbstbezogene Stil
4.2 Der dramatisierende Stil
4.3 Der gewissenhafte Stil
4.4 Der kritische Stil
4.5 Der rational-distanzierte Stil
4.6 Der kooperative Stil
4.7 Der sensibel-vermeidende Stil
4.8 Abgrenzung der Stile
4.9 Nochmalige Validierung der Notfallregel
5 Verhaltensexperimente
5.1 Einschätzung anderer Personen
5.1.1 Verhaltensbeobachtung
5.1.2 Kommunikative Präferenzen einer Person
5.1.3 Ausgelöstes Interaktionsgefühl
5.2 Das Grundprinzip des Verhaltensexperiments
5.2.1 Situationsauswahl
5.2.2 Hierarchisierung der Situationen
5.2.3 Vorbereitung des Verhaltensexperiments
5.2.4 Dokumentation des Verhaltensexperiments
5.2.5 Reflexion des Verhaltensexperiments
5.3 Exposition
5.3.1 Warum wurde bisher die Angst aufrechterhalten?
5.3.2 Der Prozess der Habituation
5.3.3 Der Prozess der Exposition
5.3.4 Erklärungen für die Wirksamkeit der Exposition
5.3.5 Ziele der Exposition
5.4 Kommunikative Experimente
5.4.1 Lernziele in Bezug auf Kommunikation
5.4.2 Kommunikative Vorübungen
5.4.2.1 Gefühle bei sich selbst und anderen benennen und validieren
5.4.2.2 Gedanken und Gefühle
5.4.2.3 Sachlich beschreiben
5.4.2.4 Ich- und Du-Aussagen
5.4.2.5 Forderungen stellen und Forderungen ablehnen – klare Appelle formulieren
5.4.2.6 Formulierung von Kritik
5.4.2.7 Der Einfachheitsindex
5.4.3 Umsetzung von Verhaltensexperimenten
5.5 Veränderung von Interaktionen
5.5.1 Wie können wir Einfluss auf andere Menschen nehmen?
5.5.2 Wie können wir den Ablauf von Interaktionen verändern?
5.5.3 Ansatzpunkte für einen veränderten Umgang mit für uns schwierigen Menschen
5.6 In welchen Bereichen kann es lohnend sein, Verhaltensexperimente durchzuführen?
6 Gedankliche Bearbeitung der Notfallregel
6.1 Veränderung mit Hilfe von Konsequenzen
6.2 Veränderung mit Hilfe positiver und negativer Vorstellungen
6.3 Veränderung mit Hilfe von Gegenargumenten
6.4 Veränderung mit Hilfe formaler Veränderung
6.5 Anwendung der Methoden
7 Verhaltensänderung
7.1 Von der seriellen zur parallelen Informationsverarbeitung
7.2 Dann üben, wenn man das Verhalten gerade nicht benötigt
7.3 Gründe für Schwierigkeiten bei der Verhaltensänderung
7.4 „Rückfall“
7.5 Inkubation
Literatur
Anhang
Einführung
Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Thema „Persönlichkeit“ und „Persönlichkeitsentwicklung“. Der Begriff „Persönlichkeit“ ist sowohl in der Alltagssprache als auch in der Wissenschaft eher unscharf und wird zur Bezeichnung unterschiedlicher Sachverhalte benutzt. In diesem Buch wird der Begriff zur Beschreibung von Verhaltensroutinen verwendet, die vor allem in Stresssituationen relativ automatisch ablaufen, ohne dass diese bewusst gesteuert werden. Diese automatisierten Verhaltensweisen (Kommunikations- und Verhaltensmuster) sind dabei zeitlich sehr konstant und laufen relativ standardisiert ab. Je stressreicher die Situation ist, in der man sich befindet, desto rigider wird das automatisierte Verhalten sein. Die Konstanz dieser automatisierten Verhaltensweisen über viele Situationen hinweg macht es möglich, eine verbale Beschreibung der dann ablaufenden Verhaltensroutinen in einigen wenigen Sätzen, der sogenannten „Notfallregel“, zu formulieren. Diese ziemlich konstanten Verhaltensstrategien stellen aus der Sicht dieses Buches also den Kern der „Persönlichkeit“ einer Person dar.
Wie entstehen solche Handlungsroutinen?
In der Regel werden diese Handlungsroutinen sehr früh im Leben als eine Konsequenz aus der Bewertung zwischenmenschlicher Situationen auf dem Hintergrund noch nicht ganz ausgereifter gedanklicher Prozesse gebildet und verfestigt. Im späteren Leben werden sie dann oft nicht mehr angemessen korrigiert. Die sich daraus ergebenden Grundannahmen über sich selbst und bezüglich der Umgebung führen zu Schemata, die in ähnlich erscheinenden Situationen wiederum relativ automatische Bewertungen dieser Situationen auslösen. Die Lebens- und Beziehungsgestaltung erfolgt dabei eher nach dem Prinzip der Konstruktion als dem der sachlichen Kausalität, das heißt, das Bild, das wir von der uns umgebenden sozialen Realität haben, entsteht zu einem guten Teil in unserem eigenen Kopf und nur bedingt aus den „objektiven“ Gegebenheiten in der Außenwelt.
Das Verhalten, insbesondere in Stresssituationen, wird nicht so sehr absichtlich gesteuert, sondern eher stark von automatisierten Handlungsroutinen geprägt, die oftmals sogar der jeweiligen Person selbst verborgen sind. Dies wird in verschiedenen Situationen besonders deutlich:
Verbal bekundete Verhaltensabsichten (z. B. auch gute Vorsätze) haben oft wenig Gemeinsamkeit mit dem tatsächlich ausgeführten Verhalten.
In vielen zwischenmenschlichen Situationen treten immer wieder die gleichen Schwierigkeiten auf. Man sagt dann: „die Chemie stimmt nicht“. Diese zwischenmenschliche „Chemie“ folgt jedoch genauen Regeln, die von den jeweiligen Notfallregeln der beteiligten Personen bestimmt werden.
Man „stolpert“ immer wieder über die gleichen Schwierigkeiten und hat den Eindruck, dass man diese zu einem gewissen Maß auch selbst erzeugt.
Wie lassen sich die in diesem Buch vermittelten Inhalte nutzen?
Die Erkenntnisse sind vor allem in drei Bereichen anwendbar: Man kann zunächst gezielt an sich selbst arbeiten, indem man die eigene Notfallregel kennenlernt, sie auf ihre Alltagstauglichkeit überprüft und an ihrer Optimierung arbeitet. Wenn man dann versucht, die Notfallregel anderer Personen zu bestimmen, kann man wiederkehrende Interaktionsmuster analysieren und schließlich Strategien erarbeiten, um Interaktionen zu optimieren. Zusätzlich ist die Kenntnis der eigenen Notfallregel insbesondere in Entscheidungssituationen hilfreich: Sie kann dabei helfen zu überprüfen, welche Entscheidungsoption wohl am besten zur eigenen Person bzw. zur eigenen Notfallregel passen würde:
a) Selbstoptimierung: In der Regel sind die Grundannahmen und die dazugehörigen Verhaltensstrategien zur Handlungssteuerung in sozialen Konstellationen nicht ganz optimal, sondern enthalten Fehlannahmen und Ungereimtheiten, die zu Sollbruchstellen (Problemen) in der Interaktion mit anderen Menschen führen können. Sofern man die eigene Notfallregel kennt, kann man diese systematisch verändern, und zwar so, dass sie weniger geeignet ist, als Stressquelle wirken zu können. Eine Entwicklung der Persönlichkeit kann also durch das Erkennen und Beseitigen der Sollbruchstellen erfolgen, die in der nicht ganz optimalen Notfallregel angelegt sind.
b) Optimierung zwischenmenschlicher Interaktionen: Die Kenntnis von Verhaltensroutinen und der dahinterstehenden verbal formulierten Verhaltensstrategien ermöglicht es, zwischenmenschliche Konflikte zu analysieren und in einem veränderten Licht zu betrachten. Das Wissen um die Notfallregel des Gegenübers führt zu einer Optimierung interaktioneller Einflussmöglichkeiten. Es gilt dabei zu beurteilen, was der Interaktionspartner braucht und ich ihm vielleicht geben kann, ohne mir selbst zu schaden. Zudem gilt es zu erkunden, wovor sich der Interaktionspartner fürchtet, was also bedrohlich für ihn ist. Ziel ist es also, die emotionale Überlebensstrategie des Interaktionspartners zu dekodieren. Dadurch wird der andere kalkulierbar und steuerbar. So kann z. B. der Umgang mit Mitarbeitern, Vorgesetzten und Kunden systematischer angegangen werden. Die zwischenmenschliche Dimension kann eine für beide Seiten positivere Tönung erhalten. Es soll die Befähigung erworben werden, Kooperation zu fördern und Synergien zu bilden. Diese Sichtweise ist ein ausgezeichnetes Instrument zur Lösung interpersoneller Konflikte. Hindernisse bei der Konfliktlösung bestehen zu einem guten Teil darin, das Wirken und Agieren des Gegenübers in seinem Warum und Wozu nicht ausreichend erfasst zu haben. Die Analyse der Überlebensstrategie des Gegenübers zeigt die Möglichkeiten und Grenzen zukünftiger Kooperationen auf und eröffnet die Chance, den eventuell schmalen Rahmen der interaktionellen Möglichkeiten optimal zu nutzen. So ist es möglich, sich in einer Situationen auf das Machbare zu konzentrieren und Bemühungen, die vorhersehbar frustrierend enden werden, von vornherein zu unterlassen.
c) Optimierung von Entscheidungen: Aufgrund der Kenntnis der eigenen Notfallregel sowie der Notfallregel anderer relevanter Personen im sozialen Umfeld ist es möglich, in Entscheidungssituationen verschiedene Optionen besser zu beurteilen und zu bewerten. Besonders relevant ist dies z. B. bei beruflichen Entscheidungen, wenn es darum geht, die Qualität der Beziehung zu den potenziellen Kollegen und noch wichtiger zum potenziellen Chef einzuschätzen. Welche berufliche Option entspricht am besten der eigenen Notfallregel? Mit welcher beruflichen Option würde man vermutlich besser zurechtkommen? Welche Verhaltensänderung wäre aufgrund einer bestimmten beruflichen Option wohl notwendig? Kann und will man diesen Veränderungsaufwand leisten, wenn man sich in die jeweilige Situation begeben würde? Man kann also überlegen, ob die jeweiligen Verhaltens- und Kommunikationsstile eher zueinander passen, neutral sind oder zu vorprogrammierten Konflikten führen werden.
Die in diesem Buch vertretene Sichtweise von „Persönlichkeit“ orientiert sich sehr an der neurophysiologischen Forschung und an der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (Delling, 2008) sowie an deren Präzisierung für den psychologischen Bereich (Saß, Wittchen & Zaudig, 2003). Das Grundverständnis von „Persönlichkeit“ fußt dabei auf dem Hintergrund der sogenannten „kognitiv-behavioralen“ Sichtweise (z. B. Sulz, 1999).
Eine Analogie
Abbildung 1 stellt eine Analogie für das Entstehen von Stress dar. Sie vergleicht die interaktionelle Situation mit dem Entstehen eines Gewitters. Wenn die Person anders strukturiert (geladen) ist, als es die Situation erfordert, bzw. es der Strukturierung (Ladung) einer anderen Person entgegensteht, so kommt es zu Entladungen (Blitzen) und es entsteht eine Belastung (es regnet). Die Belastungen (Regenfälle) sammeln sich in einem Gefäß, sobald dabei eine individuelle Schwelle überschritten ist, entstehen akute Stresssymptome.
Abbildung 1: Analogie für die Stressentstehung und die Stressbeeinflussung
Was kann man nun tun, um auf dieses Geschehen Einfluss zu nehmen? Zunächst kann man versuchen, die Entstehung der „Gewitter“ so weit wie möglich zu verhindern, indem man zentrale Lebensentscheidungen so trifft, dass die Umwelt, in der man sich befindet, in einem größtmöglichen Einklang zu den eigenen Dispositionen steht. Man kann auch versuchen, die Situation zu verändern oder sich selbst als Person, indem man die eigene Notfallregel verändert. Ist all dies nicht möglich, so ist man auf den Aufbau von Bewältigungs- oder Erholungsmöglichkeiten angewiesen (z. B. Hofmann 2001), um Dampf (Wasser) abzulassen. Besser ist es jedoch, wenn man verhindern kann, dass Spannungen entstehen.
Aufbau des Buches
Das Buch kann als Lese- und Arbeitsbuch genutzt werden. Wenn es als reines Lesebuch verwendet wird, wird es natürlich nur eine sehr begrenzte verhaltensändernde Wirkung haben. Einen größeren Nutzen kann dieses Buch entfalten, wenn man die beschriebenen Übungen auch tatsächlich im Alltag durchführt. Ein zentrales Element der kognitiv-behavioralen Sichtweise besteht gerade in der Idee, dass sich eine Veränderung im konkreten Handeln, in der Interaktion mit anderen Menschen und in Form einer Realitätsprüfung fundamentaler Annahmen über das Funktionieren von Beziehungen vollzieht und weniger in Gedanken und in theoretischen Analysen. Daher möchte ich Sie ermutigen, die vorgestellten Übungen auch tatsächlich durchzuführen.
Der Sprachstil des Buches ist häufig so gewählt, dass er eher plakativ ist, um die Sachverhalte klarer zu formulieren und klarer abgrenzen zu können.
Im ersten Kapitel des Buches wird ein Modell für die verschiedenen Arten der Verhaltenssteuerung vorgestellt. Ausgehend von diesem Modell wird im zweiten Kapitel die Bedeutung der individuellen Notfallregel erläutert, diese Notfallregel erfasst und die dazugehörige Entwicklungsregel formuliert. Im Kapitel 3 geht es um die Bedeutung sogenannter Verhaltens- und Kommunikationsstile. Sieben solcher im Alltag besonders relevanter Stile und die dazugehörigen psychologischen Kalküle werden im Kapitel 4 ausführlich vorgestellt. Die Bedeutung von Verhaltensexperimenten sowie deren konkrete Planung und Durchführung werden im Kapitel 5 erklärt. Die Durchführung von Verhaltensexperimenten ist das zentrale Mittel der Persönlichkeitsentwicklung, und eine unterstützende Maßnahme hierzu, nämlich die gedankliche Bearbeitung der Notfallregel, wird im sechsten Kapitel beschrieben. Das siebte Kapitel beschäftigt sich schließlich mit Grundprinzipien der Verhaltensänderung.
1 Verschiedene Mechanismen der Verhaltenssteuerung
Um die Mechanismen der Selbstoptimierung und die zentralen Aspekte der zwischenmenschlichen Interaktion verstehen zu können, muss man die dabei relevanten Wege der Verhaltenssteuerung kennen. Unser Verhalten wird von relativ wenigen kybernetischen Prozessen gesteuert, die im Gehirn systematisch und konstant ablaufen, so als ob dieses programmiert worden wäre. Jedes Gehirn enthält dabei auch einige Fehlprogrammierungen, die zu fehlerhaftem Verhalten in kritischen Momenten führen können. Man trifft dann z. B. Fehlentscheidungen, die hätten verhindert werden können. Unser Verhalten wird weitgehend vom Gehirn gesteuert, daher braucht man etwas Hintergrundwissen zum Aufbau des Gehirns, um die relevanten Steuerungsarten zu verstehen. Das erste Kapitel vermittelt schwerpunktmäßig dieses notwendige Wissen. Zum Verständnis der Steuerungsmechanismen benötigt man zusätzlich noch psychologisches Wissen, das im nachfolgenden Kapitel vermittelt werden soll.
Im Bezug auf zwischenmenschliche Interaktionen wird häufig davon ausgegangen, dass die Kommunikation das zentrale Thema sei, um effizienter handeln zu können. Dass dies zu kurz gegriffen ist, merken wir spätestens dann, wenn wir unsere kommunikativen Fähigkeiten absolut perfekt gemacht haben. Denn was macht ein Mensch, bevor er seinen Mund aufmacht? Was er innerlich an Gedanken und Plänen produziert, bevor er mit der Kommunikation beginnt, ist das Eigentliche. Die Art der Kommunikation ist natürlich bedeutsam, sie ist jedoch eher ein Folgeprodukt vorgelagerter Prozesse als ein eigenständiges Phänomen. Um die für die Verhaltenssteuerung relevanten Prozesse zu verstehen, muss man zunächst wissen, welche Funktionssysteme die menschliche Psyche beinhaltet.
1.1 Die Funktionssysteme der Psyche
Der Mensch verfügt grundsätzlich über zwei unterschiedliche Funktionssysteme zur Steuerung von Verhalten und Entscheidungen: über ein bewusstes System und über ein „autonomes“ Verarbeitungssystem. In diesem Zusammenhang vermeide ich den Begriff „unbewusst“, weil er sehr oft durch die Nähe zu psychoanalytischen Ideen mit Begriffen wie „Verdrängung“, „triebhaft“, „primitiv“, „unberechenbar“ etc. assoziiert wird. Das Unbewusste wird aus einer solchen Perspektive heraus oft als eine Art Rumpelkammer der Psyche verstanden. Im Gegensatz dazu sollen hier „autonome psychische Prozesse“ als Funktionen verstanden werden, die aus Ökonomiegründen automatisch ablaufen, ohne dass sie ständig mit Aufmerksamkeit belegt sein müssen. Es wäre katastrophal, wenn man sich immer und vollständig dessen bewusst wäre, was gerade im Körper abläuft. Man würde dann z. B. die Muskelspannung wahrnehmen, die in den verschiedenen Muskelgruppen nötig ist, um ein Buch in der Hand zu halten. Man würde auch wahrnehmen, wie die Körpertemperatur konstant gehalten wird. Ähnlich würde es sich beim Lesen selbst verhalten: Beim Lesen dieser Sätze würde man sich darüber bewusst sein, wie einzelne Linien Buchstaben bilden und diese zu Worten zusammengesetzt werden. Ebenso wäre man sich der Tatsache bewusst, dass die einzelnen Buchstaben im Wortverbund anders ausgesprochen werden als einzeln: Ein „Z“ wird im Wortverbund nicht als „Zett“ ausgesprochen. Wir wären uns ständig der Grammatik bewusst, mit der einzelne Worte zu Sätzen zusammengefügt werden, damit sie einen Sinn ergeben usw. Wenn uns das alles ständig bewusst wäre, bräuchten wir entweder eine ungeheure Verarbeitungskapazität oder wir wären gar nicht mehr lebensfähig. Es wäre darüber hinaus sehr unökonomisch, ständig Wahrnehmungen präsent zu halten, die für das, was im Moment passiert, nicht notwendig sind. Unter „autonom“ verstehe ich daher diejenigen Prozesse, bei denen Funktionsweisen „im Hintergrund“ ablaufen, ohne dass der Scheinwerfer des Bewusstseins im Moment gerade auf sie gerichtet ist. Eine Analogie für den Dualismus „bewusst – autonom“ stellt auch der Gebrauch eines Computers dar. Für den Benutzer des Computers ist nur das relevant, was er auf seinem Bildschirm sieht. Alles, was eigentlich in der Software abläuft, ebenso wie die gesamte Hardware, ist für die effiziente Benutzung des Computers zumindest so lange irrelevant, wie das Programm einwandfrei funktioniert. Ist dies jedoch einmal nicht der Fall, so kann man immer noch in die einzelnen Menüs gehen oder die Betriebsanleitung lesen, im Notfall sogar zu einem Spezialisten gehen, der sich mit den speziellen Funktionsweisen besser auskennt. Die Notwendigkeit, sich tiefer in die Funktionalität einzudenken, ergibt sich jedoch immer erst im Ausnahmefall, der Normalfall, die Routine, läuft rein auf der Benutzeroberfläche ab.
Unbewusst in dem hier verwendeten Sinne sind also
unterschwellige Wahrnehmungen,
Wahrnehmungen außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus,
alle gedanklichen und emotionalen Prozesse, die vor der Ausreifung der Großhirnrinde (am Ende der Pubertät) ablaufen,
Gedächtnisinhalte, die von der Großhirnrinde „abgesunken“ sind (vergessen wurden), die aber wieder bewusst gemacht werden können.
Im Zusammenspiel von bewusster und autonomer Funktionsweise sind vier verschiedene Subsysteme zu berücksichtigen: der bewusste Verarbeitungsmodus, die autonome Kognition, die autonome Emotion und das autonome Nervensystem (vgl. Abbildung 2). Diese Subsysteme sind funktionell und anatomisch gut abgrenzbar und werden nachfolgend näher beschrieben. Danach werden die Gesetzmäßigkeiten und die Besonderheiten bei der Zusammenarbeit dieser Subsysteme thematisiert.
Abbildung 2: Die verschiedenen Funktionssysteme
Autonomes Nervensystem
Ein Funktionssystem der Verhaltenssteuerung ist das „Autonome Nervensystem“, das vor allem für die vegetative Regulation verantwortlich ist. Die allermeisten Körperfunktionen laufen, ohne dass wir uns ihrer bewusst sind und ohne dass wir viel Einfluss auf sie haben ab. Sie werden vom sogenannten „Autonomen Nervensystem“ gesteuert. Solche Körperfunktionen sind z. B. der Herzschlag, die Atmung, die Verdauung, die Regulation der Körpertemperatur, die Hormonausschüttungen usw. Der Körper regelt das physiologische Gleichgewicht (die physiologische Homöostase) mit Hilfe des „Autonomen Nervensystems“ in der Regel völlig unbemerkt. Sonst wäre es beispielsweise auch schwer möglich zu schlafen. Dass das „Autonome Nervensystem“ eine ganze Menge an Funktionen reguliert, wird immer erst dann wahrnehmbar, wenn es zu Fehlfunktionen kommt. Im Normalfall dagegen läuft alles „unbewusst“. Das „Autonome Nervensystem“ befindet sich zu einem Teil zentral im sogenannten Hirnstamm und zum anderen Teil dezentral praktisch im ganzen Körper verteilt.
Autonome Kognition
Ein zweites Funktionssystem der Verhaltenssteuerung besteht in der „Autonomen Kognition“. In der „Autonomen Kognition“ läuft all das ab, was man hauptsächlich in den langen Jahren der Schul- und sonstigen Ausbildungen oftmals mühsam lernt, was durch die jahrelange Übung aber völlig automatisch geschieht. Beispiele hierfür sind das Lesen, das Verständnis für Grammatik, das Rechnen, aber auch viele komplexe Bewegungsleistungen wie z. B. das Halten des Gleichgewichts beim Radfahren, das Binden einer Krawatte oder das Binden von Schuhen. Diese Leistung kann dabei so komplex sein, dass man sehr wahrscheinlich auch beim intensiven Nachdenken darüber, wie man es eigentlich schafft, z. B. das Gleichgewicht auf einem Fahrrad zu halten, nicht genau beschreiben könnte, wie man es macht. Ein anderes Beispiel für eine solche komplexe Bewegungsleistung ist das Fahren einer Kurve mit dem Auto. Für das Fahren einer Kurve müssen komplexe Berechnungen zwischen optischen und kinästhetischen Parametern durchgeführt werden, die niemand so genau beschreiben kann, die aber während einer Autofahrt ständig autonom ablaufen. Ein weiteres Beispiel ist der Schaltvorgang beim Autofahren: Ein Fahranfänger muss enorme Aufmerksamkeit dafür aufbringen, um die Kupplung zu betätigen, den Schalthebel in die richtige Position zu bringen, die Kupplung wieder synchronisiert mit dem Gasgeben einzukuppeln und dabei auch noch den der jeweiligen Geschwindigkeit angemessenen Gang zu wählen. Noch ein anderes Beispiel: Fast jeder von uns kann erkennen, ob ein Satz grammatikalisch richtig oder falsch ist. Die wenigsten von uns können jedoch exakt begründen, warum ein Satz grammatikalisch falsch oder richtig ist. Wir nehmen auch hier nur das Ergebnis einer Regelanwendung wahr, können aber die Regel selbst nur bedingt verbalisieren.
Bei all den Funktionen, die durch die „Autonome Kognition“ gesteuert werden, ist man sich in der Regel zwar bewusst, dass man etwas tut, selten jedoch, wie man etwas genau tut. Genau dieses wie ist Inhalt der „Autonomen Kognition“. Viele Dinge, die durch die „Autonome Kognition“ gesteuert werden, sind im Langzeitgedächtnis abgelegt.
Anatomisch ist für die „Autonome Kognition“ hauptsächlich eine Gehirnstruktur wichtig, die Hippokampus heißt. Diese Struktur stellt das Tor zum Langzeitgedächtnis dar. Wenn diese Struktur (z. B. durch einen Schlaganfall) geschädigt ist, kann keine Information mehr in die „Autonome Kognition“ aufgenommen werden. Was sich jedoch schon in der „Autonomen Kognition“ befindet, ist weiterhin verfügbar. Welche Leistung die „Autonome Kognition“ vollbringt, merkt man immer dann sehr gut, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten neu lernen oder umlernen muss. Beispielsweise wird diese Leistung sichtbar, wenn man Kindern das Lesen oder Rechnen beibringt, wenn man eine neue Sportart erlernt, wenn man in einem Land mit Linksverkehr Urlaub macht, wenn man sich als Rechtshänder die Zähne mit der linken Hand putzt oder wenn man beim Autofahren von einem Schalt- auf ein Automatikgetriebe oder umgekehrt umsteigen muss. Alle Abläufe der „Autonomen Kognition“ haben zunächst einmal Aufmerksamkeit und Bewusstsein erfordert, dies war jedoch mit zunehmender Übung immer weniger erforderlich, die Abläufe wurden immer weiter automatisiert.
Autonome Emotion
Ganz analog zur „Autonomen Kognition“ gibt es auch eine „Autonome Emotion“. Wir haben alle eine „automatische“ Empfindung dafür, was gut für uns ist (z. B. Nahrung) und was nicht gut für uns ist (z. B. Schmerzen). Wir alle verfügen über ein basales Annäherungs- bzw. Vermeidungssystem, das uns sagt, was wir anstreben oder vermeiden sollen. Neben diesem angeborenen, basalen emotionalen System, das bei allen Menschen in ähnlicher Weise funktioniert, gibt es noch ein zweites emotionales Regulationssystem, das auf individuellen Lernerfahrungen beruht. Diese Lernerfahrungen dienen als gelerntes Koordinatensystem, das uns sagt, welche, insbesondere sozialen Situationen besser aufzusuchen und welche tunlichst zu vermeiden sind. Diese gelernten Regeln der Annäherung und der Vermeidung bestimmter sozialer Situationen werden vornehmlich in der Kindheit erworben. Die „Autonome (implizite) Emotion“ garantiert das physische und psychische Überleben einer Person. Sie verfolgt dabei die Strategie, die aus der Kindheit übernommenen Überlebensstrategien anzuwenden und auf deren Hintergrund ein Bild der Wirklichkeit zu konstruieren. Unsere Wahrnehmung ist nicht das objektive Abbild der „Realität“. Das zeigen schon die vielen Wahrnehmungstäuschungen. Die Wahrnehmung ist sehr selektiv, unwichtige Dinge werden weggefiltert, wichtige verstärkt. Die Wahrnehmung ist somit keine direkte Abbildung der Welt, sondern ein mehr oder weniger verzerrtes Abbild der Außenwelt, das stark von der Überlebenssituation der Person beeinflusst wird. Wie könnte ein Organismus auch überleben, wenn er sich nicht auf das Wesentliche in seiner Umwelt konzentriert? Oder anders formuliert: Ein Organismus kann gerade deshalb gut überleben, weil der Wahrnehmungs- und Erkenntnisapparat nur das für ihn Wesentliche erfasst. Worin dieses Wesentliche besteht, ist individuell verschieden und hängt mit dem zusammen, was man „Persönlichkeit“ nennt. Unser Gedächtnis ist daher das wesentliche Wahrnehmungsinstrument bei der Beurteilung komplexer Sachverhalte. Es liefert uns (oft frühzeitig erlernte und verfestigte) Interpretationshilfen, die uns sagen, was für unser Überleben wichtig ist. Wie können wir dann mit verzerrten oder zumindest prinzipiell verzerrbaren Wahrnehmungen leben? Es kommt nicht so sehr auf die Qualität der Wahrnehmung, sondern eher auf die Qualität der Handlung an, die aus der Wahrnehmung erwächst. Nicht die Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist das wichtigste Kriterium menschlichen Handelns und Entscheidens, sondern die Aufrechterhaltung eines möglichst stabilen und widerspruchsfreien Selbstbildes der handelnden Person. Man muss „mit den eigenen Entscheidungen leben können“, sie brauchen nicht unbedingt „objektiv“ richtig zu sein.
In den ersten Lebensjahren geht es vor allem um das somatopsychische Überleben, die mittelfristige Strategie der „Autonomen Emotion“ heißt: „Ich muss irgendwie einigermaßen unbeschadet durch die Kindheit kommen“. Dazu werden teilweise auch Strategien entwickelt, die zu erheblichen Nachteilen im Erwachsenenalter führen können.
Diese frühen Lernerfahrungen sind besonders intensiv, weil in den ersten Lebensjahren eine besonders hohe Lernfähigkeit besteht, die Kritikfähigkeit dagegen noch sehr gering ausgeprägt ist und der gedächtnismäßige Speicher noch ziemlich leer ist. Bei der Verarbeitung der Außenereignisse stehen dem Kind zudem die Regeln der Logik noch nicht zur Verfügung. Es dauert in der Regel mindestens bis zum 12. Lebensjahr, bis ein Kind in der Lage ist, alle formalen logischen Operationen zumindest prinzipiell beherrschen zu können. Bis ein Kind die Sprache einigermaßen beherrscht, dauert es zwei bis drei Jahre. In dieser Zeit finden jedoch natürlich auch emotionale Lernerfahrungen statt. Diese Erfahrungen können jedoch nur schlecht oder gar nicht benannt und eventuell entsprechend der Logik realitätsadäquat modifiziert werden. Das Kind bildet sich daher vor dem Beherrschen der Sprache und der formalen Logik seine eigene, individuelle Logik, mit deren Hilfe es sich die Vorgänge in der Welt erklärt, seine „Autonome Emotion“.
Es herrscht außerdem eine sogenannte „Infantile Amnesie“. Der Gehirnteil „Amygdala“ ist für die Verarbeitung emotionaler Inhalte sehr bedeutsam. Die Neuronen im oben beschriebenen Hippokampus entwickeln sich erst relativ spät, später als die Neuronen der Amygdala. Daher finden zwar sehr früh emotionale Lernerfahrungen statt, diese können aber nur unzureichend benannt und bewusst reflektiert werden, da bei ihrer Abspeicherung die Hippokampusneuronen und die Fähigkeit, Sachverhalte verbal zu benennen, noch nicht (voll) funktionsfähig waren. Oftmals werden diese frühen emotionalen Lernerfahrungen dann automatisiert und ein Leben lang nicht mehr korrigiert, sondern dienen als unhinterfragter Autopilot für große Teile des späteren Lebens. Die relevanten frühen emotionalen Lernerfahrungen sind zu einem großen Teil durch die primären Bezugspersonen, in der Regel werden dies die Eltern sein, vermittelt. Die „Autonome Emotion“ ist daher die komprimierte Lebenserfahrung, primär aus der Kindheit, jedoch auch aus Erfahrungen gebildet, die wir unser ganzes Leben lang machen. Wie eindrücklich eine erwachsene primäre Bezugsperson für ein Kind sein muss, kann man sich verdeutlichen, wenn man alleine bedenkt, dass ein Erwachsener drei- bis fünfmal so groß ist wie ein Kind.
Die Inhalte der „Autonomen Emotion“ sind normalerweise nicht unmittelbar unserem Bewusstsein zugänglich. Unsere verschiedenen Gedächtnissysteme sind jedoch in ihrer gegenseitigen Abgrenzung „nicht ganz dicht“. In Zeiten, in denen wir optimale Bedingungen für den Gebrauch unseres Bewusstseins haben, können wir uns auf die Suche nach den Inhalten und Prozessen der ansonsten autonom ablaufenden Prozesse machen und eventuelle Fehlentwicklungen erkennen und verändern lernen. Ohne die Bewertung der „Autonomen Emotion“ wären wir im täglichen Leben ziemlich aufgeschmissen, auch wenn die Bewertungen der „Autonomen Emotion“ uns nur punktuell bewusst werden.
Bewusstsein
Nachdem die autonomen Anteile beschrieben wurden, soll nun die Funktionsweise des Bewusstseins näher betrachtet werden. Betrachtet man die Gesamtfunktionen, die im Lebensvollzug reguliert werden müssen, so stellt das Bewusstsein einen eher kleineren Teil der Regulationsmechanismen dar. Anatomisch ist das Bewusstsein in der Großhirnrinde lokalisiert. Diese macht nur rund ein Prozent der Gesamtzahl der Nervenzellen aus und spielt damit rein quantitativ betrachtet eine sehr geringe Rolle. Das Bewusstsein ist ein wesentliches Kriterium, das den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet und dem Menschen einen enormen evolutionären Vorteil verschafft hat. Das Bewusstsein ist zwar eher der Ausnahmezustand in der Gesamtregulation, es stellt jedoch auch das „besondere Werkzeug“ dar. Mit Hilfe des Bewusstseins ist es möglich, sich vom Hier und Jetzt zu lösen und in die Zukunft zu planen. Es ermöglicht eine rationale Reflexion und ein logisches Durchdringen von Sachverhalten. Weiterhin macht es das Bewusstsein möglich, zumindest zeitlich begrenzt die Lust-Unlustimpulse zu unterdrücken und sie in den Dienst „höherer“ Ziele zu stellen. So kann man sich z. B. einer Zahnbehandlung unterziehen, was ja nicht besonders viel Spaß macht, aber längerfristig zu einem besseren Gesundheitszustand verhilft. Oder man kann Hausaufgaben machen, anstatt zu spielen, obwohl dies momentan relativ unattraktiv sein kann. Mit Hilfe des Bewusstseins kann man der Diktatur der momentanen Handlungsimpulse entfliehen und zumindest zeitlich begrenzt übergeordnete Ziele zum Maßstab des Handelns machen. Es ermöglicht dadurch eine stärkere Aktion in Relation zur Reaktion. Das Bewusstsein kommt daher auch immer dann zum Einsatz, wenn es um längerfristige Planungen geht.
Den Vorteilen der Informationsverarbeitung mit Hilfe des Bewusstseins stehen jedoch auch einige Nachteile gegenüber. Das Bewusstsein arbeitet im Gegensatz zu den anderen Regulationsmechanismen eher langsam und braucht viel Energie. Daher ist es gut, dessen Einsatz tunlichst auf ein Minimum zu beschränken. Unser Gehirn ist zudem ein „teures“ Organ, es verbraucht im Ruhezustand etwa zehnmal mehr Energie, als es ihm nach seinem Volumen zukäme, bei geistiger Aktivität steigt der Verbrauch noch mehr an. Der „teure“ Prozess ist dabei nicht die elektrische Aktivität der Nervenzellen, sondern eher der Reorganisationsprozess danach. Bewusstsein braucht hohe Energiemengen, bei denen es darum geht, große und unterschiedliche Datenmengen miteinander zu verknüpfen. Dies „bezahlt“ das Gehirn mit hohen Stoffwechselkosten, daher ist es verständlich, dass das Gehirn dazu neigt, Routinen auszubilden, auch wenn diese der Flexibilität eventuell abträglich sein sollten.
Merke:
Die bewusste Verarbeitung der Information kann nur seriell (also in einzelnen Schritten jeweils nacheinander) erfolgen, und es ist eher störanfällig. Besonders bei Stress ist daher auf die Funktion des Bewusstseins eher weniger Verlass. Immer dann, wenn es „eng wird“, sind die Handlungen einer Person daher eher durch die emotionalen Lernerfahrungen gesteuert. Der freie Wille kommt eher in Situationen zum Zug, in denen man Zeit und Freiheit hat, zu reflektieren. Autonome Regulationen steuern dagegen das Verhalten in Routinesituationen oder in Notfallsituationen.
Abbildung 3 zeigt die anatomische Lage der beschriebenen Gehirnstrukturen. Die Rolle des Präfrontalkortex wird im Kapitel 5 näher beschrieben.