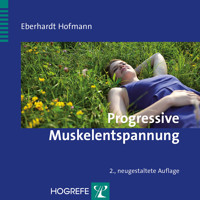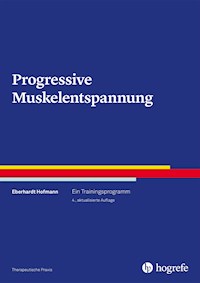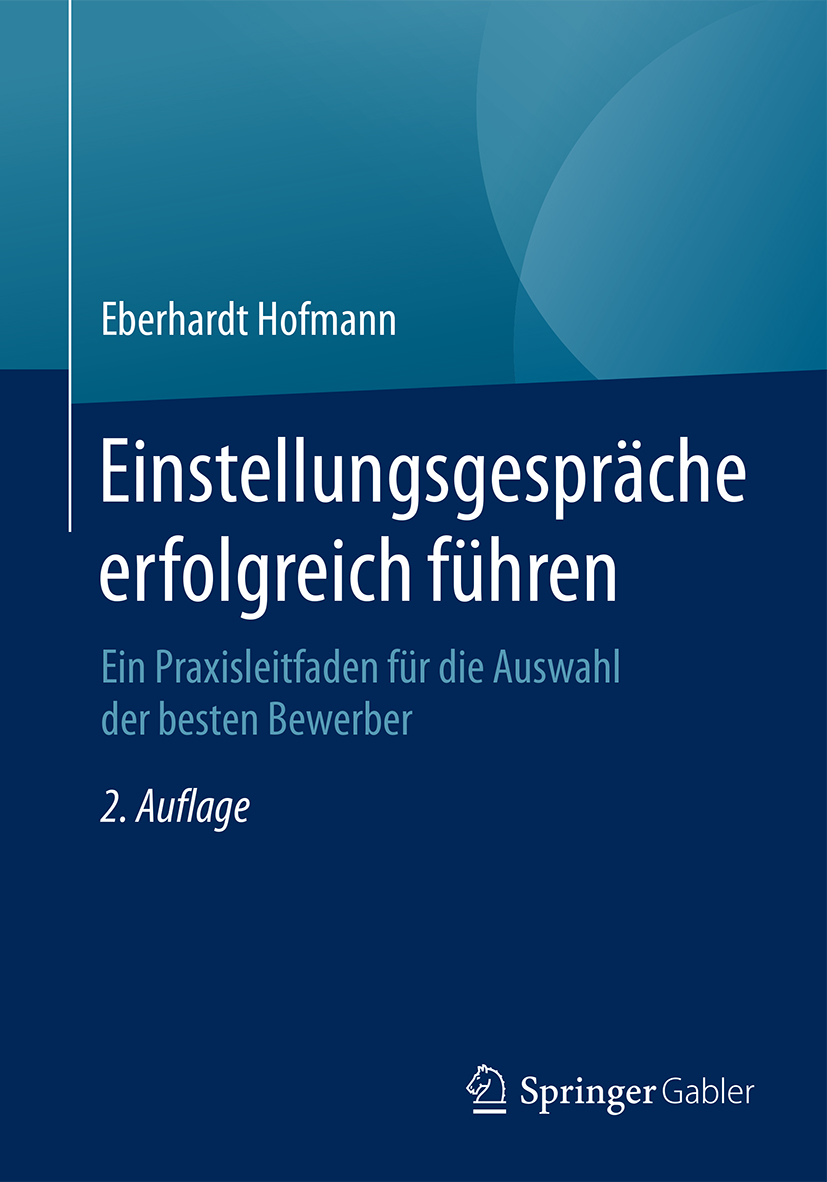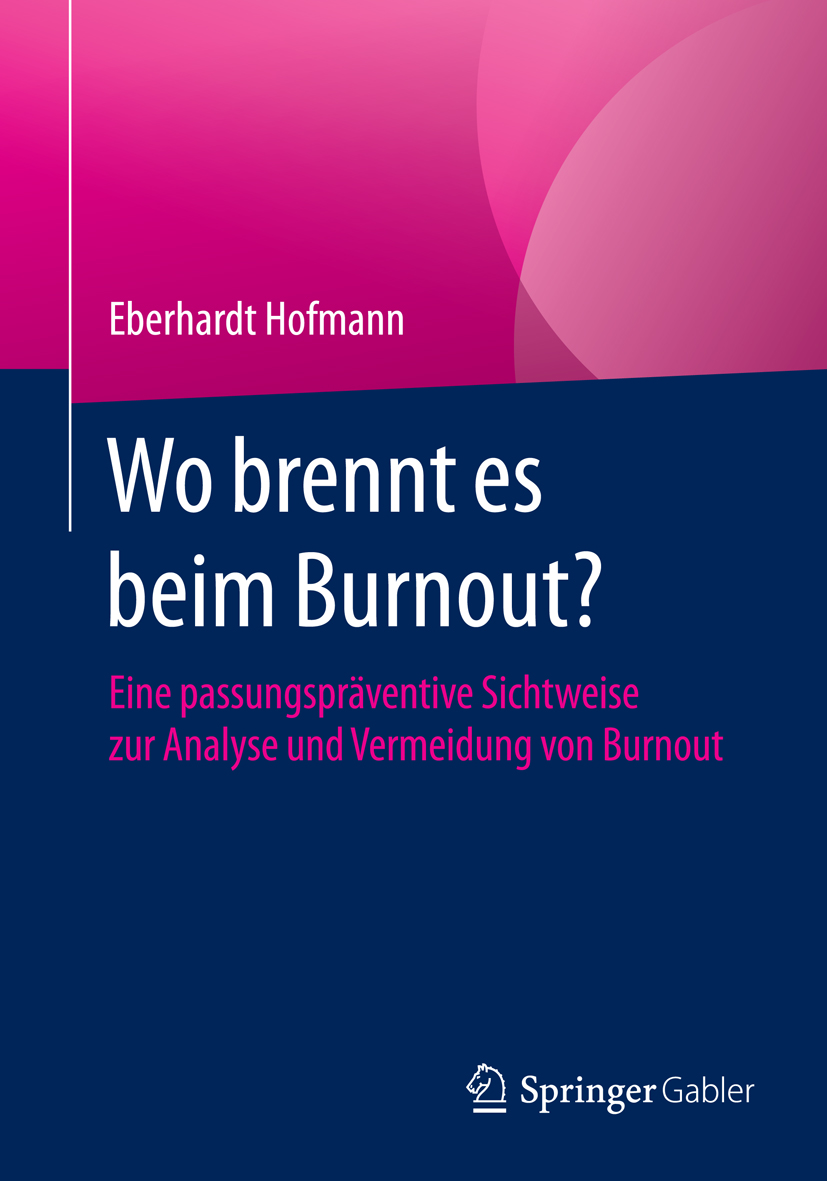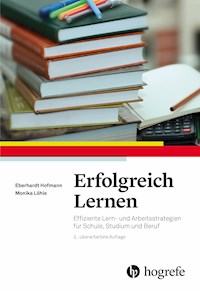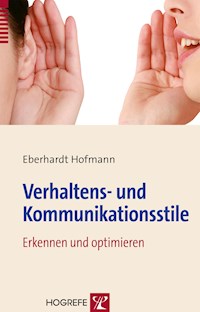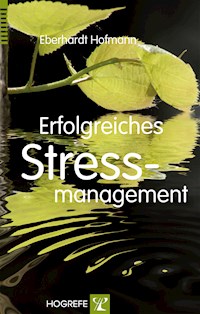19,99 €
Mehr erfahren.
Warum schaffen es manche Menschen immer wieder, andere zu etwas zu bringen, wovon diese eigentlich gar nicht überzeugt sind? Warum lassen wir uns oft auf etwas ein, obwohl wir spüren, dass dies eigentlich nicht unseren Wünschen entspricht? Ganz einfach: Wir werden manipuliert. Der Diplom-Psychologe Eberhardt Hofmann zeigt in seinem Buch, was Manipulation ist und wie man damit umgeht - denn es gibt viele wirkungsvolle Techniken, Manipulationsversuche zu erkennen und geschickt abzuwehren. So lernen Sie, Ihre Interessen zu wahren und der Einflussnahme durch andere zu trotzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Eberhardt Hofmann
Lassen Sie sich nichtmanipulieren!
Eberhardt Hofmann
Lassen Sie sichnichtmanipulieren!
Einflussnahme erkennenEigene Interessen wahrenManipulation abwehren
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Nachdruck 2013
© 2004/2005 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Münchner Verlagsgruppe GmbH
Satz: J. Echter, Redline GmbH
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN Print 978-3-86882-341-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-388-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-848-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Inhaltsverzeichnis
Einführung und Überblick
Kapitel 1: Manipulation
Was ist Manipulation?
Überredungstechniken
Killerphrasen
Mikropolitik
Wertediskussionen
Imponiertechniken zur Demonstration der eigenen Macht
Verhindern von Veränderungen
Ein weiteres Ordnungsschema
Verdrehte Logik
Kapitel 2: Kommunikation und Manipulation
Das Grundmodell der Kommunikation
Erweiterungen des Modells
Die Bedeutung des Kommunikationsmodells für die Manipulation
Übungen
Kapitel 3: Sich durchsetzen – Manipulationen entgehen
Das Kriterium für Selbstsicherheit
Stellen von Forderungen
Bei der Forderung bleiben
Ablehnen von Forderungen
Waffengleichheit
Langfristige Kalküle
Kapitel 4: Abwehr verbaler Angriffe
Prinzip und Wirkung verbaler Angriffe
Kontertechniken
Bei der Kontertechnik bleiben
Versteckte verbale Angriffe
Kann man tatsächlich so mit anderen Menschen reden?
Übungsbeispiele
Kapitel 5: Formulierung konstruktiver Kritik
Konstruktive und destruktive Kritik
Formulierung konstruktiver Kritik
Kapitel 6: Die Atmung als Möglichkeit zur schnellen Verringerung der Anspannung in schwierigen Situationen
Atmung und Anspannung
Techniken zur Kontrolle der Atmung
Anwendung der Atemtechniken in Situationen, die Selbstsicherheit erfordern
Kapitel 7: Leitideen und ihre Wirkung in schwierigen Situationen
Was sind Leitideen?
Hinderliche Leitideen
Methoden zur Erreichung der Wunschleitidee
Anwendung der Methoden
Kapitel 8: Verhaltensänderung
Die Selbstsicherheitspyramide
Von der seriellen zur parallelen Informationsverarbeitung
Zeitliche Vorverlagerung der Reaktion
Üben, wenn man die Techniken gerade nicht braucht
Das neue Verhalten mental üben
Flexibler Einsatz des Verhaltens
Verhaltenstraining
„Rückfall“
Inkubation
Gründe für Schwierigkeiten bei der Verhaltensänderung
Literatur
Kontakt
Über den Autor
Einführung und Überblick
In dem vorliegenden Buch geht es um soziale Kompetenz und um Manipulation. Der Begriff der sozialen Kompetenz ist eher weitläufig und unscharf. Im Zusammenhang mit diesem Buch verstehe ich darunter die Fähigkeit, die eigenen Anliegen in einer nichtmanipulativen Art und Weise im sozialen Kontext zu formulieren und durchzusetzen, sowie die Fähigkeit zur Abwehr von Manipulation, die durch andere Menschen ausgeübt wird. Das Thema Manipulation hat dabei verschiedene Fassetten. Es beschäftigt sich natürlich mit den Mechanismen, mit denen wir einen anderen Menschen zu manipulieren versuchen. Darüber hinaus geht es aber auch um die Art der Manipulation, bei der man selbst seine Absichten (Forderungen an andere zu stellen oder Forderungen von anderen abzulehnen) nicht nachdrücklich genug vertritt. Eine dritte Form der Manipulation findet weniger im sichtbaren Verhalten, sondern eher im Kopf statt, indem man sich durch die Art der Gedanken selbst manipuliert.
Die zentrale These dieses Buches ist dabei, dass man es in schwierigen Situationen oft vermeidet, sich eindeutig zu verhalten. Diese Zweideutigkeit im Auftreten wird von Menschen, die andere manipulieren wollen, sehr schnell erkannt und in der Regel dann sehr effizient ausgenutzt. Mein Ziel war daher, Techniken zu beschreiben, mit denen man eine größtmögliche Eindeutigkeit im Verhalten gegenüber anderen Menschen erreichen kann. Dazu werden jeweils auch gezielte Übungen vorgestellt.
Warum gibt es diese Uneindeutigkeit im Verhalten, die besonders in eher schwierigen sozialen Situationen auftritt? Sie entsteht gewöhnlich in einem langen (Ab-) Erziehungsprozess. Kinder sind von Natur aus sehr eindeutig und direkt. Der Zustand der Nichtmanipulation, des klaren Äußerns von Wünschen entspricht eher dem „Urzustand“, der im Laufe der (Lern-)Erfahrungen „verschüttet“ wird. Die eigenen Anliegen werden dann nicht mehr direkt geäußert, sondern manipulativ verpackt. Wenn man sich über lange Zeit hinweg uneindeutig verhält, kann dies dazu führen, dass man auch im gedanklichen Formulieren uneindeutig wird. Daher sind alle in diesem Buch beschriebenen Verhaltenstechniken auch gedankliche Klärungstechniken. Nur dann, wenn eine eindeutige gedankliche Klärung dessen, was man will oder nicht will, stattgefunden hat, kann man sich auch gegenüber anderen Menschen eindeutig verhalten.
Was bewirkt Uneindeutigkeit im Verhalten gegenüber anderen Menschen im eigenen Privat- und Berufsleben? Zunächst können dadurch für die Person, die sich uneindeutig verhält und dadurch leicht manipulierbar ist, handfeste objektive Nachteile entstehen. Wenn sie diese erlebt, wird das zudem zu einer unangenehmen emotionalen Reaktion führen, die einerseits aus den objektiven Nachteilen, andererseits aber auch aus der Tatsache resultiert, dass sich die Person nicht oder nicht rechtzeitig gegen die Manipulation wehren konnte.
Für die Arbeitssituation ist es fatal, wenn Manipulation zu einem wesentlichen Steuerungsprozess wird. Das Verhalten der Akteure wirkt sich auf die Arbeitsleistung aus. Es wird viel Blindleistung in Form mikropolitischer Aktivitäten verbraucht, das Klima im Arbeitsumfeld wird zusätzlich verschlechtert.
Ziel dieses Buches ist, Verhaltenstechniken und Prozesse aufzuzeigen, die einen nichtmanipulativen Umgang mit anderen Menschen erleichtern. Gegenstand des ersten Kapitels ist die Definition des Begriffs „Manipulation“ sowie die Beschreibung der verschiedenen Manipulationsmechanismen. Sie zu kennen ist wichtig, um eine manipulative Situation schnell identifizieren zu können und dadurch die Grundlage für eine effektive Reaktion zu schaffen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der Kommunikation. Jede Art der Manipulation kann nur durch Kommunikation vermittelt werden. Um das zu verdeutlichen, wird zuerst ein allgemeines Modell der Kommunikation vorgestellt und danach werden notwendige Erweiterungen dieses Modells beschrieben.
Im dritten Kapitel geht es um den Umgang mit destruktiver Kritik und verbalen Angriffen. Der Prozess, der mit einem Angriff ausgelöst werden soll, wird hier analysiert. Danach wird eine Reihe von Kontertechniken auf verbale Angriffe vorgestellt, deren Ziel ist, das Spiel des Angreifers nicht mitzuspielen, sondern gezielt den Prozess, den der Angreifer initiieren möchte, zu unterbrechen.
Das vierte Kapitel zeigt, wie man konstruktive Kritik formuliert. Dazu wird zunächst zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik unterschieden und dann ein Verhaltensschema zur Formulierung konstruktiver Kritik vorgestellt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem eindeutigen Stellen und dem eindeutigen Ablehnen von Forderungen. Besonderer Wert wird dabei auf die exakte verbale Formulierung der jeweiligen Forderungen beziehungsweise Ablehnungen gelegt.
Im Unterschied zu Kapitel eins bis fünf, wo es um Techniken geht, die sich im Verhalten äußern, widmen sich Kapitel sechs und sieben Prozessen, die nur für einen selbst wahrnehmbar sind. Kapitel sechs beschreibt den Einfluss der Atmung auf die körperliche Anspannung und stellt darauf aufbauend einige Atemübungen vor, die es erlauben, die Anspannung sehr schnell zu vermindern. Das siebte Kapitel erläutert dann die gedanklichen Prozesse, die mit dem Thema Manipulation und Selbstsicherheit in Beziehung stehen. Es hebt die Bedeutung von Leitideen hervor und identifiziert hinderliche Leitideen. Abschließend stellt es ein Verfahren vor, mit dessen Hilfe hinderliche Leitideen modifiziert werden können.
Zu guter Letzt werden in Kapitel acht wichtige Prinzipien der gezielten Verhaltensänderung beschrieben. Sie können sehr hilfreich sein, damit man Verhaltensabsichten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich realisieren kann.
Friedrichshafen, Januar 2004
Eberhardt Hofmann
KAPITEL 1:
MANIPULATION
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Methoden wirksamer Manipulation. Es umfasst bestimmt nicht alle Möglichkeiten der Manipulation, liefert jedoch einen Orientierungsrahmen, um die vielen Methoden zu systematisieren und dadurch leichter (er-)fassbar zu machen. Da es sich bei der Aufstellung um keine exakte Systematik handeln kann, gibt es dabei sicherlich auch einige Unschärfen und Überschneidungen.
Was ist Manipulation?
Manipulation ist ein alltägliches Phänomen. Wir wollen ständig, dass unsere Mitmenschen etwas für uns tun oder anderes unterlassen. Genauso möchten andere Leute dauernd, dass wir etwas für sie tun oder eben etwas nicht machen. Das ist natürlich und legitim. Schwierig wird es dann, wenn das, was man tun oder lassen soll, nicht offen ausgesprochen wird, wenn man absichtlich getäuscht wird oder wenn man zu Dingen, die man „eigentlich“ nicht will, überredet wird. In diesen Fällen hat man es mit Manipulation zu tun.
Sehen wir uns zunächst einige Definitionen des Begriffs „Manipulation“ an.
Definitionen des Begriffs „Manipulation“
Nach Meyers großem Handlexikon (1985) bedeutet Manipulation „Kunstgriff“ oder „Machenschaft“.
Mackensen (1971) definiert Manipulation als Eingriff, Handhabung, Zurechtmachung (ohne den Willen des Betroffenen), Machenschaften, Zurechtmachung der Ware nach den Verbraucherwünschen.
Smith (1990) versteht unter Manipulation Folgendes: Manipulation ist, wenn man eine andere Person veranlasst, etwas zu tun, und sie über die Ziele im Unklaren lässt oder über die Ziele täuscht.
Edmüller (2001) definiert: Manipulation ist der bewusste oder unbewusste Einsatz unfairer Verhaltensweisen.
Wenn Manipulation eingesetzt wird, findet also keine „freie“ und offene Kommunikation, sondern eher ein (eventuell auch gegenseitiges) Versteckspiel statt. Das Gegenteil von Manipulation ist somit das klare Ausdrücken der eigenen Wünsche bzw. die klare und eindeutige Ablehnung von Forderungen.
Manipulation war also offenbar immer dann am Werk, wenn man etwas getan hat, das man „eigentlich“ gar nicht tun wollte. Das kann bei konkreten Handlungen der Fall sein oder auch dann, wenn man gewisse Argumentationen übernimmt oder ihnen nicht widerspricht.
Eine pragmatische Definition von Manipulation
Es handelte sich offenbar immer dann um Manipulation, wenn man etwas getan (oder gelassen) hat, das man eigentlich gar nicht wollte (oder unbedingt tun wollte), und wenn man die Diskrepanz zwischen dem, wie man sich verhalten hat, und dem, wie man sich eigentlich verhalten wollte, als störend empfand.
In den zuvor genannten Definitionen wird darauf verwiesen, dass Manipulation nicht notwendigerweise bewusst eingesetzt werden muss. Vielen Menschen, die manipulieren, sind sicherlich die in diesem Buch beschriebenen Mechanismen nicht in der Form bewusst, dass sie die von ihnen angewendeten Strategien ohne Weiteres benennen könnten. Wie haben sie (und natürlich auch wir selbst) dann die entsprechenden Techniken erlernt? Das geschah ganz einfach dadurch, dass sie gemerkt (gelernt) haben, dass die eine oder andere Methode wirksam ist. Daher wurde sie „automatisch“ öfter herangezogen und hat sich im Laufe der Zeit als eine effiziente Reaktionsweise im Verhaltensrepertoire etabliert. Dieser Lernprozess vollzieht sich genau auf dieselbe Weise auch in vielen anderen Lebensbereichen.
Um auf Manipulationsversuche angemessen reagieren zu können, muss man sich im ersten Schritt darüber klar werden, wann und wie man manipuliert wird, d. h., man muss erkennen, dass und wie andere Personen Manipulationstechniken einsetzen. Zu diesem Zweck werden nachfolgend verschiedene Schemata vorgestellt, mit deren Hilfe man Manipulationstechniken systematisieren und dadurch besser erkennen kann. Da Manipulation auch etwas mit der Kreativität des Manipulierers zu tun hat, kann diese Auflistung nicht vollständig sein. Es gibt aber einige allgemeine Prinzipien und sehr weit verbreitete Techniken, die einen Großteil der im Alltag auftretenden Manipulationsstrategien leichter wahrnehmbar machen. Darüber hinaus ist es wichtig, zu wissen, auf welchen Manipulationsmechanismus man selbst leicht hereinfällt. Nachfolgend sind einige weit verbreitete, beliebte und erprobte Manipulationsstrategien aufgeführt.
Überredungstechniken
Eine erste Gruppe von Manipulationsmethoden stellen die Überredungstechniken dar. Wenn man jemanden zu etwas überreden will, das dieser eigentlich nicht tun möchte, so hat man prinzipiell eine ganze Menge Möglichkeiten, ihn doch noch dahin zu bringen. Diese Vielfalt lässt sich jedoch gut strukturieren, indem man die Hauptmechanismen alphabetisch auflistet.
Möglichkeiten der Manipulation
A. Appell an das schlechte Gewissen: „Ich habe schon so viel für dich getan!“
B. Belohnungen versprechen: „Wenn du das für mich tust, werde ich auch … für dich tun.“
C. Konsequenzen androhen: „Wenn du mir nicht entgegenkommst, werde ich …“
D. Diskriminieren: „Mein Anliegen ist viel wichtiger als deines.“
E. Egalisieren: „Jeder muss etwas zum gemeinsamen Wohl beitragen.“
F. Fremdargumente: „Amerikanische Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass in gut funktionierenden Beziehungen jeder einmal etwas für den anderen tun muss.“
G. Gescheiter sein: „Betrachte es doch einmal logisch …“
Z. Zeitdruck: „Jetzt ist keine Zeit zum Diskutieren, wir müssen jetzt schnell handeln.“
Diese Überredungstechniken sind besonders relevant, wenn es darum geht, den anderen zu etwas zu bewegen, das dieser eigentlich gar nicht will. Ihr Einsatz und die Möglichkeiten, ihnen zu entgehen, werden ausführlich in Kapitel 5 behandelt.
Killerphrasen
Die so genannten Killerphrasen bilden die zweite Gruppe von Manipulationstechniken. Killerphrasen sind Standardphrasen, die die Diskussion oder das Gespräch über ein Thema sehr schnell unterbinden sollen. Beispiele für solche „bewährten“ Killerphrasen sind nachfolgend aufgeführt.
Beispiele für Killerphrasen
• Das kann so gar nicht funktionieren.
• Darüber brauchen wir gar nicht zu reden.
• Wozu ändern? Es funktioniert doch!
• Haben Sie damit überhaupt Erfahrungen?
• Darüber sind wir uns ja wohl schon einig.
• Das System hat sich bewährt.
• Das hatten wir doch schon mal.
• Das ist Ihr Problem.
• Das geht so nicht.
• Regen Sie sich doch nicht so auf!
• Das sehen Sie völlig falsch.
• Was haben Sie sich dabei gedacht?
• Wissen Sie überhaupt, wovon die Rede ist?
• Haben Sie sich überhaupt schon einmal mit dem Thema beschäftigt?
• Haben Sie überhaupt zugehört?
• Ihnen kann man auch alles erzählen.
Was kann man gegen Killerphrasen tun? Wichtig ist zuerst wiederum, sie zu (er-)kennen. Wenn sie dann in Gesprächen auftauchen, kann man sein Gegenüber unterbrechen und darauf hinweisen. Eine gute Möglichkeit ist auch, am Anfang einer Diskussion oder eines Gesprächs als Regel der Zusammenarbeit zu vereinbaren, solche Phrasen nicht zu verwenden. Dazu holt man das Einverständnis der Gesprächspartner vorab ein. Man wird dieses Einverständnis praktisch immer erhalten, da ja niemand ernsthaft behaupten will, man könne mit solchen Killerphrasen eine sinnvolle Diskussion führen. Schließlich muss man dann nur noch kontrollieren, dass alle Beteiligten sich an die Vereinbarung halten. Diese Methode kann noch weiter ausgebaut werden, indem man zu Beginn einer Diskussion Killerphrasen sammelt, aufschreibt und sichtbar aufhängt oder indem man bereits eine Auflistung von Beispielen mitbringt.
Mikropolitik
Als „mikropolitische“ Techniken bezeichnet man eine dritte Gruppe von Manipulationsstrategien, die insbesondere im beruflichen Alltag eine Rolle spielen. Der Begriff wurde erstmals von Burns (1962) verwendet. Im deutschen Sprachraum wurde er vor allem durch die Veröffentlichung von Bosetzky (1980) bekannt. Er versteht unter Mikropolitik „die Bemühungen, die systemeigenen materiellen und menschlichen Ressourcen zur Erreichung persönlicher Ziele, insbesondere des Aufstiegs im System selbst und in anderen Systemen, zu verwenden, sowie zur Sicherung und zur Verbesserung der eigenen Existenzbedingungen“.
Unter Mikropolitik versteht man also das Arsenal jener alltäglichen kleinen (Mikro-)Techniken, mit denen Macht aufgebaut und eingesetzt wird, um den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und sich fremder Kontrolle zu entziehen. Mikropolitische Techniken werden hauptsächlich in hierarchischen Systemen angewendet, um sich innerhalb dieser Systeme längerfristige Vorteile zu verschaffen. Ein wichtiges Charakteristikum der Mikropolitik ist, dass sie in ihren Aktionen zugleich ihre Existenz verbirgt oder leugnet. Sie wirkt unerkannt am besten. Die nachfolgende Beschreibung (in Anlehnung an Krüper & Ortmann, 1988) stellt sehr konzentriert und grob mikropolitische Techniken dar. Sie wirkt vielleicht etwas überzeichnet, umfasst aber die wichtigsten Strategien, deren sich fast alle Menschen in ähnlicher Form im Alltag intuitiv bedienen.
Mikropolitische Techniken
1. Informationskontrolle
• Informationsfilterung
• Informationszurückhaltung
• Informationsüberflutung
• Informationsverzerrung
• Informationsbeschönigung
• Informationsverfälschung
• Gezielte Falschinformation
• Vernichten von Unterlagen
• Dosiertes Informieren
• Andere von Informationen abschotten
• Vorbereitete Formulierungen scheinbar spontan vorschlagen
• Fachsprache einsetzen, um zu beeindrucken
• Irrelevante Informationen verbreiten
• Nebenkriegsschauplätze eröffnen
• Gerüchte verbreiten
• Sich absichtlich so ausdrücken, dass man falsch verstanden wird
• Zugang zu Informationen erschleichen
• Informanten platzieren
• Durch Kontaktpflege zu Informationen gelangen
• Dritten Insiderinformationen zuspielen
• Vertraulichkeit verletzen
• Spezialwissen ansammeln
• Expertenstatus beanspruchen
2. Einfluss auf Verfahren und Regeln nehmen
• Präzedenzfälle, Gewohnheiten, Besitzstände, Traditionen etc. geltend machen
• Entscheidungsprozeduren beeinflussen
• Passende Maßstäbe auswählen
• Auf Autoritäten berufen
• Bestimmte Alternativen abwürgen
• Scheinabstimmungen
• Scheinbar neutrale (in Wirklichkeit bestellte) Dritte zur Schlichtung rufen
3. Beziehungspflege
• Verdeckte Absprachen
• Schaltstellen mit loyalen Personen besetzen
• Auf mächtige Verbündete hinweisen
• Unbequeme Leute isolieren
• Jemanden zum Sündenbock machen
• Jemandem eigene Fehler in die Schuhe schieben
• Entzug von Privilegien
• Zuschanzen von Ressourcen
• Sich in den Schutz eines „Patrons“ begeben
• „Radfahren“
• Schleimen
• Nach dem Mund reden
• Den Dienstweg umgehen (bypassen)
4. Selbstdarstellung
• Andere öffentlich herausfordern
• Bluffen
• Einschüchtern
• Sich stur stellen
• Offene Befehlsverweigerung
• Andere im Unklaren lassen
• In aller Munde sein
• Über sich gut reden (lassen)
• Fassadentechniken (vgl. Kapitel 2)
• Mit Statussymbolen Eindruck schinden
• Durch auffällige Aktionen die eigene „Sichtbarkeit“ erhöhen
5. Handlungsdruck erzeugen
• Termine setzen und kontrollieren
• Termine verschieben/nicht einhalten
• Unrealistische Forderungen stellen und sich herunterhandeln lassen
• Formelle Verfahren (Beschwerde, Gericht, Betriebsrat etc.) androhen
• Sanktionen ankündigen
• Anderen Motive unterstellen, personalisieren
Wenn im persönlichen Umfeld mikropolitische Techniken angewandt werden, kann man sich entweder dafür entscheiden, diese Spiele mitzumachen, oder man kann beschließen, sich in einem solchen eher schwierigen Umfeld klar zu äußern, sich eindeutig zu positionieren und zu verhalten. Man muss dabei für sich klären, in welchen Lebensbereichen man eine offene und authentische Kommunikation anstreben will und in welchen Lebensbereichen man mikropolitisch handeln will. Und man muss natürlich auch bedenken, wie sich die Anwendung mikropolitischer Strategien langfristig auf das eigene Image und somit auf die Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt. Kurzfristige handfeste Vorteile können sich nämlich sehr schnell in längerfristige Nachteile verwandeln. Die Mitmenschen werden jemandem, von dem bekannt ist, dass er mikropolitisch agiert, wohl eher reserviert begegnen.
Auf längere Zeit kann der Einsatz von Mikropolitik kaum geheim erfolgen. Es wird sich zumindest herumsprechen, dass eine Person häufig mikropolitische Techniken anwendet. Damit verlieren sie ihre Wirkung (die sie nur im Verborgenen entfalten können). Wenn man für sich entscheidet, nicht bei dem mikropolitischen Spiel mitzumachen, so kann man unter Umständen in gewissen Organisationen seine persönlichen Ziele nicht verwirklichen. Es bleiben dann nur noch die Alternativen, die Organisation zu verlassen oder diesen unangenehmen Zustand zu ertragen. Im Privatsektor dagegen lassen sich mikropolitische Strategien schwieriger anwenden, da dort die Beziehungen freiwillig eingegangen werden und im Gegensatz zum Arbeitsleben zumindest im Prinzip auch leichter aufkündbar sind.
Wertediskussionen
Geschrieben steht:
„Im Anfang war das Wort“
Hier stock’ ich schon!
Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort
So hoch unmöglich schätzen
(…)
Mir hilft der Geist!
Auf einmal seh’ ich Rat
Und schreib’ getrost:
„Im Anfang war die Tat.“
(Faust I)
Der Unterschied zwischen verbalem Bekunden und realem Tun
Ein weiteres, ebenfalls besonders im beruflichen Alltag weit verbreitetes Manipulationsinstrument ist der Widerspruch zwischen offiziell verkündeter Absicht, verkündeten Werten, verkündeten Handlungsmaximen etc. und dem konkreten Handeln. Die wahre Handlungsabsicht wird dadurch verschleiert, dass man mit vielen Worten eine meist idealisierte und allgemein anerkannte Handlungsweise beschwört. Die – meist berechtigte – Hoffnung besteht dann darin, dass folgender Fehlschluss erfolgt: Wer so oft so redet, muss auch so handeln. Dabei wird unterstellt, dass Sprechen (verbales Verhalten) und Handeln (reales Verhalten) identisch sind oder zumindest in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Dass diese These jedoch wenig realistisch ist, sollen die folgenden zwei Beispiele erläutern: Im Rahmen eines Assessment-Centers (eines Gruppenauswahlverfahrens für Nachwuchsführungskräfte) wurden Einzelinterviews geführt, um die verbal bekundete Führungsmotivation zu erfassen. Die daraus gewonnene Einschätzung wurde daraufhin mit dem realen Verhalten der jeweiligen Kandidaten in verschiedenen Gruppensituationen verglichen. Die Korrelation der beiden Werte lag unter 0,40, was einem eher geringen Zusammenhang entspricht. Es gab also relativ viele Kandidaten, die im Interview ihre Motivation, Gruppen zu führen, sehr überzeugend darstellten, die aber in genau dieser Situation dann das entsprechende Verhalten nicht zeigten, und umgekehrt. Diese mangelnde Übereinstimmung könnte nun daher rühren, dass das Interview schlecht geführt und somit die Verhaltensabsicht nicht richtig erfasst wurde. Dagegen spricht, dass das Interview mit ca. 40 Minuten Länge sehr ausführlich war und von zwei Psychologen durchgeführt wurde, sowie die Tatsache, dass durchgängig über alle empirischen Untersuchungen gleiche Werte berichtet werden.
Ein weiteres, sehr drastisches Beispiel für die Divergenz von Sprechen und Tun stellen die beliebten Leitsätze zur Führung und Zusammenarbeit im Unternehmen dar. Fast alle Unternehmen besitzen solche Hochglanzbroschüren, in denen das Verhalten der Mitarbeiter (insbesondere das der Führungskräfte) beschrieben wird. Die Bedeutung solcher Leitsätze wird jedoch durch zwei Sachverhalte sehr geschmälert: Erstens sind die Werte zwischen verschiedenen Unternehmen austauschbar, weil es sich dabei in aller Regel um allgemein wünschenswerte (= wünschens-werte) Werte handelt. (Wer würde z. B. angeben, nicht vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, nicht konstruktive Kritik zu pflegen, nicht dialogbereit zu sein etc.?) Wenn es sich bei den verkündeten Werten also um Werte handelt, die jeder vernünftige Mensch unterschreiben würde, können sie auch nicht zwischen verschiedenen Unternehmen differieren. Es handelt sich dann lediglich um sozial akzeptierte Stereotype, deren Informationsgehalt gegen null geht.
Zweitens haben auch hier (ähnlich wie bei den weiter hinten diskutierten Erziehungsstilen) die verkündeten Werte oft nur sehr wenig mit den von den Mitarbeitern erlebten Werten im täglichen Verhalten zu tun.
Beispiele für Leitsätze zur Führung und Zusammenarbeit in Unternehmen
• Respekt
• Menschenwürde
• Wertschätzung
• Vertrauen
• Leistungskultur
• Eigenverantwortung
• Konflikte offen aussprechen
• Feedbackkultur
• Fordern von Querdenkern
• Vorbildfunktion (insbesondere bei Führungskräften)
• Offenheit
• Hierarchieübergreifender Dialog
• Konstruktive Kritik
Diese Wertebegriffe sind in der Regel so gewählt, dass praktisch jeder Mensch sie als erstrebenswert anerkennt.
Warum gibt es diese Diskrepanz?
Die Diskrepanz zwischen Sprechen und Tun kann (mindestens) vier Gründe haben: Zum Ersten wird sie manchmal bewusst eingesetzt, um andere Menschen zu täuschen. Man kann seine wahren eigenen Interessen besser durchsetzen, wenn man die anderen darüber im Unklaren lässt (genau darin besteht ja die Definition der Manipulation).
Zweitens kann die Diskrepanz zwischen Sprechen und Tun ein Effekt der „sozialen Erwünschtheit“ sein. Wenn man über Werte spricht, äußert man immer auch Verhaltensabsichten. Der Zusammenhang zwischen Verhaltensabsicht und Verhalten ist jedoch nicht eindeutig. Auf dem Weg von der Verhaltensabsicht zum tatsächlichen Verhalten finden einige Verzerrungen statt, die letztendlich dazu führen können, dass das Verhalten nur noch wenig oder gar nichts mehr mit der geäußerten Verhaltensabsicht zu tun hat. Dieser Prozess wird sehr gut im Modell von Ajzen und Fishbein (1977) beschrieben. Man prüft die tatsächliche Verhaltensabsicht, bevor sie öffentlich geäußert wird, daraufhin, ob sie auch im jeweiligen Umfeld sozial akzeptiert oder erwünscht ist. Die Ausführung des beabsichtigten Verhaltens wird zusätzlich dadurch modifiziert, dass man häufig einfach das tut, was man immer schon getan hat. Wenn dies nicht so wäre, wäre es z. B. für einen Raucher unendlich leichter, mit dem Rauchen aufzuhören. Dann würden auch deutlich mehr Neujahrsvorsätze realisiert. Und schließlich verändert sich die Verhaltensabsicht zusätzlich durch die Gegebenheiten der jeweiligen Situation.
Der Weg von der Verhaltensabsicht zum Tun
Der Schluss von der geäußerten Verhaltensabsicht auf das reale Verhalten ist aufgrund der oben beschriebenen Mechanismen ein „Kurzschluss“.
Eine dritte Ursache für die Diskrepanz zwischen Sprechen und Tun mag in einer eher „unbewussten“ Tendenz liegen (unbewusst bedeutet dabei ungewusst und hat nichts mit dem psychoanalytischen Begriff des Unbewussten zu tun).
Aus Untersuchungen zum Erziehungsstil ist bekannt, dass der von den Eltern beabsichtigte, der von ihnen auch praktiziert erlebte und der von ihren eigenen Kindernwahrgenommene Erziehungsstil sehr wenig miteinander gemein haben. Ein großer Zusammenhang besteht jedoch zwischen dem von den Kindern erlebten elterlichen Erziehungsstil und dem von ihnen wahrgenommenen Erziehungsstil der Großeltern den Eltern gegenüber. Die Eltern meinen also einen bestimmten Erziehungsstil zu praktizieren, nur die Kinder merken davon nichts. Tatsächlich reproduzieren die Eltern jedoch die Erziehung, die man ihnen angedeihen ließ. Und sie tun das (unbewusst), während sie behaupten, den von ihnen verbal bekundeten und für richtig erachteten Erziehungsstil zu leben.
Bekundeter und erlebter Erziehungsstil
Ein vierter Grund für die mangelnde Deckungsgleichheit verbaler Äußerungen mit tatsächlichem Verhalten ist oft in dem Selbstdarstellungsanteil der Kommunikation (vgl. Kapitel 2) begründet. Jede Kommunikation kann als Information über einen Sachverhalt und als Selbstdarstellung des Senders aufgefasst werden. Wie stark die jeweiligen Anteile sind, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Bei Wertediskussionen steht oft eher der Selbstdarstellungsaspekt im Vordergrund.