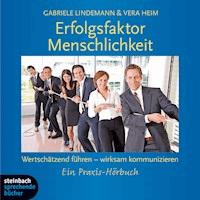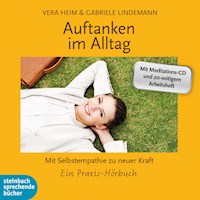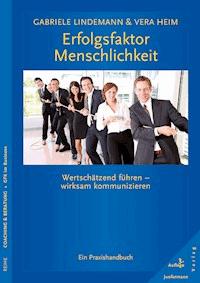
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wünschen Sie sich mehr Leichtigkeit und Freude im Kontakt mit Kollegen und Ihren Teams? Möchten Sie, dass Menschen kooperieren und gemeinsam an einem Strang ziehen, um Ziele zu erreichen? Wertschätzende Kommunikation ist dabei eine Kernkompetenz für alle Menschen, die am Arbeitsplatz etwas bewegen wollen. Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrungen in Unternehmen haben die Autorinnen das Modell der Gewaltfreien Kommunikation für den Geschäftsalltag anwendbar gemacht. In diesem Buch erfahren Sie, - wie Sie sich effektiv ausdrücken, für Ihre Anliegen einstehen und gleichzeitig Ihre Gesprächspartner ernst nehmen; - wie Sie Ihren kooperativen und situativen Führungsstil weiterentwickeln und neun Strategien für effektives Beziehungsmanagement nutzen können; - wie Sie zu einer wertschätzenden Unternehmenskultur beitragen, in der Sie mehr Raum für Initiative, Handlungsfähigkeit und Win-Win-Lösungen schaffen und so den langfristigen Unternehmenserfolg sichern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gabriele Lindemann & Vera HeimErfolgsfaktor MenschlichkeitWertschätzend führen – wirksam kommunizieren
Über dieses Buch
Wünschen Sie sich mehr Leichtigkeit und Freude im Kontakt mit Kollegen und Ihren Teams? Möchten Sie, dass Menschen kooperieren und gemeinsam an einem Strang ziehen, um Ziele zu erreichen? Wertschätzende Kommunikation ist dabei eine Kernkompetenz für alle Menschen, die am Arbeitsplatz etwas bewegen wollen.
Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrungen in Unternehmen haben die Autorinnen das Modell der Gewaltfreien Kommunikation für den Geschäftsalltag anwendbar gemacht. In diesem Buch erfahren Sie,
wie Sie sich effektiv ausdrücken, für Ihre Anliegen einstehen und gleichzeitig Ihre Gesprächspartner ernst nehmen;wie Sie Ihren kooperativen und situativen Führungsstil weiterentwickeln und neun Strategien für effektives Beziehungsmanagement nutzen können;wie Sie zu einer neuen Unternehmenskultur beitragen, in der Sie mehr Raum für Initiative, Handlungsfähigkeit und Win-Win-Lösungen schaffen und so den langfristigen Unternehmenserfolg sichern.Gabriele Lindemann(Foto links) ist zertifizierte GFK-Trainerin, Coach und Inhaberin von »Menschen und Ziele« in Nürnberg, Ausbildung und Beratung für menschliche Unternehmenskultur.
Vera Heim (Foto rechts) ist zertifizierte GFK-Trainerin und Coach. Seit 2004 bietet sie mit »The Coaching Company« Seminare in Zürich an und setzt sich für eine wertschätzende Unternehmenskultur ein.
Copyright: © Junfermann Verlag, Paderborn 2010 3., überarbeitete Auflage 2016
Coverfoto: © 12foto.de – Fotolia.com
Textabbildungen: Ina Liesefeld, Berlin
Covergestaltung / Reihenentwurf: Christian Tschepp
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsdatum dieser eBook-Ausgabe: 2016
Satz & Digitalisierung: JUNFERMANN Druck & Service, Paderborn
ISBN der Printausgabe: 978-3-95571-615-8
ISBN dieses E-Books: 978-3-87387-814-3 (EPUB), 978-3-95571-083-5 (PDF), 978-3-95571-082-8 (MOBI).
1. Vorwort zur 3. Auflage
Jeder Mensch braucht Einfühlung und möchte mit seinem Engagement gesehen werden! Diese Botschaft von Marshall B. Rosenberg zieht sich wie ein Roter Faden durch das vorliegende Buch. Und als Hochschullehrer mit leitender Verantwortung weiß ich, welche Konsequenzen sich aus dieser Erkenntnis ergeben, wenn es um Führung in Organisationen geht. Im Zentrum steht der Austausch auf Augenhöhe – bei gleichzeitigem Respekt von Funktionshierarchien. Dann kann es gelingen, dass strukturelle Macht miteinander geteilt und auf Machtausübung über andere verzichtet wird. Letztlich sind es die Wortwahl und die Haltung in der Kommunikation, die über den Erfolg oder Misserfolg zwischen Menschen und damit auch im Arbeitsalltag entscheiden. Die in diesem Buch beschriebene positive Handlungssprache schafft Raum für menschliche Begegnung und Win-Win-Situationen. Es kann entdeckt werden, was hinter einem Ja oder Nein verborgen ist, um gemeinsame Lösungswege zu beschreiten.
Der Mensch ist ein kooperatives Beziehungswesen! Diese neurologische Tatsache (J. Bauer) ermuntert, der weit verbreiteten Aggressionstriebtheorie (S. Freud) konstruktiv entgegenzutreten, die von einer grundsätzlich gewalttätigen Reaktion des Menschen im Umgang mit Konflikten ausgeht. Dieses Wissen ermuntert mich in meinem Hochschulalltag, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Es sind Momente des Feierns, wenn aufrichtige und wertschätzende Kommunikation mit Studierenden, KollegInnen in Forschung und Lehre sowie mit Menschen auf sehr unterschiedlichen Hierarchieebenen der Verwaltung gelingt. Es bedeutet, die Masken abzusetzen, die Menschen in ihren Rollen oft tragen, um sich zu schützen. Wenn mir Menschen am Ende meiner Seminarveranstaltungen davon berichten, dass sich durch mein Kommunikationsangebot ihr Leben verändert hat, dass sie mit den Menschen ihres Umfeldes anders umgehen, dann ist Verständigung ein Beitrag zum Frieden. Auch dann, wenn mich aufgrund meiner klaren Worte ein Lächeln einer Verwaltungsangestellten berührt, weil sie Offenheit erlebt, oder auch, wenn es als Studiendekan gelingt, durch das wiederkehrende Benennen von Bedürfnissen eine Kollegin zu mehr Ruhe in der Kommunikation einzuladen. Es sind Momente der Ernte für den langen Weg, den ich bis hierhin gehen durfte und bei dem mich auch das vorliegende Buch begleitet und motiviert hat. Um Brücken der Verbindung und Verständigung zu bauen hilft (Selbst-)Reflexionsfähigkeit. Das ist die Grundlage, damit sich Individuen mit Ihren Potenzialen entfalten und gleichermaßen in Gemeinschaften konstruktiv wirken können.
Die systematischen Schritte der Wertschätzenden Kommunikation bieten dazu methodische Ausgangspunkte hin zu einer veränderten Lebenshaltung – mit sich selbst und anderen. Das schafft Spielräume auch für Neuentdeckungen des Selbstführens und Geführt-Werdens. Wer als ganzer Mensch Wertschätzung erfährt, dem kann es gelingen, die Gemeinschaft der anderen und sich selbst als Teil davon aktiv voranzubringen. Was einfach klingt, ist gleichzeitig in der Umsetzung nicht immer leicht. Die Methode der Wertschätzenden Kommunikation ist ein Geschenk. Sie hilft dabei, in eine Haltung gewaltfreier Wertschätzung zu kommen. Das braucht kontinuierliche Übung, die zu einer lebenslangen Chance werden kann.
Das vorliegende Buch bietet dazu eine Fülle strukturierter Anregungen und systematischer Angebote, die sich in den zurück liegenden Jahren in Fort- und Weiterbildungen und auch der Hochschulbildung hinsichtlich effektiver Kommunikation bewährt haben. Mich beeindruckt die Fähigkeit der Autorinnen, ihre jahrelange Trainingserfahrung durch konkrete Beispiele aus dem Businessalltag auf den Punkt zu bringen und Angebote für Perspektivenwechsel zu machen. Da mich die Wertschätzende Kommunikation täglich im Arbeitskontext und in der Familie begleitet, feiere ich diese 3. Auflage. Es bedeutet Anerkennung für das Werk zweier Frauen, die das (be)schreiben, wofür sie leben und wovon sie zehren. Danke für diesen Beitrag zur Bereicherung einer lebendigen Menschheit!
Weingarten, Februar 2016
Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik
Pädagogische Hochschule Weingarten
2. Einleitung
Wertschätzung und Menschlichkeit sind die Erfolgsfaktoren für Wirtschaftsunternehmen – gerade heute. Denn der Blick auf das, was Manager heute weltweit bewegt, macht deutlich, warum es mehr denn je davon bedarf.
Die Weltwirtschaftsforen in Davos zeigen Trends auf. In 2015 widmeten sich die Wirtschaftsexperten dem Thema Achtsamkeit: sich in humanitären Projekten zu engagieren, sahen sie als Notwendigkeit für nachhaltiges Wirtschaften. Dies bedeutet auch, als Unternehmer nicht allein den Aktienkurs zu fokussieren, sondern sich gleichzeitig seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu werden. In 2016 gehören zu den vorwiegenden Sorgen der Manager unter anderem geopolitische Risiken. Auch die Angst vor Instabilität bewegt die Experten, nicht zuletzt wegen der Erschütterungen durch die aktuelle Flüchtlingskrise. Zudem stehe das Tempo des technischen Fortschritts bei den unternehmerischen Risiken zusammen mit dem Fachkräftemangel ganz oben.
Wir sind davon überzeugt, dass es zum Meistern dieser Herausforderungen Fähigkeiten braucht, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zu hören. Es gilt, das Bewusstsein zu stärken, dass Menschen einander bedingen. Deshalb richten wir den Blick auf den wesentlichsten Wirtschafts- und Erfolgsfaktor der Unternehmen: den Menschen. Das erkennen heutzutage mehr und mehr Unternehmen und suchen realisierbare Alternativen für einen besseren Umgang mit ihren Mitarbeitenden. Gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene liegt noch ein großes Potenzial, das für die Lösung aller wirtschaftlichen Anliegen nutzbar gemacht werden kann. Kernelemente sind dabei der respektvolle Umgang miteinander, der geprägt ist von Wertschätzung, Kooperation und Menschlichkeit. Das sind die wahren Erfolgsfaktoren für Wirtschaftsunternehmen in der heutigen Zeit.
Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann wünschen wir uns zwischen Monatszielen und Karrierestreben oft, gelassener und mit mehr Leichtigkeit miteinander umzugehen. In unseren alltäglichen Auseinandersetzungen setzen wir gerade unsere Sprache oft als Machtinstrument ein, um auf Kosten von anderen das zu bekommen, was wir wollen. Dadurch wird unsere Verständigung mitunter beträchtlich gestört.
Unser Ansatz, die „Wertschätzende Kommunikation“ (WSK), baut auf einer Haltung von Respekt und Vertrauen auf. Er ist für alle engagierten Führungskräfte und Mitarbeitenden geeignet, die statt einer direktiven Führung von Menschen mehr auf die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen setzen wollen. Die klare und handlungsorientierte Sprache der WSK setzt auf der Beziehungsebene an und bezieht die Anliegen aller Beteiligten mit ein. Das dient letztlich der Effektivität im Arbeitsalltag, weil durch die verbesserte Beziehungsebene Gespräche wieder auf die Sachebene geführt werden können. Dieser Kommunikationsansatz basiert auf dem weltweit bewährten Modell der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall B.Rosenberg. Wir haben ihn aufgrund unserer Erfahrungen im Business speziell für Wirtschaftsunternehmen anwendbar gemacht. Eingeflossen sind dabei auch unsere Erkenntnisse aus der Interpersonalen Neurobiologie.
Ziel der Wertschätzenden Kommunikation ist es, eine neue Haltung den Menschen im Unternehmen gegenüber einzunehmen. Eine Haltung, die auf Gleichwertigkeit basiert und damit die Menschen im Unternehmen wieder in das Zentrum rückt. Denn Fortschritte im heutigen Arbeitsumfeld lassen sich nicht mehr dort erzielen, wo sie bis jetzt stattfanden. Die Geschäftsprozesse sind optimiert und auf Effizienz getrimmt. Arbeitsabläufe sind schlank, die IT-Infrastruktur ist vernetzt und aufeinander abgestimmt. Die nächste Innovationswelle wird auf einer anderen Ebene stattfinden und bestimmt sein durch eine Art und Weise, wie wir gemeinsam Herausforderungen anpacken und Probleme lösen. Wenn es uns gelingt, Menschen dafür zu begeistern, aus freien Stücken am gleichen Strang zu ziehen, weil sie einen Sinn sehen, in dem was sie tun, dann legt dies ein unerschöpfliches Potenzial frei. Es wird darum gehen, wie wir Menschen auch im Berufsleben wieder in einem Geist der Gemeinsamkeit Projekte verwirklichen können und dabei Freude empfinden. WSK kann hier mithelfen, den nächsten Quantensprung zu ermöglichen und das Potenzial, das in Kooperation und einem konstruktiven Miteinander liegt, freizusetzen.
Wenn wir von Menschlichkeit sprechen, dann meinen wir einen respektvollen Umgang, bei dem die Bedürfnisse aller gleichermaßen gehört und ernst genommen werden. Dazu braucht es auch die Fähigkeit, auf einer Ebene zu kooperieren, die von der Gleichwertigkeit jedes Menschen ausgeht. Doch häufig wird geglaubt, dass wirtschaftlicher Erfolg nur auf Kosten von Menschlichkeit erreicht werden kann und wir es uns nicht „leisten“ können, auch im Wirtschaftsleben wohlwollend miteinander umzugehen.
Aus unserer langjährigen Berufserfahrung, unter anderem im Banken- und Telekommunikationssektor, wissen wir, was Menschen zum Kooperieren motiviert. Gleichzeitig haben wir oft hautnah erfahren, wie Machtkämpfe, ungeklärte Konflikte und eine kompromisslose Erwartungshaltung zu Frustration und Resignation führen und wie schnell eine Situation ausweglos erscheint. In unserer Position als Führungskräfte haben wir erlebt, dass wir meist größeren Einfluss nehmen können als zunächst angenommen. Hürden sind oft einfacher zu überwinden, wenn man die Blickrichtung ändert und die Menschen mit ihren Ressourcen und Potenzialen auf der Ebene von Gleichwertigkeit in die Mitverantwortung nimmt. Dies führt zu zufriedenen Mitarbeitenden und steigert gleichzeitig den Unternehmenserfolg.
Seit fast zwei Jahrzehnten begleiten wir als Beraterinnen zahlreiche Menschen, Teams und Organisationen auf ihrem Weg. Viele beschäftigen die Fragen, wie sie mehr Klarheit in der Führung gewinnen, die Kooperationsbereitschaft in ihrem Unternehmen erhöhen, klar kommunizieren und Konflikte leichter lösen können.
Auseinandersetzungen gehören zum Alltag, doch wie können Arbeitsbereiche lebendig bleiben und funktionieren, wenn es anhaltend untereinander klemmt und knirscht? Entscheidend scheint uns dabei, wie Menschen mit Unstimmigkeiten und Problemen umgehen – ob sie sich resigniert ihrem Schicksal ergeben oder ihre eigenen Handlungsräume und Entwicklungsmöglichkeiten erkennen und erweitern. Dafür braucht es die Fähigkeit sich selbst und andere zu führen.
In dieser Arbeit ist die Wertschätzende Kommunikation unser Schwerpunkt, weil wir sie als das wirksamste Modell erleben, wie Menschen ihre Handlungsspielräume entwickeln können. Aus unseren vielfältigen Erfahrungen mit diesem Ansatz in der Beratung, im Training und als Ausbilderinnen haben wir unter dem Begriff „Wertschätzende Kommunikation“ (WSK) neue Variationen entwickelt und die Gewaltfreie Kommunikation für die Geschäftswelt noch besser anwendbar gemacht. Durch das Lernen bei Marshall Rosenberg und auch die Zusammenarbeit mit ihm haben wir erkannt, was Empathie bewegen kann und welche Ressourcen diese bei Menschen freisetzt. Dafür danken wir Marshall Rosenberg. Weitere bedeutende Quellen der Inspiration, die in dieses Buch einfließen, sind u. a. Riane Eisler, Friedrich Glasl, Joachim Bauer und Gerard Endenburg.
Zukunftsfähige Unternehmen gestalten
Mit unserem Buch möchten wir Sie ermutigen, die Kultur in Ihrem Unternehmen aktiv mitzugestalten. Im letzten Jahrzehnt zeigen Entwicklungstrends zum Wertewandel verschiedene Ansätze zu evolutionären Organisationsmodellen, die, konsequent umgesetzt, auch neue Organisationsstrukturen bedingen. Auch wenn die grundlegende Veränderung von Strukturen in Großunternehmen noch ein längerer Weg ist, zeigt sich selbst in traditionell geführten Systemen, dass der Gestaltungsraum oft größer ist als gedacht. Durch Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung der eigenen Haltung können sich Führungskräfte und engagierte Mitarbeitende schon heute vorbereiten – für den Übergang auf zukunftsfähige Kulturen, die geprägt sind von einem Umgang auf Augenhöhe, Mitverantwortung und Initiative. Dadurch nehmen wir Einfluss auf das Miteinander in unserem direkten Umfeld.
Die Wirksamkeit der WSK bestätigt uns in dem, was wir tun. Wir möchten Sie daher einladen, vertraute Verhaltensweisen und Überzeugungen beiseite zu stellen und sich auf neue Wege zu begeben. Probieren Sie mit Offenheit und Neugier selbst aus, was davon für Ihr Leben nützlich und hilfreich ist. Wir sind sicher, dass Sie damit wertvolle Erfahrungen gewinnen werden.
Es kann sein, dass Ihnen die Wertschätzende Kommunikation zu Beginn ungewohnt erscheint. Aber genau so, wie eine neue Sprache zu Beginn fremd anmuten mag, werden Sie mit der Zeit damit vertraut werden und sie allmählich ganz selbstverständlich anwenden können.
Dieses Buch bringt Ihnen folgenden Nutzen:
Sie setzen sich aktiv mit Ihrem eigenen Führungsverständnis auseinander und werden sich bewusst, wie die WSK Ihr Führungsverhalten günstig beeinflussen kann.
Sie machen sich Schritt für Schritt mit den Elementen der WSK vertraut und erweitern dadurch Ihr Sprachrepertoire und Ihre persönlichen Handlungsspielräume.
Sie lernen, für Ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen und dabei gleichzeitig die Anliegen Ihrer Gesprächspartner(innen) zu hören und ernst zu nehmen. Damit fördern Sie zwischenmenschliche Beziehungen und schaffen Raum für Win-Win-Lösungen.
Sie schärfen Ihren Blick, um in herausfordernden Situationen leichter die Ursachen von Problemen zu finden, statt Schuldige zu suchen. Sie können Verantwortung fördern, um tragfähigere Konfliktlösungen zu erreichen.
Ob Sie nun als Projektleiterin, Kundenberater, Produktmanagerin, Verkäufer, im Telefon-Support arbeiten oder als Führungskraft in der Linie Menschen führen, mit der WSK tragen Sie zu einer Unternehmenskultur bei, die die Potenziale aller Beteiligten besser miteinander verbindet und nutzbar macht.
Das Buch im Überblick:
Kapitel 3
und
4
: Zusammenhänge, Inspirations-Quellen, Wissenswertes
Sie erfahren nützliche Hintergründe und was uns zu diesem Buch bewegt hat.
Kapitel 5
: Leitgedanken Wertschätzender Kommunikation
Sie reflektieren Ihre eigene innere Einstellung.
Kapitel 6
: Das Sprachmodell
Sie lernen die theoretischen Grundlagen kennen.
Kapitel 7
: Praktische Gesprächsvorbereitung mit Leitfaden
Sie experimentieren mit eigenen Alltagsbeispielen.
Kapitel 8
und
9
: Umgang mit Überraschungen
Sie trainieren Ihre Flexibilität im Gespräch.
Kapitel 10
: Praktische Umsetzung im Berufsalltag
Sie bauen Ihre Gesprächskompetenz aus.
Kapitel 11
und
12
: Nachhaltig führen und erfolgreich Beziehungen managen
Sie ergänzen und entwickeln Ihren persönlichen Führungsstil und stärken Ihre Leistungsfähigkeit.
Kapitel 13
und
14
: Erfahrungsberichte und Ausblick
Sie erfahren, wie WSK im Alltag wirkt und welche Organisationsformen den Prozess unterstützen.
MANAGEMENT SUMMARY
Zum effizienten Zugriff auf die Kernaussagen haben wir die Essenz der einzelnen Themen hervorgehoben und mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Gleichwertigkeit ist uns wichtig. Um trotzdem die Lesbarkeit zu erleichtern, wechseln wir zwischen der weiblichen und männlichen Form.
„Unsere wirtschaftlichen Erfolge verdanken wir den Menschen,der Gesellschaft, in der unsere Unternehmen arbeiten.“
Daniel Goeudevert
3. Menschlich führen – Luxus oder Notwendigkeit?
„Menschlich führen“ bedeutet, mit dem Kollegen, dem Mitarbeiter, dem Vorgesetzen oder dem Geschäftspartner neben der sachlichen auch eine persönliche Basis zu finden. Dazu gehört ehrliches Interesse füreinander und die Fähigkeit, mit Wohlwollen auf den anderen und seine Leistungen zu blicken. Wenn wir den Menschen als Ganzes wahrnehmen, tun wir uns leichter, bemerkenswerte Ressourcen und Fähigkeiten zu entdecken, die Menschen kaum entfalten können, wenn sie nur als „Kostenfaktor“ oder „Leistungserbringer“ in Unternehmen gesehen werden. „Menschlich führen“ heißt deshalb auch, die Menschen im Unternehmen ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören. Empathie – Einfühlungsvermögen – für das Gegenüber setzt bisher ungenutzte Kräfte frei, die wir zur Lösung der anstehenden Herausforderungen brauchen.
Dass wir dieses Potenzial noch viel zu wenig nutzen, zeigt der jüngste Gallup-Engagement-Index aus dem Jahr 2015, der Aussagen von etwa 2000 ausgewählten Arbeitnehmern auswertete. Diese Untersuchung zeigt alarmierende Fakten auf: 68 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland fühlen sich kaum noch an ihr Unternehmen gebunden und machen Dienst nach Vorschrift. 16 Prozent haben innerlich bereits gekündigt. Lediglich 16 Prozent der Beschäftigten verspüren eine echte Verpflichtung ihrem Unternehmen gegenüber und arbeiten hoch engagiert. Die Beschäftigten bemängeln in der Umfrage vor allem, dass sie zu wenig Anerkennung am Arbeitsplatz erhalten oder ihre Meinung im Unternehmen nicht gehört wird. Andere sehen sich auf dem falschen Platz. Der Aussage „Mein Chef legt den Schwerpunkt auf meine Stärken und positiven Eigenschaften“ stimmten lediglich rund ein Drittel der Befragten zu. Rückblickend zur Entwicklung seit 2008 hat sich zwar der Anteil der innerlich Gekündigten von 20 auf 16 Prozent reduziert und die Gruppe mit hoher Bindung ist gewachsen. Dennoch lässt die hohe Quote mit wenig Bindung darauf schließen, dass die Begeisterung bei der Arbeit weitgehend auf der Strecke bleibt.
Ein wichtiger Hebel, um die emotionale Bindung am Arbeitsplatz zu erhöhen, ist der kontinuierliche Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden und dabei den Fokus auf die Stärken zu richten. Weiterhin bleibt offen, wie zufrieden und dauerhaft leistungsfähig Mitarbeitende unter wachsendem Leistungsdruck sind. Dem letzten Stressreport 2014 der Bertelsmann Stiftung zufolge liegt das größte Potenzial zur Stressprävention in einer Verbesserung der Führungsfähigkeit.[1]
Laut Medienberichten über Medikamentenmissbrauch am Arbeitsplatz bestätigt jeder 20. Arbeitnehmer, als Gesunder schon einmal mit aufputschenden, konzentrationssteigernden oder beruhigenden Arzneien nachgeholfen zu haben, um im Job mithalten zu können. Dies sind immerhin gut zwei Millionen Beschäftigte in Deutschland. Die Hälfte davon – bis zu 800.000 Menschen – nehmen regelmäßig und sehr gezielt diese Medikamente als Doping ein.[2]
Die Folgen sind wirtschaftlich bedeutsam. Die Quote der Fehltage liegt bei Beschäftigten mit geringer emotionaler Bindung an ihren Arbeitgeber bis zu vier Mal höher als bei loyalen Mitarbeitenden. Einem Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitenden können so leicht jährliche Mehrkosten von einer halben Million Euro entstehen.
3.1 Führen heißt Handeln auf verschiedenen Ebenen
Die heutigen Anforderungen an Führungskräfte sind weit gespannt. Zum einen braucht es fachliches und methodisches Können. Zum anderen aber auch die Fähigkeit, ethische und soziale Aspekte im eigenen Tun und Handeln zu reflektieren und zu berücksichtigen. Daraus entsteht ein Fundament, eine innere Haltung, die sich auf das, was wir tun, auswirkt. Sie spiegelt sich auch in unserer Kommunikation wider und hat damit einen großen Einfluss darauf, wie wir Menschen in der Umsetzung unserer fachlichen und methodischen Fähigkeiten begegnen. Die folgende, vereinfachte Grafik zeigt die Vielfalt der Aufgaben, die jeder Mitarbeiter und Führungskräfte im Besonderen erfüllen müssen. Um dies erfolgreich zu tun, braucht es die Kooperation der Mitarbeitenden, Vorgesetzten, Kollegen und Kundinnen. Wir arbeiten in vernetzten Systemen und sind bis zu einem gewissen Grad voneinander abhängig. Wie aber können wir in diesen Systemen Kooperation bewirken? Die innere Haltung, die sich über unser Kommunikationsverhalten ausdrückt, spielt bei der Erfüllung unserer Aufgaben und beim Gewinnen von Mitwirkenden deshalb eine entscheidende Rolle.
Die Wertschätzende Kommunikation verbindet eine wertschätzende Haltung mit einer klaren Sprache. Je mehr wir uns unserer Sprache bewusst werden, desto besser können wir damit Einfluss nehmen und eine Kultur der Kooperation fördern.
„Es reicht nicht, wenn unsere Manager großartige Wirtschaftsfachleute oder auch Techniker sind,wenn sie den Menschen, also ihren Kunden, längst aus dem Auge verloren haben.“
Daniel Goeudevert
3.2 Klare Verständigung spart Zeit und Geld
Störungen und Konflikte gehören zum alltäglichen Miteinander. Produktiv genutzt, bewirken sie eine Horizonterweiterung und steigern die Qualität des Schaffens. Was jedoch Schaden anrichtet, sind nicht oder sehr spät angesprochene Konflikte. Die erste, 2009 durchgeführte Konfliktkostenstudie in Industrieunternehmen[3] aus Deutschland und der Schweiz zeigt, welche enorme finanzielle Belastung sowohl durch Kommunikationsprobleme und Personalwechsel entstehen als auch durch betriebsschädigendes Verhalten der Mitarbeitenden. Darin sind die Kosten für die alltäglichen kleineren und größeren Reibungsverluste noch gar nicht enthalten, da sie schwer zu beziffern sind.
Die Konfliktstudie wurde bei kleineren, mittleren und großen Industrieunternehmen durchgeführt und zeigt auf, dass jeder zweite Betrieb für ungelöste Konflikte und damit verzögerte Projekte, jährlich EUR 50.000 ausgibt. Jeder zehnte sogar über EUR 500.000 pro Jahr.
In jedem Unternehmen kostet die Konfliktbewältigung 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit.
Reibungsverlust, Konflikte oder Konfliktfolgen absorbieren 30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften.
Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen und Gesundheitskosten aufgrund innerbetrieblicher Konflikte belasten Unternehmen jährlich mit mehreren Milliarden Euro.
Darauf aufbauend wurden seit 2011 im Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen gut gelöste Konflikte vorgestellt und die ersparten Konfliktkosten transparent berechnet.[4]
Wenn es uns gelingt eine Kommunikationskultur in Unternehmen zu etablieren, bei der Konflikte frühzeitig erkannt, offen angesprochen und in gegenseitiger Achtung gelöst werden, besteht ein erhebliches Potenzial, Kosten zu reduzieren und die frei werdenden Ressourcen können in Projekte fließen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen.
„Anstatt Dinge richtig zu tun, ist es effektiver, die richtigen Dinge zu tun.“
Peter Drucker
Eine Vision
Stellen Sie sich vor, wie es wäre, in einer Gesellschaft zu leben, die geprägt ist von Gleichwertigkeit und Achtsamkeit. Jeder Mensch hat genügend zu essen und ein ausreichendes Einkommen, um neben dem Lebensunterhalt auch noch Weiterbildung und Freizeit finanzieren zu können. Sie gehen gerne zur Arbeit und sehen einen Sinn in dem, was sie tun. Die Unternehmen bauen auf das Wissen aller Mitarbeitenden und beziehen diese in die Lösungsfindung mit ein. Führungskräfte unterstützen, befähigen und inspirieren mehr und kontrollieren weniger. Die Kraft der Kooperation bringt neue Technologien hervor, die die Menschen dabei unterstützt, die vorhandenen Ressourcen optimal und umweltschonend zu nutzen. Der Erhalt unserer Umwelt spielt dabei eine entscheidende Rolle. Männer wie Frauen kümmern sich gleichermaßen um die Entwicklung der Kinder – die Zukunft der Gesellschaft. Und Arbeitgeber unterstützen dies mit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung.
Utopie oder Vision? Immer mehr Menschen fragen sich, was getan werden kann, um diesen Wandel zu einer fürsorglichen Ökonomie zu vollziehen. Es werden Organisationsmodelle entwickelt, die diese Form der partnerschaftlichen Zusammenarbeit unterstützen (siehe auch Kapitel 14) und immer mehr Unternehmen erkennen, dass es sich auszahlt, für ihre Mitarbeitenden zu sorgen. Eine neue Sichtweise der Dinge, die auch die globale Dimension mit einbezieht, kann diese Vision mit Leben füllen.
3.3 Zurück in die Steinzeit mit Blick auf die Zukunft
Besonders angesichts der anstehenden globalen Herausforderungen braucht es einen Paradigmenwechsel. Wie Albert Einstein sagte, kann ein Problem nicht auf derselben Bewusstseinsebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Die letzten siebentausend[5] Jahre waren durch eine Gesellschaftsform geprägt, die von Dominanz gekennzeichnet ist. Merkmale dafür sind hierarchisches Denken und Ausüben von Macht und Gewalt zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse. Die Folge davon waren Kriege, Unterdrückung und Ausbeutung. Ein Blick in die Medien macht klar, dass diese Gesellschaftsform bis heute existiert. Es wird uns Menschen nicht möglich sein, die Herausforderungen unserer Zeit mit den alten Denkmustern zu lösen. Dafür braucht es Orientierung an Neuem oder an bereits Bewährtem, aber weniger Bekanntem:
Viele Menschen glauben auch heute noch, dass Krieg und Kampf die Quelle unseres technologischen Fortschritts ist[6]. Und so wurden geschichtliche Ereignisse über Jahrtausende durch diese Brille interpretiert. Riane Eisler, eine amerikanische Rechtsanwältin, Kulturanthropologin und Schriftstellerin, hat die Zeichen der Geschichte neu erforscht und widerlegt diese These. In Ihrem Werk „Kelch und Schwert“ zeigt sie auf, dass praktisch alle materiellen und sozialen Technologien, auf denen unsere Zivilisation heute aufbaut, bereits im Neolithikum (Jungsteinzeit), vor zirka zehntausend Jahren, entwickelt wurden[7]. Nach Jahrtausenden der Jäger- und Sammlerkultur entstand vor allem in Mitteleuropa eine landwirtschaftliche Revolution. Die Menschen dieser Zeit erzielten mit der Weiterentwicklung von Ackerbau, Jagd, Fischerei und Haustierzucht große Fortschritte. Mit ihren Innovationen in der Baukunst, bei der Herstellung von Teppichen, Möbeln, Stoffen und Kleidern, Kunst und Stadtplanung legten sie damals einen Grundstein, von dem wir heute noch profitieren. Diese Zeit zeichnete sich unter anderem auch dadurch aus, dass gesellschaftliche Macht bedeutete, Verantwortung zum Wohle aller zu tragen. Überleben und Fürsorge standen im Fokus des Tuns. Frauen wie Männer wurden gleichwertig behandelt und sorgten in einer kooperativen sozialen Organisation für das Allgemeinwohl.
3.4 Einfluss nehmen, statt Macht ausüben
Der Erfolg dieser Zeit ist u. a. auf die partnerschaftliche Einstellung der Menschen zurückzuführen. Sie nutzten die Macht, um gemeinsam etwas zu erreichen. Es ging dabei auch um die Förderung des Individuums, ohne die Entwicklung anderer dabei einzuschränken. Der partnerschaftliche Gedanke unterstützte die Menschen darin, die Gruppe und die einzelnen Individuen in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Daraus entstand eine Kultur der Fülle.
In unserer Zeit wird Macht mehrheitlich im Sinne eines Gewinn- / Verlust-Verständnisses genutzt. Man setzt seine Macht ein, indem man seine eigenen Anliegen über die der anderen stellt. Dadurch fehlt dem Gegenüber die Chance, aus freien Stücken zu kooperieren (siehe Abschnitt 6.4.1). Die Annahme, dass Menschen nicht freiwillig und aus Freude zum Wohl anderer beitragen könnten, kurbelt eine Spirale verbaler und physischer Gewalt an und bildet den Nährboden für eine Dominanzkultur, in der die Menschen befürchten, nicht das zu bekommen, was sie brauchen. Dies führt zu einer Kultur des Mangels. Hier braucht es ein kooperatives Weltbild, dass wir im Grunde alle voneinander abhängen und darum hochgradig vernetzt wirken sollten, im Denken, im Kommunizieren und im Handeln.
Wir alle wollen zu einem gewissen Grad Macht ausüben. Wir möchten Einfluss nehmen, unsere Träume erfüllen, Ziele erreichen – unsere Welt aktiv gestalten – und uns weiterentwickeln. Wenn es uns gelingt, Macht dahingehend zu nutzen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann liegt darin ein unerschöpfliches Potenzial. Dies trägt zum Wohl unserer Gemeinschaft bei.
3.5 Der Mensch: Einzelkämpfer oder kooperatives Beziehungswesen?
Immer wieder hören wir die Argumentation, dass der Mensch den natürlichen Trieb in sich trägt, zu kämpfen, sich gegen andere durchzusetzen. Dieses Denken ist stark beeinflusst durch eine von Charles Darwins Evolutionstheorien. Diese wurde oftmals so interpretiert, dass Lebewesen aufgrund des Selektionsdrucks der Natur fortlaufend gegeneinander ums Überleben kämpfen müssen. Seine späteren Theorien wurden von David Loye, Sozialpsychologe und Evolutionstheoretiker, in einem neuen Licht betrachtet. Er entdeckte, dass die Aussage „Survival of the fittest“ (Überleben des Geeignetsten) gerade zwei Mal in Darwins Werk „Abstammung des Menschen“ vorkam. Der Begriff „Liebe“ jedoch fünfundneunzig Mal. In seiner weiteren Forschungsarbeit fand er heraus, dass auch Darwin Kooperation für die menschliche Fortentwicklung weitaus bedeutsamer betrachtete als das Zusammenspiel von Wettbewerb und Eigennutz[8].
Heute betrachtet u. a. die Interpersonale Neurobiologie (IPNB) das Wunder „Mensch“ aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven. Dabei versuchen Ärztinnen, Neurobiologen, Psychologen, Mathematikerinnen, Biologinnen, Physiker, Philosophen und Ethologinnen neue Theorien wissenschaftlich zu untermauern. Die IPNB geht davon aus, dass unser Gehirn ein „soziales“ Organ ist, das sich aufgrund zwischenmenschlicher Erfahrungen formt und entwickelt. Deshalb wird der (Ver-)Bindung zwischen Menschen und ihren Wirkungen aufeinander eine besondere Bedeutung zugewiesen[9].
Auch Joachim Bauer, Neurobiologe und Psychotherapeut, zeigt in seinem Buch „Prinzip Menschlichkeit“[10] auf, dass wir nicht primär auf Egoismus und Konkurrenz eingestellt sind, sondern auf das Gelingen von menschlichen Beziehungen. In unserem Gehirn befindet sich ein sogenanntes „Motivationssystem“, das bei erfolgreichem Beziehungsaufbau verschiedene Glücksbotenstoffe ausschüttet. Diese Botenstoffe bescheren uns nicht nur Zufriedenheit, sondern auch körperliche und mentale Gesundheit. Sind Beziehungen belastet, so fällt die Ausschüttung dieser Glücksbotenstoffe aus. Dies hat zur Folge, dass ihre beruhigende Wirkung ausbleibt, und es in den emotionalen Angstzentren des Gehirns stattdessen zur Ausschüttung von Alarmbotenstoffen kommt. Diese Stressreaktion ruft Angst, Panik, Trauer und Aggression hervor. Mit anderen Worten: Der Mensch ist aus biologischer Sicht ein Beziehungswesen, das nach Kooperation, Zugehörigkeit, Wertschätzung und Anerkennung strebt. Bleiben diese grundlegenden Bedürfnisse längerfristig unerfüllt, leiden Psyche und Physis. Das erklärt auch die Ergebnisse des jüngsten Gallup-Engagement-Indexes und der KPMG Konfliktstudie. Mangelnde Wertschätzung und Aufmerksamkeit beeinflussen das biologische Motivationssystem negativ. Der länger andauernde Ausschluss von Mitarbeitenden, wie z. B. durch Mobbing, führt unweigerlich zu gesundheitlichen Schäden und Arbeitsausfällen.
3.6 Wertschöpfung durch Wertschätzung
Anerkennung, Aufmerksamkeit und Vertrauen sind also so etwas wie unser „neurobiologischer Treibstoff“, eine Art natürliches Motivationssystem. Denn wir Menschen streben Kooperation und Gemeinschaft an. Die WSK bietet dafür eine wirksame Kommunikationsform, weil sich die Menschen mit ihren Potenzialen entfalten können.
Wie bereits erwähnt, gab es lange vor unserer Zeit hoch entwickelte Kulturen, die auf der Basis von Partnerschaft, Kooperation und Miteinander bestens funktioniert haben. Wichtige Erfindungen wurden hervorgebracht, von denen wir heute, nach zehntausend Jahren, noch profitieren. Aus unserer Sicht wird diese Art und Weise des Zusammenlebens ein entscheidender Faktor sein, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.
Wir wissen heute noch nicht, wie tragfähig unser gegenwärtiges sozioökonomisches System ist. Denn viele aktuelle Fragen bewegen sich um den Erhalt der Arbeitsplätze und der Finanzkraft, um die Versorgung im Alter, die Tragfähigkeit der Krankenund Sozialversicherungssysteme. Worauf wir uns hingegen verlassen können, ist die Fähigkeit der Menschen, fürsorglich zu sein. Aus dieser Perspektive gewinnen soziale Netzwerke, beruflich wie privat, im Bewusstsein vieler Menschen wieder mehr Bedeutung. Es gilt, die Fähigkeiten weiterzuentwickeln, die wir als Menschen alle haben: Empathie und Fürsorge.
Barack Obama sprach oft über die Macht der Empathie und dass es mehr davon bedarf: „Das größte Defizit heutzutage ist Empathie. Wir brauchen Menschen, die in den Schuhen anderer stehen und durch ihre Augen sehen können.“[11] Empathie hilft auch, den Wandel gemeinsam gut zu meistern. Deshalb brauchen wir diese Fähigkeit nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch in Unternehmen und in den Teams. Es liegt in unserer Entscheidungsmacht und in unserem Interesse, auf den Erfolgsfaktor Menschlichkeit zu bauen und das größte Kapital der Firmen, den Menschen, wieder wahrzunehmen. Dort liegt ein riesiges Potenzial. Denn Wertschätzung trägt ganz wesentlich zur Wertschöpfung bei.
MANAGEMENT SUMMARY
Das rasante Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte hat seine Spuren hinterlassen. Angespannte Finanzsysteme, Integration und die Frage, wie wir uns alle nachhaltig versorgen können, zeigen auf, dass ein Umdenken nötig ist. Es wird deutlich, dass Menschen voneinander abhängen und gesellschaftliche Verantwortung stärker in den Fokus von Unternehmensführung rückt. Übertragen auf den Mikrokosmos Führungsalltag sind wir gefordert, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen ihr Potenzial einbringen können und gemeinsam als „Mitunternehmer“ Verantwortung übernehmen. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass es bereits vor zirka zehntausend Jahren gut funktionierende Gesellschaftssysteme gab, deren Fokus auf Kooperation und Einbezug des Potenzials aller Beteiligten lag. Die Menschen des Neolithikums (Jungsteinzeit) nutzten ihren Einfluss zum Wohle aller. Neurobiologische Erkenntnisse bestätigen, dass menschliche Motivationssysteme nicht auf Konkurrenzdenken beruhen, sondern auf Kooperation und Wertschätzung. Empathie ist wichtiger denn je. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg und damit wird Menschlichkeit zum Erfolgsfaktor.
4. Sprache beeinflusst den Führungsalltag
Wo gehobelt wird fallen Späne. Wo Menschen miteinander arbeiten gibt es Konflikte. Konflikte können dann entstehen, wenn wir etwas haben wollen, aber nicht bekommen. Sie möchten zu einer bestimmten Zeit Urlaub nehmen, aber die Chefin sagt nein. Sie brauchen von einem Kollegen dringend Unterlagen, aber er liefert diese nicht fristgerecht ab. Sie haben Pläne, wie Sie ein Projekt umsetzen wollen, aber die Geschäftsleitung sieht das anders. Sicher fallen Ihnen dazu noch viele andere Beispiele aus Ihrem Alltag ein. Konflikte gehören zum Alltag. Und trotzdem fällt es vielen Menschen schwer, konstruktiv mit ihnen umzugehen. Anstatt diese zu klären, werden die Konflikte aggressiv und impulsiv ausgetragen oder tagelang mit sich herumgeschleppt, vielleicht auch tabuisiert. Irgendwann platzt dann der Kragen und man verschafft sich Luft auf eine Art und Weise, die wenig förderlich für die Beziehung ist oder man kündigt innerlich und macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Das kostet Zeit, Geld und Energie.
Ein Mitarbeiter einer Firma erzählte uns, dass er mit einer Person derart verkracht sei, dass er nur noch äußerst ungern den Lift benutze. Er befürchte, es könne ihm, wenn sich die Fahrstuhltüre öffne, sein Erzfeind gegenüberstehen. Er hätte nie geglaubt, dass ihm so etwas einmal passieren könne. Es koste ihn viel Zeit und Energie, den Konfliktgegner zu meiden. Und für den Fall, dass er ihm doch begegnen würde, dachte er stundenlang darüber nach, was er ihm in diesem Fall sagen könnte. Wie kann so etwas passieren? Warum fällt es uns so schwer, Konflikte frühzeitig anzusprechen? Weshalb bringt uns das Verhalten des Gegenübers oder ein Nein so auf die Palme?
4.1 Wenn uns Konflikte re(a)gieren
Starke Emotionen zeigen sich dann, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden und wir befürchten, nicht zu bekommen, was wir wollen. Und wenn unsere Erwartungen, wie etwas sein sollte, nicht erfüllt werden oder wir Angst haben, nicht mehr aus freien Stücken kooperieren zu können. Wird eine Situation von unserem Unterbewusstsein als gefährlich eingeschätzt, schaltet unser Gehirn vom rationalen Denken auf einen Überlebensmodus um. Dieser wird vom Reptilienhirn (Limbisches System) aus gesteuert und kennt vor allem drei Verhaltensmöglichkeiten: Flucht, Angriff oder Lähmung. Der Ursprung dieser Reaktionen liegt einige Millionen Jahre zurück, als unsere Vorfahren im ständigen Kampf ums Überleben auf lebenserhaltende Strategien angewiesen waren. Täglich wurde das Leben bedroht und so mussten sie in Gefahrensituationen blitzschnell reagieren. Damals machte es durchaus Sinn, instinktiv und schnell zu handeln, einen angreifenden Säbelzahntiger zu bekämpfen, sich mit schnellen Füßen in Sicherheit zu bringen oder mit einer Körpererstarrung den Tod vorzutäuschen. Diese Reaktionen haben dazu beigetragen, dass wir Menschen überlebt haben. Sie sind in gewissen Situationen nach wie vor nützlich und hilfreich. In der Zwischenzeit hat sich jedoch unser Umfeld verändert, so dass die wenigsten Situationen für uns wirklich lebensbedrohlich sind.
Der Erzfeind des erwähnten Mitarbeiters ist nicht von einem Tag auf den anderen zu einem gefährlichen Säbelzahntiger mutiert. Feindbilder entstehen durch unerfreuliche Begegnungen, Interpretationen von erlebtem Verhalten, wertende Gedanken und Unterstellen böser Absichten. Je stärker das Feindbild, desto verzerrter wird die Wahrnehmung von dem, was geschieht.
Was diesen Prozess möglicherweise noch verstärkt, sind Projektionen auf das Gegenüber. Manchmal erinnern Sprache, Gestik, Mimik oder auch das Aussehen eines Menschen an frühere Bekanntschaften, die einem einmal das Leben erschwert haben. Diese Erfahrungen werden dann auf aktuelle Situationen übertragen. Projektionen passieren blitzschnell und bleiben meist unbewusst.
Die Vorstellung, dem Erzfeind zu begegnen, löste beim erwähnten Mitarbeiter ein Fluchtverhalten aus – welches ihn daran hinderte, ganz unbekümmert den Lift zu benutzen. Andere Menschen neigen in solchen Fällen dazu, sich tot zu stellen und sich möglichst nicht mehr zu bewegen, bis die Gefahr vorbei ist. Wieder andere ziehen die kämpferische Auseinandersetzung vor. Was all diese Strategien gemeinsam haben ist, dass sie von der Art und Weise, wie Menschen über andere Menschen denken, stark beeinflusst werden. Stellen Sie sich vor, eine Kollegin liefert eine Arbeit nicht zum vereinbarten Termin ab. Was geschieht mit Ihrem persönlichen Empfinden wenn Sie
Folgendes denken: „Das ist doch wieder mal typisch! Ständig verpasst sie ihre Abgabetermine. Die ist so was von unzuverlässig! Wegen ihr kommt jetzt das ganze Projekt in Verzug!“? Löst dieses Denken bei Ihnen auch Wut oder Ärger aus? Je wertender und verurteilender unsere Gedanken sind, desto größer ist unser Stresspegel und um so eher schaltet sich unser Reptilienhirn ein. Das sind die Momente, in denen uns Konflikte und Emotionen regieren und wir auf unser Gegenüber reagieren, ohne zu wissen, worum es uns wirklich geht.
4.2 Wie wir andere mit unserer Sprache dominieren
Sind wir erst einmal im wertenden Denken gefangen, greifen wir gerne auf Kommunikationskeulen zurück, in der Hoffnung, doch noch zu bekommen, was wir wollen. Diese verbalen Attacken sind oft vom Impuls begleitet, den anderen zu strafen, ihm Schuld zuzuweisen oder Macht auszuüben. Damit sind wir bereits bei der Gewalt in der Sprache. Wir versuchen uns verbal über den anderen zu stellen, ihn zu dominieren, in eine bestimmte Richtung zu drängen oder zu gewinnen. Deshalb werden diese Strategien auch „Dominanzstrategien“ genannt. Wer meint, dass diese Dominanzstrategien mit lautem Gebrüll und Fluchen verbunden sein müssen, täuscht sich. Dominanzstrategien können auch ganz subtil ausgesprochen werden. Hier einige Beispiele dazu:
Ein Kollege sagt zum Projektleiter: „Tut mir leid, ich kann die gewünschten Zahlen nicht bis heute Mittag zusammentragen. Ich schaffe das zeitlich einfach nicht.“
Dominanzstrategie
Mögliche Antworten des Projektleiters
1
befehlen, anordnen, auffordern,erwarten, fordern
„Ich erwarte von Ihnen, dass Sie den Bericht bis mittags abliefern!“
2
drohen, warnen,Entweder-oder-Strategien
„Wenn Sie in einer Stunde den Bericht nicht abliefern, werde ich mir überlegen, wie ich das in der Teamsitzung anspreche …“
3
moralisieren, predigen
„Zuverlässige Mitarbeitende informieren vorher, wenn sie einen Termin nichteinhalten können!“
4
Ratschläge erteilen, voreilige Lösungen vorgeben
„Ich habe Ihnen immer gesagt, dass Sie Prioritäten setzen sollen.“
5
Vorträge halten, belehren,Fakten liefern
„Sie wissen doch, dass wir die Zahlen brauchen, damit wir die Marketingstrategie festlegen können!“
6
Urteile fällen, Vorwürfe machen,wertend kritisieren
„Sie sind so was von unzuverlässig!“
7
loben, schmeicheln
„Sie schaffen doch sonst immer alles! Das kriegen Sie doch noch bis Mittag hin. Oder?“
8
beschimpfen, lächerlich machen
„Jetzt müssen alle auf Sie warten –das ist ja so was von peinlich!“
9
interpretieren, diagnostizieren,analysieren
„Sie sind scheinbar überfordert mit derAufgabe! – Als Akademiker würde ich da anders an die Sache rangehen!“
10
Ich habe das Gefühl, dass …
„Ich habe das Gefühl, Sie sind der Aufgabe nicht gewachsen.“
11
Schuld zuweisen
„Wegen Ihnen kommt jetzt das ganzeProjekt in Verzug!“
12
trösten, Sympathie bekunden, schonen
„Ach Sie Armer – jetzt hängt alles an Ihnen. Wie erdrückend muss das sein!!!“
13
forschen, fragen, verhören:Wieso-, Weshalb-, Warum-Fragen
„Warum sagen Sie das erst jetzt?“
14
Rechthaberei
„Es ist Ihre Pflicht, diese Arbeit fristgerecht abzuliefern.“
15
zurückziehen, ablenken, ausweichen
„Sorry, ich hab jetzt grad Wichtigeres zu tun!“
16
Ich kann nicht …, ich muss …
„In diesem Fall kann ich Ihnen keine anderen Aufgaben mehr in diesem Projekt geben.“
17
Verantwortung vorschieben, bevormunden, sich auf Autorität berufen
„Ich habe hier die Verantwortung für das Projekt, deshalb machen Sie das jetzt bitte.“
In Anlehnung an die Kommunikationssperren von Thomas Gordon[12]
Was geschieht hier eigentlich? In den Beispielen 1 bis 5 setzt sich der Projektleiter über den Kollegen. Zuerst versucht er ihn in die gewünschte Richtung zu bewegen, ohne sich ein Bild seiner Situation zu verschaffen. Danach signalisiert er ihm, dass er nicht weiß, wie man etwas macht. Mit den Dominanzstrategien 6 bis12 wird dem Kollegen mit Diagnosen und Analysen mitgeteilt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Bei der Botschaft 13 läuft der Kollege ins Leere oder bekommt vermittelt, dass er etwas falsch gemacht hat. Bei den Beispielen 14 bis 17 geht es darum, die Verantwortung abzugeben oder so an sich zu reißen, dass die Gleichwertigkeit verloren geht.
Versetzen Sie sich in die Lage des Kollegen. Wie würden Sie auf solche Aussagen reagieren? Würden Sie in den Gegenangriff gehen, sich schuldig fühlen, sich schämen oder Sorgen machen, wie es jetzt mit Ihnen weiter geht? Wie würde sich das auf Ihre Freude, zum Gelingen des Projektes beizutragen auswirken? Wie motiviert wären Sie jetzt, zu kooperieren?
4.3 Wie Konflikte entstehen und eskalieren
Wir haben beleuchtet, wie schnell sich Dominanzstrategien einschleichen können. Je häufiger Sie diese verwenden, desto größer ist die Gefahr, dass Auseinandersetzungen eskalieren. Ehe man sich versieht, nimmt ein Konflikt eine Dynamik an, aus der es schwierig ist, wieder herauszukommen.