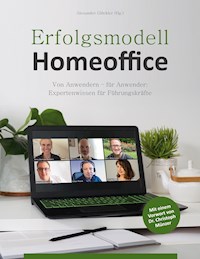
Erfolgsmodell Homeoffice E-Book
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Homeoffice boomt - und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, wird sich weiter etablieren. Immer häufiger werden Arbeitnehmer bei Einstellungsgesprächen auch gezielt danach fragen. Darauf sollten Unternehmen und Führungskräfte gut vorbereitet sein. Wie nicht nur die Etablierung, sondern auch die dauerhafte Implementierung dieses Arbeitsmodells gelingen kann, ist Inhalt dieses Buches. Sechs Fachleute - langjährig erfahrene und ausgewiesene Experten ihres Fachs - bringen ihr Wissen kompakt auf den Punkt. Mit vielen Beispielen zur direkten und erfolgreichen Umsetzung. So wird aus dem Arbeitsmodell Homeoffice ein "Erfolgsmodell Homeoffice".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Homeoffice hat Zukunft!
Vorwort von Dr. Christoph Münzer
Volker Rozek Erst das „wozu“ – dann das „wie“
Ein dauerhaft erfolgreiches Homeoffice-Projekt beginnt im Kopf
Sven Wiesrecker Aus den Augen aus dem Sinn?
Arbeitsrecht und Datenschutz im Homeoffice: Die Gesetze, ihre Bedeutung und Umsetzung
Alexander Glöckler Besser zweimal hinschauen
Ein strategisch entwickelter Arbeits- und Gesundheitsschutz hat zahlreiche Vorzüge
Anna Stempel-Romano und Marco Romano So gelingt Führung auf Distanz
Wie Führungskräfte das Zwischenmenschliche in digitalen Zeiten im Blick behalten
Brigitte Kälin Survivalstrategien für den Sitzalltag
Fit, gesund und motiviert sein – im Homeoffice zahlt sich das dreifach aus
Weiterführendes Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweise
Homeoffice hat Zukunft!
Es ist noch nicht lange her, da lag Deutschland bei der Homeoffice-Nutzung deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Dann kam Corona und führte zu einem regelrechten Homeoffice-Boom: Drei Viertel der deutschen Unternehmen schickten Teile ihrer Belegschaft während der Krise 2020 ins Homeoffice. War das nur ein kurzzeitiger Trend? Oder ist Homeoffice ein Konzept für die Zukunft? Aller Voraussicht nach letzteres: Eine Studie des Münchner Ifo-Instituts kam im Juli 2020 zu dem Ergebnis, dass mehr als jedes zweite Unternehmen seine Beschäftigten auch weiterhin von zu Hause arbeiten lassen will.1 Homeoffice wird sich also weiter etablieren und wird immer häufiger von Arbeitnehmern2 auch gewünscht und nachgefragt werden. Ohne dieses Angebot für ihre Angestellten werden es Unternehmen zukünftig sehr viel schwerer haben, auf dem Markt zu bestehen.
Corona hat gezeigt, dass Homeoffice grundsätzlich funktioniert, gleichzeitig hat die Krise aber auch offenbart, dass es diesbezüglich noch viele offene Fragen und Herausforderungen gibt. Vor allem für Führungskräfte, die das Arbeitsmodell nicht nur einführen, sondern auch erfolgreich und vor allem dauerhaft implementieren sollen.
Unter welchen Bedingungen ist Homeoffice erfolgreich? Was gilt es in organisatorischer und technischer Hinsicht zu berücksichtigen? Welche Parameter müssen Unternehmen hinsichtlich der Arbeitssicherheit beachten? Was sagt die Rechtsprechung und welche Besonderheiten finden sich in den entsprechenden Gesetzen? Wie gelingt es Führungskräften ihr Team bzw. einzelne Mitarbeiter auch aus der Entfernung heraus erfolgreich zu motivieren und zu führen? Wie sieht es mit den gesundheitlichen Aspekten im Homeoffice aus? Diese und weitere wichtige Fragen beantworten die sechs Autoren dieses Buches – alle sind langjährig erfahrene und ausgewiesene Experten ihres Fachs. Und alle sind selbst Praktiker. Deshalb finden sich in den Beiträgen auch immer wieder entsprechende Hinweise und Tipps zur direkten Umsetzung im Unternehmen. Genau in dieser Kombination wird dann aus dem Arbeitsmodell Homeoffice ein „Erfolgsmodell Homeoffice“!
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
Autorenteam
[1] https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-07-alipour-falck-schueller-homeoffice.pdf (zuletzt geprüft am 13.8.2020)
[2] Im gesamten Text wird grundsätzlich auf das Gendern verzichtet. Dies stellt keine Diskriminierung dar, sondern dient der verbesserten Lesbarkeit.
Vorwort
Lieber Leser,
Homeoffice - ein Wort wie Donnerhall. Kaum ein Konzept hat in den letzten Jahren die Gemüter so erhitzt. Für die einen ist Homeoffice der langersehnte Traum einer modernen Arbeitswelt, die ohne Pendlerstau ein selbstverantwortliches Arbeiten in vertrauter Umgebung möglich macht und so endlich die harmonische Versöhnung von Berufs- und Privatleben durch moderne Technologie und andere Arbeitsformen bewirkt.
Für die anderen ist Homeoffice die organisierte Anarchie, in der Mitarbeiter sich schrittweise von Team und Unternehmen lösen und als unproduktive Satelliten in fernen Umlaufbahnen langsam verloren gehen. Die einen loben die Transparenz und Effizienz, die durch neue Tools wie etwa MS-Teams, Trello, Slack, Zoom, WebEx und einer anschwellenden Zahl von immer neuen Systemen entstehen kann.
Die anderen befürchten, dass wir uns mit Tools statt mit Problemen beschäftigen, sehen den Verlust der persönlichen Begegnung als Hindernis für Kreativität und spontane Innovationen und wissen nicht, wie das offene und zwanglose Gespräch in Kaffeepausen und in der Kantine digital simuliert werden könnte. Corona hat in einem weltweiten Schock-Experiment gezeigt, dass technisch und organisatorisch viel mehr geht, als wir alle zuvor geglaubt hätten. Die Praxis hat genauso gezeigt, dass „Online“ eine klug eingesetzte Methode und keine Ideologie sein darf, wenn wir tatsächlich vorwärtskommen wollen. Klar ist auch: Nicht alle haben ein passendes Homeoffice zur Verfügung, nicht jeder Mensch ist persönlich gleichermaßen für die Arbeit ohne Büro im Unternehmen geeignet. Und natürlich kann nicht jede Aufgabe allein mit dem PC gelöst werden. Ein Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer ist deshalb barer Unsinn.
Klar ist auch, dass man Homeoffice oder „remotes Arbeiten“, wie man es besser nennen sollte, richtig machen muss. Es gibt viele Fallstricke – von IT, Organisation bis Führung und Arbeitssicherheit reichen die Themen. Dieses Buch – geschrieben von Praktikern für Praktiker – hilft dabei, wie jedes Unternehmen seinen Weg finden kann. Die Zukunft von Homeoffice hat gerade erst begonnen.
Dr. Christoph Münzer
Hauptgeschäftsführer wvib Schwarzwald AG
Erst das „wozu“ – dann das „wie“
Ein erfolgreiches Homeoffice-Projekt beginnt im Kopf
1
Über den Autor
Volker Rozek
Volker Rozek blickt auf drei Dekaden Erfahrung im internationalen Umfeld der Automobilzuliefererindustrie zurück. Dort war er in Produktion und Projektmanagement in leitenden Positionen erfolgreich tätig. Er ist Experte für Projektmanagement und Prozessoptimierungen.
[Kontaktdaten]
Volker Rozek
Rozek Consulting
Dingelstädter Straße 29 | 37308 Heilbad Heiligenstadt | T 0175/66 96 224
[email protected] | www.rozek-consulting.de
Erst das „wozu“ – dann das „wie“
Ein erfolgreiches Homeoffice-Projekt beginnt im Kopf
In Unternehmen, die sich auf dem Markt behaupten, gehören professionelle Arbeitsbedingungen für Teams und Mitarbeiter unabdingbar zur Erfolgsstrategie. Gilt das auch für das Arbeiten im Homeoffice? Ja – sogar noch mehr! Warum das so ist und wie Sie als Unternehmer und Führungskraft Homeoffice-Modelle organisatorisch sowie technisch mit Erfolg etablieren, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Keine hochwertigen Ergebnisse ohne professionelle Arbeitsbedingungen
Arbeit im Homeoffice – mit Anspruch an hochwertige Ergebnisse – ist professionell zu organisieren. Ob Homeoffice-Modelle angesichts von Krisen oder durch Engpässe oder deshalb eingeführt werden, weil neue Arbeitsmodelle etabliert werden sollen, spielt dabei keine Rolle.
Für die Planung hingegen macht es einen erheblichen Unterschied,
ob ein Wechseln vom Betrieb ins Homeoffice erfolgt (Variante 1),
oder ob das Homeoffice die Einstellungsvoraussetzung für neue Mitarbeiter ist (Variante 2).
Das Ergebnis soll und muss effektives Arbeiten im privaten Umfeld bedeuten. Doch die Vorbereitungen dazu unterscheiden sich deutlich, deshalb erfolgt in diesem Beitrag hierzu eine Differenzierung. Damit Homeoffice ohne Reibungsverluste startet und auf Dauer gut funktioniert, empfiehlt es sich, dieses Vorhaben als ein vierstufiges Projekt mit diesen Phasen zu realisieren:
Umfassende Vorbereitung
Klären der Voraussetzungen
Erstellen eines detaillierten Plans
Gewissenhafte Umsetzung
Werfen wir einen ausführlichen Blick auf die vier Phasen.
1. Die umfassende Vorbereitung
Auch wenn es „nur“ darum geht, die betriebliche Anwesenheit mit den damit verbundenen Aufgaben zu verlagern, liegt ein vollwertiges Projekt vor. Die entsprechende DIN 69901 nennt als Kriterien:
Aufsetzen einer Projekt-Organisation (einschließlich Leitung mit der erforderlichen Aufbau- und Ablauforganisation)
Vorgeben eindeutiger Ziele
Bestimmen der Projektdauer mit definiertem Start- und Endpunkt
Bereitstellen der erforderlichen Ressourcen (Budget, Personal, Infrastruktur und Rahmenorganisation)
Hervorheben der Neuartigkeit und Einmaligkeit
Berücksichtigung der zu erwartenden Komplexität (Diese ist im
Handeln der Akteure einschließlich der Stakeholder zu finden, und weniger in der Technik beziehungsweise in der Organisation zu erwarten – siehe unten).
Eine solide Projektstruktur vermittelt dem Team die notwendige Orientierung sowie Transparenz.
Variante 1: Verlagern bestehender Aufgaben aus dem Betrieb in das private Umfeld
Was bedeutet diese Maßnahme für die direkt betroffenen Mitarbeiter? Bei Variante 1 verlassen Mitarbeiter ihr gewohntes betriebliches Umfeld, um anschließend in einem anderen zu arbeiten. Diese Veränderungen greifen erheblich in die bislang praktizierten Routinen und Gewohnheiten ein. Bewertungen in positiv oder negativ, gut oder schlecht, zum Vorteil oder zum Nachteil sind im Rahmen der Vorbereitung nicht relevant. Es gilt, pragmatisch vielerlei Interessen zu berücksichtigen und diese in für alle Parteien tragbare Lösungen zu transformieren. In dieser Phase geht es darum, die Menschen zu motivieren, sie abzuholen und anschließend gemeinsam mit ihnen die nachfolgenden Prozessschritte zu entwickeln. Wenn Maßnahmen das Verhalten von Menschen verändern sollen, spricht man von Veränderungsmanagement beziehungsweise von Changemanagement.3 Diese Situation ist bei dieser Variante gegeben und verdient besondere Beachtung.
Wie man Menschen in Veränderungsprozessen mitnimmt
In einem Veränderungsprozess ist es wichtig, bestimmte Regeln zu beachten, um die nächsten Schritte in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Werden diese Faktoren ignoriert, ist damit zu rechnen, dass dem Vorhaben mit Misstrauen, Angst, Widerwillen und Blockaden begegnet wird. Das Verweigern der Akzeptanz kann zum Scheitern des Projekts führen. Legen wir also im Folgenden einen besonderen Fokus auf die Regeln und Abläufe.4
Die wenigsten Menschen sehen in Veränderungen neue Chancen und gehen diese intrinsisch motiviert sowie proaktiv an. Bei den meisten rufen anstehende Neuerungen Abwehrreaktionen hervor. Diese liegen in Unsicherheiten, Abneigung gegen Neues, Ängsten, Befindlichkeiten, Statusdenken und Besitzstandswahrung begründet – um nur einige zu nennen.
Die folgende Grafik zeigt, welche Empfindungen während des Projekts bei den Betroffenen auftreten können:
Diese sieben Entwicklungsphasen des Veränderungsprozesses beziehen sich auf die Kompetenz, die wir selbst empfinden. Aus nachvollziehbaren Gründen verläuft dieser Prozess in Wellenform: Bisherige, gut bekannte Gewohnheiten der Komfortzone müssen aufgeben werden und so ist der Weg zum Ziel häufig ein anspruchsvoller Lernprozess unter schwierigen Bedingungen. Das Wiederlangen des ursprünglichen (oder sogar eines noch ausgeprägteren) Kompetenzgefühls wird durch belastende Emotionen zusätzlich erschwert.
Wie gelingt es am besten, die Mitarbeiter in einem Veränderungsprozess mitzunehmen?
Betrachten Sie das Unterfangen umfassend, indem Sie die Menschen, Strukturen und die umgebenden Aspekte einbeziehen. Bedenken Sie dabei, dass der Kreis der beteiligten Personen über denjenigen hinausgeht, der in das Homeoffice wechseln soll. Der Fach- und Sammelbegriff für die Personen oder Gruppen, die ihre eigenen Interessen vertreten, lautet Stakeholder. (Die Erfahrung zeigt, dass der Begriff Stakeholder negativ besetzt ist – diese Betrachtung ist jedoch nicht zielführend.)
In dem hier beschriebenen Zusammenhang kommen die Stakeholder
aus dem betrieblichen Bereich (Betriebsrat, Leiter und/oder Mitarbeiter benachbarter Abteilungen, Arbeitsschutz, Gewerkschaft, Management, Leiter und/oder Mitarbeiter der betroffenen Bereiche, Datensicherheitsexperten, IT, …)
aus dem privaten Umfeld der Mitarbeiter (Ehepartner, Kinder, weitere Personen, die im Haushalt leben, Steuerberater, …)
aus externen Geschäftskontakten (Kunden, Lieferanten, Behörden, Dienstleister, …)
Das Auflisten der Stakeholder stellt bereits den ersten Teil der notwendigen Analyse dar. Für den weiteren zielgerichteten Umgang haben wir eine Tabelle [siehe Seiten 18/19] entwickelt.
Projektverantwortliche sollten sich Gedanken darüber machen, ob die Stakeholder dem Projekt positiv, negativ oder neutral gegenüberstehen und welchen Einfluss sie aufgrund ihrer Machtposition auf das Projekt ausüben. Dieser Einfluss kann je nach Konstellation nicht vorhanden sein, schwach, mittel oder groß sein. Möglicherweise bringt ein Stakeholder mit großem Einfluss, der dem Vorhaben zudem noch positiv gegenübersteht, das Projekt signifikant nach vorn. Es ist fatal, wenn die Projektleitung diesen Sachverhalt nicht kennt. Das gleiche gilt natürlich für den umgekehrten Fall.
Die ausgefüllte Tabelle verdeutlicht, welches Verhalten von den Stakeholdern zu erwarten ist beziehungsweise tatsächlich vorliegt. Das Stakeholdermanagement übernimmt anschließend die Aufgabe, ob und wie die Stakeholder eingebunden und informiert werden. Da sich Interessenslagen verändern, ist das Stakeholdermanagement ein dynamischer Prozess, der das Projekt von Anfang bis Ende begleitet.





























