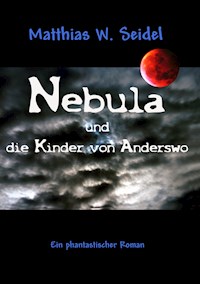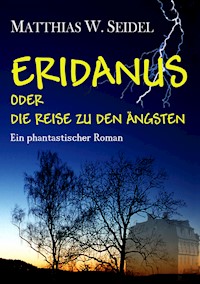
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Drei Jungen, Tom, James und Claus, überlegen, wie sie sich die Sommerferien interessant gestalten können. Sie kommen auf die glorreiche Idee, dem "Palais de la Frankenstein", einer alten, verfallenen Villa einen nächtlichen Besuch abzustatten. Nach sorgfältiger Planung und von Opa Heiner mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet, machen sie sich auf den Weg. Ein schweres Gewitter zieht auf, und sie begegnen Eridanus, einem Angst. Er führt sie in eine fantastische Parallelwelt, die von seltsamen Kreaturen bevölkert wird. Plötzlich sehen sich die drei gefährlichen Kämpfen ausgesetzt und müssen nicht nur ihre eigene Haut retten. Ein spannendes Abenteuer nimmt seinen Lauf, das eigentlich ganz harmlos anfing: "Wir sind hier her gekommen, ohne zu wissen, was uns erwartet. Wir haben Dinge gesehen, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben Abenteuer erlebt, die wir uns nicht im Traum vorzustellen wagten. Und das Wichtigste: Wir haben Freunde gefunden, wie wir sie noch nie gehabt haben und wie wir sie auch niemals wieder haben werden ..." Eine fantastische Geschichte präsentiert sich hier, in der es um Angst und deren Bewältigung, vor allem aber um Freundschaft geht. Spannend geschrieben, für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Tom den Großen, der mich Kindheit neu erleben ließ!
Inhaltsverzeichnis
Dicke Freunde
Unternehmen Franky 1
Die Nacht der Nächte
Der Geschichtenerzähler
Viel Angst um Ängste
Eridanus erzählt von seiner Welt
Eine ungewöhnliche Mahlzeit
Fern der Heimat
Drei steinerne Unterschriften
Türme und Mauer
Die Namenlosen Sümpfe
Eine Hütte mit Herd und Feuer
Die große Wende
Ein Opf kommt immer allein
Auf der Flucht
Weg der Verwüstung
Siel und Wurzel
In der Gefangenschaft
Viele Freunde & ein Plan
Regulabs Ende
Der Abschied fällt schwer
Die letzten Stationen
-Dicke Freunde-
Jährlich verschwinden unzählige Menschen. Sie verschwinden einfach so, von heute auf morgen, ohne jemals wieder aufzutauchen. Niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist. Wir möchten die Geschichte eines solchen Menschen erzählen. Gleich jetzt, nach der Werbung ...
»Blödsinn! Ein Actionfilm wäre mir lieber«, grollte James, während er den Fernseher mit dem großen Zeh ausdrückte. Er lehnte sich in seine Kuschelecke zurück und legte eine CD auf.
Normalerweise dröhnte seine Musik lautstark durch das ganze Haus, aber seine Mutter hatte Migräne. Des Öfteren wurde sie von starken Kopfschmerzen heimgesucht, besonders jetzt im Sommer. Kein Wunder, seit vierzehn Tagen hatte es nicht mehr geregnet und sie vertrug nun mal die Hitze nicht. Gewöhnlich schluckte sie dann über den Tag verteilt mehrere dieser kleinen weißen Tabletten, die sie vorrätig im Arzneischrank in der Küche hortete. Heute musste sein Vater allerdings zur Apotheke fahren, weil sie ihr unglücklicherweise ausgegangen waren. Nun lag seine Mutter auf der Couch im Wohnzimmer und hielt mit der Hand einen nassen Lappen fest an die Stirn gepresst, um dem Ziehen und Drücken entgegenzuwirken. Er und Papa mussten mucksmäuschenstill sein, weil ihr jetzt jedes Geräusch angeblich unglaubliche Schmerzen bereitete.
»Ihr könnt euch das nicht vorstellen!«, hatte sie seinen Vater angefahren, weil er den Krimi sehen wollte. Daraufhin hatte dieser seine Pfeife aus dem Wohnzimmerschrank geholt und ein Buch aus dem Regal und war beleidigt in sein Arbeitszimmer getrottet.
Ihr!, hatte sie gesagt. James wusste Bescheid. Immer wenn sie die Mehrzahl benutzte, war es besser zu verduften. So war er die Treppe hoch zu seinem Zimmer geschlendert.
Im Fernsehen lief wie immer nichts Ansprechendes. Also, was blieb ihm anderes übrig, als Musik zu hören? Er atmete tief durch, kramte den Kopfhörer zwischen den Kissen hervor und platzierte die Hörmuscheln gelangweilt an seinen Ohren. Er startete den CD-Player und kurz darauf hämmerte ein Technosong angenehm gegen seine Schläfen.
James ließ den Blick durchs Zimmer gleiten: Vorbei am Schreibtisch, auf dem sein nagelneuer PC stand, vorbei am Bücherregal, in dem Jules Verne und Michael Ende neben langweiligen Schulbüchern ihr Dasein fristeten, vorbei am Kleiderschrank, dessen rechte Tür schief hing, weil Mama mit der Konstruktion eines modernen Scharniers nichts anzufangen wusste, schließlich hinauf zur kahlen Zimmerdecke, wo sein Modellsegelflieger schlapp in den Schnüren hing.
Meine Eltern führen eine gute Ehe, dachte er bei sich. Erst neulich hatte er die dicke Metzgersfrau darüber reden hören, als er sich auf dem Weg zum Ausgang befunden hatte. »Das ist wirklich eine nette Familie, nicht wahr?«, hatte sie gesagt, wobei die anwesenden Kunden aus der Nachbarschaft beifällig gebrummelt hatten. Er konnte solches Gerede nicht ertragen; er wurde immer so betont als Baby dargestellt, dabei war er vierzehneinhalb und der zweitbeste Schüler in seiner Klasse.
James brachte aber nicht nur gute Noten mit nach Hause. Er war auch ansonsten ein aufgeweckter blonder Wuschelkopf. Er hatte graue Augen und die gleiche Stupsnase wie seine Mutter. Für sein Alter war James zwar nicht besonders groß, aber im Sportunterricht dennoch ein Ass. Federleicht ließ er sich beim Hochsprung über die Latte gleiten. Andreas, der Größte seiner Klasse, riss dabei stets die Stange mit. James war wirklich kaum zu bremsen, wenn es darum ging, gegen die Lehrer Streiche auszuhecken. Wenn er manchmal ertappt vor seinen Mitschülern stand und für seine Schandtaten gerügt wurde, legte er seinen besonderen Blick auf. Es war ein Ausdruck echter Reue, der ihm im Gesicht geschrieben stand. Die Lehrer verziehen ihm noch einmal, wie sie sich auszudrücken pflegten. Daheim klappte die Masche mit dem Blick allerdings fast nie. Da konnte er sich in besonders schweren Fällen eine Woche Hausarrest einhandeln.
Mit seinen Eltern hatte James wirklich einen guten Fang gemacht, und das wusste er auch ohne die dicke Metzgersfrau. Sein Vater war Bauleiter; jedenfalls wurde er bei der Arbeit nie schmutzig. Als James in den Kindergarten gegangen war und seine Mutter ihn nachmittags mit dem Auto abgeholt hatte, besuchten sie ihn oft auf Baustellen, wo sie über Ziegel, Eimer und Kabel klettern mussten, um ihn zu erreichen. Seine Mutter war Krankenschwester gewesen, aber seit James auf der Welt war, hatte sie sich ausschließlich um ihn und den Haushalt gekümmert – und um ihren Mann, versteht sich.
Jetzt im Sommer saß James die meiste Zeit über im Sattel seines Mountainbikes. Dazu summte und pfiff er unablässig.
»Er ist eben musikalisch«, hatte Tante Mine vor kurzem gesagt. »Man muss sein Talent unbedingt fördern!«
Fördern, oh nein, das klang James allzu sehr nach fordern. Dennoch hatte Mine zwei Tage später dem Jungen eine Blockflöte geschenkt. Zu allem Überfluss war Onkel Cornelius nun drauf und dran, ihm die Flötentöne beizubringen. Ekelhaft!
James hieß nicht immer James. Eigentlich war er auf den Namen Marcel getauft, aber der Spitzname hatte sich in kürzester Zeit derart eingebürgert, dass selbst seinen Eltern nichts anderes übrig geblieben war als sich diesen Amerikanismus (wie sich sein Vater geringschätzig auszudrücken pflegte) anzueignen. Marcel hatte sich einfach angewöhnt, auf nichts anderes mehr zu reagieren.
James klang das gleichmäßige Schlagen des Techno im Ohr, als er aus den Augenwinkeln heraus erkannte, wie seine Zimmertür geöffnet wurde. Kann man heute nicht einmal in Ruhe Musik hören?, dachte er verärgert. Er riss den Kopfhörer herunter, warf ihn achtlos neben sich und wollte eben beginnen, seiner Wut in Form von Worten Ausdruck zu verleihen, als zwei stets willkommene Gesichter vorsichtig ins Zimmer lugten: Tom der Große und Indianerclaus.
Tom ging mit James in eine Klasse. Bis vor kurzem hatten die beiden zusammen auf einer Bank gesessen. Bis vor kurzem deshalb, weil den Lehrern die Streiche der zwei einfach zu viel geworden waren. Die Störenfriede mussten auseinander, das war klar gewesen. Tom und James hatte die Entscheidung wie ein Faustschlag getroffen, aber seit sie nur noch in Sichtkontakt beisammen waren, klappte vieles besser. Ein ungestörter Unterricht ergab sich jetzt fast wie von selbst.
Tom war gut zehn Zentimeter größer als James, aber bei weitem kein so geschickter Sportler. Er hatte braunes, kurzes Haar, das er in der Mitte gescheitelt trug. Die Brille mit dem runden Gestell rutschte ihm oft viel zu tief auf die Nase. Wenn er den Kopf leicht senkte, um sein Gegenüber ansehen zu können, wirkte er wie ein richtiger zerstreuter Professor.
Tom der Große wusste wie kein Zweiter in der Klasse über geschichtliche Dinge Bescheid. Zuhause in seinem Zimmer türmten sich Geschichtsbücher über Geschichtsbücher. Auf dem Schreibtisch thronte neben einem Totenschädel (den sein Opa bei seiner Pensionierung als Volksschulrektor eigens für seinen Enkel abgezweigt hatte) eine Nachbildung des Steines von Rosette, mit dem es damals Champollion gelungen war, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Gänzlich unsichtbar war der Junge geworden, als vor zwei Jahren am Stadtrand eine Handvoll Archäologen sich darangemacht hatte, eine dort entdeckte keltische Viereckschanze freizulegen. Tom hatte so lange gebettelt, bis er schließlich, sowohl vonseiten der Eltern als auch der Wissenschaftler, die Genehmigung erhalten hatte, vor Ort bei den Ausgrabungen dabei sein zu dürfen.
Indianerclaus war der kleinste der drei. Er war mit seinen dreizehn Jahren auch der Jüngste. Claus wohnte mit seinen Eltern in einem Mietshaus in Toms Nachbarschaft. Der Junge hatte genau die gleichen braunen Augen wie Tom. Sein Haar war beinahe schwarz und seine Frisur meist völlig zerzaust. Man erzählte sich, dass Claus sich morgens nach dem Aufstehen nie die Haare kämmte. Er ging einfach so in die Schule, wie er aufgewacht war, und man konnte genau sehen, auf welcher Seite er die vergangene Nacht im Bett gelegen hatte.
Den ganzen Sommer über sah man ihn mit ausgewaschenen Jeans herumlaufen, deren Knie nicht selten ausgefranste Löcher aufwiesen. Meist trug er einen roten Pulli, seinen Lieblingspulli, der ihm viel zu weit war und ihn aussehen ließ, als würde er mit hängenden Schultern herumlaufen. Auch die Turnschuhe, durch die nicht selten der eine oder andere Zeh blinzelte, weil die Socke an der gleichen Stelle ein Loch aufwies, trug er das ganze Jahr über. Seinen Eltern war die Kleidungsordnung ihres Sohnes zwar ein Dorn im Auge, aber er ließ sich einfach nicht von deren Argumenten überzeugen.
Er ging erst in die siebte Klasse, weil er ein Jahr später eingeschult worden war. Im Unterricht war er trotz des schläfrigen Gesamteindrucks, den er bei den meisten hinterließ, ein aufmerksamer Schüler. Er erledigte seine Aufgaben nie mit penibler Sorgfalt, eher mit einer ihm angeborenen Gelassenheit, die von seiner Umwelt nie wirklich gewürdigt wurde.
Sein Zimmer musste er sich mit seiner kleinen Schwester teilen, und nicht selten gab es Krach, weil sie eines seiner Hefte als Malvorlage gebrauchte oder aus herausgerissenen Buchseiten unbeholfene Schiffchen und Flugzeuge zu falten versuchte.
Claus kannte Tom von der Schule, aber unzertrennliche Freunde sind sie erst an dem Tag geworden, als Claus vor Toms Haus mit dem Vorderrad seines Fahrrads in eine dieser verflixten Kanaldeckelrillen geraten war. Er hatte sich überschlagen und war mit geprellter Schulter und aufgeschundenem Knie reglos liegen geblieben. Er und seine Mutter hatten ihn verarztet und Claus’ Eltern verständigt. Einige Tage später saß Claus erstmals in Toms Zimmer und lauschte aufmerksam seinen Vorträgen. Tom liebte es, wenn er jemanden zum Zuhören hatte, und Claus war derjenige, der für sein Leben gern zuhörte. Er war immer zur Stelle, wenn Not am Mann war. Seine Einfälle waren oft unübertrefflich. Durch ihn hatte James, der Chefdenker, eine ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen.
»Wie geht’s, Brüder?«, fragte James freudig, als er die beiden ins Zimmer kommen sah.
»Gut, Bruder!«, antworteten die Freunde.
Rasch bezogen sie in James’ Kuschelecke ihre angestammten Plätze. Tom lehnte wie immer seinen Kopf lässig gegen die Wand, während er seine Beine überschlug und ein Kissen hinter den Rücken schob. Claus ließ sich im Schneidersitz mitten auf dem großen bunten Sitzkissen nieder.
»Was ist denn mit deiner Mutter los, James?«, fragte Tom erstaunt. »Dein Vater hat mir die Tür geöffnet, und ehe ich etwas sagen konnte, legte er seinen Zeigefinger an die Lippen und machte pst! Dabei deutete er auf die halb offene Wohnzimmertür, durch die ich den Kopf deiner Mutter erkannte.«
»Sie liegt auf der Couch und hält sich die Stirn«, antwortete James, zog die Achseln hoch und öffnete die Hände zu einer gleichgültigen Geste. »Sie hat Migräne!«
»Hör zu! Ist dir eigentlich was eingefallen?«, fuhr Tom fort. »Die Ferien haben zwar erst begonnen, aber unsere Pläne für diesen Sommer stehen auf verdammt wackeligen Beinen. Außerdem bleiben uns nur um die zwei Wochen für gemeinsame Unternehmungen. Ich muss mit meinen Eltern wie jedes Jahr für drei Wochen auf Korsika. Claus’ Eltern haben sich Ungarn in den Kopf gesetzt. Und du«, dabei deutete er in James’ Richtung, »musst ganze drei Wochen Australien über dich ergehen lassen, stimmt’s?«
»Stimmt!«
»Heuer wird es wohl langweilig werden – schrecklich langweilig«, stöhnte Claus niedergeschlagen.
»Nun hört mal zu: Urlaub hin, Urlaub her, aber deshalb werden wir genauso viel Spaß haben wie immer«, versuchte James zu trösten.
»Ach ja! Und wie stellst du dir das vor?«, gab Claus zurück.
James runzelte die Stirn und schwieg eine Weile. »Ich bin nicht umsonst euer Chefdenker, Männer!«, entgegnete er energisch. »Mir wird schon rechtzeitig etwas einfallen. Ich muss nur länger darüber nachdenken.«
»Und wie lange wird das dauern?« Claus ließ nicht locker. »Wie schnell sind die Ferien vorbei und dir ist nichts eingefallen. Uns stehen die ödesten Tage unseres Lebens bevor …«
Tom nickte zustimmend.
-Unternehmen Franky 1-
Indianerclaus kauerte still auf seinem Kissen. Wenn er überhaupt ein Geräusch von sich gab, dann einen seiner Wehmutsseufzer. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt, machte er einen Katzenbuckel. Tom rutschte nervös auf der Unterlage hin und her. Das Kissen in seinem Rücken schien sich in einen kalten Felsbrocken verwandelt zu haben, denn es war nicht mehr in der Lage, seinem Rückgrat Entspannung zu bieten.
Aber halt! Auf James’ Gesicht konnte man plötzlich eine deutliche Erleichterung bemerken. Die Stirn, die er die ganze Zeit über gerunzelt hatte und die ihn Jahre älter aussehen ließ, hatte sich mit einem Mal geglättet. Genau so, wie sich sein starrer Blick und die unbeweglichen Augen deutlich verändert hatten. Ein Ausdruck der Freude ging in seinem Gesicht auf wie die Sonne an einem klaren Frühlingstag. »Nun gut«, begann James, lauter als beabsichtigt, »ich habe mir etwas überlegt.«
Die Stille wurde so plötzlich durchbrochen, dass es Tom und Claus einen regelrechten Riss gab.
»Ist dir wirklich etwas eingefallen?«, lärmte Tom los.
»So ist es«, erwiderte James nicht ohne Stolz.
»Spann uns nicht auf die Folter!« Claus’ Augen glänzten vor Neugierde, und Tom rutschte ungeduldig auf der Decke hin und her.
James hob den Zeigefinger und blickte gönnerhaft in die beiden neugierigen Augenpaare. »Mal was anderes. Nicht das Übliche. Ihr kennt doch das Palais de la Frankenstein.« Er machte eine kurze Pause, um die Wichtigkeit seiner Worte zu unterstreichen. »Was haltet ihr davon, wenn wir eine Nacht darin verbringen?« Der Zustimmung sicher wartete James auf die Reaktion seiner beiden Freunde. Er forschte in ihren Gesichtern, blickte von einem zu andern. Aber nichts geschah.
»Das könnte lustig werden, oder?«, hakte er verhalten lächelnd nach. »Vor allem für dich, Claus. Wir wissen ja, dass du dich vor der Dunkelheit fürchtest.«
»Stimmt überhaupt nicht!«, verteidigte sich dieser empört. »Ich …«
Tom unterbrach ihn. »Wozu willst du eine Nacht in dieser alten Bruchbude hausen? Willst du dir Flöhe und Läuse holen?«
»Natürlich müssen wir uns entsprechend ausrüsten«, warf James ein. »Wir müssen die Sache genau planen. Und wir haben genügend Zeit alles zu durchdenken«, ergänzte er rasch.
»Schön und gut, aber was zum Teufel willst du eigentlich dort?« Tom wollte es genau wissen.
»Man sagt«, begann der Chefdenker zögernd, »dass sich dort allerhand seltsame Dinge abspielen sollen.«
»So? Sagt man das?«, gab Tom unbeeindruckt von sich.
Claus schwieg beharrlich.
James sah die beiden missmutig an. Sein Vorschlag hatte ganz und gar nicht den Anklang gefunden, den er sich erhofft hatte. Normalerweise wurden seine Einfälle mit lautem Hurra! gefeiert, aber diesmal?
Tom äugte zur Zimmerdecke hinauf und überlegte, während Indianerclaus unentwegt auf seine Füße starrte.
»Hat es euch die Sprache verschlagen? Wenn ihr von meiner Idee nicht begeistert seid, müsst ihr euch eben selbst was ausdenken.« Sollen sie sich doch einen anderen Chefdenker suchen, dachte er und war augenblicklich beleidigt. Mit grimmigem Gesicht und verschränkten Armen lehnte er steif an der Wand und sah zum Fenster hinaus. Um seine Enttäuschung abzureagieren, fing er an, die Blätter des jungen Kastanienbaumes zu zählen, dessen oberste Äste bis zur Mitte des Fensters reichten.
»Sei nicht eingeschnappt«, versuchte Tom die Sache wieder einzurenken.
»Eingeschnappt? Ha!«, protestierte James, ohne die Augen vom Fenster zu nehmen.
»Wer hat denn gesagt, dass uns deine Idee nicht gefällt?«, setzte Claus an. »Ich … ich finde den Vorschlag gar nicht so übel.« Er blickte zu Tom, dessen Gesicht ein zustimmendes Grinsen zeigte.
Im Nu war James der alte. Er wandte sich erleichtert von der Kastanie ab, und man konnte sehr deutlich sehen, wie bestätigt er sich in seiner Rolle fühlte.
»Ich habe gehört, dass es im alten Palais spuken soll«, begann Tom der Große.
»Ich denke«, sagte Claus, »wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Oder etwa nicht? Dazu braucht es knallharte Männer, wie wir es sind.«
Alle drei lachten erleichtert.
»Wir nennen es Unternehmen Franky 1!«
»Warum Franky 1?«, wollte Tom wissen.
»Ganz einfach«, erläuterte James. »Wenn uns die Sache gefällt, machen wir das Ganze einfach noch mal. Dann nennen wir es Unternehmen Franky 2.«
»Alles klar«, erwiderte Tom und Claus grinste über beide Ohren.
So hatten sie also doch eine Lösung gefunden. Je länger Tom der Große und Indianerclaus darüber nachdachten, desto mehr Gefallen fanden sie daran. Der Anfang der Sommerferien war gerettet.
Es gab allerdings ein winziges Problem, und das wussten die Freunde nur zu gut: Was würden ihre Eltern dazu sagen? Und wie sollten sie ihnen den Vorschlag schonend beibringen?
Das Hauptproblem lag natürlich weniger in der Tatsache, dass sie eine Nacht alleine fortbleiben wollten. Vielmehr war es der Ort, den sie sich als Nachtlager gewählt hatten. Der Bau war eine uralte, verfallene Villa, die seit vielen Jahren nicht mehr benutzt worden war. Zu dem Besitz gehörte ein parkähnlicher Garten, der sich bis weit hinter das Haus erstreckte. Die Eltern kannten das Palais aus ihrer eigenen Jugendzeit und wussten nur allzu gut, wie baufällig es inzwischen geworden war. Leicht konnte sich ein Stein aus dem Gemäuer lösen; leicht konnte eine Treppenstufe nachgeben oder sonst ein Unfall geschehen. Gute Gründe, den Ausflug zu verbieten, gab es allemal.
»Das kommt gar nicht in Frage!« So lautete tags darauf die einstimmige Antwort der Eltern. Wie immer die Jungs es anzustellen versuchten, sie blieben hart. Tom der Große erklärte sich bereit, im bevorstehenden Urlaub zumindest in der ersten Woche den Geschirrspüldienst zu übernehmen – was für ihn stets die übelste aller Hausarbeiten gewesen war. Indianerclaus versprach unter Eid, für die gesamten Ferien das Kriegsbeil zwischen ihm und seiner Schwester zu begraben. James unterbreitete seinen Eltern, dass er sich künftig bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Flötenonkel Cornelius am Riemen reißen wollte. Alles half nichts.
Nachdem eine friedliche Einigung nicht möglich war, schworen sie Rache: Tom verweigerte augenblicklich jegliche Mitarbeit bei sämtlichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Claus brach sogleich einen heftigen Streit mit seiner Schwester vom Zaun, und James vergrub die Blockflöte im Garten unter dem Holunderstrauch, wo er sie nie wieder hervorzuholen gedachte.
Nach einer mehrstündigen Krisensitzung am Abend waren sich die drei einig, ihr Vorhaben ohne die Zustimmung der Eltern zu verwirklichen. Da die diplomatische Vorgehensweise, ebenso wie die durchgeführten Sanktionen sie keinen einzigen Schritt weitergebracht hatten, half nur Meuterei.
Die nächsten zwei Tage waren für unsere Rebellen völlig ausgebucht. Es galt die nötige Ausrüstung zu besorgen, ohne aufzufallen. Sie hatten eine Liste zusammengestellt, die, in zwei Abschriften, jeder in der hinteren Hosentasche bei sich trug. Hinter den Gegenständen war entweder ein J, ein T oder ein I gekritzelt, je nachdem, wer was am leichtesten beschaffen konnte. Hinter drei Ausrüstungsgegenständen war ein großes Fragezeichen gemalt. Es waren dies der Campingkocher nebst Geschirr und eine Leuchte, von denen keiner der Freunde auf Anhieb wusste, woher sie sie kriegen sollten. Dennoch wuchs die Vorfreude von Stunde zu Stunde, wobei die Heimlichtuerei ihnen ganz besonderes Vergnügen bereitete. Die Jungs kamen sich vor wie die Hauptdarsteller in einem Kriminalfilm. Wie eine Schmugglerbande trafen sie sich, unter dem Siegel äußerster Verschwiegenheit, im aufgelassenen Steinbruch am Hohlen Hügel und beratschlagten den weiteren Verlauf der Operation.
*
Vier Tage waren vergangen, und die Vorbereitungen waren fast abgeschlossen. Selbst für die Dinge mit dem Fragezeichen hatte sich eine Lösung gefunden. Claus wusste Rat. Sein Opa Heiner hatte einen riesigen Vorrat an Sachen auf seinem Speicher, die sonst keiner mehr haben wollte. Alle Verwandten waren sich darüber einig, dass es bei ihm nicht mehr ganz stimmte. Schwamm drüber! Er würde es als Ehrensache ansehen, die Jungs zu unterstützen. So standen sie am Spätnachmittag voller Erwartungen vor seinem Gartentor.
»Bist du ganz sicher, dass hier irgendjemand wohnt?« James erschien dies äußerst zweifelhaft, denn das alte rostrote Stadthaus mit seinen vielen ehemals grünen Fensterläden, den zwei finster dreinblickenden Schleppgauben und dem verwilderten Vorgarten sah einsam und verlassen aus.
»Natürlich bin ich mir sicher«, erwiderte Claus und drückte den in mattem Messing gefassten Klingelknopf.
Einige Zeit geschah nichts. Alsdann sahen sie, wie sich eine der gelblichen Gardinen im Erdgeschoss bewegte.
»Der macht’s wieder spannend«, erklärte Indianerclaus. »Ihr müsst wissen, dass Opa Heiner sehr argwöhnisch ist. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer.«
»Vielleicht sollten wir wieder gehen. Die paar Sachen kriegen wir sicher woanders her«, warf Tom ein. Irgendwie fühlte er sich in seiner Haut nicht wohl. Die trüben Fenster des Hauses schienen auf ihn herunterzuglotzen.
James vergrub die Hände in den Hosentaschen, zuckte mit den Schultern und kippte von einem Bein auf das andere.
»Seht, da ist er schon!«, schrie Claus und nickte zur Haustür.
Ein alter Mann, in schwarzer Weste und brauner Cordhose, kam leicht gebeugt, aber dennoch behände, zum Gartentor geeilt. Misstrauisch musterte er mit seinen kleinen stahlblauen Augen die Freunde. Seine nach unten gekrümmte Nase gab ihm das Aussehen eines alten Raubvogels. Flink blickte er abwechselnd von einem zum anderen. »Was wollt ihr?«, krächzte er.
»Opa Heiner, pst!«, begann Claus leise, aber in wichtigem Tonfall zu sprechen. »Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Es geht um die Ausrüstung einer Expedition.«
»Expedition, soso«, wiederholte der Alte nachdenklich. Wieder sausten seine Augen zwischen den Jungen hin und her.
»Wir kommen in geheimer Mission, verstehst du? Keine Menschenseele darf davon erfahren«, fuhr Indianerclaus fort.
»Hm.« Er rieb sich mit seiner linken, knochigen Hand das Kinn. »Wenn das so ist, dann kommt rein. Aber schnell, der Feind kann überall lauern.« Opa Heiners Gesichtszüge spannten sich. Blitzschnell öffnete er das Gartentor, schob die drei an sich vorbei, kontrollierte vom Zaun aus in beiden Richtungen die Straße und spurtete er wie der Wind an den verdutzten Jungs vorbei zum Haus.
Tom und James blickten fragend zu Claus.
»Tja, das ist Opa Heiner«, lachte dieser.
Brav und still saßen Tom und James nebeneinander auf dem alten Kanapee und musterten den altmodisch eingerichteten Raum. Indianerclaus erklärte indes ihr Vorhaben. Die Augen des alten Mannes begannen bald zu leuchten. Als sein Enkel die benötigten Gegenstände aufzählte, sprang er hoch und rieb sich die Hände. »Euer Vorhaben ist genial«, sagte er geschäftig. »Ich sehe es selbstredend als große Ehre an, euch bei der Ergänzung der Ausrüstung behilflich zu sein. Kommt mit auf den Dachboden, Männer! Dort finden wir, was ihr braucht.« Schon eilte er aus dem Zimmer. Im Vorbeigehen schnappte er sich hastig einen der vielen groben Schlüssel, die aufgereiht an einem Holzbrett im Flur hingen, und keuchte die knarrende Treppe empor. Vor einer weiß lackierten Brettertür im ersten Stock machte er halt und drehte den mitgebrachten Schlüssel flink im Schloss herum. Eine steile Stiege kam dahinter zum Vorschein. Sie führte zum Speicher hinauf.
Unter dem Dach herrschte brütende Hitze. Nach wenigen Minuten stand allen der Schweiß auf der Stirn. Der Alte machte sich sogleich an dem riesigen Schrank zu schaffen, der an der Giebelwand thronte. Die beiden Türen weit geöffnet, kramte er aufgeregt im Inneren des Möbelstückes herum.
»Wir bleiben besser hier und warten«, flüsterte Claus. »Er hat es nicht gern, wenn jemand seine Sachen sieht. Besonders die Dinge in dem Schrank da hütet er wie einen Schatz.«
So sahen sie sich derweil auf dem Speicher um. Was es hier alles zu entdecken gäbe? Geheimnisvolle Dinge befanden sich unter den verstaubten Teppichen und Decken, mit denen alles fein säuberlich, geschützt vor Blicken und Schmutz, bedeckt war. Die kleinen Fenster der spitzen Dachgauben warfen harte Lichtkegel auf die Bodenbretter. Jedes noch so winzige Staubkorn wurde darin für kurze Zeit sichtbar. Die dicken Spinnweben vor den Fensterchen schimmerten wie Seide. Alle drei bekamen große Augen. Jeder stellte sich in diesem Moment die gleiche Frage: Wie würde es wohl erst im Palais aussehen?
Opa Heiner beendete abrupt seine Suche. Er warf die gefundenen Sachen in einen alten Karton, verschloss sehr gewissenhaft seinen Schrank und hastete damit zurück in die Stube. Erst dort zeigte er den neugierigen Freunden stolz die mitgebrachten Schätze. Der Alte hatte es sich in seinem Ohrensessel bequem gemacht. Über jedes der Dinge wusste er eine Geschichte zu erzählen. So erfuhren sie alles über den Spirituskocher und das Blechgeschirr, über die Petroleumlampe, und vor allem über die alte Armeemütze und den Feldstecher, die sie unbedingt mitnehmen mussten.
Als sich die Sonne tief über die Dächer beugte, verließen sie das rostrote Haus und Opa Heiner, der mehrmals hatte schwören müssen, wirklich niemandem von dem Plan zu erzählen.
Der ersehnten Durchführung stand nichts mehr im Wege.
-Die Nacht der Nächte-
Es war kurz vor dreiundzwanzig Uhr. Die Armbanduhr an James’ Handgelenk begann zu piepsen. Rasch sprang er aus dem Bett, turnte zum Kleiderschrank und kramte nach seiner ältesten Jeans sowie seinem ausgewaschenen Explorer-T-Shirt. Nachdem er sich angezogen hatte, holte er seinen Rucksack unter dem Bett hervor, ging zur Tür und löschte das Licht. Er musste verdammt leise sein, denn das Schlafzimmer seiner Eltern lag auf dem selben Flur. Allzu gern ließen sie die Tür offen stehen. Er schlich sachte auf Zehenspitzen den Gang entlang. An der Schlafzimmertür blieb er kurz stehen und lauschte. Es war nichts Verdächtiges zu hören. Beide schliefen tief und fest.
James hatte den ganzen Tag über ein schlechtes Gewissen geplagt: Wenn er an seiner Eltern dachte, wenn sie das Bett ihres Sohnes leer vorfinden würden ... Wenn sie sich Sorgen machten ... Wenn sein Vater mitten in der Nacht all die Eltern seiner Bekannten anrief, um seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen ... Wenn beide müde hinter dem Steuerrad ihres Wagens vergebens durch leere Straßen fuhren ... Wenn seine Mutter vor Kummer um sein Verschwinden Migräne bekam ... Wenn, wenn, wenn ... Fast war er so weit gewesen, alles im letzten Moment abzublasen, wäre ihm nur eine passende Alternative in den Sinn gekommen. Aber in seinem Kopf hatte nichts anderes mehr Platz. Das Abenteuer war zum Greifen nahe; zu nahe, als dass er einen Rückzieher hätte machen können.
James riss den Blick von seinen schlafenden Eltern los und schlich weiter. Gut die Hälfte des Weges hatte er hinter sich gebracht, als das schwerste Stück Arbeit bevor stand: die Holztreppe! Das Knarren der Bretter musste seine Eltern wecken. Wie ein Akrobat am Hochseil glitt er hinab. Dabei verstand er es sehr gut, sein Gewicht so zu verlagern, dass die verräterischen Geräusche ausblieben. Unten angekommen atmete er auf, schnappte sich im Flur ein paar Schuhe und eilte weiter in Richtung Küche. Dort setzte er sich auf einen Stuhl und zog sie an. Etwas Wurst und Käse sowie vier Semmeln ließ er in seinem Rucksack verschwinden. Schlussendlich öffnete er leise die Tür und trat mit bangem Herzen hinaus in die stille Nacht.
Von fern tönte Hundegebell, als er die leeren Gehsteige entlanglief. Die Straßenlaternen spendeten ihr gelbliches Licht, und der fahle Mond am Himmel war sein einziger Begleiter auf dem Weg durch leere Vorstadtstraßen. Ab und zu kreuzten Katzen seinen Weg. Sie liefen ihm zwischen den Füßen herum, warteten, bis er sie einige Meter hinter sich gelassen hatte, um kurz danach ihre Verfolgungsjagd von neuem zu beginnen. In der Siedlung gab es viele dieser kleinen Nachtjäger. Zu viele, denn in warmen Sommernächten hielten sie oft ein Konzert ab, das einem die Sinne rauben konnte.
James lief und lief und war bald am vereinbarten Treffpunkt angelangt. Hinter einer grünen Bank öffnete sich der Stadtpark. Er setzte sich hin und blickte um sich. Nicht weit entfernt befanden sich Schaukeln, eine Rutsche und ein Sandkasten. Am Weg standen vereinzelt Gaslaternen. Um die Glaskolben herum tummelten sich Scharen von Mücken und Nachtfaltern.
Ein schriller Pfiff durchdrang die Stille. James zuckte kurz zusammen, doch dann lachte er, denn fast hätte er Claus nicht erkannt. Er sah aus wie ein wandelnder Tramperrucksack. Tom trottete gemächlich neben her.
»Wie lange willst du wegbleiben? Zwei Wochen?«, spottete James.
»Wieso?« Claus nahm den Tornister ab und fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
Tom schmunzelte. »Unser Freund hat sich strikt auf das Wesentliche beschränkt.«
»Und ob ich das habe«, bekräftigte Indianerclaus und blickte fragend in die Gesichter der beiden anderen.
»Äh ... Wie lief es bei euch zu Hause. Hat jemand was gemerkt?« James wechselte rasch das Thema, denn ihm war gerade eingefallen, dass Claus einen Großteil der Ausrüstung trug, der für sie alle bestimmt war.
Tom und Claus berichteten kurz über ihre Flucht. Die Eltern der beiden hatten nichts mitbekommen. Das Abenteuer konnte somit beginnen. Der schwere Rucksack wechselte mehrmals auf dem Weg zum Palais seinen Träger. Als Claus dessen Gewicht zu Hause getestet hatte, war es ihm durchaus erträglich erschienen, doch jeder der ihn trug, spürte bereits nach wenigen Metern, wie unsichtbare Hände immer mehr Ballast zuluden. Alle drei waren spürbar erleichtert, als das Ziel endlich vor ihnen aus der Dunkelheit auftauchte.
Zu dem Besitz gehörte, wie erwähnt, ein parkähnlicher Garten, der sich weit bis hinter das Haus erstreckte. Drum herum zog sich eine längst baufällig gewordene Mauer, von der man annehmen konnte, ein scharfer Blick hätte genügt, sie gänzlich zum Einsturz zu bringen. Die Freunde, allen voran Claus mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken, verschafften sich durch eines der vielen Löcher Zutritt.
Der Garten sah wie ein dichter Urwald aus: Hohe Sträucher und alte Bäume, deren Äste im Mondlicht wie verkrüppelte Arme und Hände wirkten, begrüßten die Eindringlinge mit schauerlichem Wanken im lauen Sommerwind. Die Abenteurer kämpften sich vorsichtig durch dichte Hecken und Büsche vorwärts. Vorbei ging es an übergroßen Disteln, Pferdekümmel und wildwuchernden Rosentrieben. Der Garten schien kein Ende nehmen zu wollen. Von außen hatte das Ganze keineswegs unbegehbar ausgesehen. Auch die Entfernung zum Palais hatten sie um ein Vielfaches unterschätzt. Je weiter sie in das Gelände vordrangen, desto unwirklicher erschien ihnen die Umgebung. Fast dachten sie, eine unbekannte Macht hätte sie in ein fremdes Land entführt als Indianerclaus abrupt stehen blieb. Es wurde still. Nur das monotone Zirpen der Grillen, versteckt irgendwo im hohen Gras, und das Rufen der Käuzchen aus den mächtigen Bäumen war zu hören.
»Was ist?«, fragte Tom hektisch.
James sah nervös zu Indianerclaus. »Sag schon?«
»Möchte nicht mal einer von euch vorneweg gehen? Ich glaube … ich hab ‘nen Stein im Schuh«, klagte er.
»Ich glaube, dir ist eher das Herz in die Hose gerutscht«, entgegnete Tom spürbar erleichtert.
»Hast du etwa doch Angst im Dunkeln?«, setzte James munter hinzu.
»Blödmänner!«, verteidigte sich Claus. »Wie ihr wollt. Dann werde ich eben mit dem Stein im Schuh weiterlaufen. Aber wenn einer von euch vielleicht den Rucksack schleppen könnte …« Er ging weiter. Tom nahm schweigend den Tornister an sich.
Endlich waren sie am Haus angelangt. Sie stiegen die mit Moos bewachsenen steinernen Treppen des Eingangsportals empor und stoppten vor der schweren Tür. Sie war mit Eisenbeschlägen verziert. In Brusthöhe befand sich ein massiger Türklopfer in der Form eines Löwenkopfes. Selbst mit vereinten Kräften gelang es ihnen nicht, den Ring zu bewegen. Tom machte sich daraufhin an dem Türdrücker zu schaffen. Nach dem gescheiterten Versuch mit dem Klopfer erwartete er hier die gleichen Probleme. Aber der Drücker ließ sich beinahe ohne Widerstand bewegen. Nachdem sie sich gegen die übermannshohe Tür gelehnt hatten, öffnete sich diese wie von selbst. Mit leisem Keuchen schob sie sich nach innen. Sie meinten das Rieseln des Rostes zu vernehmen, der zwischen den alten Scharnieren wie Pulver herausbröselte. Während des Öffnens stieg ihnen übelster Modergeruch in die Nasen. Sie standen in der riesigen Eingangshalle und wagten kaum zu atmen, wohl aus Angst, den Staub vergangener Jahrzehnte in Aufruhr zu versetzen.
»Nun bräuchten wir etwas Licht«, flüsterte Tom.
»Kein Problem.« Claus kniete sich nieder und knotete die Petroleumlampe vom Rucksack los.
»Gib her«, bat James, der sein Feuerzeug bereits aus der Hosentasche gezogen hatte. Er wollte die nötige Flamme stiften, als ein plötzlicher scharfer Windzug durch den Raum fegte. Die Jungen blickten zur Eingangstür zurück und sahen, wie sich diese langsam und knarrend schloss. Als sie zuschlug, wurde es stockdunkel. Sie spürten, wie ihnen das Blut aus dem Kopf schoss und kalter Schweiß über die Rückenpartie kroch. Der Widerhall war übertrieben langanhaltend. Oder kam es ihnen nur so vor?
Keiner wagte zu atmen. Jeder war heilfroh, in der Dunkelheit das Gesicht des anderen nicht sehen zu müssen. Tom brach als erster das unangenehme Schweigen. »Hat einer von euch so was schon mal gehört?«
»Nö«, entgegnete James kleinlaut und setzte ein zweites Mal sein Feuerzeug in Gang. Endlich brannte die Lampe.
Von der Halle aus zweigten viele Türen ab. Vor ihren Augen führte eine sehr breite Treppe nach oben, deren Geländer kunstvoll mit in sich verschlungenen Schlangenleibern verziert war. Rechts daneben stand ein riesiger, vorsintflutlicher Heizkörper. Alles war umsponnen von nebligweiß schimmernden Spinnweben und einer nicht zu durchdringenden Schicht Staub. Der Boden unter ihren Füßen war mühsam aus kleinen Mosaiksteinen zusammengesetzt. In der Mitte des Raumes wurde in einem Kreis aus rötlichen Steinen ein Familienwappen sichtbar, welches stolz an den einstigen Glanz und die Macht der Bewohner erinnerte. Über ihren Köpfen hing drohend ein reich geschmückter Leuchter, dessen wahre Größe von unten nur zu schätzen war.
Langsam näherten sich die drei der Treppe. Indianerclaus konnte es nicht lassen, ständig hinter sich zu blicken, um sich zu vergewissern, dass wirklich niemand (oder nichts) sie verfolgte. James, der als erster einen Fuß auf den unteren Absatz setzte, schaffte es, den verspannten Bohlen ein wehklagendes Ächzen zu entlocken. Er stieg vorsichtig einige Stufen empor und die beiden anderen folgten. Die zurückbleibenden Fußabdrücke im Staub der Jahrzehnte sahen aus wie Spuren im Neuschnee.
Oben angelangt blickten sie in die Eingangshalle hinunter. Sie stellten sich vor, wie es wohl gewesen sein mochte, von hier aus Besuch zu empfangen. Wie graziös und mächtig! Dann wurde ihre Aufmerksamkeit von einer Tür gefesselt, die sich geradewegs vor ihnen aus dem schummrigen Dunkel abhob. Sie fiel ihnen besonders deshalb auf, weil die übrigen Durchgänge hier oben um einiges schmäler und niedriger waren. Sie hielten darauf zu und blieben kurz davor stehen. Claus drückte die Klinke und mit vorgehaltener Laterne spitzten sie neugierig in den dahinterliegenden Raum.
Rechts neben der Eingangstür thronte in der Mitte der Wand ein mächtiger Kamin. Im Halbkreis davor war der Fußboden mit Marmor ausgelegt. Das Holzparkett, an vielen Stellen von Feuchtigkeit und Fäulnis angegriffen, hatte kleine Wölbungen gebildet. In Nähe der Fenster waren etliche Tafeln herausgebrochen. Die meisten Scheiben waren längst kaputtgegangen; hier und da ragten drohend spitze Glaskeile in die Öffnungen hinein und gaben dem Ganzen das Aussehen von aufgerissenen, zähnefletschenden Schlünden. Ein verbliebener Gardinenfetzen hing von einer der alten Messingstangen herab. Er war zusammengestockt und von Motten zerfressen. Die Wände im Zimmer, ehemals mit teuren Stoffen versehen, boten ebenfalls ein klägliches Aussehen. Nur Reste waren übrig geblieben, und dazwischen hoben sich tiefschwarze, unförmige Flecken ab.
»Schimmelpilze, pah!«, ekelte es Tom, als er mit den Fingern über die Wand strich und seine Hand danach am Hosenbein abrieb.
»Wie gefällt es euch hier?«, fragte James.
Claus lachte. »Toll! Fast so gemütlich wie in einer leeren Konservendose.«
Trotz der Unbehaglichkeit, die dieser Raum ausstrahlte, beschlossen sie, hier ihr Lager aufzuschlagen. Indianerclaus begann seinen Rucksack zu entleeren. Ein Stück nach dem anderen tauchte auf: Am Sack, gut befestigt, befanden sich drei fein säuberlich zusammengerollte Luftmatratzen, die er vorsichtig ablöste und neben sich auf den Boden legte. Obenauf im Sack lag der dazugehörige Blasebalg, den er auf die Matratzen warf. Claus hängte sich den Feldstecher um und setzte die Mütze auf.
»Was hast du vor?«, fragte ihn James verwundert.
»Ich ernenne mich hiermit zum Lagerobersten. Also hört mir gut zu, Männer!«
Tom und James sahen einander verdutzt an. Claus hatte sich vom Boden erhoben und stand breitbeinig, die Hände am Rücken verschränkt, vor ihnen. »Zunächst müssen wir die Luftmatratzen aufpumpen. James, ich denke, du bist dafür der geeignete Mann. Tom, du säuberst die Zimmerecke, die hinter der Tür liegt. Damit haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite und halten uns obendrein einen Fluchtweg offen. Wenn du damit fertig bist, hilfst du James.«
»Scheint in der Familie zu liegen«, flüsterte James kichernd in Toms Ohr. Laut sagte er. »Und wofür teilt sich der Herr Oberst ein?«
»Ich«, erklärte Indianerclaus stolz, »werde mich um die Feldküche kümmern. Nach dem beschwerlichen Marsch brauchen die Männer etwas Warmes im Magen. Wer weiß, was uns in dieser Nacht bevorsteht?«
»Jawohl, Herr Oberst!«, salutierten die beiden.