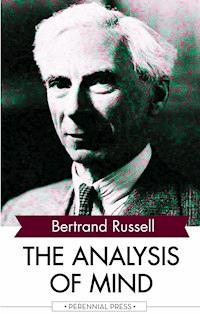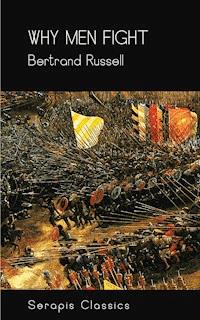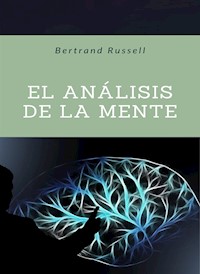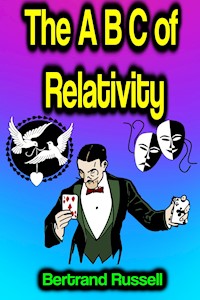11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch hat nicht nur »Glück« zu seinem Thema, sondern ist selber ein Glücksfall. Russell war einer der Begründer des »logischen Positivismus«, einer deren die maßgeblich daran beteiligt waren, Philosophie zum ersten Mal auf den neuesten Stand von Wissenschaft und Logik zu bringen. Aber er hat sich nicht gescheut, über die allzu eng gezogenen Grenzen von Wissenschaftlichkeit hinweg an eine alte Tradition der Philosophie anzuknüpfen: daß sie den Menschen in den praktischen Belangen ihres Lebens etwas zu sagen habe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bertrand Russell
Eroberung des Glücks
Neue Wege zu einer besseren Lebensgestaltung
Suhrkamp
Inhalt
Vorwort
Erster Teil Ursachen des Unglücks
1. Kapitel Was macht den Menschen unglücklich?
2. Kapitel Byronscher Weltschmerz
3. Kapitel Der Geist der Konkurrenz
4. Kapitel Langeweile und Anregung
5. Kapitel Müdigkeit
6. Kapitel Neid
7. Kapitel Schuldgefühle
8. Kapitel Verfolgungswahn
9. Kapitel Was wird die Welt dazu sagen?
Zweiter Teil Ursachen des Glücks
10. Kapitel Können wir noch glücklich sein?
11. Kapitel Lebensbejahung
12. Kapitel Zuneigung
13. Kapitel Familie und Ehe
14. Kapitel Arbeit
15. Kapitel Der Wert »unpersönlicher Interessen«
16. Kapitel Streben und Entsagung
17. Kapitel Der glückliche Mensch
Vorwort
Dieses Buch nimmt keinerlei besondere Bildung des Lesers zur Voraussetzung und richtet sich auch nicht an solche, die ein praktisches Problem nur als Unterhaltungsstoff betrachten. Weder tiefschürfende Philosophie noch imponierende Gelehrsamkeit wird man darin finden. Mein einziges Bestreben war die Zusammenstellung einer Reihe von Bemerkungen, die, wie ich hoffe, vom gesunden Menschenverstand eingegeben sind. Alles, was ich zugunsten der hier vorgelegten Rezepte zum Glück anführen kann, ist, daß sie meiner eigenen Erfahrung und Beobachtung entspringen und meinem eigenen Glück stets förderlich waren, wenn ich mich an sie hielt. Aus diesem Grunde wage ich zu hoffen, daß einige von den unzähligen Menschen, die ihr Unglück über sich ergehen lassen, ohne ihm etwas Gutes abgewinnen zu können, in den folgenden Blättern eine Diagnose ihres Zustandes finden werden und zugleich einige Anregungen, wie sie ihm entrinnen können. Denn in dem Glauben, daß viele, die unglücklich sind, glücklich werden könnten, wenn sie es nur richtig anzufangen verstünden, habe ich dieses Buch geschrieben.
Erster Teil Ursachen des Unglücks
Erstes Kapitel Was macht den Menschen unglücklich?
Tiere sind glücklich, solange sie gesund sind und nicht unter Futtermangel leiden. Auch den Menschen, so meint man, sollte es nicht anders gehen, wenigstens in den allermeisten Fällen. Doch wer unglücklich ist, wird sich heutzutage nicht als Ausnahme, sondern als einer von Unzähligen fühlen, wer glücklich ist, bei geringem Nachdenken feststellen, daß nicht viele unter seinen Freunden dasselbe von sich sagen können. Und haben wir unsern Bekanntenkreis an uns vorbeiziehen lassen, dann sollten wir die Kunst erlernen, auch in fremden Zügen zu lesen, empfänglich zu werden für die Stimmungen aller, mit denen unsere Tagesverrichtungen uns zusammenführen.
»Ein Mal in jedem Antlitz nehm’ ich wahr,
Ein Mal der Schwäche, Mal des Leids und Wehs« sagt Blake. So verschieden sich auch das Unglück gebärden mag, wir begegnen ihm überall. Nehmen wir einmal an, wir wären in New York, dieser typischen modernen Weltstadt, und stellten uns während der Arbeitsstunden an einer lebhaften Straßenecke oder am Wochenende an einer der großen Durchfahrtsstraßen auf, oder wir sähen bei einem abendlichen Tanzvergnügen zu. Unser eigenes Ich haben wir für den Augenblick völlig ausgeschaltet, um die Persönlichkeiten der Fremden nach der Reihe von uns Besitz ergreifen zu lassen. Da werden wir finden, daß jede von diesen verschiedenen Menschengruppen ihre besonderen Sorgen hat. Bei der Masse der Arbeitenden weist eine übermäßige Spannung der Gesichtszüge vielfach auf Angst, auch merken wir diesen Leuten an, daß sie an schlechter Verdauung leiden, für nichts außer für den Existenzkampf Interesse aufbringen, unfähig zu jeder spielerischen Leichtigkeit sind und in keiner Weise um ihre Mitmenschen wissen.
Auf der breiten Autostraße sehen wir am Wochenende, wie Männer und Frauen, von denen alle vermögend, manche sehr reich sind, ihrem Vergnügen nachjagen –, eine Jagd, die bei allen im gleichen Tempo vor sich geht, nämlich in dem des langsamsten Wagens der langen Reihe. Die Straße ist vor Autos nicht zu sehen und die Umgebung deshalb nicht, weil jeder Seitenblick sogleich einen Unfall nach sich ziehen würde; alle Autoinsassen haben nur den einen Wunsch, den andern Wagen vorzufahren, was bei der überfüllten Fahrbahn natürlich unmöglich ist; schweifen ihre Gedanken einmal von diesem Wunsche ab – bei denen, die nicht selber lenken, kommt das gelegentlich vor –, dann fühlen sie sich gleich maßlos angeödet, und über ihre Züge legt sich ein Ausdruck kleinlichen Mißvergnügens. Ab und zu einmal sieht man eine Wagenladung voll farbiger Ausflügler, bei denen es vergnügt zugeht; durch ihr formloses Benehmen erregt sie aber sogleich den allgemeinen Unwillen und fällt gewöhnlich, weil die Sache mit einem Zusammenstoß endet, der Polizei in die Hände: Lebensfreude an freien Tagen verträgt sich nun einmal nicht mit dem Gesetz.
Oder man sehe sich die Menschen während einer Abendgesellschaft an! Alle kommen sie mit dem festen Willen, sich zu amüsieren, mit derselben Art grimmiger Entschlußfestigkeit, die man zum Zahnarzt mitbringt. Da alle meinen, Trinken und Knutschen seien die Tore zum Lebensgenuß, betrinken sie sich so schnell wie möglich und mühen sich, die Antipathie, die ihnen ihr Partner nicht selten einflößt, zu unterdrücken. Nachdem gehörig gezecht worden ist, erfaßt die Männer dann heulendes Elend, und sie fangen an, darüber zu jammern, daß sie der Liebe ihrer Mütter unwürdig seien. Der einzige Erfolg der Trinkerei ist nämlich, daß sie Schuldgefühle freilegt, die der gesunde Menschenverstand in lichteren Augenblicken nicht aufkommen läßt.
Die Gründe für diese verschiedenen Arten von Unglück liegen teils in unserm Sozialsystem, teils an der seelischen Verfassung des einzelnen, die selbstverständlich wieder ihrerseits in hohem Grade ein Produkt des sozialen Systems ist. Bei anderer Gelegenheit habe ich mich über die sozialen Änderungen ausgesprochen, die nötig wären, um bessere Vorbedingungen für das menschliche Glück zu schaffen. In diesem Bande will ich nicht wieder auf die Abschaffung des Krieges, auf die wirtschaftliche Ausbeutung, auf die Erziehung in Grausamkeit und Angst zurückkommen. Ein Mittel zur Aufhebung der Kriege zu finden, ist zwar eine vitale Notwendigkeit unserer Kultur; kein solches Mittel aber hat Aussicht auf Erfolg, solange die Menschen so unglücklich sind, daß die gegenseitige Austilgung sie nicht so furchtbar dünkt wie der Zwang, dauernd das Licht des Tages zu ertragen. Auch der Armut muß ein Ende bereitet werden, sollen die Vorteile der Maschinenproduktion denen, die sie am nötigsten brauchen, in irgendeiner Weise zugute kommen; was aber nutzt es, alle reich zu machen, wenn auch die Reichen so jammervoll daran sind? Erziehung in Grausamkeit und Angst ist verwerflich; doch wer selbst der Sklave dieser Leidenschaft ist, wird sie auch als Erzieher weitergeben. Diese Betrachtungen führen uns zu dem Lebensproblem, vor das sich jeder einzelne gestellt sieht: Was kann der Mensch hier und jetzt als Mitglied unserer Gesellschaft, die an der Sehnsucht nach Besserem krankt, tun, um sich selbst ein Glück zu schaffen? Bei der Erörterung dieser Frage werde ich meine Aufmerksamkeit nur denjenigen zuwenden, die nicht Opfer einer hoffnungslosen äußeren Lage sind. Ich werde ein Einkommen voraussetzen, das ausreicht, um Nahrung und Obdach zu beschaffen, und einen Gesundheitszustand, der der gewöhnlichen körperlichen Betätigung nicht im Wege steht. Auch werde ich mich nicht mit den großen Katastrophen des Lebens befassen, wie etwa mit dem Verlust sämtlicher Kinder oder mit öffentlicher Entehrung. Zwar kann man auch darüber manches – und manches Wichtige – sagen, aber das liegt auf einer anderen Ebene, als ich sie jetzt beschreiten will. Augenblicklich kommt es mir darauf an, einen Ausweg aus dem gewöhnlichen Alltagsunglück zu finden, an dem die meisten Kulturmenschen kranken und das um so unerträglicher ist, als es keine deutlich erkennbare äußere Ursache hat und daher kaum heilbar scheint. Unglück solcher Art beruht, wie ich glaube, meist auf einer falschen Weltauffassung, falschen ethischen Begriffen und falschen Lebensgewohnheiten, die zur Vernichtung jener natürlichen Lebensfreudigkeit, jener Lust nach erreichbaren Freuden führen, von denen letzten Endes alles Menschenglück abhängt. Da all dies im Willensbereich des Individuums liegt, will ich zu zeigen versuchen, wie man es anders machen kann, um bei halbwegs annehmbaren äußeren Verhältnissen glücklich zu werden.
Vielleicht sind ein paar autobiographische Worte die beste Einführung in die Philosophie, die ich vertrete. Ich wurde nicht als ein glücklicher Mensch geboren. Als Kind hatte ich ein Lieblingslied, das so anfing: »Müde der Welt und mit meiner Sünde beladen …« Im Alter von fünf Jahren stellte ich die Betrachtung an, daß ich, falls ich siebzig Jahre alt würde, bisher nur den vierzehnten Teil meines Lebens hinter mir hätte, und ich empfand die meiner wartende lange Daseinsöde als beinahe unerträglich. Während meiner Jugendzeit war mir das Leben verhaßt, und ich spielte ständig mit dem Gedanken an Selbstmord, vor dem mich indessen der Wunsch bewahrte, mich weiter in der Mathematik zu vervollkommnen. Jetzt hingegen habe ich Freude am Leben; ja, ich könnte fast sagen, daß ich von Jahr zu Jahr mehr Freude daran gewinne. Das kommt teils, weil ich nun herausgefunden habe, welcher Art die Dinge sind, die ich am meisten begehre, und mir allmählich viele davon verschafft habe, teils weil ich gewisse Wunschobjekte – wie z. B. die Erlangung unbezweifelbaren Wissens über diesen oder jenen Gegenstand – zu meinem Vorteil als grundsätzlich unerreichbar fahren gelassen habe. Zum allergrößten Teil aber ist meine heutige Gemütsverfassung einer immer geringeren Beschäftigung mit mir selbst zu verdanken. Gleich vielen anderen, die wie ich auf eine puritanische Erziehung zurückblicken, war es mir Gewohnheit, über meine Sünden, Torheiten und Mängel nachzugrübeln. Ich erschien mir selbst – gewiß mit völligem Recht – als ein jammervolles Wesen. Allmählich lernte ich dann, mir und meinen Unzulänglichkeiten gegenüber gleichmütig zu bleiben; ich gelangte dahin, meine Aufmerksamkeit in wachsendem Maße äußeren Dingen zuzuwenden: den Zuständen in der Welt, verschiedenen Wissenszweigen, Menschen, für die ich Zuneigung empfand. Auch äußere Interessen tragen zwar ihre Leidensmöglichkeiten in sich: die Welt kann in Krieg versinken, Erkenntnis oft schwer zu erringen sein, Freunde können sterben. Doch Schmerzen dieser Art zerstören nicht wie jene, die dem Ekel am eignen Ich entspringen, den wesentlichen Gehalt des Daseins. Und jedes äußere Interesse belebt irgendeine Tätigkeit, die, solange es anhält, ein ausgezeichnetes Verhütungsmittel für die Langeweile ist. Ein Aufgehen in sich selbst dagegen verhilft zu keinerlei ersprießlicher Tätigkeit. Es vermag zur Abfassung eines Tagebuchs, zu einer psychoanalytischen Kur, vielleicht auch ins Kloster führen. Doch ein Mönch wird nicht glücklich sein, bevor das Einerlei seines Daseins ihm Vergessen der eigenen Seele gebracht hat. Das Glück, das er der Religion zuschreibt, könnte er auch als Straßenkehrer erlangt haben, wäre er gezwungen gewesen, einer zu sein und zu bleiben. Für die Unglücklichen, deren Selbstvertiefung zu fest eingewurzelt ist, um auf andere Art geheilt werden zu können, ist der einzige Weg zum Glück ein streng diszipliniertes Hinlenken des Geistes auf äußere Interessen.
Solch ein Aufgehen in sich selbst äußert sich ganz verschieden. Als drei besonders häufig vorkommende Typen wollen wir den Sünder, den Narzissten und den Größenwahnsinnigen unter die Lupe nehmen.
Wenn ich »Sünder« sage, meine ich nicht jemanden, der sündigt; denn das tut jeder oder keiner, je nachdem, wie man das Wort auffaßt. Ich meine vielmehr den Menschen, der sich in das Bewußtsein seiner Sündigkeit vergräbt. Ein solcher Mensch leidet unausgesetzt unter seiner eigenen Mißbilligung, die er, sofern er gläubig ist, als die Mißbilligung Gottes empfindet. Er hat ein Bild von sich, wie er sein zu sollen glaubt, und dieses Bild steht in ständigem Widerspruch zu seinem Wesen, wie er es sieht. Das Schuldgefühl eines Menschen, der in seinem bewußten Denken die auf den Knien seiner Mutter gelernten Grundsätze aufgegeben hat, mag tief in seinem Unterbewußtsein verschüttet liegen und nur im Alkoholrausch oder im Schlafe emportauchen. Doch auch schon das genügt oft, um ihm allen Geschmack am Leben zu nehmen. Im Grunde erkennt er noch immer alle die Verbote an, die ihm in der Kindheit eingeprägt wurden: Fluchen ist schlimm; Trinken ist schlimm; das übliche gerissene Geschäftsgebaren ist schlimm; vor allem aber ist der Geschlechtstrieb etwas Schlimmes. Natürlich enthält er sich darum nicht etwa dieser Dinge, doch sind sie ihm alle vergiftet durch das Gefühl, daß sie ihn erniedrigen. Das einzige, wonach ihn von ganzer Seele verlangt, ist das Gefühl, von seiner Mutter gehätschelt und belobt zu werden, wie es einst in der Kindheit geschah. Da ihm diese Freude nicht mehr zuteil werden kann, hat er das Gefühl, nun sei alles andere gleichgültig. Und da er sündigen muß, beschließt er, es wenigstens gründlich zu tun. Verliebt er sich, dann ersehnt er zwar mütterliche Zärtlichkeit, kann sie aber nicht entgegennehmen, weil er auf Grund des Mutterbildes für eine Frau, mit der er sexuelle Beziehungen hat, keine Achtung fühlt. So wird er in seiner Enttäuschung grausam, bereut dann seine Grausamkeit und beginnt von neuem die trostlose Runde von eingebildeter Sünde zu echten Gewissensbissen. Das ist der Seelenvorgang zahlreicher scheinbar hartgesottener Sünder. Sie werden irregeleitet durch ihr Verankertsein in einem unerreichbaren Objekt (Mutter oder Mutterersatz) in Verbindung mit einem lächerlichen Sittenkodex, der ihnen in früher Jugend eingeprägt worden ist. Lösung von der Tyrannei früherer Überzeugungen und Zuneigungen ist für diese Opfer der mütterlichen »Tugend« der erste Schritt dem Glück entgegen.
Der Narzißmus ist sozusagen das Gegenstück des ewigen Schuldgefühls; er besteht in der Gewohnheit, sich selbst zu bewundern und Bewunderung zu heischen. Bis zu einem gewissen Punkte ist das freilich normal und nicht weiter bedauerlich; zu weit getrieben wird es jedoch zu einem schweren Übel. Bei manchen Frauen, besonders bei reichen Damen der Gesellschaft, ist die Fähigkeit, Liebe zu empfinden, völlig eingetrocknet und an ihre Stelle der unbändige Wunsch getreten, alle Männer in sich verliebt zu machen. Sobald aber eine Frau dieser Art der Liebe eines Mannes sicher ist, hat sie keine Verwendung mehr für ihn. Das gleiche kommt, wenn auch weniger häufig, bei Männern vor; das klassische Beispiel dafür ist der Held der »Liaisons Dangereuses«. Wo die Eitelkeit dermaßen auf die Spitze getrieben wird, kommt kein echtes Gefühl für einen andern Menschen auf, und so kann auch die Liebe keine wahre Befriedigung bieten. Mit andern Interessen steht es noch schlimmer. Ein Narzisst kann z. B., gereizt durch die Bewunderung, die großen Malern gezollt wird, selbst anfangen, Malerei zu studieren; da die Kunst für ihn aber nur Mittel zum Zweck ist, wird ihn ihre Technik nie fesseln, und er vermag keinen Vorwurf anders zu sehen als in Beziehung zu sich selbst. Das Ergebnis ist Mißerfolg und Enttäuschung; denn statt die erhoffte Schmeichelei einzuheimsen, hat er sich lächerlich gemacht. Dasselbe trifft auf Schriftstellerinnen zu, die in ihren Romanheldinnen immer sich selbst idealisieren. Jeder wirkliche Erfolg in der Arbeit beruht auf einem echten Interesse am Material dieser Arbeit. Die Tragödie, die einen erfolgreichen Politiker nach dem andern befällt, besteht darin, daß allmählich an die Stelle des Gemeininteresses ihr Narzissmus tritt und die Aufgabe verdrängt, die ihnen obliegt. Wer nur für sich selbst Interesse hat, verdient keine Bewunderung und wird auch keine empfangen. Folglich hat der, dem es nur darauf ankommt, von der Welt bewundert zu werden, wenig Aussicht auf Erfolg. Und selbst wenn er ihn hat, wird er nicht ganz glücklich sein, da der menschliche Instinkt nie völlig egozentrisch ist und der Narzisst sich selbst genau so wie der von Schuldgefühlen Geplagte künstliche Grenzen setzt. Der primitive Mensch mag stolz gewesen sein, daß er ein guter Jäger war, sicherlich aber genoß er auch die Bewegtheit der Jagd an sich. Eitelkeit, die über einen gewissen Punkt hinausgeht, macht jedes Vergnügen an einer Tätigkeit um ihrer selbst willen zunichte und führt damit unweigerlich zu Verdrießlichkeit und Langeweile. Oftmals ist Mangel an Selbstvertrauen ihre Quelle; das Heil liegt in solchem Falle in dessen Stärkung. Das aber läßt sich nur durch befriedigende Betätigung im Dienste sachlicher Interessen zuwege bringen.
Der Größenwahnsinnige unterscheidet sich insofern vom Narzissten, als er weniger nach Anerkennung seines persönlichen Wesens als nach Macht strebt und lieber gefürchtet als geliebt sein will. Diesem Typus gehören viele Wahnsinnige und die meisten großen Männer der Geschichte an. Machtliebe ist gleich der Eitelkeit ein starkes Element der normalen Menschennatur und als solches nicht zu verwerfen; verderblich wird sie erst, wenn sie ausartet oder mit einem mangelhaften Wirklichkeitssinn verknüpft ist. Wo das geschieht, wird der Mensch unglücklich oder zum Narren oder beides. Der Irrsinnige, der sich für ein gekröntes Haupt hält, mag in einer Weise glücklich sein, doch ist es ein Glück, um das kein vernünftiger Mensch ihn beneiden würde. Alexander der Große war der Anlage nach nichts anderes als ein Wahnsinniger, wenn er auch durch seine hohen Gaben den Wahnsinnstraum zu verwirklichen vermochte. Doch gelang es ihm nicht, seinen eigenen Traum zu verwirklichen, der, je unerhörter Alexanders Erfolge waren, seine Ziele immer weiter hinausrückte; denn als offenbar wurde, daß er der größte Eroberer war, den die Erde je gesehen, ließ er verkünden, er sei ein Gott. War er glücklich? Seine Trunkenheit, seine wahnwitzigen Zornesausbrüche, seine Gleichgültigkeit gegen Frauen und sein Anspruch auf Göttlichkeit deuten darauf hin, daß er es nicht wahr. Es liegt keine letztliche Befriedigung in der Hochzüchtung eines einzelnen Elementes der menschlichen Natur auf Kosten aller üblichen, ebenso wenig wie in der Wertung der ganzen Welt als Rohstoff zur Verherrlichung des eigenen Ich. Gewöhnlich ist der Größenwahnsinnige, ob er nun wirklich irrsinnig oder scheinbar seiner Sinne mächtig ist, das Produkt irgendeiner unerhörten Erniedrigung. Napoleon litt in der Schule unter Minderwertigkeitsgefühlen seinen Kameraden gegenüber, die reiche Aristokratensöhne waren, während er selbst ein bedürftiger Stipendiat war. Als er den Emigranten die Rückkehr erlaubte, hatte er die Genugtuung, seine einstmaligen Schulgefährten sich vor ihm zur Erde neigen zu sehen. Ein armseliger Triumph! Dennoch gab er ihm den Wunsch ein, sich eine ähnliche Genugtuung auf Kosten des Zaren zu verschaffen, und das wiederum brachte ihn nach Sankt Helena. Da kein Mensch allmächtig ist, wird ein völlig von Machtliebe beherrschtes Leben früher oder später an unbesiegbaren Hindernissen scheitern. Die Erkenntnis, daß dem so ist, kann nur durch irgendeine Form des Irrsinns daran verhindert werden, zum Bewußtsein durchzudringen, was freilich nicht hindert, daß der Machthaber den in den Kerker werfen oder hinrichten lassen kann, der ihm die Augen zu öffnen sucht. So gehen politische und seelische Verdrängung Hand in Hand. Und wo eine seelische Verdrängung in ausgesprochener Weise stattfindet, kann wahres Glück nicht gedeihen. Macht, die in ihren Grenzen gehalten wird, kann viel zum Glück beitragen, als einziger Lebenszweck aber führt sie, wenn nicht äußerlich, so doch innerlich zum Unheil.
Vielfältig sind, wie jedem einleuchtet, die inneren Ursachen menschlichen Unglücks. Etwas aber haben alle gemein. Der typisch Unglückliche ist stets ein Mensch, der, in der Jugend um irgendeine normale Befriedigung betrogen, nun dieser besonderen Art der Befriedigung einen übertriebenen Wert beimißt und so seinem Leben eine einseitige Richtung gibt. Überdies legt er ein übermäßiges Gewicht auf die fertige Tat im Gegensatz zu dem mit ihr verknüpften Handeln. Es gibt jedoch noch eine weitere Stufe, die heutzutage sehr häufig ist. Es kann sich ein Mensch so von Grund aus hoffnungslos fühlen, daß er keinerlei Befriedigung mehr sucht, sondern nur noch Zerstreuung und Vergessen. Dann jagt er einzig dem »Vergnügen« nach. Mit andern Worten, er sucht sich das Leben dadurch erträglich zu machen, daß er sich selbst unlebendiger macht. Der Rausch z. B. ist ein zeitweiliger Selbstmord; das Glück, das er schenkt, ist rein negativer Art: ein augenblickliches Aussetzen des Unglücks. Narzissten und Größenwahnsinnige glauben aber wenigstens noch, daß ein Glück möglich ist, wenn sie auch falsche Mittel zu seiner Herbeiführung anwenden mögen; doch der Mann, der den Rausch in irgendeiner Form sucht, hat jede Hoffnung außer der auf Vergessen fahren lassen. Ihn muß man darum zu überzeugen suchen, daß Glück etwas Begehrenswertes ist. Wer unglücklich ist und wer schlecht schläft, pflegt sich dessen gern zu rühmen, das heißt, er macht es ähnlich wie der Fuchs mit den sauren Trauben; in solchem Falle muß ihm derjenige, der ihn heilen will, zeigen, wie er zu den Trauben kommen kann. Nur die wenigsten, so glaube ich, werden bewußt das Unglück wählen, wenn sie eine Möglichkeit sehen, glücklich zu sein. Ich leugne zwar nicht, daß es solche Menschen gibt; sie sind aber so sehr in der Minderzahl, daß sie kaum ins Gewicht fallen. Darum nehme ich ein für allemal an, daß der Leser lieber glücklich wäre als unglücklich. Ob ich ihm helfen kann, diesen Wunsch zu erfüllen, weiß ich nicht; der Versuch aber kann auf keinen Fall schaden.
Zweites Kapitel Byronscher Weltschmerz
Heutzutage wie in manchen vorangegangenen Perioden der Weltgeschichte herrscht die Ansicht vor, ein Mensch, der es zu einer gewissen Weltweisheit gebracht habe, sei damit aller Begeisterung früherer Zeiten auf den schalen Grund gekommen und darüber belehrt, daß das Leben nichts Lebenswertes mehr biete. Wer so denkt, ist unglücklich, zugleich aber auch stolz auf sein Unglück, da er es der Natur des Weltalls zuschreibt und als die einzige vernunftgemäße Einstellung für einen aufgeklärten Menschen betrachtet. Solcher Stolz auf eigenes Unglück erweckt bei unkomplizierten Naturen leicht Zweifel an dessen Echtheit; denn sie folgern, daß jemand, dem es Freude macht, sich unglücklich zu fühlen, es gar nicht wirklich sein kann. Das ist indes zu einfach geurteilt. Zwar liegt sicherlich ein gewisser Ausgleich in dem Gefühl der Überlegenheit und höheren Einsicht, das die derart an der Welt Leidenden haben, doch wiegt er nicht schwer genug, um für den Verlust einfacherer Freuden zu entschädigen. Persönlich glaube ich nicht, daß im Unglücklichsein irgendeine höhere Vernunft sich kundgibt. Der Weise wird gern so glücklich sein, wie die Verhältnisse es erlauben, und wenn er über einen gewissen Punkt hinaus aus der Betrachtung des Alls nur Leid zu schöpfen vermag, wird er sich etwas anderem zuwenden. Das zu beweisen, soll das gegenwärtige Kapitel dienen: ich möchte den Leser überzeugen, daß – was man auch einwenden möge – Vernunft kein Hindernis für Glück ist; ja mehr noch, ich bin überzeugt, daß diejenigen, die in aller Ehrlichkeit ihre Sorgen ihrer Weltanschauung zuschreiben, den Esel hinter den Karren spannen. Denn in Wirklichkeit steht es so, daß sie aus irgendeinem Grunde, den sie nicht erkennen, unglücklich sind und erst dadurch veranlaßt werden, vorwiegend bei den weniger erfreulichen Seiten der Welt, in der sie leben, zu verweilen.
Ein moderner Amerikaner, Joseph Krutch, hat diesem Standpunkt, den ich hier näher betrachten möchte, ein Buch mit dem Titel »The Modern Temper« (Das moderne Temperament) gewidmet; für die Generation unserer Großeltern wurde der gleiche Standpunkt von Byron, für alle Zeiten durch den Prediger Salomo vertreten. Krutch sagt: »Einer verlorenen Sache dienen wir, und das natürliche Weltall hat keinen Platz für uns, aber dennoch beklagen wir nicht, Menschen zu sein. Lieber als Mensch sterben, denn als Tier leben.« Byron singt:
Die Erde schenkt kein Glück so tief wie jenes, das sie nimmt, Wenn jungen Denkens Feuer im erkalteten Gefühle blaß verglimmt.
Und der Prediger Salomo drückt den gleichen Gedanken so aus:
Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben hatten;
Und der noch nicht ist, ist besser denn alle beide, und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht.
Diese drei Pessimisten kamen einer wie der andere zu ihrer düsteren Weltanschauung, nachdem sie die Freuden des Lebens einer Musterung unterworfen hatten. Krutch lebte in den intellektuellsten Kreisen New Yorks; Byron durchschwamm den Hellespont und hatte unzählige Liebesaffären; der Prediger Salomo huldigte bei der Wahrnehmung seines Vergnügens noch größerer Mannigfaltigkeit: er versuchte es mit dem Wein, er versuchte es mit der Musik, und zwar »jederlei Art«, er legte Teiche an, er hatte Knechte und Mägde und Diener, die in seinem Hause geboren waren. Doch trotz alledem verließ ihn seine Weisheit nicht. Trotz alledem erkannte er, daß alles eitel ist, selbst die Weisheit:
Und gab auch mein Herz darauf, daß ich erlernte Weisheit, und Torheit, und Klugheit. Ich ward aber gewahr, daß solches auch Mühe ist.
Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens; und wer viel lernen muß, der muß viel leiden.
Seine Weisheit scheint ihm ein Ärgernis gewesen zu sein; er machte vergebliche Versuche, sich ihrer zu entledigen:
Da dachte ich in meinem Herzen: Wohlan, ich will wohl leben, und gute Tage haben; aber siehe, das war auch eitel.
Allein seine Weisheit blieb ihm:
Da dachte ich in meinem Herzen: weil es dem Narren geht wie mir, warum habe ich denn nach Weisheit gestanden? Da dachte ich in meinem Herzen, daß solches auch eitel sei.
Darum verdroß mich das Leben; denn es gefiel mir übel, was unter der Sonne geschieht, daß es so gar eitel und Mühe ist.
Es ist ein Glück für die Schriftsteller, daß die Menschen nichts mehr von dem lesen, was vor langer Zeit geschrieben wurde, sonst würde gewiß mancher zu dem Schluß kommen, daß, wie es sich mit der Anlage von Teichen auch verhalten mag, das Schreiben neuer Bücher auf alle Fälle eitel ist. Denn wenn wir beweisen können, daß die Lehre des Predigers Salomo nicht die einzige ist, die dem Weisen offensteht, brauchen wir uns nicht viel mit den späteren Formen zu befassen, in die sich derselbe Gemütszustand ergossen hat. Bei einer Beweisführung dieser Art sollten wir aber wohl unterscheiden zwischen einer Gemütsstimmung und ihrem geistigen Ausdruck. Mit einer Stimmung ist nicht zu argumentieren; sie kann durch ein glückliches Ereignis oder durch eine Änderung unseres Körperbefindens beeinflußt werden, niemals aber durch Argumente. Ich kenne aus eigenster Erfahrung die Stimmung, in der man alles als eitel empfindet; wenn ich mich ihr entriß, so gewiß nicht kraft irgendeiner philosophischen Einsicht, sondern weil die dringende Notwendigkeit zu handeln an mich herantrat. Der Vater, dem sein Kind erkrankt, mag unglücklich sein, sicher aber wird er nicht das Gefühl haben, alles sei eitel; sondern er wird von der Empfindung beherrscht werden, daß für die Genesung des Kindes alles geschehen muß, einerlei, ob im menschlichen Dasein letztlich ein Wert liegt oder nicht. Ein Reicher mag – und wird sehr oft – fühlen, daß alles eitel ist, sollte er aber sein Vermögen verlieren, so wird er alsbald merken, daß seine nächste Mahlzeit keineswegs eitel ist. Wir haben es hier mit einem Gefühl zu tun, das einer zu leichten Befriedigung natürlicher Bedürfnisse entspringt. Das menschliche Tier ist gleich anderen Tieren auf ein gewisses Maß von Daseinskampf eingerichtet, und wenn jemand so reich ist, daß er all seinen Launen mühelos nachgeben kann, beraubt ihn das bloße Fehlen jeder Anstrengung eines wesentlichen Glückselementes. Wer sich jeden, auch den nebensächlichsten Wunsch erfüllen kann, schließt daraus, daß es nicht glücklich macht, zu erlangen, was man begehrt. Ist er von philosophischer Denkart, dann geht er so weit, zu folgern, das menschliche Leben sei nichts wert, da selbst derjenige sich unglücklich fühlt, der alles hat, was er will. Er vergißt nur, daß es unbedingt mit zum Glück gehört, manches, was man möchte, nicht zu haben.
So weit die Stimmung. Der Prediger Salomo bringt jedoch auch Vernunftgründe vor:
Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller.
Es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Man gedenkt nicht, wie es zuvor geraten ist.
Und mich verdroß alle meine Arbeit, die ich unter der Sonne hatte, daß ich dieselbe einem Menschen lassen müßte, der nach mir sein sollte.
Wollte man versuchen, diese Zeilen im Stil eines modernen Philosophen umzuschreiben, so würden sie etwa so lauten: Der Mensch bemüht sich unablässig, und die Materie ist in unablässiger Bewegung, und dennoch ist nichts von Bestand, obwohl das, was nachkommt, sich in keiner Weise von dem unterscheidet, was gewesen ist. Der Mensch stirbt und sein Erbe erntet die Frucht seiner Mühen; die Ströme fließen ins Meer, ihre Wasser aber bleiben nicht ewig darin. Wieder und wieder treten in endlosem, zwecklosem Kreislauf Menschen und Dinge ans Tageslicht und gehen dahin ohne Veredelung, ohne dauernde Vollendung, Tag um Tag und Jahr um Jahr. Die Ströme, hätten sie Vernunft, würden bleiben, wo sie sind. Salomo, hätte er Weisheit, würde nicht Obstbäume pflanzen, deren Früchte sein Sohn einst genießen wird.
Doch wie verschieden sieht dies alles in einer anderen Stimmung aus! Nichts Neues unter der Sonne? Und die Wolkenkratzer, die Flugzeuge, die politischen Reden im Rundfunk? Was wußte Salomo[1] von alledem? Würde er bei seinen unnützen Bäumen und Teichen nicht Tröstung gefunden haben, wenn er im Radio die Ansprache der Königin von Saba an ihre Untertanen gehört hätte, als sie aus seinen Ländern zurückkehrte? Wäre er in einem Zeitungsausschnittbüro abonniert gewesen und hätte immer gleich erfahren, was die Presse über die Schönheit seiner Bauten, die Ausstattung seines Harems und den Ärger zu berichten wußte, der er durch Auseinandersetzungen mit seinen Konkurrenten in der Weltweisheit hatte – ob er dann wohl noch behauptet hätte, es gäbe nichts Neues unter der Sonne? Vielleicht, daß ihn auch dies von seinem Pessimismus nicht ganz geheilt haben würde; immerhin aber hätte er einen neuen Ausdruck dafür finden müssen. Mr. Krutch für sein Teil wiederum beklagte sich just über die vielen neuen Dinge unter der Sonne. Wenn aber das Fehlen von Neuerungen ebenso sehr Anlaß zum Ärger gibt wie ihr Vorhandensein, dann wird beides doch kaum die wirkliche Ursache des Lebensüberdrusses sein. Oder nehmen wir den Umstand, daß »alle Wasser ins Meer laufen, doch wird das Meer nicht voller, denn von wannen sie kommen, dorthin sollen sie auch zurückkehren«. Als Grund zum Pessimismus gewertet, führt das etwa zu der Ansicht, das Reisen sei etwas Unangenehmes, weil die Menschen, die im Sommer in die Kurorte gehen, dann wieder an den Ort zurückkehren, von dem sie kamen. Beweist das aber, daß es unnütz ist, im Sommer Erholung zu suchen? Wären die Gewässer mit Empfindung begabt, so würden sie sich vermutlich ihres abenteuerlichen Kreislaufs nach Art von Shelleys »Wolke« herzlich erfreuen. Und was die ärgerliche Notwendigkeit betrifft, daß unser Besitz nach unserem Tode unsern Erben anheimfällt, so hat auch sie zwei Seiten: vom Standpunkt der Erben aus ist sie ganz gewiß weniger schmerzlich. Ebenso wenig bietet die Tatsache, daß alles vergeht, an sich Anlaß zum Pessimismus. Wenn das, was folgt, schlechter ist, dann vielleicht ja, ist es aber besser, so hat man im Gegenteil Ursache zum Optimismus. Was jedoch sollen wir denken, wenn stets völlig gleichartige Dinge einander ablösen? Macht das nicht den ganzen Vorgang hinfällig? Nein, sicherlich nicht, sofern nicht die einzelnen Stadien des Kreislaufs an sich schmerzbetont sind. Die Gewohnheit, in die Zukunft zu blicken mit dem Gedanken, daß die Bedeutung der Gegenwart einzig in dem beschlossen liegt, was sie hervorbringen wird, ist durchaus von Übel. Das Ganze kann keinen Wert haben, wenn nicht die einzelnen Teile auch Wert haben. Das Leben läßt sich nicht nach Art eines Melodramas auffassen, in dessen Verlauf Held und Heldin unermeßliche Mißgeschicke durchmachen, für die sie zum Schluß durch ein Happy-End belohnt werden. Ich lebe und habe meinen Tag, mein Sohn folgt auf mich und hat seinen Tag, und auf ihn folgt wiederum sein Sohn. Warum aus alledem ein Trauerspiel machen? Im Gegenteil – wenn ich ewig lebte, würden sicherlich die Freuden des Lebens schließlich ihren Reiz verlieren. So aber behalten sie ihre ganze Frische.
»Ich wärmte mir die Hände an des Lebens Feuer,
Nun es verlischt, geh ich willig von hinnen«,
heißt es im Lied. Diese Lebensauffassung steht genau so gut mit der Vernunft im Einklang wie jene andere, die sich mit dem Tod nicht abfinden mag. Hingen demnach Stimmungen von vernunftgemäßen Erwägungen ab, so wäre genau soviel Grund zum Frohsinn wie zur Verzweiflung.
Der Prediger Salomo hat eine tragische Note; in Krutchs »Modern Temper« liegt etwas Ergreifendes; denn Krutch trauert im Grunde dem Schwinden der alten mittelalterlichen – und auch einiger modernerer – Gewißheiten nach. »Betrachten wir die gegenwärtige unselige Zeit«, schreibt er, »in der noch die Gespenster einer versunkenen Welt spuken, ohne daß sie in sich selbst schon gefestigt wäre, so erkennen wir, daß ihre mißliche Lage nicht unähnlich der eines Jünglings ist, der noch nicht gelernt hat, sich ohne Zurückgreifen auf die Mythologie zurechtzufinden, die den Schauplatz seiner Kindheit bildete.« Diese Feststellung trifft völlig auf eine gewisse Gruppe von Intellektuellen zu, nämlich auf diejenigen, die infolge ihrer literarischen Erziehung von der heutigen Welt nichts wissen und, weil sie in ihrer Jugend gelehrt wurden, für ihren Glauben eine gefühlsmäßige Grundlage zu fordern, diesen infantilen Wunsch nach Sicherheit und Beschütztheit, dem die Welt der Wissenschaft nicht Folge geben kann, nicht abzulegen vermögen. Krutch ist, wie die meisten literarisch Gerichteten, von der Vorstellung besessen, daß die Wissenschaft nicht gehalten hat, was sie versprach. Er sagt uns freilich nicht, worin diese Versprechungen bestanden, doch scheint er zu meinen, daß vor sechzig Jahren Männer wie Darwin und Huxley von der Wissenschaft etwas erwarteten, was dann nie von ihr geleistet wurde. Das halte ich für einen völligen Wahn, genährt von jenen Schriftstellern und Theologen, die verhindern wollen, daß ihr Spezialfach an Ansehen verliert. Daß die Welt gegenwärtig viele Pessimisten aufweist, ist wahr. Es gibt immer viele Pessimisten in Zeiten, wo es viele Leute mit verkürztem Einkommen gibt. Krutch ist allerdings Amerikaner, und die amerikanischen Einkünfte sind im allgemeinen durch den Krieg gestiegen, allein auf dem