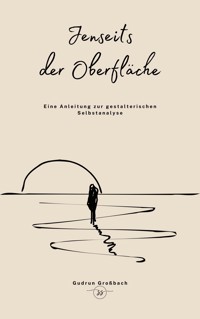Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Warum folgen wir manchmal Pfaden, die uns selbst überraschen? Jeder von uns trägt eine Sammlung von persönlichen Geschichten in sich, die wir als "Selbstgeschichten" bezeichnen können. Sie verankern in uns ein grundlegendes Lebensgefühl, das uns ständig begleiten und unbewusst als Lotsen lenken kann. Selbstgeschichten ohne Führung haben keine klare Richtung und können sich in einer chaotischen Mixtur zeigen. Sie sind in diesem Fall weder effizient noch harmonisch. Dieses Buch ist ein optimaler Begleiter für alle, die die zentrale Welt der Selbstgeschichten in der Psychologie kennenlernen wollen. Mit klaren, zugänglichen Erklärungen und praktischen Übungen führt dieses Buch dich durch den Prozess der Erkundung deiner Selbstgeschichten. Es lehrt dich, wie du diese Geschichten als Werkzeuge für deine Emotionen und Gedanken nutzen kannst. Es zeigt dir, wie du deine Selbstgeschichten erkennen, verstehen und sogar neu schreiben kannst. Egal, ob du aktiv an dir arbeiten oder dich einfach nur vom Konzept der Selbstgeschichten inspirieren lassen willst – das Buch bietet dir nützliche Einsichten und praktische Werkzeuge für beide Zwecke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage, Mai 2023
© Gudrun Großbach – alle Rechte vorbehalten.
Waldblick 24, 46509 Xanten
Zur Autorin:
In ihrer freien Praxis in Xanten bietet Gudrun Großbach eine spezielle Psychotherapie an - die Analyse und Gestaltung von Selbstgeschichten. Selbstgeschichten, auch bekannt als innere Geschichten oder Self-Storytelling, sind ein wichtiger Bestandteil der kognitiven Verhaltenstherapie und narrativen Psychologie.
In diesem Buch erhältst du nützliche Einblicke in die Möglichkeiten von Selbstgeschichten - und Gudrun Großbach erklärt dir lebhaft und fachkundig, warum wir unsere Gedanken und Gefühle zu Selbstgeschichten verweben. Sie zeigt dir, wie diese Geschichten uns manchmal hindern oder belasten und wie wir sie analysieren können, um sie emotional und gedanklich umzugestalten.
Gudrun Großbach schreibt schon seit Jahren psychotherapeutische Ratgeber und Handbücher für ihre Klienten und Patienten. Lass dich auf die vertrauensvolle Reise ein, auf die sie dich mitnehmen wird.
Über das Buch:
Warum folgen wir manchmal Pfaden, die uns selbst überraschen?
Jeder von uns trägt eine Sammlung von persönlichen Geschichten in sich, die wir als "Selbstgeschichten" bezeichnen können. Sie verankern in uns innere Botschaften, die uns ständig begleiten und unbewusst als Lotsen lenken.
Selbstgeschichten ohne Führung haben keine klare Richtung und können sich in einer chaotischen Mixtur zeigen. Sie sind in diesem Fall weder effizient noch harmonisch.
Dieses Buch ist ein optimaler Begleiter für alle, die die zentrale Welt der Selbstgeschichten in der Psychologie kennenlernen wollen.
Mit klaren, zugänglichen Erklärungen und praktischen Übungen führt dieses Buch dich durch den Prozess der Erkundung deiner Selbstgeschichten. Es lehrt dich, wie du diese Geschichten als Werkzeuge für deine Emotionen und Gedanken nutzen kannst. Es zeigt dir, wie du deine Selbstgeschichten erkennen, verstehen und sogar neu schreiben kannst.
Egal, ob du aktiv an dir arbeiten oder dich einfach nur vom Konzept der Selbstgeschichten inspirieren lassen willst – das Buch bietet dir nützliche Einsichten und praktische Werkzeuge für beide Zwecke.
________________________________
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die männliche Form aus Gründen der Lesbarkeit und Kürze verwendet habe. Es ist jedoch ausdrücklich anzumerken, dass alle Geschlechter angesprochen sind und meine Aussagen für Frauen, Männer und Menschen aller Geschlechter gleichermaßen relevant sind. Es ist mir ein Anliegen, in meinen Formulierungen eine inklusive und respektvolle Sprache zu verwenden, die niemanden ausschließt oder diskriminiert.
Erstens kommt es anders, und zweitens als man lenkt
Die innere Erzählung als Lotse - Selbstgeschichten in der Psychologie
Gudrun Großbach
Inhaltsverzeichnis
Vorwort2
Einleitung3
Einführung6
Erster Akt14
Zweiter Akt23
Gefühlswelten82
Zwischen zwei Stühlen – Ambivalenzen118
Bis die Wut uns beherrscht – Aggressionen131
Die Angst als ständiger Begleiter142
Wenn die Grenzen überschritten werden165
Der Einfluss des emotionalen Stils auf Beziehungen und Lebensqualität187
Der Blick von außen – Wahrnehmung197
Der Blick von innen – Selbstwahrnehmung207
Eine Frage der Haltung – Grundeinstellung214
Beziehungen im Wandel221
Die Kunst der Kommunikation238
Die unsichtbaren Ketten von Gedanken, Grübeln, inneren Dialogen253
Selbstfürsorge als lebenslanger Prozess273
Auf dem Weg zur Ich-Stärke283
Der Kampf um die Aufmerksamkeit301
Die Dualität vom Ich – Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich313
Das Rätsel lösen – Aufklärer323
Schlusswort329
Haftungsausschluss
Die Autorin dieses Buches veröffentlicht die darin enthaltenen Aussagen, Ratschläge, Verfahren und sonstigen Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist ausgeschlossen, dass Ansprüche auf Ersatz bei jeglichem mittelbaren und unmittelbaren Schaden an die Autorin gestellt werden können, da das Buch keine Anleitung zur Selbsttherapie bietet. Die Aussagen der Autorin erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und dienen lediglich der Information. Im Einzelfall müssen sie individuell angepasst werden. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Buch keine ärztliche, psychologische oder psychotherapeutische Behandlung ersetzen kann.
Vorwort
Unser Gehirn ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Es kreiert unwillkürlich und im Bruchteil von Sekunden Selbstgeschichten. Unser Gehirn verknüpft sofort unsere Gedanken und Gefühle mit bereits bekannten Selbstgeschichten. Sie sind wie innere Textgrundlagen, die zu jeder bewussten und unbewussten Wahrnehmung den ganz individuellen richtigen Text finden. Dies geschieht meist unbewusst und automatisch. Es ist, als würde unser Gehirn in seiner riesigen Bibliothek von Selbstgeschichten nach einer passenden Geschichte suchen, das zu dem passt, dass wir gerade wahrnehmen.
Daher sind Selbstgeschichten das beste Analysetool, was wir haben.
Unsere Selbstgeschichten und wie sie analysiert werden, können auf den ersten Blick komplex erscheinen. Für viele von uns mag es nicht sofort klar sein, was sie wirklich bedeuten und welchen Einfluss sie auf unser Leben haben können.
Einleitung
Ein Gespräch zu Beginn einer Beratung zwischen einem Psychologen und seinem Klienten, in dem das Konzept und das Arbeiten mit Selbstgeschichten lebensnah vorgestellt werden:
Psychologe: Hallo, Herr Müller. Was kann ich heute für Sie tun?
Klient: Hallo. Ich habe gehört, dass Sie Menschen helfen, ihre inneren Erzählungen zu hören, zu analysieren und zu verändern. Aber ich muss gestehen, ich verstehe das ganze Gerede über "Selbstgeschichten" nicht wirklich. Kennen Sie sich damit aus?
Psychologe: Ja, wir können darüber sprechen. Nun, Selbstgeschichten sind innere und sehr persönliche Erzählungen, die wir alle in uns tragen, die wir alle im Laufe unseres Lebens über uns selbst, andere und unsere Umwelt formen und uns ständig innerlich erzählen. Sie beeinflussen, wie wir die Welt sehen und uns selbst in ihr positionieren.
Klient: Ich bin mit der Regel aufgewachsen, dass Geschichten Lügen sind. Mir wurde immer gesagt, ich solle keine Geschichten formulieren und schon gar nicht erzählen, weil sie falsch und lächerlich sind. Warum sollte ich jetzt versuchen, Selbstgeschichten in meinem Kopf wahrzunehmen, zu analysieren und zu verändern?
Psychologe: Das tut mir leid, zu hören. Betrachten Sie es bitte so: Selbstgeschichten sind nicht unbedingt „Geschichten erzählen“ im Sinne von lustvollen Unterhaltungen zur Abkehr von der wunschlosen Realität oder wahnhaften Störungen usw.. Es sind eher die Interpretationen des Gehirns auf unsere Wahrnehmungen durch die Kombination von Gedanken und Gefühlen. Das menschliche Gehirn arbeitet so. Diese inneren Erzählungen haben nur die Aufgabe, einen ganzheitlichen Sinn und Zweck herauszuarbeiten.
Klient: Also sind es keine Arten von Wahn oder Halluzinationen?
Psychologe: Nein, keineswegs. Sie helfen uns, unsere Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft zu verstehen.
Klient: Aber warum sollte ich meine inneren Geschichten aus Text, Ton und Bild überhaupt beachten?
Psychologe: Weil sie Einfluss darauf haben, wie Sie sich selbst sehen, wie Sie andere sehen und wie sie mit anderen und Ihrer Umwelt interagieren. Selbstgeschichten ohne Führung haben keine klare Richtung und können sich in einer chaotischen Mixtur zeigen. Sie sind in diesem Fall psychisch und mental weder effizient noch gesund.
Klient: Es ist schwierig für mich, das zu akzeptieren. Mir wurde immer gesagt, innere Geschichten, Töne und Bilder seien etwas Krankes.
Psychologe: Das macht mich traurig. Aber lassen Sie uns langsam vorgehen. Vielleicht können wir anfangen, indem Sie zunächst lernen, Ihre Selbstgeschichten wahrzunehmen. Im nächsten Schritt könnten wir sie analysieren und dann verändern. Sie stellen sich die Fragen: Was formuliere ich über mich und andere? Was erzähle ich mir selbst? Unser Gehirn verknüpft jeden Gedanken, also auch Fakten und Erfahrungen mit den dazugehörigen Gefühlen zu einer zusammenhängenden Selbstgeschichte. Diese Selbsterzählung beeinflusst uns dann mit ihren enthaltenen Botschaften.
Klient: Ich bin unsicher, aber ich bin bereit, es zu versuchen. Aber was, wenn ich nicht mag, was ich entdecke?
Psychologe: Ich verstehe Ihre Bedenken. Das ist möglich, aber diese Entdeckung ist der erste Schritt zur Veränderung. Es geht darum, sich selbst und seine Rollen zu verstehen, um zu wissen, wer wir sind und wie wir sein möchten. Dazu müssen wir die Selbstgeschichten verändern.
Klient: Ich werde darüber nachdenken. Es ist alles so neu und anders für mich.
Psychologe: Das ist völlig in Ordnung. Ich verstehe, dass nicht nur das Konzept und die Arbeit mit seinen Selbstgeschichten schwer zu begreifen ist, sondern auch Scheu verursacht.
Klient: In den folgenden Wochen begann Herr Müller, sich seiner Geschichten bewusst zu werden. Er bemerkte, wie oft er sich als Opfer und andere als Täter, ansonsten als getarnte Retter, in seinen Selbstgeschichten formulierte und wie diese Sichtweise sein Leben beeinflusste: Er hat Angst, Schwäche zu zeigen. Deswegen hält er immer Distanz zu den Menschen.
Einführung
Gespür und Verständnis für die Selbstgeschichten
Konzept der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis
Veränderungen in den Selbstgeschichten und ihr Nutzen
Wirkungen des Erforschens der eigenen Selbstgeschichten
Verständnis und Einschätzung der verbalisierten Selbstgeschichten anderer
Reflexion und Ergründen dienen als Instrumente, um persönliche Veränderungen und Wachstum zu fördern
Unsere Selbstgeschichten sind tief in unserem Unterbewusstsein verankert und entziehen sich oft unserer bewussten Wahrnehmung. Sie sind persönlich und intim.
Unsere Selbstgeschichten entstehen aus Gedanken und Gefühlen, geformt durch Lebenserfahrungen, Überzeugungen und Werte. Sie sind die Erzählungen, die wir aus Fakten und Fiktionen über uns selbst, über andere Menschen und die Welt um uns herum konstruieren. Sie beeinflussen, wie wir uns selbst sehen und lieben, wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Sie können uns stärken oder einschränken, uns inspirieren oder ängstigen.
Das Wahrnehmen unserer Selbstgeschichten kann uns helfen, uns selbst besser zu verstehen und zu lieben. Indem wir lernen, auf dieses Flüstern zu hören und es zu deuten, können wir die verborgenen Muster und Dynamiken in unserem Leben umschreiben. Wir können verstehen, warum wir uns in bestimmten Situationen so fühlen, wie wir uns fühlen, warum wir so handeln, wie wir handeln, und welche tief verankerten Überzeugungen und Werte unsere Entscheidungen beeinflussen.
Es gibt Phasen, in denen bestimmte Selbstgeschichten uns besonders fordern oder uns zu schaffen machen: Sie sind geprägt von Selbstzweifel, Kritik und negativen Überzeugungen. In diesen Momenten sind wir dazu eingeladen, genauer hinzusehen und uns mit diesen Themen wohlwollend auseinanderzusetzen. Im Laufe unserer Reise bemerken wir vielleicht, dass bestimmte Themen oder Muster immer wieder in unseren Geschichten auftauchen, als ob sie uns etwas Wichtiges sagen möchten. Es geht darum, mit diesen wiederkehrenden Themen zu interagieren und sie zu erkennen. Vielleicht entdecken wir sogar spezifische Wege, um sie zu bewältigen, sie zu akzeptieren oder auf eine Weise in unsere persönlichen Erzählungen zu integrieren, die uns hilft, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen.
In den Selbstgeschichten begegnest du Emotionen, Erinnerungen und Gedanken. Es gibt Geschichten, die von Kraft und Mut zeugen. Sie sind wie helle Sterne, die dich daran erinnern, welche Kämpfe du gewonnen hast und welche Erfolge du gefeiert hast. Diese Erfahrungen sind dein innerer Kompass, sie geben dir Mut und Zuversicht, selbst wenn der Weg holprig ist. Sie treiben dich an, dranzubleiben und an dich selbst zu glauben.
Aber nicht alle deine Geschichten sind gefüllt mit Licht. Einige enthalten alte Wunden, Narben und Erinnerungen an vergangene Schmerzen und Enttäuschungen, die wie dunkle Wolken über deinem Ich hängen. Es schmerzt manchmal, die unbewussten Selbstgeschichten aufzudecken.
Und dann gibt es die Selbstgeschichten, die weniger schmeichelhafte Teile deines Charakters enthüllen. In ihnen spiegeln sich verachtende, verärgernde, verängstigende, abwertende Worte und selbstzerstörerische Handlungen.
Innerhalb deiner Selbstgeschichten entdeckst du deine Ängste und die Trigger, die diese verstärken, wie etwa das stetige Erzählen negativer Geschichten über dich oder eine übermäßige Konzentration auf Gefahren. Indem du diese Selbstgeschichten bewusst änderst, kannst du Ängste reduzieren und einen inneren Frieden erreichen.
Was depressive Stimmungen betrifft, so erweist sich das sorgfältige Analysieren der Selbstgeschichten als unschätzbar wertvoll. Du hast die Möglichkeit, die düsteren Teile, die zu deinem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Wertlosigkeit beitragen, zu erkennen. Du kannst lernen, wie du diese Teile in deinen Geschichten verändern und damit deine Stimmung aufhellen kannst. Eine positivere Sichtweise auf dein Leben und dich selbst kann ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.
Doch die Selbstgeschichten sind nicht unser Schicksal. Sie sind anpassungsfähig und veränderbar. Die Analyse und bewusste Veränderung unserer Selbstgeschichten kann eine mächtige Praxis sein, um zu mehr Selbstwirksamkeit zu gelangen. Es ist wie das Umschreiben eines alten Romans – wir können die Protagonisten neu gestalten, den Plot verändern, ein anderes Ende schreiben. In diesem Prozess entdecken wir, dass wir Autoren unserer eigenen Selbstgeschichten sind. Und als Autoren haben wir die Macht, uns in unseren Selbstgeschichten wertzuschätzen, unabhängig von äußeren Umständen. Indem wir uns in unseren Selbstgeschichten erlauben, mit Mitgefühl und Akzeptanz auf unsere Schwächen und Fehler zu blicken, statt sie zu verleugnen oder zu verurteilen, wächst die Selbstwirksamkeit. Statt uns selbst in unseren Selbstgeschichten zu kritisieren, lernen wir, uns in unseren inneren Geschichten zu trösten und zu ermutigen.
Indem wir unsere Selbstgeschichten neu schreiben, erschaffen wir einen wirkungsvollen Raum für uns selbst. Einen Raum, in dem wir uns so akzeptieren können, wie wir sind und Selbstwirksamkeit gedeihen kann.
Besonders die negativen Selbstgeschichten können uns in Schwierigkeiten bringen. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Kränkungen und Verletzungen, die wir erlebt haben, immer wieder in unseren Selbstgeschichten aufzuarbeiten und zu wiederholen. Es ist, als würde es uns ständig warnen wollen. Dabei entstehen Ängste. Unser Gehirn möchte uns vor erneuten Kränkungen und Verletzungen schützen. Gleichzeitig will sich unser inneres Ich die Bedürfnisse nach Sicherheit und Anerkennung erfüllen, was Sehnsüchte erzeugt. In uns entsteht ein Kampf zwischen verschiedenen Selbstgeschichten.
Aber auch mit überwiegend positiven Selbstgeschichten sind wir nicht völlig frei von Sorgen und Problemen.
Das Erforschen beeinflusst nicht nur dein Selbstverständnis, es ermöglicht auch ein besseres Verstehen und Bewerten der Erzählungen anderer. Es ist, als hättest du jetzt eine magische Brille, die dir erlaubt, die wahren Beweggründe und Hintergründe zu sehen, die dir vorher verborgen geblieben sind.
Die Selbstreflexion wird zum Instrument des Wandels und unterstützt dein stetes Wachstum.
Das Ergründen ist ein wirkungsvolles Instrument, mit dem du deine Denkweisen und Gefühlsmuster verändern kannst. Mit jeder neuen Erkenntnis, die du durch die Arbeit an dir selbst erlangst, erweiterst du dein Bewusstsein und gestaltest dein Leben aktiv mit.
Hier sind einige therapeutische Fragen und Anregungen, die dir neue Perspektiven eröffnen können:
Stelle dir vor, die Ereignisse deines gestrigen Tages sind in einem Buch festgehalten. Lese jede Seite mit Sorgfalt und Bewusstheit, und sei offen dafür, die Selbstgeschichten neu zu formulieren. Jeder Tag bringt dir die Gelegenheit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und deine Selbstgeschichten zu einer inspirierenden und bereichernden Reise zu gestalten.
Gibt es derzeit bestimmte Selbstgeschichten, die dir besonders zu schaffen machen oder dich besonders herausfordern?
Hast du schon einmal festgestellt, dass bestimmte Themen oder Muster immer wieder in deinen Selbstgeschichten vorkommen?
Wie gehst du mit diesen wiederkehrenden Themen um? Hast du bestimmte Wege gefunden, um sie zu bewältigen oder in deine Selbstgeschichten zu integrieren?
Nimmer dir, wenn du dazu bereit bist, etwas Zeit und lass die Selbstgeschichten Revue passieren, die du in den letzten Stunden verfasst und erzählt hast. Was waren die Hauptthemen und -ereignisse? Wie hast du deine Erfahrungen und Gefühle in den Selbstgeschichten interpretiert, dargestellt und ausgedrückt. Diese Überlegungen könnten dir helfen, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, welche Art von Selbstgeschichten du dir formulierst und erzählst.
Ein weiterer Schritt wäre, diesen Reflexionsprozess mit Achtsamkeit zu durchlaufen. Verschiedene Gedanken und Emotionen könnten an die Oberfläche treten, während du deine Geschichten betrachtest. Das Wiederaufrufen dieser Selbstgeschichten kann Gefühle hervorrufen, Reaktionen auslösen, die von gestern bis heute variieren. Dieser Prozess kann eine Möglichkeit bieten, ein tieferes Bewusstsein für die eigenen Reaktionen auf die persönlichen Erzählungen zu entwickeln.
Und schließlich könnte das Bedürfnis auftauchen, einige der Selbstgeschichten neu zu formulieren. Vielleicht gibt es Aspekte, die du gerne verändern würdest. Aus der Perspektive von heute könnten bestimmte Ereignisse, Gedanken und Gefühle anders betrachtet werden. Neue Betrachtungsweisen oder Schwerpunkte könnten in den Erzählungen hinzugefügt werden, die die Geschichten in ein neues Licht rücken und das Selbstbild auf positive Weise beeinflussen.
Vielleicht könntest du dir vorstellen, welche Elemente du in deinen zukünftigen Selbstgeschichten verändern oder erreichen möchtest. Es könnte spannend sein, neue Ziele zu entwerfen, die du in deine Selbstgeschichten einweben möchtest. Erschaffe Visionen von den Selbstgeschichten, die du dir in der Zukunft erzählen möchtest.
Lass dich von dem Gedanken leiten, dass deine Selbstgeschichten dazu beitragen könnten, dich zu inspirieren, zu fördern und dir ein Gefühl der Erfüllung zu geben. Überlege, welche Inhalte dich inspirieren könnten. Vielleicht gibt es bestimmte Themen, die dir besonders am Herzen liegen oder die dir besonders viel Freude bereiten. Diese könnten die Basis für deine zukünftigen Selbstgeschichten bilden und dir helfen, dein Leben in eine Richtung zu lenken, die dich erfüllt und glücklich macht.
Diese Betrachtungen helfen dir, deine Selbstgeschichten unter die Lupe zu nehmen und sie bei Bedarf zu überarbeiten. Sie sind ein essenzieller Baustein auf deinem Weg zur persönlichen Weiterentwicklung und einem verbesserten Wohlbefinden. Nur so kannst du dein inneres Gleichgewicht finden und ein erfüllteres, zufriedeneres Leben führen.
Erster Akt
Selbstgeschichten beleuchten verschiedene Facetten des „Ichs“
Selbstgeschichten bringen Aspekte der Persönlichkeit zum Ausdruck
Selbstgeschichten können wir kontrollieren und abwandeln
Selbstakzeptanz und Selbstwirksamkeit
Die Rolle von Selbstgeschichten als Reflexionswerkzeug für die eigene Identität
Dein Ich[Fußnote 1] bewegt sich in deinen Selbstgeschichten, da sie dein Ich in die vielen Teile aus Gedanken, Gefühlen und Handlungen einbinden. Alle Selbstgeschichten und dein Ich sind miteinander verflochten, jedoch beleuchtet jede Selbstgeschichte eine andere Facette von dir.
In einigen deiner Selbstgeschichten leuchtest du vor Freude und Zuversicht. Du erlaubst dir, zu träumen und große Ziele ins Auge zu fassen. Du bist dir selbst eine sichere Zuflucht. Doch in anderen deiner Selbstgeschichten bist du von Ängsten und Zweifeln umgeben. Dein Ich fühlt sich ohnmächtig und scheint den Widrigkeiten des Lebens nicht standhalten zu können.
Dein Innerstes ringt mit den Kernfragen des Lebens: Wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein und wohin strebe ich? Bist du die Person, die strahlend und selbstsicher ist oder diejenige, die von Ängsten und Unsicherheiten geplagt wird? Oder eine Kombination aus beidem? Dein Ich sehnt sich danach, diese unterschiedlichen Aspekte in deine Selbstgeschichten einzufügen und auszuprobieren.
In deinen Selbstgeschichten begegnen dir unterschiedliche Persönlichkeitsanteile[Fußnote 2] deines Wesens. Einerseits gibt es den mutigen Part in dir, der dich ermutigt, Neues zu wagen und an dich selbst zu glauben. Andererseits existiert auch eine kritische Instanz, die unaufhörlich Zweifel säht und dein Ich zu untergraben versucht.
Deine Selbstgeschichten können von dir gesteuert und geändert werden. Es ist dir möglich, sie mit Bewusstheit wahrzunehmen und zu verändern. Indem du dies tust, verwandelst du zugleich die in ihnen verborgenen Gedanken- und Gefühlsmuster. So wird der Spielraum deiner Selbstgeschichten begrenzt, dich nach Belieben zu lenken und zu formen.
Mit jedem bewussten Schritt gewinnst du Kraft und Selbstvertrauen. Du emanzipierst dich und beginnst positive Erfahrungen, Freiheit, Hoffnungen und die Liebe zu dir selbst stärken. Du akzeptierst dich wieder und zeigst Mitgefühl für deine eigenen Mängel und Fehltritte.
Selbstgeschichten entwickeln sich mit der Zeit. Sie enden nicht mit dem klassischen „Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende“, sondern offen und voller Potential für unzählige Möglichkeiten.
◆◆◆
Das Gehirn macht nämlich alles zu Selbstgeschichten.
Gestern im Supermarkt bekam ich mit, wie eine junge Frau am Handy sagte: „Nachdem sie mir das gebeichtet hatte, sagte ich Knut, dass er sich die Sache mit dem Job im Ausland noch einmal überlegen solle ..., doch er hat offenbar schon unterschrieben.“
Ich war zwar nicht im Bilde darüber, was zwischen den beiden Personen vorging, doch mein Geist erschuf sofort eine Selbstgeschichte.
Praktisch war es mir unmöglich, die Dame nach den Details zu befragen. Stattdessen überlegte ich, was sie von wem gehört hatte und was geschehen war: Hatte sie erfahren, dass Knuts Freundin ihn betrogen hatte? Beabsichtigte er wegen seiner anstrengenden Familie einen neuen Job im Ausland anzutreten, um weit weg zu sein? Hatte er etwas Verwerfliches getan?
◆◆◆
Die Magie der Selbstgeschichten steckt in der ganzheitlichen Verknüpfung von Gedanken, Emotionen und Themen. Freude, Überraschung, Angst, Wut, Ekel, Trauer und Verachtung sind dort eingewoben, mal verborgen, mal offensichtlich. Die Charaktere in deinen Selbstgeschichten sind Projektionsflächen. Selbstgeschichten erzählen von Frieden und Konflikt, von Verwirrung und Hemmungen. Sowohl die bewussten als auch die unbewussten Selbstgeschichten berühren und fordern uns. Selbstgeschichten gleichen einem Haus, bewohnt von einem bunten Sammelsurium an Emotionen, Gedanken und Themen. Freude strahlt in jedem Raum und erwärmt dein Herz. Mut hockt behaglich am Kamin und lässt sich nicht so einfach verjagen. Zorn huscht gelegentlich herein und hat im Schutz dieses Hauses ebenfalls einen Platz. Trauer, sanft wie sie ist, vermischt sich mit dem Sonnenlicht, denn hier darf sie weinen, bis Trost sie umarmt. Angst schleicht auf knarrenden Dielen umher und sucht nach Sicherheit, denn in den Selbstgeschichten wird sie gehört, hier bekommt sie Beistand.
Du bist nicht nur ein Beobachter deiner Selbstgeschichten, du bist ihr Schöpfer und Hauptdarsteller. Sie sind ein Teil von dir, durchziehen dich, rühren dein Ich an und hinterlassen ihre Spuren.
Ruhe und Zufriedenheit können in deinen Selbstgeschichten als kostbare Elemente repräsentiert sein und als idyllische und friedliche Szenen hervorscheinen. Diese friedvollen Szenarien können in deinen Erzählungen auftauchen und ihren ganz eigenen Platz einnehmen.
Auch die Rolle von Natur und Umwelt kann in deinen Selbstgeschichten entscheidend sein. Wir können in der Natur Trost und Freude finden. Unsere Umgebung kann unsere Stimmung und unser Erleben prägen und beeinflussen.
Es ist möglich, dass wir uns mit bestimmten Orten oder Umgebungen in unseren Selbstgeschichten identifizieren. Deine „vertrauten Orte“ könnten ein wichtiger Teil deiner Erzählungen sein, verbunden mit speziellen Gefühlen und Assoziationen.
Wenn du deine Selbstgeschichten ignorierst, werfen sie Schatten auf dein Leben. Du verlierst dein Selbstbewusstsein, deine Zufriedenheit und Echtheit. Dein Ich versinkt im Wir, d. h. deine Selbstvergewisserung[Fußnote 3] löst sich auf, wie ein Wassertröpfchen im Ozean.
Wenn du deine Selbstgeschichten herabwürdigst, entfremdest du dich womöglich von dir selbst. Es ist, als würdest du ein kostbares Gemälde mit Farbe übermalen, sodass du die feinen Details nicht mehr erkennst. Du fühlst dich verloren, unsicher und unglücklich, deine wahre Identität entgleitet dir. Probleme in Beziehungen können die Folge sein, weil du die Bindung zu anderen Menschen verlierst.
Wenn du dir in deinen Geschichten immer wieder erzählst, dass du nicht gut genug bist oder dass du etwas nicht schaffst, ziehst du dich selbst runter. Deine eigenen Worte wirken wie eine schwere Last auf deinen Schultern.
Die narrative Psychologie[Fußnote 4] und die kognitive Verhaltenstherapie[Fußnote 5] betonen, dass du deine Gefühle und Gedanken als Teile eines größeren Ganzen in deinen Selbstgeschichten interpretierst - wie Puzzleteile, die ein größeres Bild ergeben. Die Gehirnwissenschaft hat erkannt, dass unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen eng miteinander verbunden sind und unser Gehirn diese Verbindung in unseren Selbstgeschichten zum Ausdruck bringt.
Hier sind einige Reflexionsgeschichten, therapeutische Fragen und Anregungen, die dir neue Perspektiven eröffnen können:
Tritt ein in die Welt einer Spiegelungs-Erzählung[Fußnote 6]:
Mia genießt die sanfte Brise, die ihr durch das Haar streicht. Sie nimmt den Duft der Blumen wahr. Die Sonne kitzelt auf der Haut und das fühlt sich gut an. Sie sieht sich um und bemerkt die Schönheit der Umgebung: die grünen Bäume, das leuchtende Gras, die bunten Blumen. Alles scheint perfekt zu sein.
Nichtsahnend registriert Mia, dass sie diesen Ort schon mal gesehen hat, nur nicht von außen. Sie kennt ihn aus ihren Selbstgeschichten. Dieser Ort war ein Teil von ihr, genauso wie sie ein Teil von ihm war. Sie empfindet tiefe Ruhe und Geborgenheit. Dieser Ort gibt ihr Halt und Orientierung. Mia hat ihren Wohlfühlort und ihr inneres Selbst in einer Selbstgeschichte gefunden.
Wie repräsentierst du Ruhe und Zufriedenheit in deinen Selbstgeschichten? In Mias Geschichte wird eine idyllische und friedliche Szene beschrieben. Wie und wo erscheint diese Art von Szenario in deinen Selbstgeschichten?
Welche Rolle spielen Natur und Umwelt in deinen Selbstgeschichten? Mia scheint in der Natur Trost und Freude zu finden. Wie wirkt sich die Umgebung auf deine eigene Stimmung und dein Erleben in deinen Selbstgeschichten aus?
Identifizierst du dich mit Orten oder Umgebungen in deinen Selbstgeschichten, so wie Mia es tut? Wo sind deine „vertrauten Orte“, und welche Gefühle verbindest du mit ihnen?
Wie repräsentierst du Selbstreflexion und Selbsterkenntnis in deinen Selbstgeschichten? In Mias Geschichte erkennt sie den Ort aus ihren Selbstgeschichten. Wie reflektierst du über dein inneres Selbst in deine eigenen Selbstgeschichten?
Wie verändert du deine Selbstgeschichten, um friedliche und idyllische Szenen zu fördern? Welche Ansichten von Mias Geschichte integrierst du in deine eigenen Selbstgeschichten?
Wie wirkt sich diese Überprüfung auf deine zukünftigen Selbstgeschichten aus? Welche Erkenntnisse hast du gewonnen und wie bringst du sie in deine zukünftigen Selbstgeschichten ein?
Diese Reflexion soll dazu beitragen, deine eigenen Selbstgeschichten zu verändern, indem du dich mehr auf die positiven, ausgeglichenen und friedlichen Szenerien deiner Geschichten konzentrierst.
Zweiter Akt
Übersicht:
Vorteile von Analyse und bewusster Gestaltung - Selbstreflexion - Kreativität - Selbstheilung - Selbstbewusstsein
die Trägheit unseres Gehirns und die Folgen
Wirkung der Selbstgeschichten auf unser Handeln
Veränderung durch Beobachtung der Selbstgeschichten
der Einfluss der Selbstgeschichten auf unsere Lebensführung
die Ablenkung von der Gegenwart durch Selbstgeschichten
die Bedeutung von Selbstgeschichten für unser Wertesystem, für unsere Einstellungen und für unser Selbstbild
die Rolle von Selbstgeschichten bei der Verhaltensaktivierung
Selbstgeschichten als Navigation für unser Leben
die Bedeutung von positiven und negativen Reaktionen auf unsere Selbstgeschichten
Selbstorganisation und Selbstdisziplin
Es war einmal ein Ich, das in einer Welt voller Selbstgeschichten lebte. Diese Geschichten waren wie Wurzeln, die tief in sein Inneres reichten und seine psychischen und mentalen Erfahrungen aufnahmen. Das Ich erkannte nicht immer, dass es die Hauptrolle in den Selbstgeschichten spielte, welche Geschichten es sich selbst erzählte und wie es von ihnen beeinflusst wurde. Es war, als ob das Ich in einem Nebel der Unbewusstheit gefangen war.
Die Geschichten, die das Ich sich erzählte, waren vielfältig. Manchmal nahm es die Rolle eines Mystikers an, der nach tieferer Bedeutung und spirituellem Verständnis suchte. In diesen Geschichten erkundete es die Geheimnisse des Universums und seiner eigenen Seele.
Dann wiederum schlüpfte das Ich in die Rolle eines Helden, der mutig gegen Widerstände kämpfte und für das Gute einstand. Diese Geschichten erzählten von Tapferkeit, Opferbereitschaft und dem Streben nach Gerechtigkeit.
Es gab Zeiten, in denen das Ich sich selbst als Opfer sah. In diesen Geschichten fühlte es sich machtlos und vom Schicksal benachteiligt. Es suchte nach Mitgefühl und Verständnis von anderen, aber fand sich oft in einem endlosen Kreislauf des Leidens gefangen.
Manchmal verwandelte sich das Ich in den Täter seiner eigenen Geschichten. Es fühlte sich schuldig, bedauerte sein Handeln und suchte nach Erlösung. Diese Geschichten handelten von Reue, Vergebung und dem Streben nach Veränderung.
Und dann gab es die Geschichten, in denen das Ich zum Retter wurde. Es versuchte, anderen zu helfen, ihr Leiden zu lindern und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Diese Geschichten waren erfüllt von Empathie, Fürsorge und dem Wunsch, Gutes zu tun.
Die Angst spielte eine große Rolle in diesen Selbstgeschichten. Die Angst vor Ablehnung, vor dem Scheitern, vor der eigenen Unzulänglichkeit. Diese Ängste verhinderten oft, dass das Ich sich um seine Selbstgeschichten kümmerte.
Es wurde klar, dass das Ich bereit sein musste, sich seinen Ängsten zu stellen, um die Kontrolle über seine Geschichten zurückzugewinnen. Es musste lernen, seine Selbstgeschichten anzunehmen und zu verstehen, denn sie waren der Schlüssel zur Selbstreflexion und Veränderung.
Das Ich übernahm die Macht, welche Rollen und Inhalte es seinen Akteuren zuwies. Es schaffte sich selbstbestimmte Rollen und gestaltete seine Selbstgeschichten nach seinen eigenen Werten und Träumen.
Es war nicht immer einfach, diese Veränderungen umzusetzen.
In den Selbstgeschichten ist dein Ich auf der Suche nach einem klaren Weg, nach Bedeutung und nach innerem Frieden.
Dein Ich möchte nicht nur passiver Zuschauer sein. Dein Ich sehnt sich nach Kontrolle und bewusster Gestaltung deiner inneren Welt. Dein Ich möchte den Inhalt deiner Selbstgeschichten genauer betrachten und kritisch hinterfragen.
Dein Ich trifft auf die wiederkehrenden Muster, d. h. auf die gleichen Ängste und Selbstzweifel, die sich immer wieder einschleichen und auf die gleichen Verhaltensweisen, die sich ständig wiederholen. Ist es nicht an der Zeit, diese Muster zu durchbrechen und neue Wege zu erkunden?
Frage dich: Welche Handlungen und Gedanken haben in den Selbstgeschichten zu welchen Ereignissen geführt? Wie haben die Charaktere in deinen Geschichten ihre Rollen gespielt?
Du hast die Macht, alle Handlungen in den Selbstgeschichten zu ändern, neue Charaktere einzuführen und den Verlauf deiner Geschichten zu beeinflussen.
Mit der Zeit wirst du selbstreflexiver[Fußnote 7] und erkennst eventuell wiederkehrende Themen und Motive sowie deine Stärken und Schwächen.
Durch die bewusste Gestaltung deiner Selbstgeschichten entdeckt dein Ich seine Kreativität und verändert deine Muster[Fußnote 8]. Es verarbeitet alte Verletzungen und erholt sich. Es sortiert die Ereignisse und Emotionen, die das Gehirn unbewusst in den Selbstgeschichten zusammengefasst hat, findet Wege, mit ihnen umzugehen und sie loszulassen. Es erkennt, dass es nicht von vorgegebenen Mustern[Fußnote 9] abhängig ist, sondern die Schöpferkraft besitzt, neue Wege zu finden und Selbstgeschichten über alternative Ausgänge zu schreiben.
Das Ich blüht auf. Es ist, als ob es aus der Tatsache, die Hauptrolle in den Selbstgeschichten zu spielen, Kraft und Trost schöpft. Das Ich gestaltet die Handlungen, trifft die Entscheidungen und ist die zentrale Figur seiner Selbstgeschichten. Dies kann dem Ich das Gefühl geben, sein eigenes Leben aktiver gestalten und lenken zu können, was wiederum sein Selbstbewusstsein stärkt und deinem Ich neue Kraft verleiht. Es ist eine innere Stärke, die dein Ich auch in herausfordernden Zeiten tröstet und unterstützt.
Dein Gehirn ist von Natur aus träge und ökonomisch. Es folgt den Naturgesetzen und versucht, so energieeffizient wie möglich zu arbeiten. Es ist kein Wunder, dass dein Ich oft das Gefühl hat, nur halb zu leben. Dein Gehirn behält das Alte bei und sucht nicht nach Neuem. Es begnügt sich mit dem, was es kennt und was in seiner Denkschublade liegt. Hier, in dieser wohligen Vertrautheit, ruhen oft tief verborgen, deine Selbstgeschichten.
Also, wenn du das Gefühl hast, dass du nur halb lebst, denk daran: Es liegt an deinem ökonomischen Gehirn, das gerne mit Autopiloten arbeitet. Aber wer sagt, dass es so bleiben muss? Sammele allen Mut zusammen, um etwas Neues in deinen Selbstgeschichten zu schreiben, und du könntest überrascht sein, was du entdeckst!
Dein Ich registriert vielleicht, dass Selbstorganisation auch Selbstdisziplin erfordert. Diese Disziplin hilft dir, deine Selbstgeschichten inspirierend und ermutigend zu gestalten. Sie hilft dir, klare Regeln und Strukturen in deinen Selbstgeschichten einzuführen. Selbstdisziplin hält dich auf Kurs, selbst wenn der Wind deine Gedanken und Gefühle heftig durcheinander wirbelt.
Für dich und dein Ich ist es nicht immer bequem, Selbstdisziplin aufrechtzuerhalten. Es erfordert Anstrengung, Ausdauer und die Bereitschaft, sich selbst zu kontrollieren und Verhaltensweisen anzupassen.
Selbstkontrolle
Eine zentrale Komponente in unseren Selbsterzählungen ist oft die Selbstkontrolle[Fußnote 10]: unsere Fähigkeit, unsere Impulse, Emotionen und Handlungen zu steuern. Selbstkontrolle kann sowohl ein Segen als auch eine Bürde sein. Auf der einen Seite ermöglicht sie uns, kluge Entscheidungen zu treffen, uns auf unsere Ziele zu konzentrieren und mit schwierigen Emotionen umzugehen. Durch Disziplin, Ausdauer und die Fähigkeit, kurzfristige Versuchungen für langfristige Ziele zu opfern, erreichen wir unsere Ziele. Wir erreichen Erfolg und Selbstverwirklichung durch die Selbstkontrolle.
Auf der anderen Seite kann zu viel Selbstkontrolle zu Starrheit, Überforderung und einem Gefühl des Eingesperrtseins führen. Unsere ständige Selbstüberwachung und die Angst vor Fehlern hält uns in einem Zustand der Anspannung und Unzufriedenheit. Zu viel Selbstkontrolle kann uns von Freude und Spontaneität abschneiden.
Es geschieht, dass wir uns in Komplikationen verheddern, obwohl wir im Grund fähig sind, mit Gelassenheit und Weitblick zu agieren. Uns ist die Macht und Festigkeit der Selbstdisziplin bewusst, wir wissen, dass sie wie ein strahlendes Licht unsere Willenskraft symbolisiert.
Die Selbstkontrolle ist kein stummer Beobachter, sondern hat eine aktive Rolle. Sie dient als Ausdruck der Willensstärke.
Doch es gibt Zeiten, in denen wir uns ausgebrannt und ohnmächtig fühlen, weil wir all unsere Kräfte für die Selbstkontrolle verwendet haben. Die dauernde Selbstkontrolle ist für uns zur Belastung geworden und wir spüren, wie wichtig es ist, uns zu erholen. Denn sie kann zu einer Obsession werden.
Therapeutische Fragen und Anregungen zur Selbstkontrolle findest du am Ende dieses Kapitels.
Selbstdisziplin[Fußnote 11]
Eine dieser mächtigen Kräfte, die oft in unseren Selbsterzählungen auftaucht, ist die Selbstdisziplin. Sie ist das unsichtbare Ruder, das uns durch die stürmischen Meere des Lebens steuert. Als eine stille, unauffällige Kraft zeigt sie sich nicht in lauten Taten oder großen Gesten, sondern in den kleinen, täglichen Entscheidungen, die wir treffen. Es ist die Fähigkeit, das zu tun, was getan werden muss, auch wenn es unbequem oder schwierig ist wegen der Ablenkungen des Alltags und der Versuchungen des Aufschiebens. Selbstkontrolle kann als eine Art innerer Mentor oder Freund auftreten, der uns ermutigt, weiterzumachen, auch wenn der Weg steinig ist.
In unserem Leben erleben wir eine Vielfalt von Situationen, in denen wir mit unseren inneren Impulsen und unserer Fähigkeit zur Selbstkontrolle konfrontiert sind. Manchmal geben wir diesen Impulsen nach, lassen uns von ihnen treiben und setzen dabei unsere eigenen Ziele aufs Spiel. Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle scheint in solchen Momenten in den Hintergrund zu treten und wir handeln, obwohl wir tief in uns wissen, dass Zurückhaltung uns auf dem Pfad des Erfolgs halten könnte.
Es gibt jedoch auch Momente, in denen wir fest im Sattel der Selbstkontrolle sitzen. Wir lassen uns nicht von unseren Impulsen verführen, sondern agieren aus einer Position der Ruhe und Besonnenheit heraus. In diesen Momenten erkennen wir die Bedeutung der Selbstbeherrschung und ziehen sie impulsiven Reaktionen vor.
Diese unterschiedlichen Verhaltensweisen zeichnen das vielschichtige Bild unserer menschlichen Natur. Sie offenbaren die Spannung zwischen der Freiheit, unseren Impulsen zu folgen und der Notwendigkeit, sie zu kontrollieren, um langfristige Ziele zu erreichen. Dieser Balanceakt zwischen Spontaneität und Selbstbeherrschung ist ein zentrales Element unserer Selbstgeschichten und formt unsere Erfahrungen und unser Wachstum.
Therapeutische Fragen und Anregungen zur Selbstdisziplin findest du am Ende dieses Kapitels.
Selbstfürsorge
Eine der zentralen und oft übersehenen Kräfte in unseren Selbstgeschichten ist die Selbstfürsorge. Sie ist der liebevolle Kompass, der uns durch die Höhen und Tiefen des Lebens führt.
Selbstfürsorge ist die Kunst, auf sich selbst zu achten, sowohl körperlich als auch emotional und mental. Sie bedeutet, dass wir uns Zeit für uns selbst nehmen, unsere Bedürfnisse anerkennen und Maßnahmen ergreifen, um uns selbst zu pflegen und zu stärken. Sie ist ein entscheidender Aspekt unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens.
Das Wahrnehmen und Analysieren unserer Selbstgeschichten kann ein heilsamer Prozess sein. Es ermöglicht uns, schwierige Erfahrungen zu verarbeiten und neue Bedeutungen zu finden. Indem wir unsere Geschichten erzählen und reflektieren, können wir uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden und einen Raum für Verständnis, Mitgefühl und Selbstfürsorge schaffen.
Eine bewusste, positive und konstruktive Gestaltung unserer Selbstgeschichten kann die Achtsamkeit für uns selbst fördern und uns dabei unterstützen, besser für uns selbst zu sorgen. Sie hilft uns dabei, unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen, anzuerkennen und zu erfüllen.
In der Welt unserer eigenen Selbstgeschichten schaffen wir einen Raum zum inneren Wohlbefinden und tiefer Zufriedenheit. Wir führen eine Art inneren Dialog, in dem wir Geschichten des Wohlbefindens und Glücks für uns selbst kreieren und so abstrakt erleben. Mit dieser bewussten Praxis schöpfen wir Kraft und sorgen für Momente der Stille und Selbstreflexion in unserem Leben.
Zu diesem Zweck erzählen wir uns Selbstgeschichten über Wohlergehen und Zufriedenheit, die das Glück nach sich ziehen. Dieses Gefühl der Erfüllung kann so stark sein, dass wir uns in diesen Momenten dabei ertappen, wie wir nach Gelegenheiten suchen, um Kraft zu tanken und Zeit für sich selbst zu reservieren. Wir können dann beobachten, wie gut es uns tut, dieses Wohlbefinden zu erleben.
Therapeutische Fragen und Anregungen zur Selbstfürsorge findest am Ende dieses Kapitels.
Selbstverschwendung
In unseren Selbstgeschichten schildern wir das allzu menschliche Drama, uns unter dem selbstauferlegten und fremdbestimmten Druck der Zeit zu befinden. Das Ringen mit der Zeit ist ein zentrales Thema. Wir verlieren kostbare Energie in endlosen inneren und äußeren Kämpfen, ohne dass wir dadurch Zeit gewinnen oder unsere Ziele erreichen. Unsere Bemühungen, schneller zu arbeiten oder schneller Lösungen zu finden, führen letztlich dazu, dass wir unsere Kraft verschwenden und frustriert und erschöpft zurückbleiben. Es ist, als ob wir uns in einem Hamsterrad befinden, das sich immer schneller dreht, ohne dass wir vorankommen. Die Paradoxie des Zeitzwangs ist: Je mehr wir versuchen, die Zeit zu kontrollieren und zu sparen, desto mehr verlieren wir an Energie und Lebensfreude. Wir sollten uns immer mal wieder daran erinnern, dass wir nicht gegen die Zeit arbeiten sollten, sondern mit ihr, um unsere Ziele zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen.
Indem du deine Selbstgeschichten überprüfst und anpasst, lernst du, konstruktiver mit dem Thema Kampf[Fußnote 12] gegen Druck von innen aus den Selbstgeschichten und gegen Druck von außen umzugehen und deine Energie besser zu nutzen.
Therapeutische Fragen und Anregungen zur Selbstverschwendung findest du am Ende dieses Kapitels.
Selbstwirksamkeit
Wir befinden uns manchmal in schwierigen Situationen. Die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, können uns riesig erscheinen. Aber da sind unsere erfreulichen Selbstgeschichten, die uns wie Leuchtfeuer durch die Dunkelheit leiten. In ihnen agieren wir alle mit Resilienz und treffen diszipliniert und effektiv Entscheidungen. Mit jedem mutigen Schritt, den wir gehen, fühlen wir uns besser und sicherer.
Schließlich kommt der Moment, in dem auch wir unsere scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen besiegen. Wir blicken auf unseren zurückgelegten Weg und erkennen, dass wir mehr erreicht haben, als wir uns zunächst zugetraut haben - und weit mehr, als unsere eigenen Selbstgeschichten prophezeiten.
Dieser Wendepunkt bringt uns zu einer tiefen Einsicht: Unsere Fähigkeiten und Potenziale, die wir uns in unseren Selbstgeschichten zusprechen, sind nicht festgelegt, sondern können erweitert und überschritten werden. Sie können uns inspirieren, mit Mut und Entschlossenheit unseren Weg zu gehen - sogar die größten Hürden zu überwinden. Wir sind mehr, als wir uns erzählen.
Denke daran, dass Veränderung Zeit braucht und es normal ist, Rückschläge zu erleben. Sei geduldig mit dir selbst und feiere jeden Fortschritt.
Es ist eine Tatsache, dass negative Szenen sich immer wieder in unseren Köpfen abspielen, da unser Gehirn darauf ausgerichtet ist, sich auf das Problematische zu konzentrieren. Doch diese Dynamik muss uns nicht länger beherrschen. Du kannst lernen, diese Szenen in deinen Selbstgeschichten zu erkennen und ihnen nicht mehr auszuweichen.
Der Schlüssel dazu liegt in deinen Selbstgeschichten. Formuliere sie mit Resilienz, mit einem aufrechten Gang trotz Widrigkeiten. Denk dabei an die Verbündeten in deinem Leben, an jene Menschen und Umstände, die dich stärken und unterstützen. Integriere sie als Protagonisten in deine Geschichten. Sie helfen dir, deine Herausforderungen zu meistern und dein Leben selbstbestimmt und gelassen zu führen.
Negative Szenarien sind Teil unseres Menschseins, doch sie bestimmen nicht zwingend unsere Selbstgeschichten. Indem du deine resilienten Selbstgeschichten bewusst formst und lebst, gewinnst du an Kontrolle und Lebensfreude zurück.
Therapeutische Fragen und Anregungen zur Selbstwirksamkeit findest du am Ende dieses Kapitels.
Erlernte Hilflosigkeit
In schwierigen Lebensphasen stecken wir im Nu fest. Die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, erscheinen nahezu unüberwindbar. Unsere eigenen Selbstgeschichten sind von Bildern erfüllt, die uns als hilflos und ohnmächtig darstellen. Aufgrund unserer Konditionierung haben wir uns in eine dunkle Ecke zurückgezogen und harren schicksalsergeben aus, in Angst und Atemlosigkeit auf unser vermeintliches Urteil wartend. Es fühlt sich an, als wären uns die Flügel gestutzt worden, die uns die Möglichkeit geben könnten, uns aus dieser prekären Situation zu befreien.
Unsere bisherige Disziplin nutzen wir lediglich, um uns unserem Schicksal zu ergeben. Doch indem wir unsere Selbstgeschichten bewusst umschreiben und die Helden unserer eigenen Erzählungen werden, können wir uns erheben und die vorhandenen Herausforderungen bewältigen. Es ist an uns, den Schlüssel zu unserer Befreiung in uns selbst zu finden und unsere Flügel wieder zum Schwingen zu bringen.
In diesem Prozess verwendest du deine Selbstgeschichten als ein mächtiges Instrument, um ein positiveres Selbstbild zu fördern. Statt dich von deinen Problemen erdrücken zu lassen, erlaubst du dir, deinen Fokus gezielt auf die Lösungsfindung zu lenken. Auf diese Weise besitzt du die Kontrolle und navigierst aktiv durch deine Herausforderungen, statt passiv von ihnen beherrscht zu werden. Dies stärkt nicht nur dein Selbstbild, sondern ermöglicht dir auch einen konstruktiven Umgang mit Schwierigkeiten, um diese zu bewältigen und daraus zu wachsen.
Therapeutische Fragen und Anregungen zur erlernten Hilflosigkeit findest du am Ende dieses Kapitels.
Ambivalenz
Unser Gehirn schleust unbemerkt die Schattenseiten unserer unklaren und zwiespältigen Emotionen - die sogenannten abgespaltenen[Fußnote 13] Widersprüchlichkeiten (Ambivalenzen) – in unsere Selbstgeschichten ein. Dese Emotionen präsentieren sich in extremen Gegensätzen: entweder als hochfliegendes Glück oder tiefste Traurigkeit, als leuchtender Glanz oder als düstere Tristesse. Wir neigen dazu, diese Ambivalenzen zu meiden, uns davor zu verschließen. Doch selbst wenn wir es versuchen, schleichen sie sich als schemenhafte Silhouetten in unsre Selbstgeschichten ein, kaum greifbar und doch ständig präsent. Sie agieren im Verborgenen, wie Schatten, die hinter der Bühne unseres Bewusstseins lauern. Aber trotz ihrer Heimlichkeit geben sie unseren Selbstgeschichten tiefe und Komplexität.
Der Konflikt kann so intensiv werden, dass die Stimme des Verstandes kaum mehr in den Selbstgeschichten zu hören ist.