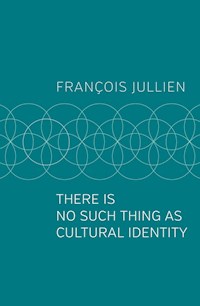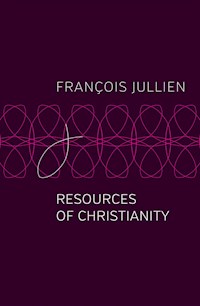11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der globalisierten Welt geht die Angst vor einem Verlust der kulturellen Identität um, und fast überall formieren sich die selbsterklärten Retter: In Frankreich gibt Marine Le Pen vor, sie »im Namen des Volkes« zu verteidigen, die AfD fordert in ihrem Grundsatzprogramm »deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus«, und die Identitäre Bewegung ruft gleich in mehreren Ländern mit aggressiven Aktionen zur ihrer Bewahrung auf.
Doch gibt es überhaupt so etwas wie eine kulturelle Identität? In seinem neuen Buch zeigt François Jullien, dass dieser Glaube eine Illusion ist. Das Wesen der Kultur, so Jullien, ist die Veränderung. Er plädiert dafür, Bräuche, Traditionen oder eine gemeinsame Sprache als Ressourcen zu begreifen, die prinzipiell allen zur Verfügung stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
2In der globalisierten Welt geht die Angst vor einem Verlust der kulturellen Identität um, und fast überall formieren sich die selbsterklärten Retter: In Frankreich gibt Marine Le Pen vor, sie »im Namen des Volkes« zu verteidigen, die AfD fordert in ihrem Grundsatzprogramm »deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus«, und die Identitäre Bewegung ruft gleich in mehreren Ländern mit aggressiven Aktionen zu ihrer Bewahrung auf.
Doch gibt es überhaupt so etwas wie eine kulturelle Identität? In seinem neuen Buch zeigt François Jullien, dass dieser Glaube eine Illusion ist. Das Wesen der Kultur, so Jullien, ist die Veränderung. Er plädiert dafür, die Vielfalt der Bräuche, Traditionen und Sprachen als Ressourcen zu begreifen, die prinzipiell allen zur Verfügung stehen.
François Jullien, geboren 1951 in Embrun, ist Philosoph und Sinologe. Er war unter anderem Direktor des Collège international de philosophie und Professor an der Universität Paris-Diderot. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2010 mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken.
François Jullien
Es gibt keine kulturelle Identität
Wir verteidigen die Ressourcen einer Kultur
Aus dem Französischen von Erwin Landrichter
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Hauptteil
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Vorbemerkung
I. Das Universelle, das Gleichförmige, das Gemeinsame
II. Im europäischen Unterbau des Universellen: Ist das Universelle ein veralteter Begriff?
III. Die Differenz oder der Abstand: Identität oder Fruchtbarkeit
IV. Es gibt keine kulturelle Identität
V. Wir verteidigen die Ressourcen einer Kultur
VI. Von den Abständen zum Gemeinsamen
VII. Dia-log
Anmerkungen
2
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
7Vorbemerkung
Die Forderung nach einer kulturellen Identität hat derzeit überall auf der Welt Konjunktur: in Form einer Wiederkehr des Nationalismus und als Reaktion auf die Globalisierung.
Die kulturelle Identität sei ein Schutzwall: gegen eine von außen drohende Uniformierung; und gegen Gruppen, die Gesellschaften von innen dissoziieren könnten. Wo aber den Cursor platzieren zwischen Toleranz und Assimilation, zwischen der Verteidigung des Einzigartigen und dem Erfordernis von Universalität?
Diese Debatte wird insbesondere in Europa geführt, das plötzlich von Zweifeln am Ideal der Aufklärung erfasst wird. Sie betrifft, ganz allgemein, die Beziehung der Kulturen zueinander und die Richtung, die diese in Zukunft nehmen könnte.
Nun glaube ich, dass man sich in dieser Debatte nicht der richtigen Konzepte bedient: dass hier nicht von »Unterschieden« die Rede sein sollte, welche die Kulturen voneinander isolieren, sondern von Abständen (écarts). Diese Abstände, welche die Kulturen in Gegenüberstellung und daher in Spannung zueinander aufrechterhalten, bringen das Gemeinsame zwischen ihnen zum Vorschein. Außerdem sollten wir nicht von »Identität« sprechen, da Kultur sich 8dadurch auszeichnet, dass sie mutiert, dass sie sich permanent verändert. Angebrachter scheint es mir daher, von Fruchtbarkeit zu sprechen und das ins Auge zu fassen, was ich Ressourcen nennen werde.
Ich werde daher keine französische kulturelle Identität verteidigen, die unmöglich zu identifizieren ist, dafür jedoch die französischen (europäischen) kulturellen Ressourcen – wobei »verteidigen« hier weniger im Sinne von beschützen gemeint ist als vielmehr im Sinne von nutzen oder ausbeuten. Denn selbst wenn klar ist, dass solche Ressourcen in einer Sprache oder im Schoß einer Tradition, in einem bestimmten Milieu oder in einer Landschaft entstehen, sind sie anschließend doch für alle verfügbar und nicht irgendjemandes Eigentum. Anders als »Werte« sind sie nicht exklusiv; sie preisen sich nicht an, und man »predigt« sie nicht. Man bringt sie vielmehr zur Geltung oder nicht, man aktiviert sie oder lässt sie verkommen; ob dies geschieht, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.
Eine solche konzeptuelle Verschiebung verlangt im Vorfeld die Neudefinition dreier miteinander rivalisierender Termini: des Universellen, des Uniformen bzw. Gleichförmigen und des Gemeinsamen. Es gilt, sie von ihrer Zweideutigkeit zu befreien. Außerdem führt diese Verschiebung zu einer anderen Sichtweise auf den »Dia-log« der Kulturen: dia von Abzweigung/Abstand und von Verlauf; logos vom 9Gemeinsamen des Intelligiblen. Denn es ist dieses Gemeinsame des Intelligiblen, welches das Menschliche ausmacht.
Irrt man sich in Bezug auf die Konzepte, verstrickt man sich in eine falsche Debatte und steckt von Anfang an in einer Sackgasse fest.
11I.
Das Universelle, das Gleichförmige, das Gemeinsame
Um in diese Debatte einzusteigen, muss man zunächst die Termini präzisieren, sonst kommt man nicht voran. Beginnen wir mit den rivalisierenden Begriffen, die ich eben genannt habe: das Universelle, das Gleichförmige und das Gemeinsame. Wir müssen der Gefahr entgehen, sie miteinander zu verwechseln, und sie zugleich von den Zweideutigkeiten reinigen, die jeden von ihnen beflecken. Das Universelle, das die Spitze dieses Dreiecks bildet, hat wiederum selbst zwei Bedeutungen, die wir voneinander unterscheiden müssen, da man sonst weder versteht, woher seine Schärfe rührt, noch, was damit für die Gesellschaft auf dem Spiel steht. Da ist einerseits eine konstative, man könnte sagen schwache Bedeutung, die sich auf die Erfahrung beschränkt: Soweit wir bisher beobachten konnten, stellen wir fest, dass etwas immer so gewesen ist. In diesem Sinne bezieht sich der Begriff auf das Allgemeine, er bereitet keine Probleme und tut niemandem weh. Das Universelle besitzt jedoch auch eine starke Bedeutung, nämlich die der universellen Gültigkeit im genauen oder strengen Sinn – sie ist es, woraus wir, hier in Europa, eine Forderung des 12Denkens gemacht haben: Wir behaupten von vornherein, noch vor aller Bestätigung durch die Erfahrung (ja sogar bewusst auf sie verzichtend), dass eine bestimmte Sache so sein muss. Sie ist nicht nur bisher so gewesen, sondern sie kann gar nicht anders sein. Bei diesem »Universellen« geht es nicht länger um etwas Allgemeines, sondern um eine Notwendigkeit: universell nicht nur aufgrund von Tatsachen, sondern von Rechts wegen (a priori); nicht nur komparativ, sondern absolut; nicht so sehr extensiver als vielmehr imperativer Natur. Auf ebendieses Universelle im starken und strengen Sinn haben die Griechen die Möglichkeit der Wissenschaft gegründet; das Europa der klassischen Epoche hat es von der Mathematik auf die Physik übertragen (Newton) und daraus – überaus erfolgreich, wie wir wissen – die »universellen Naturgesetze« abgeleitet.
Damit sind wir bei einer Frage, welche die Moderne spaltet: Gilt dieses Universelle im strengen Sinn (dem die Wissenschaft ihre Macht verdankt, da sie die logische Notwendigkeit auf Naturphänomene anwendet oder mathematische Regeln auf die Physik) auch für das menschliche Verhalten? Ist es auch für den Bereich der Ethik relevant? Ist unser Verhalten in einem ähnlichen Sinn der Notwendigkeit »kategorischer« moralischer Imperative (im Sinne Kants) unterworfen wie die Naturphänomene jener apriorischen Notwendigkeit, die den unbestrittenen Erfolg 13der Physik ausmacht? Oder sollte man nicht für den separaten Bereich der Moral, für das (geheime) Rückzugsgebiet der inneren Erfahrung, das Recht auf etwas einfordern, das geradezu das Gegenteil des Universellen darstellt: das Individuelle oder das Singuläre (wie das Nietzsche oder Kierkegaard getan haben)? Diese Frage stellt sich umso dringlicher, als der Terminus des Universellen gerade in der Sphäre der Subjekte und, noch allgemeiner, jener der Gesellschaft durch die ihm anhaftende Mehrdeutigkeit belastet ist. Wenn wir von »Universal-« bzw. »Weltgeschichte« sprechen (oder von »Expositions Universelles«, wie die »Weltausstellungen« im Französischen heißen), ist damit sehr wohl etwas Allumfassendes und Allgemeines, aber nicht unbedingt etwas Notwendiges gemeint. Aber gilt das nicht auch für die Universalität der Menschenrechte? Sprechen wir diesen nicht ebenfalls eine prinzipielle Notwendigkeit zu? Woraus bezieht diese Redeweise ihre Legitimation? Wird diese Universalität eventuell missbräuchlicherweise behauptet?
Diese Frage stellt sich in der Gegenwart auch deshalb besonders dringlich, da wir inzwischen eine wichtige Erfahrung, ja vielleicht sogar die entscheidende Erfahrung unserer Epoche gemacht haben: In der Begegnung mit anderen Kulturen stellen wir fest, dass die Forderung nach universeller Gültigkeit, auf welcher die europäische Wissenschaft basiert und die auch von der klassischen Moraltheorie formuliert 14wurde, alles andere als universell ist. Sie ist vielmehr singulär – also das Gegenteil von universell – und sehr eng an die europäische Kulturgeschichte gekoppelt, jedenfalls was die Behauptung ihrer Notwendigkeit anbelangt. Und überhaupt: Wie übersetzt man den Begriff des »Universellen«, wenn man Europa einmal verlässt? Das ist auch der Grund, weshalb die Forderung nach Universalität, die wir so bequem in das Glaubensbekenntnis unserer Sicherheiten eingereiht und zum Prinzip all dessen gemacht haben, was uns evident erscheint, mit solchem Nachdruck zurückkehrt, weshalb sie vor unseren Augen den Anschein der Banalität abstreift und weshalb sie plötzlich als erfinderisch, gewagt, ja abenteuerlich erscheint. Und tatsächlich nimmt man sie außerhalb Europas als etwas faszinierend Fremdartiges wahr.
Auch der Begriff des Uniformen oder Gleichförmigen ist missverständlich. Zunächst könnte man annehmen, es stelle die Realisierung und Erfüllung des Universellen dar. In Wirklichkeit ist es das Gegenteil davon, ja ich würde sogar sagen, seine Perversion. Denn anders als das Universelle ist es nicht der Vernunft, sondern der Logik der Produktion untergeordnet: Es handelt sich lediglich um Standards und Stereotype. Das Uniforme verdankt sich nicht der Notwendigkeit, sondern der Bequemlichkeit: Ist es nicht billiger, gleichförmige Dinge zu produzieren? Während das Universelle auf »das Eine hin« ausge15