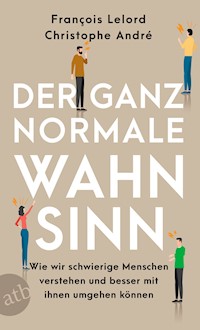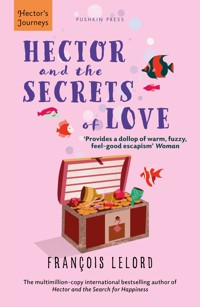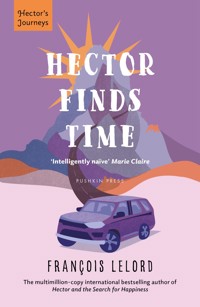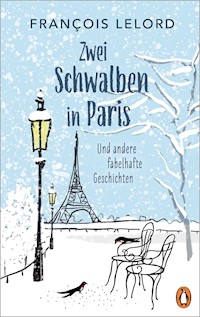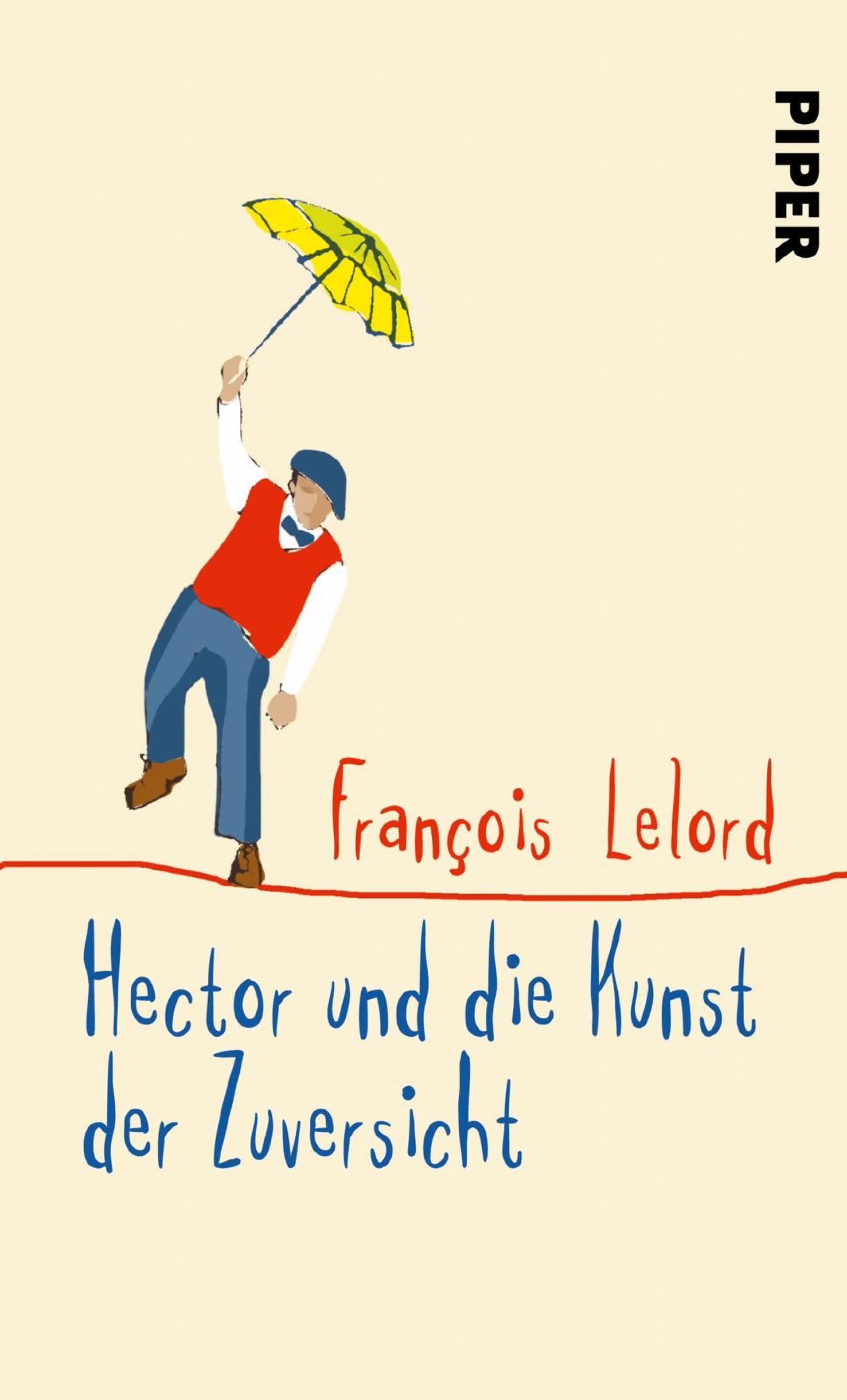4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine inspirierende Geschichte über das, was wir in Zukunft brauchen, um glücklich zu sein
Der junge Robin ist überwältigt, als er aus seiner Raumkapsel steigt. Der warme Sand unter seinen Füßen, der sanfte Wind und das Farbenspiel des Meeres sind so viel besser als jede noch so perfekte virtuelle Realität. Er ist auf der Erde, diesem fernen blauen Planeten, den er bislang nur aus Filmen und Erzählungen kannte. Doch seine Mission ist keine leichte:
- Können die Menschen auf ihren Heimatplaneten zurückkehren, obwohl sie einst dafür gesorgt hatten, dass er unbewohnbar wurde?
- Wie sollen sie leben, damit Glück für alle möglich ist?
- Und zählt Liebe noch?
Mit Hector erschuf François Lelord einen unvergesslichen Helden, dem Millionen Leserinnen und Leser folgten. Nun lässt er den liebenswerten Robin in einer abenteuerlichen Mission die große Frage erkunden, wie wir in Zukunft leben wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch:
Der junge Robin ist überwältigt, als er aus seiner Raumkapsel steigt. Der warme Sand unter seinen Füßen, der sanfte Wind und das Farbenspiel des Meeres sind so viel besser als jede noch so perfekte virtuelle Realität. Er ist auf der Erde, diesem fernen blauen Planeten, den er bislang nur aus Filmen und Erzählungen kannte. Doch seine Mission ist keine leichte: Können die Menschen auf ihren Heimatplaneten zurückkehren, obwohl sie einst dafür gesorgt hatten, dass er unbewohnbar wurde? Wie sollen sie leben, damit Glück für alle möglich ist? Und zählt Liebe noch?
Mit Hector hatte François Lelord einen unvergesslichen Helden geschaffen, dem Millionen Leserinnen und Leser folgten. In seinem neuen Roman lässt er den liebenswerten Robin in einer abenteuerlichen Mission die große Frage erkunden, wie wir in Zukunft leben wollen.
Zum Autor:
François Lelord, geboren 1953, studierte Medizin und Psychologie in Frankreich und Kalifornien. Eines Tages schloss er seine Praxis in Paris, um zu reisen und sich und seinen Leserinnen und Lesern die wirklich großen Fragen des Lebens zu beantworten. »Hectors Reise« und die folgenden sieben Romane um den Psychiater Hector und seine Suche nach dem Glück eroberten ein Millionenpublikum. François Lelord lebt mit seiner Familie in Paris.
»Macht beim Lesen einfach so richtig glücklich!« Pforzheimer Zeitung
»Wenn man dieses Buch gelesen hat, ich schwöre es Ihnen, ist man glücklich.« Elke Heidenreich zu »Hectors Reise«
»Die Bücher von François Lelord setzen zeitgemäß fort, wo Exupéry aufhörte.« Profil
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de
François Lelord
Es war einmal ein blauer Planet
Roman
Aus dem Französischen
Für A.,
»Schön, Sie zu sehen«, sagt Admiralin Colette.
Und doch macht sie dazu eine verdrossene Miene – wie üblich. Ich weiß nicht, ob sie wirklich verärgert ist oder ihre schöne Stirn nur in Falten legt, um die eigene Autorität zu betonen. Mir ist aufgefallen, dass die höheren Offizierinnen dazu neigen, so ein unzufriedenes Gesicht zu ziehen. Wie einst die Männer, als sie es noch bis in die oberen Dienstgrade schafften. Als ich durch den Laufgang in die Kommandantur ging, habe ich die Porträtgalerie mit den strengen Mienen ihrer Vorgänger gesehen.
»Stehe zu Befehl, Admiralin.«
»Wir sind hier nicht in der Öffentlichkeit, Sie dürfen ein wenig lockerer sein. Setzen Sie sich doch«, sagt sie und lächelt mir zu.
Muss ich noch hinzufügen, dass Admiralin Colette ein warmes, ein beinahe strahlendes Lächeln hat? Ich sehe sie heute zum zweiten Mal lächeln, seit sie meine Vorgesetzte ist, also seit mehr als zwei Jahren. Ihr silbernes und bronzefarbenes Haar ist in einem tadellosen Dutt zusammengeführt, was das lange Oval ihres Gesichts freilegt, ihre Züge, die so regelmäßig sind, dass man sie für eine Androidin halten könnte. Aber nein, wenn sie mir zulächelt, graben sich kleine Falten in ihre Augenwinkel, und das zeigt ja wohl, dass sie ein Mensch ist.
»Sicher fragen Sie sich, weshalb ich Sie kommen ließ, ohne über Lieutenant Jessica, Ihre direkte Vorgesetzte, gegangen zu sein.«
»Ich gebe zu, dass es mich ein wenig erstaunt, Admiralin.«
Und erstaunt ist noch vorsichtig ausgedrückt. Als einfacher Rekrut habe ich es nie direkt mit einem höheren Offizier zu tun und erst recht nicht mit der Admiralin, die ganz an der Spitze unserer militärischen Organisation steht. Außerdem liege ich in allen Tests unterhalb des Durchschnitts meines Jahrgangs, und so habe ich wirklich keine Erklärung dafür, hier in diesem Raum zu sitzen.
Sogleich fühle ich mich eingeschüchtert. Ich versuche es zu verbergen, aber das ist nicht so leicht – einer der Nachteile, wenn man jung ist; man reagiert dann einfach emotionaler.
Hinter ihr, durch das große ovale Bullauge, sehe ich unseren blauen Planeten, der sich langsam um sich selbst dreht, bedeckt von der grauen Watte seiner Wolken, die hin und wieder aufreißen und den Blick auf das dunkle Blau eines Ozeans freigeben. Diese einzigartige Farbe hat dem Planeten seinen Namen gegeben.
Die Admiralin lässt den Zeigefinger über das Display ihres Schreibtischs fahren. Ich sehe, dass sie ein Dokument überfliegt.
»Tatsächlich habe ich auch Lieutenant Jessica konsultiert, aber ebenso sehr verließ ich mich auf Athena.«
Athena ist unsere zentrale Intelligenz. Sie und ihre Vorgängerversionen haben seit meiner Geburt alles über mich zusammengetragen; ich selbst habe nur Zugriff auf eine vereinfachte Fassung meiner Akte. Die vollständigen Unterlagen sind der Admiralin zugänglich, die jetzt ihren Blick vom Display hebt und mir ins Gesicht schaut. Sie hat schöne graue Augen, und es heißt, dass sie noch ihre natürliche Iris hat und keine genetisch verbesserte, wie es hier üblich ist.
Die Admiralin mustert mich eingehend.
»Haben Sie wirklich keine Ahnung, weshalb ich Sie herbestellt habe?«
»Nein, Admiralin.«
»Lieutenant Jessica hat Ihnen also nichts gesagt … Da muss ich doch annehmen, dass sie etwas gegen Sie hat. Aber das habe ich auch schon aus ihrem Bericht über Sie abgeleitet.« Und sie zeigt auf das Display.
Sie hat völlig recht, natürlich hat Lieutenant Jessica etwas gegen mich, aber ich halte lieber den Mund. In meiner kurzen Laufbahn beim Militär habe ich gelernt, dass es einen teuer zu stehen kommt, wenn man vor einem Offizier etwas Schlechtes über einen anderen Offizier sagt, auch wenn er es zu billigen scheint.
Mein Schweigen verrät der Admiralin, dass sie aus mir nichts herausbekommen wird. Sie lächelt wieder.
»Und der Grund? Können Sie mir eine Erklärung dafür liefern, dass Lieutenant Jessica Ihnen nicht wohlgesinnt ist?«
Der Grund ist: Vor einigen Wochen ließ mich Lieutenant Jessica eines Abends in ihre Kabine rufen. Ich habe Unwohlsein vorgetäuscht. Drei Tage später die gleiche Anfrage und von meiner Seite die gleiche Entschuldigung. Die anderen haben mir gesagt, ich sei ein Idiot; es habe schließlich nichts Entehrendes, seiner Chefin auf diese Weise zu Diensten zu sein, ganz im Gegenteil! Ich bin ja nicht aus Prinzip dagegen, aber im Blick von Lieutenant Jessica, in ihren brüsken Bewegungen, ihrer ätzenden Ironie liegt etwas, das mir schon immer missfallen hat. Manche meiner Kameraden stellten sich nicht so an, und es hat sich für ihre Beurteilung ausgezahlt.
»Ich weiß nicht«, sage ich. »Es ist wahrscheinlich eine Frage der Sympathie.«
»Der Sympathie? Haben Sie etwas getan, was sie verärgert haben könnte?«
»Soweit ich mich erinnere, nicht …«
Die Admiralin muss schon wieder lächeln.
»Also wirklich – exzellent. Sie bestätigen mir, dass ich damit richtig lag, gerade Sie auszuwählen.«
»Mich auszuwählen?!«
Einen Moment lang denke ich, dass mich die Admiralin aus dem gleichen Grund in die Kommandantur kommen ließ wie Lieutenant Jessica in ihre Kabine. Ich spüre, wie ich rot werde. Obwohl die Admiralin beinahe doppelt so alt ist wie ich, fühle ich doch, dass ich für ihren Charme nicht unempfänglich wäre.
Sie bemerkt meine Verlegenheit.
»Aber nein«, sagt sie lachend, »nicht aus diesem Grund habe ich Sie herbestellt …«
»Entschuldigen Sie bitte, Admiralin.«
»Schon gut. Aber haben Sie wirklich keine Ahnung, worum es geht?«
»Nein.«
Sie lässt ihren Pilotensitz herumschwenken und weist auf unseren Planeten.
»Wie wär’s, wenn Sie dorthin aufbrechen?«
Auf die Erde zurückkehren! Das ist das große Projekt der Kolonie seit mindestens einer Generation.
Da ich nicht weiß, wer diese Erzählung liest – und ob überhaupt jemand sie eines Tages lesen wird –, sollte ich hier vielleicht ein paar Dinge erläutern.
Wir leben auf dem Mars. Zu Beginn waren wir eine kleine Ansiedlung von Wissenschaftlern, aber seit beinahe einem Jahrhundert sind wir vermutlich alles, was von der Menschheit übrig geblieben ist.
Wir alle haben in der Schule gelernt, wie die letzte bekannte Zivilisation auf Erden endete. Infolge von Klimakatastrophen und wirtschaftlichen Verwerfungen waren ganze Landstriche verödet. Das führte zu Migrationswellen und regionalen Kriegen zwischen Ländern, die sich um Wasser und Rohstoffe stritten. Aber eines Tages löschte eine thermonukleare Bombe eine Hauptstadt des Ostens aus. Es war ein Attentat, man hatte die Bombe dort platziert, sie war nicht von einer Rakete gelenkt worden. Das betroffene Land hatte gute Gründe zu der Annahme, ein rivalisierender Staat habe das Attentat ausgeheckt oder jedenfalls jene unterstützt, die es ausgeführt hatten. Und so ließ ein General der Armee dieses Landes unter Umgehung der üblichen Entscheidungsprozesse drei Marschflugkörper abfeuern. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Europa rief zu Frieden und Mäßigung auf, aber schon bald schnitt ihm ein neuerliches Attentat (diesmal ein gewöhnliches) das Wort ab. Danach wurde alles immer schlimmer, weitere Raketen zogen ihre perfekten Bahnen, jedes Land beschuldigte ein anderes, sie abgeschossen zu haben, und schon bald konnte niemand mehr jemanden beschuldigen, denn die radioaktiven Wolken und der nukleare Winter waren gekommen und hatten der menschlichen Zivilisation ein Ende gesetzt – und zugleich der Klimaerwärmung, obgleich man die doch für unumkehrbar gehalten hatte.
Vom Mars aus hatte die Kolonie diese Apokalypse mit Schrecken und Fassungslosigkeit verfolgt. Das Leben auf dem Mars war beängstigend klaustrophobisch, aber dennoch erträglich, wenn man stets daran dachte, dass man nach ein paar Monaten oder Jahren wieder auf die Erde zurückkehren konnte, um in einer ganz und gar unvirtuellen Realität dem Gesang der Vögel zu lauschen und dem Murmeln der Bäche. Aber nun war die Erde nicht mehr unsere Welt, und seither nennen wir sie nur noch den blauen Planeten, als wollten wir sie von ihrer tragischen Vergangenheit reinigen und ihr einen neuen Anfang ermöglichen.
Es war auch eine Katastrophe für den Fortschritt von Wissenschaft und Technik. Bis dahin hatte die Kolonie stets von dem profitiert, was die Forschung weltweit auf allen Gebieten hervorgebracht hatte, aber nun konnte sie nur noch auf sich selbst zählen – wie eine Universität, der man für immer jeden Kontakt mit der restlichen Welt verboten hatte.
Da man aber die mutmaßlich besten, sorgfältig ausgesuchten Individuen hierhergeschickt hatte und die künstliche Intelligenz bei der Einrichtung der Kolonie schon ziemlich weit fortgeschritten war, hatte es glücklicherweise nicht an Kreativität gefehlt, wenn es darum ging, sich anzupassen. So hat sich in weniger als fünf Generationen eine kleine Gesellschaft herausgebildet, die recht gut funktioniert und weiterhin Neuerungen in Wissenschaft und Technik hervorbringt.
Ich würde nicht sagen, dass bei uns alles rosig wäre, aber zumindest ist alles perfekt organisiert für eine Gemeinschaft von ein paar Hundert Menschen, die wie in einer Blase leben, die sie vor der giftigen Marsatmosphäre schützt.
Das jedenfalls ist die optimistische Sichtweise, und doch sind ziemlich viele Leute nicht richtig glücklich in der Kolonie.
Weshalb das so ist? Weil alles schon vorherbestimmt ist, sorgfältig geplant mit Athenas Hilfe; nichts geschieht hier unerwartet. Außer vielleicht in unseren Liebesbeziehungen, die sind der letzte Bereich, in dem uns noch so etwas wie Abenteuer bleibt. Oder vielmehr ist es Athena, die uns diesen Freiraum belassen hat, denn sie könnte unfehlbar jene Person bestimmen, die am besten zu uns passt, sei es für eine Affäre oder eine dauerhafte Beziehung. Aber man hat beschlossen, dass uns ein Bereich bleiben soll, in dem es Freiheit gibt und Unvorhersehbares. Allerdings geht es selbst dort nicht gerade riskant zu: Für den Fall von Liebeskummer stehen uns sehr effiziente Desensibilisierungstherapien zur Verfügung. Nach ein paar Sitzungen können Sie an der Person, die Sie beinahe verrückt gemacht hat, mit einer Gleichgültigkeit vorbeilaufen, in der sogar ein wenig Abscheu liegt.
Und übrigens: Wenn Sie genervt sind von der Liebe und all ihren Bekümmernissen, können Sie auch ein Medikament einnehmen, das alles Verlangen in Ihnen beseitigt, ohne dass es Ihre Leistungsfähigkeit im Geringsten mindert. Dann haben Sie endlich absolut Ruhe in Herzensangelegenheiten und können sich ganz und gar Ihrer Arbeit widmen und allen Dingen im Leben, die Sie wirklich interessieren.
Wenn es Ihnen aber zu langweilig wird, können Sie die Therapie absetzen, und schwupps, geht es wieder los, und Sie beginnen davon zu träumen, jemanden in die Arme zu schließen.
Alles in allem sind wir also nicht unglücklich, jeder geht einer Tätigkeit seines Zuschnitts nach, aber außer den Forschern, die eine Leidenschaft für ihr Fach hegen, den Militärs, die ganz in ihre Kriegsspiele vertieft sind, und den Ehrgeizigen, die in der Hierarchie aufsteigen wollen, langweiligen sich hier etliche Leute. Ich zum Beispiel.
Selbst wenn wir die schönsten Landschaften aus der Zeit vor der Apokalypse in virtueller Realität durchstreifen können, fehlt uns der echte Kontakt mit der Natur, den wir nie hatten. Wie übrigens die letzten Erdenbewohner, denn die Umwelt war bereits so heruntergekommen und die Unsicherheit so gewachsen, dass die meisten Leute die Metropolen nicht mehr verließen.
Deshalb träumt hier jeder oder zumindest fast jeder von dem großen Projekt der Kolonie: Eines Tages wollen wir auf den blauen Planeten zurückkehren und uns dort ansiedeln. Das wäre endlich ein echtes Abenteuer! Bestimmt nicht ohne Risiken, aber auch mit den Freuden des Unvorhergesehenen und – so denken manche – der Freiheit.
Ich glaube ja, dass diese Leute ein bisschen zu viel träumen, denn weshalb sollte Athena ihre Herrschaft auf dem blauen Planeten nicht fortsetzen wollen?
Jedenfalls wissen wir, dass die radioaktive Verstrahlung entgegen der pessimistischsten Voraussagen schon lange gesunken ist und in Ozeannähe wieder ein angenehmes Klima herrscht.
Aber warum sollte die Admiralin gerade mich für ein so wichtiges Projekt ausgewählt haben, mich, Robin Normandie, gewöhnlicher Rekrut, ohne militärische Karriere und sehr mittelmäßig in den Tests?
»Athena hat Sie ausgewählt«, sagt sie und hebt den Blick vom Bildschirm. »Und außerdem werden Sie nicht der Erste sein. Wir haben schon ein paar Zomos losgeschickt.«
Ich kann es kaum fassen. Zomos sind Berufssoldaten; sie werden für eine Rückkehr zur Erde ausgebildet, ganz anders als ich. Worin könnte ich ihnen vor Ort nützlich sein?
Und jetzt hat die Admiralin ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen.
»Möchten Sie wissen, was Athena über Sie denkt?«
Nach meiner Begegnung mit der Admiralin beschließe ich, bei Yû vorbeizuschauen.
Ich finde sie in der virtuellen Realität, die sich in einem Helm mit undurchsichtigem Visier verbirgt. Er zeigt ihr Bilder, die ich nicht sehe, und maskiert ihr Gesicht – nur nicht den nachdenklich wirkenden Mund (den ich, das muss ich leider zugeben, noch immer küssen möchte) und ihr hübsches Kinn. Sie hält sich sehr gerade und sitzt auf ihren Fersen in einer Position, die bei ihren japanischen Vorfahren verbreitet gewesen sein muss. Ich weiß nicht, ob sie gerade meditiert oder arbeitet. Der Helm übermittelt die Aktivitäten ihres Gehirns direkt an Athena. Das ist eine Technologie, die auf der Erde schon fast fertig entwickelt war, als die Apokalypse kam. Wir haben eine Weile gebraucht, um sie wiederzuerlangen.
Yû ist eine der Programmiererinnen von Athena.
Sie ist unter den besten 0,1 Prozent, was die intellektuelle Leistungsfähigkeit angeht, und unter den besten zwanzig Prozent bei den sportlichen Leistungen, natürlich hochgerechnet auf ihre Gewichtsklasse, denn sie ist federleicht. Und sie ist die Frau, die ich liebe. Falls Sie poetische Metaphern mögen: Ein Regenwurm, der in einen Stern verliebt ist – so fühle ich mich manchmal mit Yû.
Sie hat gehört, wie ich beim Eintreten ihren Namen aussprach, aber ihren Helm hat sie aufbehalten.
»Ich gehe fort«, sage ich.
Nun nimmt sie doch den Helm ab, und zum Vorschein kommt ihr neuer Haarschnitt, mit dem sie aussieht wie eine Mangaheldin. Und als ich das Funkeln ihres Blickes unter dem Bogen der Augenlider sehe und ihre Oberlippe, die immer ein wenig bebt, als wollte Yû gleich anfangen zu weinen (in Wahrheit aber weint sie nie), da spüre ich einmal mehr, wie verliebt ich in sie bin.
»Wohin gehst du denn?«
»Ein bisschen frische Luft schnappen.«
Ich versuche, witzig zu sein, aber ihre Augen werden immer größer.
»Etwa auf den blauen Planeten?«
»Ja. Admiralin Colette will mich da hinschicken.«
»Aber warum denn?«
»Damit ich rauskriege, was mit den Zomos passiert ist. Die Admiralin hat eine Abteilung zur Erde geschickt, aber sie senden keine Nachrichten mehr.«
Yû hockt schweigend da, wendet ihren Blick aber nicht von mir ab.
»Die Zomos sind nicht zurückgekommen, aber dich schickt man dorthin?«
»Ja.«
»Ganz allein?«
»Ja.«
Yû schlägt die Augen nieder und denkt im Schutz ihrer gesenkten Lider nach.
»Gehst du … gehst du unseretwegen fort? … Wegen mir?«
Und ich sehe, wie sie mich ausforscht – sie will wissen, ob ich ihr die Wahrheit sage oder den wahren Grund meines Abschieds vor ihr verberge. (Was ich ja auch gerade tue.)
»Nein, überhaupt nicht, das ist nicht wegen uns. Und glaub mir, ich hoffe sehr, von der Reise zurückzukommen!«
»Sagst du mir auch die Wahrheit?«
»Ja, ich versichere es dir. Ich habe große Lust darauf, die Erde zu entdecken.«
Dass Yû und ich uns getrennt haben, ist bald sechs Monate her. Oder eigentlich hat Yû beschlossen, dass sie mich verlassen muss.
Aus Gründen, die ich nicht erklären kann, war ihr Embryo nicht in gleichem Maße genetisch verbessert worden wie meiner. Das lässt sie so altern, wie es damals die Menschen auf der Erde taten, ungefähr vier Mal schneller als ich. Ich bin nicht unsterblich, aber mit jedem Lebensjahr, das sie abschließt, bin ich nur drei Monate gealtert. Als wir uns kennenlernten, waren wir gleichaltrig, aber heute zählt sie ein paar biologische Jahre mehr als ich, obgleich sie immer noch jung ist. Ich bin bereit, sie für immer zu lieben, aber sie hat beschlossen, dass es nichts bringe, wenn wir zusammenblieben; sie wollte später nicht leiden müssen.
»Lieber mache ich die Yû von heute unglücklich«, sagte sie mir, »wenn ich dadurch die Yû von morgen glücklich machen kann.« Das ist ein Beispiel für einen einfachen Satz aus ihrem Mund. An die anderen habe ich mich gewöhnen müssen wie an eine neue Sprache.
Ich weiß, dass sie jetzt mit Kavan zusammenlebt, einem grenzgenialen Ingenieur, der im selben Rhythmus älter wird wie sie.
»Und wann wirst du zurück sein?«
»Im Laufe des Jahres, denke ich mal.«
Ich hoffe, dass mein Optimismus aufrichtig klingt.
Sie will etwas sagen, hält es aber zurück.
»Es ist lieb von dir, dass du bei mir vorbeigeschaut hast«, sagt sie schließlich, »aber weißt du, eigentlich wäre es nicht nötig gewesen.«
Am Ende des Satzes zittert ihre Stimme.
»Yû …«, sage ich.
Ich gehe auf sie zu und schließe sie in die Arme. Sie lässt mich gewähren.
Ihre warme Wange legt sich an meine, und ich spüre, wie ihr Herz ganz nah an meinem schlägt.
»Auf jeden Fall …«, flüstert sie mir ins Ohr.
»Was denn?«
»Auf jeden Fall kann es für die Zukunft nichts ändern«, seufzt sie, »nicht für dich und mich.«
»Mach dir keine Sorgen, Yû.«
»Auf Wiedersehen«, sagt sie und dreht sich von mir weg.
Ich verlasse den Raum.
Im Fortgehen habe ich gerade noch die durchscheinende Perle gesehen, die an der Spitze ihrer hübschen Nase saß. Eine Träne.
Yû, Licht meines Lebens, ich werde dich immer und ewig lieben.
Und ich habe dir verschwiegen, weshalb ich bereit bin zu dieser Mission.
Um Yû zu sehen, habe ich das Kommandoschiff verlassen und die Große Kuppel durchquert. Sie überspannt den größten Teil der Weltraumkolonie und ist mit atembarer Luft gefüllt. Die Große Kuppel hat wirklich gewaltige Ausmaße, aber vom Kosmos aus gesehen, ist sie nur eine paradiesische kleine Blase, die auf einer Eishölle sitzt – der Marsoberfläche, auf der das Fehlen von Sauerstoff und die kosmische Strahlung jede Form von Leben unmöglich machen. In meiner Kindheit existierte die Große Kuppel noch nicht, aber heute ermöglicht sie es, einen Spaziergang wie früher auf der Erde zu machen. Die Ingenieure haben sie von einer Version zur nächsten sogar noch weiterentwickelt, damit sie die Farben annimmt, die der Himmel hat, wenn man ihn zu verschiedenen Tageszeiten von der Erde aus betrachtet. Sogar das Vorüberziehen der Wolken und den Lauf der Jahreszeiten haben sie einprogrammiert.
Ich will jetzt nicht alle Aspekte des Lebens in der Kolonie beschreiben, sondern einfach erwähnen, dass Körperkraft bei uns unnütz ist – bei allen Anstrengungen assistieren uns Roboter –, damit man keine Risiken eingeht und angesichts einer so lebensfeindlichen Umgebung unbedingt auf alle Einzelheiten achtet. Nicht zuletzt deshalb haben im Lauf einiger Generationen Frauen alle wichtigen Positionen besetzt.
Die Zomos haben wir trotzdem behalten.
»Nur für den Fall der Fälle«, sagte damals Admiralin Bérangère, nachdem sie die Macht übernommen hatte. Das war nach der Großen Rebellion, in der jeder dritte Bewohner der Kolonie ums Leben gekommen war. Ausgebrochen war sie infolge einer Auseinandersetzung zwischen einem Admiral unseligen Angedenkens und dem Vizeadmiral – den beiden letzten Männern, die diese Positionen innegehabt hatten.
Admiralin Bérangère hatte bereits vorausgesehen, dass die Rückkehr auf die Erde eines Tages möglich sein würde. Allerdings würden die Gesellschaften der irdischen Überlebenden, die man dort anträfe, nicht unbedingt sanftmütig sein – und zu allem Überfluss wahrscheinlich noch von Männern angeführt.
Und so beschloss man, die Zomos zu behalten. Sie haben vermutlich am meisten Ähnlichkeit mit dem, was man auf Erden einst als »Spezialeinheiten« bezeichnete; allerdings haben wir ein paar genetische Verbesserungen vorgenommen, was ihre Körperkraft und Aggressivität angeht. Die Zomos bringen ihre Tage damit zu, sich in diversen Sportarten und Kämpfen zu trainieren. Wenn sie in einem Laufgang auftauchen, hört man schon von Weitem ihre Ausrufe und ihr raues Lachen. Die meisten hier mögen sie nicht, was ich ziemlich ungerecht finde. Ich habe sogar einen Freund aus Kindheitstagen, Stan, der Zomo geworden ist.
Auch ihn muss ich noch aufsuchen.
Ich finde ihn im Trainingsraum für den Nahkampf ohne Waffe, wo er gerade mächtig auf einen anderen Zomo eindrischt. Beide tragen Helme und Protektoren mit Mikrochips, die all ihre Bewegungen aufzeichnen, damit man sie später auswerten kann. Sie können aber auch das Ende eines Kampfes auslösen, sobald die Wucht eines Treffers zu Schädigungen zu führen droht.
Genau das ist gerade passiert, als ich ankomme. Der mit den Mikrochips vernetzte Computer hat ein Signal ertönen lassen, um den Kampf zu stoppen, aber Stans Gegner, der sichtlich angeschlagen ist, versucht wieder auf die Beine zu kommen und ruft: »Nein! Wir hören nicht auf, los, weiter geht’s!«
So sind sie, die Zomos.
Stan nimmt seinen Helm ab und kommt mir entgegen.
Er ist ein schönes Exemplar der Gattung Mensch, auf die kriegerische Art. Seine Muskeln füllen den Kampfanzug harmonisch aus. Sein entschlossener Blick unter geraden Brauen, das energische, von einem Grübchen gezierte Kinn und die hohlen Wangen eines Athleten ohne Fettanteile lassen ihn so aussehen, wie er wirklich ist: ein Elitesoldat mit der Gabe zum Kommandanten.
Ich weiß, dass er ziemlich oft in die Kabinen der Offizierinnen gerufen wird. Dennoch herrschen strenge Regeln: nie mehr als zweimal nacheinander mit derselben Person und, was ihn betrifft, höchstens fünf Nächte pro Monat. Nachdem sexuelle Beziehungen zwischen Militärangehörigen jahrzehntelang verboten gewesen waren (was stets unterlaufen wurde), gelangten Athena und ihre Vorläufer schließlich zu den genannten Empfehlungen. Man hält sie für optimal, um Rivalitäten und enge Bindungen, die dem Funktionieren der Truppe schaden könnten, so weit wie möglich zu vermeiden. Stan ist zufrieden damit, er liebt die Abwechslung und verspürt überhaupt keine Lust, sich an jemanden zu binden, es sei denn, an seine Kumpel unter den Zomos – und auch an mich, seinen einzigen Freund, der kein Zomo ist.
»Was machst du denn hier, Rob? Wie geht’s dir?«
Ich berichte ihm von meinem Besuch bei der Admiralin und meiner künftigen Mission.
Mein Freund macht ein noch erstaunteres Gesicht als Yû.
»Die Zomos sind nicht zurückgekommen, und ausgerechnet dich schickt man dorthin?«
Genau das hat auch Yû gesagt, und ich weiß nicht warum, aber es nervt mich langsam.
»Du bist doch nicht mal Berufssoldat«, fügt Stan hinzu.
Ja, anders als er, der sich alle Hoffnungen auf eine Karriere machen darf. Dank seiner vorzüglichen Evaluationen (sowohl für seine Leistungen als auch für seine Menschenführung) kann Stan darauf hoffen, die höchsten Dienstgrade zu erklimmen; sein Handicap, ein Mann zu sein, wird dadurch kompensiert, dass die höheren Offizierinnen eine Vorliebe für ihn haben.
Vielleicht träumt er sogar davon, eines Tages Vizeadmiral zu werden – oder warum nicht gar Admiral, der erste seit mehreren Generationen?
Weil Stan unter seiner rauen Schale ein feinfühliger Freund ist, spricht er eine Sache nicht aus, aber ich weiß, dass er daran denkt: Und außerdem, mein armer Rob, bist du nur ein Neutrum!
Mit meinen Testergebnissen bin ich wirklich nichts anderes. Meine Fähigkeiten reichen nicht aus für die hochqualifizierten Jobs in der Weltraumkolonie, von denen die meisten mit Forschung oder Programmieren zu tun haben.
Neutrum ist ein besseres Wort als Nichtsnutz, aber jeder hier weiß, was es bedeutet. In den fortgeschrittenen Gesellschaften auf der Erde hatten die meisten Neutren bis in die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts Arbeit finden können, denn damals entsprach die Mehrzahl der Jobs noch ihren Fähigkeiten. Allmählich aber hatten die Fortschritte in Robotertechnik und Künstlicher Intelligenz diese Menschen immer nutzloser gemacht. Dabei hatten sie keinen anderen Makel, als durchschnittlich zu sein oder ein wenig unter dem Durchschnitt zu liegen. Die wachsende Zahl nutzloser Menschen hatte auch die mächtigen sozialen Konflikte und Migrationswellen hervorgerufen, durch die auf der Erde ein gewalttätiges und instabiles Lebensumfeld entstanden war.
Die Kolonie hat es gelernt, im Umgang mit ihren Neutren klüger zu sein, spätestens nach der Großen Rebellion, an welcher die Neutren beträchtlichen Anteil gehabt hatten und die ausgebrochen war, nachdem der damals herrschende Admiral sie in eine abgetrennte Zone der Kolonie hatte verbannen wollen.
Um die Neutren nicht mehr auszuschließen, weist man ihnen seither die Rolle von Assistenten an der Seite begabterer Individuen zu.
Es gibt auch ein paar Tätigkeiten, die noch nicht vollständig automatisiert wurden, damit man bei ihrer Ausführung das Gefühl hat, nützlich zu sein. So drosselt man beispielsweise die Roboter, um den Neutren noch ein wenig Spielraum zu lassen.
Aber die Vorstellung, eines Tages als persönlicher Assistent oder Aushilfstechniker unglaublich toll zu sein, erweckt in mir keinen wirklichen Enthusiasmus.
Zum Glück lässt man uns viel Zeit, für Hobbys, für die wir besonders talentiert zu sein glauben, auch wenn Athena schon vorhergesehen hat, dass nie etwas Großes daraus wird. Bei mir sind es das Studium der Weltgeschichte und das Schachspiel.
Ich gehöre zu einer der letzten Generationen von Neutren. Dank der Fortschritte in der Gentechnologie wird es eines Tages in der Kolonie kein einziges mehr davon geben.
Manchmal, wenn auch selten, kommt es zwischen Neutren und Höherbegabten zu Liebesbeziehungen, etwa zwischen Yû und mir, und auch zu Freundschaften, wie Stan und ich sie pflegen.
»Aber warum schicken sie gerade dich zur Erde?«, fährt Stan fort, und es klingt beinahe zornig. »Du wirst dort inmitten von Wilden sein, vielleicht von Kannibalen. Weshalb schicken sie nicht wieder uns Zomos, diesmal vielleicht eine Kampfeinheit?«
Denn die Admiralin hat mir verraten, dass man einen Trupp von zwölf Männern zur Erde geschickt hatte, und zwar unter der Führung von Lieutenant Zulma, einer Art von weiblichem Pendant zu den Zomos (ich kenne sie, denn sie ist mehrmals im Schachklub aufgetaucht – mit dem einzigen Ziel, Yû anzubaggern). Nach einigen beruhigenden Nachrichten, die sie bei ihrer Ankunft auf einer Insel abgeschickt hatten, war von den Zomos kein Lebenszeichen mehr eingetroffen. Auch die automatische Übermittlung ihrer medizinischen Werte war zum Erliegen gekommen.
»Die Admiralin hält es für eine fehlerhafte Denkweise, eine größere Truppe hinschicken zu wollen. Es hat schon einmal nicht funktioniert, und jetzt noch mehr vom Gleichen?«
»Es kotzt mich an, wenn Menschen versuchen, einen auf Künstliche Intelligenz zu machen«, sagt Stan.
Ich schaue ihm eindringlich in die Augen, um ihn zu warnen. Hier weiß man doch nie, wann unsere Gespräche mitgeschnitten werden, und da ich gerade aus dem Büro der Admiralin komme, wird meine Unterhaltung mit Stan mit Sicherheit aufgezeichnet. Aber da er auf allen Gebieten so tolle Ergebnisse hat, weiß er natürlich auch, dass man ihm ein paar Unverschämtheiten durchgehen lässt. Zu Beginn hatten die Leute Angst vor den Überwachungs- und Speichersystemen, deren Daten von Athena verarbeitet werden. Bald aber entdeckte man, welche Vorteile es hat, von automatisierten Systemen bewertet zu werden: Die subjektiv gefärbte Note eines Vorgesetzten hat wenig Einfluss – wie man ja am unvorteilhaften Bericht sehen konnte, den Lieutenant Jessica über mich abgegeben hat.
Athena hat keine wechselnden Stimmungen und lädt dich nicht ein, zu ihr aufs Zimmer zu kommen.
»Okay«, sagt Stan, der mein kleines Warnsignal empfangen hat. »Aber warum ausgerechnet du?«
»Ich habe eine Begabung für Sprachen.«
»Für Sprachen … Aber für welche denn?«
Die gleiche Frage hatte ich der Admiralin gestellt.
Nach Robins Besuch schaffe ich es nicht mehr, mich zu konzentrieren.
Statt mit der Arbeit voranzukommen, habe ich das Gefühl, Kreise in tiefem Sand zu ziehen.
Gefühle sind nicht gerade hilfreich beim Programmieren von Algorithmen.
Athena spürt das vermutlich. Sie schickt mir kleine Nachrichten wie »Bist du müde, meine kleine Yû?« oder »Mach doch mal eine Pause!«.
Athena gelingt es, mit mir zu sprechen wie eine gute Freundin – so stark ist sie geworden. Ich habe gelesen, dass man in der Anfangszeit von »starker« und »schwacher« Künstlicher Intelligenz sprach; heute hat die Unterscheidung gar keinen Sinn mehr.
Am Ende nehme ich den Helm ab und gehe in den für »Techies« wie mich reservierten Raum, um einen Kaffee zu trinken.
Und dort stoße ich auf meine beste Freundin, auf Alma.
»Na, sag mal, was ziehst du denn für ein Gesicht?«
»Robin hat vorbeigeschaut …«
»Ach, der schon wieder …«
»Er wird bald zu einer Mission auf die Erde aufbrechen.«
Alma wirkt genauso überrascht, wie ich es vorhin war.
»Was? Robin Normandie?!«
»Ja, er. Und warum auch nicht?«
»Ähm … ja … warum nicht? Aber wieso gerade er?«
Alma konnte Robin noch nie leiden – oder vielmehr, sie mochte es nicht, dass ich in ihn verliebt war. »Er ist für dich nicht gut genug«, sagte sie mir die ganze Zeit, »und weißt du, am Ende wird er dich betrügen. Ich habe nie verstanden weshalb, aber die Frauen mögen ihn.«
»Admiralin Colette und Athena haben ihn ausgewählt.«
»Gut, dann müssen wir das nicht weiter diskutieren.«
»Weißt du, sie fanden beide, dass Robin der Beste für diese Mission sei.«
»Ja, ja.«
»Ich bin also nicht die Einzige, die etwas Gutes an ihm findet!«
»Nein, natürlich hat er seine guten Seiten …«
»Für mich war es ein seltsames Gefühl, ihn so wiederzusehen.«
»Ja, sicher, du und er, das lief ja eine ganze Zeit …«
»Und jetzt bricht er zur Erde auf.«
»Eine verdammt harte Mission.«
»Die Zomos sind nicht zurückgekommen. Und er … er soll ganz allein hinfliegen …«
»Yû, bitte, nun fang doch nicht an zu weinen …«
Alma schließt mich in die Arme. Eigentlich sollte mich das trösten, aber es funktioniert überhaupt nicht. Emotionaler Sturm, Tränen.
Dieses Miststück von Athena wird eine Weile auf mich warten müssen.
In der Kolonie wird seit Generationen nur Englisch gesprochen. In den ersten internationalen Besatzungen, die man hergeschickt hatte, beherrschte jeder diese Sprache, und die Zeit auf dem Mars war zu kostbar, als dass alle erst einmal die Muttersprachen ihrer Teamkollegen hätten erlernen können. Und inzwischen sind alle diese Sprachen aus der Mode gekommen, außer bei ein paar Leuten, die beschlossen haben, in der Freizeit die Sprache ihrer Vorfahren zu lernen. So hält Yû es mit dem Japanischen.
Aus diesem Grund verstehe ich auch nicht, wie die Admiralin mich für »sprachbegabt« halten kann – nie habe ich eine andere Sprache erlernt als die eine, die ich seit meiner Kindheit spreche.
»Athena«, sagte sie nur und lächelte. »Ihre Resultate in verschiedenen psychometrischen Tests liegen nahe an denen, die Athena von den sprachbegabtesten Erdbewohnern in ihrem Speicher hat. Die Morphologie Ihres Temporallappens bestätigt dies. Im Übrigen muss es Ihnen ja selbst schon aufgefallen sein, dass Sie ein feines Gehör haben.«
Daran ist sicher etwas Wahres. Ob die Admiralin weiß, dass sich meine Freunde schon seit der Schulzeit schieflachen, wenn ich Vorgesetzte imitiere?
»Ähm, ja … ich erinnere mich, dass ich ziemlich gut war, als wir uns in der Schule ein bisschen mit Musik befasst haben. Und meine Lieblingslieder kann ich mühelos vor mich hinsingen.«
»Das und anderes«, sagte sie.
Also wusste sie Bescheid über meine Imitationen.
Habe ich tatsächlich ein Talent für Sprachen? Plötzlich durchströmt mich ein Glücksgefühl: Ich habe eine Begabung! Ich, das Neutrum!
Zugleich aber mache ich mir ziemliche Sorgen, wenn ich an das Verschwinden der Zomos denke. Wie könnte ich es besser machen als sie?
»Besser, weil anders«, sagte Admiralin Colette. »Sie wissen, wie man Konflikte dämpft. Sie haben etwas an sich, das Sie beliebt macht.«
Offensichtlich haben die seit meiner Kindheit erhobenen Daten mehrere Situationen angezeigt, in denen ich Streitigkeiten schlichtete. Und ich selbst habe mich nie in eine Keilerei gestürzt. Obwohl ich nur ein Neutrum bin, wurde ich oft zum Klassensprecher gewählt. All das hat Athena also aufgespürt und verarbeitet.
»In der Praxis sind Sie vermutlich ein guter Unterhändler. Athena sagt das jedenfalls voraus.«
»Das würde aus mir keinen guten Zomo machen«, warf ich ein.
»Genau. Wir haben bereits Krieger entsandt, ausgerüstet mit modernster Technik, automatischen Übersetzungsprogrammen und Waffen.«
Nichttödliche Waffen, dachte ich.
Bei den Zomos ist das ein Gegenstand hitziger Diskussionen. Um zu vermeiden, dass sich wiederholt, was in der Weltgeschichte so oft vorgekommen ist – Massaker an Indigenen durch besser bewaffnete Neuankömmlinge –, hatte die Kommandozentrale beschlossen, dass die Zomos keine tödlichen Waffen mitführen sollten, sondern Schallgewehre oder solche mit elektromagnetischen Wellen, die einen trotzdem auf hundert Meter Entfernung niederstrecken können. Nach Ansicht der Zomos war diese beschränkte Ausrüstung einer der Gründe für den Fehlschlag der Mission. Ich glaube nicht so richtig daran; nichttödliche Waffen können sehr wirkungsvoll sein, und bei Urvölkern erregen sie gewiss Furcht und Schrecken.
Und dann glaube ich auch nicht an ein plötzliches und unerklärliches Verschwinden. Zomos! Perfekt ausgerüstet, wie sie waren, hatten sie doch bestimmt Zeit gehabt, die Marskolonie darüber zu informieren, was mit ihnen geschehen war, und vielleicht sogar zu melden, wem sie auf der Insel begegnet sind.
Ich versuchte, mehr darüber zu erfahren.
»Hat man denn keine anderen Daten empfangen, die etwas über den Grund ihres Verschwindens aussagen?«
Die Admiralin schwieg einen Moment.
»Nichts, was Ihnen von Nutzen sein könnte«, sagte sie ohne jedes Lächeln und zeigte mir damit, dass ich ein wenig zu weit gegangen war.
Als unser Gespräch sich dem Ende zuneigt, kommt mir eine Idee: Was wäre, wenn ich mich der Mission verweigerte? Immerhin bin ich nur ein Wehrpflichtiger, der bald wieder in sein ziviles Leben als Neutrum entlassen wird; ich brauche keine militärische Karriere abzusichern. Und weil wir uns nicht im Krieg befinden, würde mir eine Ablehnung nur eine leichte Strafe einbringen, schlimmstenfalls die Verlängerung meiner Dienstzeit um ein paar Monate oder ein mühseliges Praktikum in einem Bergwerksregiment.
Im Vergleich zu der Gefahr, wie die Zomos von der Bildfläche zu verschwinden und Yû niemals wiederzusehen, ist das ein Klacks.
Und so versuche ich, den Coup zu landen: »Admiralin Colette, eigentlich …«
»Ich bin noch nicht fertig«, erwidert sie.
»Ich wollte nur sagen, dass …«
»Ich bin noch nicht fertig«, wiederholt sie, diesmal in strengerem Ton.
Und ich halte den Mund.
»Sie sind kein Rebell«, schließt sie und schaut dabei auf ihren Bildschirm. »Aber in Ihrem Jahrgang haben Sie trotzdem die schlechteste Punktzahl in ›Respekt vor Autoritäten‹.«
»Aber … aber ich habe mich der Autorität doch nie entgegengestellt!«
»Nein, denn Sie mögen keine Konflikte, und bis jetzt hat man Ihnen wahrscheinlich nur vernünftige Befehle erteilt …«
Nicht immer, denke ich und habe dabei Lieutenant Jessica vor Augen.
»… aber Athena hat trotzdem herausgefunden, dass Sie wenig Respekt vor der Macht haben. Das wäre für Sie ganz sicher wenig hilfreich, wenn Sie eine militärische Laufbahn verfolgen wollten.«
»Das ist, wie Sie wissen, auch gar nicht mein Wunsch, und überhaupt …«
Plötzlich zögere ich. Selbst wenn ich vielleicht wirklich keinen großen Respekt vor Autoritäten habe – wie könnte ich der Admiralin auf höfliche Weise absagen? Wie würde ich sie davon überzeugen, dass ich dieser Mission nicht gewachsen bin?
Aber sie lässt mir nicht die Zeit, meinen Satz zu beenden.
»Sie stehen einer jungen Wissenschaftlerin ziemlich nahe, glaube ich – Yû Mishima?«
Ich bin sprachlos. Weshalb diese Anspielung auf Yû mitten in einem Gespräch über eine militärische Mission? Ich fühle mich ganz durcheinander. Noch ein Beweis dafür, dass ich nicht besonders intelligent sein kann.
»Wir waren einander sehr verbunden …«
»Wir waren einander sehr verbunden«, wiederholt die Admiralin in spöttischem Ton. »Vor lauter Lektüre der alten Autoren reden Sie nun schon so wie sie!«
Diesen Vorwurf macht man mir häufig. Was kann ich dafür, wenn ich hier einer der ganz wenigen bin, die noch Bücher von vor der Apokalypse gelesen haben, und wenn ich ihre Sprache, die oft viel schöner als unsere ist, ins Herz geschlossen habe?
»Immerhin haben Sie wirklich einen guten Geschmack«, meint die Admiralin. »Sie ist schön wie ein Engel, und ihr Gehirn ist eines der besten in der ganzen Kolonie.«
»Sie lebt jetzt mit einem anderen«, sage ich.
»Ja, auch darüber bin ich auf dem Laufenden.«
Die Admiralin schaut mich an. Vermutlich kann sie von meinem Gesicht ablesen, dass ich Yû noch immer liebe.
»Sie wissen vielleicht, dass wir an einem streng geheimen neuen Genprogramm arbeiten.«
»Nein.«
»Das beruhigt mich – wenigstens ein paar Geheimnisse lassen sich hier noch hüten!«
In Wahrheit habe ich schon Gerüchte über dieses Projekt gehört, aber ich habe auch eines gelernt: Mit einem Vorgesetzten soll man nie über ein Projekt sprechen, ohne den genauen Sachverhalt zu kennen.
»Sie wissen ja, dass wir es schon seit einiger Zeit hinbekommen, die menschliche Lebensdauer zu verlängern, indem wir auf die Frühphasen der Embryonalentwicklung einwirken. Sie sind übrigens eines der besten Beispiele dafür.«
»Ja.«
Meiner Meinung nach bin ich nicht gerade ein tolles Beispiel. Als die Forscher mitbekommen haben, dass es ihnen bei mir gelungen ist, den Alterungsprozess zu stoppen, müssen sie sich doch die Haare gerauft haben: »Was für eine Verschwendung – wir haben das Leben eines Neutrums verlängert!« Bei Yû war es sicher genau umgekehrt; sie müssen sehr betrübt gewesen sein, als sie sahen, dass das Verfahren in ihrem Fall nicht funktionierte.
»Nun haben wir ein neues Programm gestartet. Unser Ziel liegt darin, das Altern von Erwachsenen zu stoppen oder wenigstens zu verlangsamen.«
Die Admiralin legt eine kleine Pause ein, als wollte sie mir Zeit lassen zu erahnen, was dies für die Zukunft der Kolonie bedeuten könnte.
»Aber in wie vielen Jahren wird es da Resultate geben?«
Den Gerüchten zufolge steckt dieses Programm noch in den Kinderschuhen und ist weit davon entfernt, Ergebnisse zu liefern.
»In wenigen Monaten«, sagt die Admiralin. »Es hat einen unerwarteten Durchbruch gegeben … und Ihre Frage«, fügt sie in verärgertem Ton hinzu, »lässt mich annehmen, dass Sie doch Bescheid wussten über das Programm.«
Ich versuche gar nicht erst, es zu leugnen.
»Wir können erst einmal nur mit sehr wenigen Versuchspersonen beginnen. Zusätzlich zu Athena werden alle höheren Offiziere und wichtigen zivilen Funktionsträger eine Liste der Personen erstellen, die für die Kolonie von höchstem Wert sind. Natürlich hat da jeder seine Lieblingskandidaten …«
Und als ranghöchste militärische Kraft werde die Admiralin natürlich ein entscheidendes Wort mitzureden haben, wenn man die Liste erstellt.
»Ich verstehe«, sage ich.
Durch das Bullauge erblicke ich unseren blauen Planeten, und erneut geben die Wolken den Blick frei auf die glitzernde Oberfläche eines Ozeans.
»Sie wissen, dass ich stets Wort halte«, setzt die Admiralin hinzu.
Und das stimmt auch; sie hat sich diesen Ruf im Lauf ihrer ganzen Karriere erworben.
»Also, Rekrut Robin Normandie, melden Sie sich freiwillig für diese Mission?«
Von diesem Teil unseres Gesprächs habe ich Yû nichts erzählt.
Wenn meine Mission schlecht ausgeht, möchte ich nicht, dass sie sich verantwortlich fühlt für mein Verschwinden – ihr ganzes neues Leben lang.
Ich habe etwa hundert Stunden in den Lernmaschinen zugebracht und darin sogar geschlafen, um mich mit den verschiedenen polynesischen Sprachen vertraut zu machen, die Athena gespeichert hat.
Die einzigen Zeichen menschlicher oder nachmenschlicher Aktivität, die man seit einem guten Jahrhundert ausmachen kann, stammen nämlich alle von kleinen Inseln des Pazifischen Ozeans, und auf einen dieser Festland-Konfettischnipsel hat man auch die Zomos geschickt.
Die Übersetzungscomputer der Zomos waren mit diesen zum Teil gewiss untergegangenen Sprachen programmiert, und vielleicht ist auch dies – neben dem aggressiven Auftreten der Zomos – ein Grund für das Fehlschlagen der Mission.
Die Kommandozentrale (und damit Athena) hat es für richtig befunden, mich mit den ehemaligen Sprachen dieser Völker vertraut zu machen. So würde ich die heutigen Bewohner schneller verstehen können und womöglich nicht von der Bildfläche verschwinden – anders als unsere Spezialeinheiten.