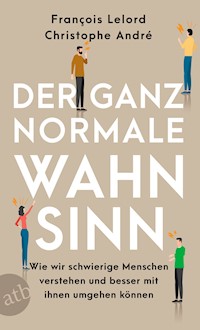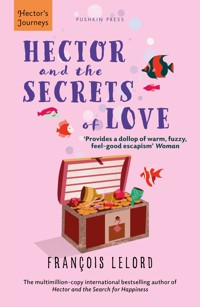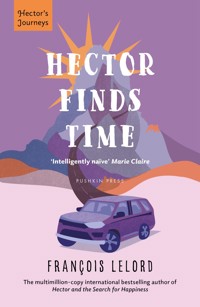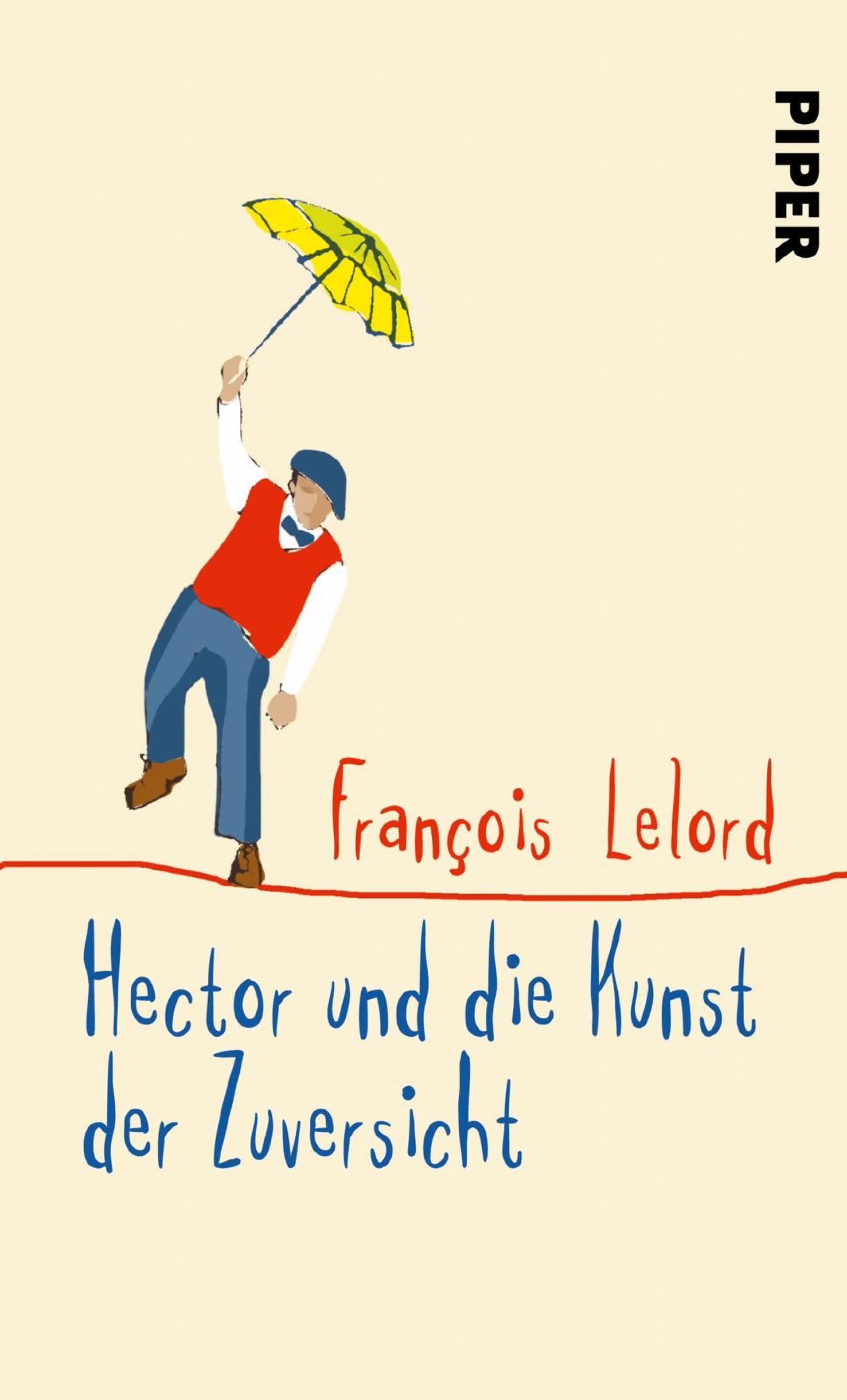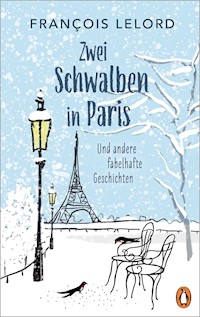
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählungen aus der Welt, in der wir leben
In zehn fabelhaften Geschichten erzählt der beliebte Bestsellerautor und Glücksspezialist François Lelord von Mensch und Tier. Und er offenbart uns, dass unser Umgang mit der Natur nicht nur unseren Fortbestand sichert, sondern auch der Schlüssel zu unserem Glück ist. Auf seine lebenskluge und humorvolle Art lässt er Hunde, Schwalben und Schuppentiere zu Wort kommen. Inspiriert vom großen Dichter Jean de la Fontaine hat Lelord mit seinen ökologisch-psychologischen Geschichten eine zeitgemäße Form der Fabel entwickelt. Darin hat er stets unsere menschliche Wesensart, unser Streben nach einem guten Leben und unseren Umgang mit der Welt, in der wir leben, im Blick.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ZUMBUCH
In zehn fabelhaften Geschichten erzählt Glücksspezialist François Lelord von Mensch und Tier. Und er offenbart uns, dass unser Umgang mit der Natur nicht nur unseren Fortbestand sichert, sondern auch der Schlüssel zu unserem Glück ist. Auf seine lebenskluge und humorvolle Art lässt Lelord Schwalben und Schuppentiere zu Wort kommen. Inspiriert vom großen Dichter Jean de la Fontaine, hat Lelord mit seinen ökologisch-psychologischen Geschichten eine zeitgemäße Form der Fabel entwickelt: Sie hat unsere menschliche Wesensart, unser Streben nach einem guten Leben und unseren Umgang mit der Welt, in der wir leben, im Blick.
ZUMAUTOR
François Lelord, geboren 1953, studierte Medizin und Psychologie in Frankreich und Kalifornien. Eines Tages schloss er seine Praxis in Paris, um zu reisen und für sich und seine Leserinnen und Leser Antworten auf die wirklich großen Fragen des Lebens zu finden. Hectors Reise und die folgenden sieben Romane um den Psychiater Hector und seine Suche nach dem Glück eroberten ein Millionenpublikum. Zuletzt erschien mit großem Erfolg bei Penguin sein Roman Es war einmal ein blauer Planet. François Lelord lebt mit seiner Familie in Paris.
»Macht beim Lesen einfach so richtig glücklich!«Pforzheimer Zeitung
»Wenn man dieses Buch gelesen hat, ich schwöre es Ihnen, ist man glücklich.«Elke Heidenreich zu Hektors Reise
»Die Bücher von François Lelord setzen zeitgemäß fort, wo Exupéry aufhörte.«Profil
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
FRANÇOIS LELORD
und andere
fabelhafte
Geschichten
Mit Illustrationen von Daphne Patellis
Aus dem Französischen
von Ralf Pannowitsch
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin-Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2022 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: Daphne Patellis
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28630-9V002
www.penguin-verlag.de
Inhalt
EINS Im Rosengarten
ZWEI Das Schuppentier, die Katze und der kleine Junge
DREI Titus und die weiße Frau
VIER Die Gesetze der Natur
FÜNF Zwei Muttersöhnchen
SECHS Der beste Therapeut
SIEBEN Von Eisbrechern und Eisbären
ACHT Der letzte Mann
NEUN Octobre
ZEHN Zwei Schwalben in Paris
Nachwort
EINS
Im Rosengarten
Er war als Präsidentenhund geboren.
Nun ja, im Grunde nicht wirklich; seine Mutter war eine große, schokoladenbraune Hündin gewesen, die in einem Holzhaus am Ufer eines Sees gelebt hatte. Der See war von Ahornbäumen gesäumt, deren Blätter sich im Herbst rot färbten. Auf dem Rasen, der in einem leichten Gefälle zum Wasser hinabreichte, hatte er als Welpe mit seinen Geschwistern gespielt. Er hatte sehr früh zu schwimmen begonnen, was seine Mutter beunruhigt hatte, auch wenn seine Rasse dafür bekannt war, geschossenes Wildgeflügel aus dem Wasser zu holen.
Auf die Jagd war er allerdings nie gegangen, denn nun lebte er in einem anderen Haus, das ganz weiß und von Gärten und sogar einem Park umgeben war. Es lag im Herzen einer großen Stadt. Zuweilen nahmen ihn seine Besitzer mit zu anderen Anwesen, die auch immer große Gärten hatten. Eines davon befand sich an der Ozeanküste, und er mochte es ganz besonders, denn der Präsident nahm ihn dort immer zu Strandspaziergängen mit und warf ihm salzwassergetränkte Holzstücke ins Meer, und dann schwamm er hinaus und holte sie zurück, um sie stolz vor seinem Herrn niederzulegen. Das waren seine schönsten Erinnerungen.
Aber er war ohnehin ein glücklicher Hund, denn seine Besitzer und auch deren Kinder behandelten ihn rundum freundlich, und in diesem großen Haus, in das andere Menschen jeden Tag zum Arbeiten kamen, kannte ihn jeder, und alle grüßten ihn freundschaftlich. Und selbst wenn er Dummheiten machte (jetzt sowieso nicht mehr, aber in seiner Jugend war es manchmal passiert) – wenn er etwa einen Teil eines wichtigen Dokuments zerkaut und am Ende sogar verschluckt hatte oder darangegangen war, das Bein eines Schreibtischs anzunagen, an dem schon alle Präsidenten vor seinem gesessen hatten –, schimpfte man nie lange mit ihm.
Diese günstigen Umstände und sein glückliches Naturell führten dazu, dass Yop fast immer ein fröhlicher Hund war, vor allem, wenn er mit den Kindern des Präsidenten spielte. Aber inzwischen waren sie größer geworden; morgens kam immer ein riesiges Auto, das sie in die Schule brachte, und dann waren sie tagsüber abwesend, und später saßen sie oft an ihren Hausaufgaben. Und so begann Yop sich manchmal ein wenig einsam zu fühlen, und das Wasser der Seen fehlte ihm mehr als früher.
Eines Tages aber war es anders als an den übrigen Tagen. Schon beim Aufwachen merkte er, dass die Leute auf den Fluren schneller unterwegs waren und dass sie (wie ungewöhnlich!) nicht auf ihn achteten. Der Präsident und seine Gattin waren übrigens schon vor ihm aufgestanden; es hatte ihn überrascht, ihr Bett leer vorzufinden, wo er es doch so liebte, sie zu wecken.
Im Laufe des Morgens lief er ihnen ein paarmal über den Weg, aber außer einem knappen »Hello Yop« nahmen sie sich keine Zeit für ihn, nicht einmal, um ihn zu wuscheln oder zu einem kleinen Spiel einzuladen. Weil er ein sehr intelligenter Hund war, erriet er, dass es nicht an ihm lag, sondern dass etwas im Gange war, was bei den Menschen ein anderes Verhalten auslöste.
Später am Tag begriff er, was es war: Ein anderer Präsident stattete seinem Präsidenten einen Besuch ab! Gleich bei seiner Ankunft sah Yop, dass sich dieser Präsident von seinem ziemlich unterschied; er war nicht so groß, und vor allem hatte er ein unbewegliches Gesicht, das überhaupt nichts ausdrückte. Das verwunderte Yop sehr, denn er brachte sein Leben damit zu, die Gesichter der Leute zu betrachten, um herauszufinden, ob sie fröhlich und zu einem Spiel aufgelegt waren oder aber wütend oder traurig. (Besonders gut erinnerte er sich an einen Tag, an dem die Frau des Präsidenten traurig ausgesehen hatte, und da war er gekommen und hatte ihr die Pfoten auf die Knie gelegt, und sie hatte plötzlich zu weinen begonnen und gesagt: »Wenigstens du …«) Doch aus dem Gesicht dieses fremden Präsidenten konnte man überhaupt nicht erraten, ob er zufrieden war oder nicht – selbst dann nicht, wenn er kaum merklich lächelte (seine Augen aber lächelten nicht mit).
Und dieser Präsident war mit seinem Hund gekommen! Das verblüffte Yop noch mehr. Zunächst einmal war er von den Augen dieses Hundes überrascht; sie waren von einem sehr blassen Blau – wie Eis in der Morgendämmerung. Sonst hatte Yop in den Augen der Hunde immer nur Farben gesehen, die von Goldgelb bis zu einem tiefen Dunkelbraun reichten. Seine eigenen Augen hatten, so sagte es jedenfalls die Tochter des Präsidenten, die Farbe von Karamell.
Und noch eine Überraschung: Während er dem anderen Hund Willkommenssignale aussandte, indem er mit dem Schwanz wedelte und kurze Belllaute ausstieß, um anzuzeigen, dass er Bekanntschaft mit ihm schließen wollte, ließ der andere kein einziges Hundezeichen erkennen. Er schaute Yop mit seinem eisblauen Blick einfach nur fest in die Augen, und sein Schwanz war aufgerichtet und bewegte sich nicht.
»Glauben Sie, dass sich die beiden gut verstehen werden?«, fragte Yops Präsident.
»Ja. Yak weiß, dass das hier nicht sein Revier ist.«
Yop sah, dass sein Präsident ein wenig erstaunt über diese Antwort war, aber zumindest schien sie ihn zu beruhigen. Und als die beiden Präsidenten in den großen Korridor einschwenkten, der zum Büro von Yops Präsident führte, folgten ihnen die Hunde. Als sie so nebeneinander herliefen, ohne sich anzuschauen, war es Yak, der das Schweigen brach.
»Lebst du schon lange hier?«
»Schwer zu sagen. Bei meiner Ankunft war ich jedenfalls noch ein Welpe.«
»Das hat nichts zu bedeuten. Aber du wirkst tatsächlich noch ziemlich jung.«
»Ja, und ich spiele gern! Du auch?«
»Ich glaube, ich bin schon länger Präsidentenhund als du«, sagte der andere, ohne die Frage zu beantworten.
Sie waren inzwischen im Büro des Präsidenten angelangt, und als wohlerzogene Hunde legten sie sich nahezu geräuschlos zu den Füßen ihrer Herren nieder.
»Schön, dass Sie gekommen sind«, sagte Yops Präsident, »wir haben wichtige Themen zu besprechen.«
»Ich glaube nicht, dass sie für mich von gleicher Bedeutung sind«, entgegnete der andere.
Schon wieder sah Yop, dass sein Präsident von der Antwort ein bisschen überrascht und sogar verärgert war.
»Mag sein, dass Sie diese Themen nicht für dringlich ansehen, aber wichtig sind sie trotzdem. Wir müssen an die Zukunft unserer Völker denken.«
»Ich denke unaufhörlich an die Zukunft meines Volkes.«
»In diesem Fall werden Sie mir zustimmen, dass wir vernünftige Abmachungen treffen müssen, um uns die Ressourcen des Hohen Nordens aufzuteilen.«
»Die Chinesen haben bereits begonnen, sich dort zu bedienen. Auf unsere Abmachungen haben sie nicht gewartet«, antwortete der andere Präsident, und diesmal sah Yop einen beinahe unmerklichen Schatten von Verärgerung über sein Gesicht huschen.
Danach wurde die Unterhaltung langweilig für Hunde, und Yop begann ungeduldig zu fiepen. Sein Präsident bemerkte es.
»Ich glaube, unsere Hunde haben Langeweile«, sagte er, »wir sollten sie lieber nach draußen lassen.« Und schon hatte er sich erhoben, um die Tür zu öffnen, und Yop war begeistert aufgesprungen. Der andere Präsident stand nicht auf; sein Hund hatte sich nicht gerührt, aber nun gab er ihm einen kurzen Befehl, und Yak stellte sich auf die Pfoten und folgte Yop.
Man öffnete ihnen die Tür, die vom Büro in den Garten führte.
Yop wollte loslaufen, damit Yak die Verfolgung aufnahm und sich ein Wettrennen mit ihm lieferte, aber der andere Hund machte keine Anstalten.
»Ich renne nur, wenn es nützlich ist«, sagte Yak.
»Ach so?«, meinte Yop enttäuscht. »Und wann ist es nützlich?«
»Wenn mein Herr ein Stück Holz oder einen Ball wirft und ich das Ding zurückbringen soll.«
»Na klar!«, sagte Yop. Die Antwort beruhigte ihn. Wenigstens gingen dieser Präsident, der so anders war als seiner, und sein seltsamer Hund auch ein paar normalen Beschäftigungen nach.
»Oder um ihn zu verteidigen.«
»Um ihn zu verteidigen? Dafür hat mein Präsident immer ein paar Männer und Frauen, wenn er das Haus verlässt. Sie bleiben ganz in seiner Nähe.«
»Hat meiner auch«, sagte Yak. »Aber er weiß, dass er mir immer vertrauen kann. Seine Wachen hingegen …«
Yop fand es unglaublich, dass man seinen eigenen Wachen nicht trauen konnte. Das wäre ihm nie in den Sinn gekommen und seinem Präsidenten auch nicht, da war er sich ganz sicher.
»Der Präsident sagt oft zu mir: ›Mein kleiner Yak, du bist meine letzte Verteidigungslinie …‹« Und zum ersten Mal bemerkte Yop bei Yak einen Anflug von Genugtuung.
Na schön, dann würden sie eben nicht rennen, denn Yak war der Gast und wünschte es nicht. Und so setzten sie ihren Spaziergang fort.
»In diesem Garten gibt es viele Rosen«, sagte Yop.
»Sie duften zu stark«, meinte Yak, »da kann man nichts anderes mehr riechen.«
»Die Frau meines Präsidenten kommt gern hierher, und manchmal schneidet sie Rosen für die Gäste.«
»Das macht sie selbst?!«
»Ja, sie stellt gern Sträuße zusammen, um sie dann zu verschenken.«
Yak blieb stehen, um die Rosen in Augenschein zu nehmen, und Yop sagte sich, dass dieser Hund unter seiner rauen Schale vielleicht doch empfindsam war und Blumen liebte.
»Wenn sich jemand in diesem Garten verstecken würde, könnte man ihn nicht wittern.«
»Aber wer soll sich denn hier verstecken?« Yop konnte nicht recht nachvollziehen, was dem anderen Hund durch den Kopf ging.
»Man weiß nie«, sagte Yak.
Um den Park zu besuchen, mussten sie wieder durchs Haus laufen und durch den Salon, in dem ihre Herren noch immer miteinander redeten. Wenn man ihnen die Türen öffnete, um sie durchzulassen, nahmen sie das für selbstverständlich, denn immerhin waren sie Präsidentenhunde. Als sie schließlich in den Park gelangten, drang ihnen sofort der Lärm in die Ohren.
Hinter dem Zaun, der den Park umgab, stand eine überschaubare Menschenmenge. Die Leute hielten Schilder hoch und stießen Schreie aus. Yop überraschte das nicht weiter; so etwas kam immer wieder mal vor. Aber er sah, wie sich auf Yaks Rücken das Fell sträubte und wie er die Zähne fletschte.
»Hör auf! Beruhige dich doch.«
»Aber sie werden gleich angreifen.«
»Nein, nein. Sie bleiben immer auf der anderen Seite des Zauns.«
»Willst du etwa sagen, dass es bei euch alle Tage so zugeht?«, fragte Yak und knurrte.
»Nein. Manchmal bleiben sie einen Tag, manchmal ein bisschen länger, aber am Ende ziehen sie immer ab.«
»Aber warum kommen sie dann überhaupt?«
Zum ersten Mal sah Yop, dass der bisher so selbstsichere Yak irritiert war. Das freute Yop, zeigte es doch, dass auch er mit seiner Erfahrung als Präsidentenhund beeindrucken konnte.
»Sie kommen, weil sie mit meinem Präsidenten nicht zufrieden sind.«
»Aber warum nimmt dein Präsident das einfach so hin?«, fragte Yak. »Man sollte sie fortjagen!« Und er zeigte aufs Neue die Zähne.
»Wieso denn? Sie stören doch niemanden, oder?«
Yak blickte ihn an, und einen Augenblick lang hatte Yop das unangenehme Gefühl, dass ihn der andere Hund für einen Idioten hielt.
»Ich vermute, in deinem Land ist das anders«, sagte er.
»Allerdings!«
Sie beschlossen, eine kleine Parkrunde zu drehen, auch wenn der Lärm der Menschen ein bisschen störend war. Diesmal lag das Problem darin, dass man nichts anderes hören konnte. Sie waren gerade dabei, ein Loch zu inspizieren, das wie der Zugang zu einem Kaninchenbau aussah (endlich ein gemeinsames Interessengebiet), als Yak plötzlich auffuhr.
»Ich habe den Namen meines Präsidenten gehört.«
Yop kannte diesen Namen nicht, aber im Geschrei der Menschen jenseits des Parkgitters kehrte immer das gleiche Wort wieder, und Yop spürte deutlich, dass es nicht die aufmunternden Rufe waren, die seinem eigenen Präsidenten manchmal zuteilwurden. Nein, er konnte ganz deutlich den Hohn oder die Wut in den Stimmen der Menschen ausmachen. Und Yak ging es natürlich genauso; er war schon wieder auf dem Sprung und hatte eine drohende Körperhaltung angenommen, wodurch er ziemlich furchterregend wirkte.
»Ja«, meinte Yop, »vielleicht ist das wirklich sein Name.«
»Nicht bloß vielleicht – ich habe ihn genau erkannt!«
Und er fixierte Yop mit einem eisigen Blick, als wäre jemand, der den Namen seines Präsidenten nicht erkannte, bereits sein Feind. Yop war es einen Moment lang mulmig zumute, aber dann sagte er sich, dass er sich nicht zu fürchten brauchte. Dieser Yak war zwar sonderbar, aber nicht verrückt.
»Selbst wenn es sein Name war, riskiert dein Präsident nichts – er ist ja mit meinem zusammen.«
Yak schien sich dieser Tatsache zu beugen. Er beruhigte sich, aber später sah Yop, wie sich sein Körper immer wieder anspannte, sobald die Menge den Namen des anderen Präsidenten rief.
Plötzlich erzitterte vor ihnen ein Busch. Yop hatte es gerade erst bemerkt, als Yak auch schon nach vorn geschossen und zwischen den Zweigen verschwunden war.
»Halt!«, rief Yop.
Er fürchtete, dass Yak einen Gärtner angreifen würde. Die kamen nämlich öfter hier entlang, wobei es unmöglich schien, dass ein Gärtner sich von Kopf bis Fuß in so einem kleinen Strauch verbergen konnte. (Immerhin war Yop mal auf einen gestoßen, der in einem ganz ähnlichen Gebüsch lag und schlief; sein Atem hatte irgendwie merkwürdig gerochen.)
Aber da tauchte Yak schon wieder auf, und zwischen den Fangzähnen hielt er ein großes Kaninchen, dessen Körper ihm zu beiden Seiten der Schnauze hinabbaumelte. Sandfarbenes Fell, schneeweißer Bauch – Yop erkannte es sofort: Es war Tom, das Häschen von Dorothy, einer der Töchter des Präsidenten. Und jetzt lebte Tom nicht mehr.
»Du hast Tom getötet!«
»Ja, gleich im ersten Anlauf«, sagte Yak stolz und ließ das Kaninchen ins Gras fallen.
»Das ist das Kaninchen der Präsidententochter!«
Yak wirkte überrascht, aber es schien ihm überhaupt nicht peinlich zu sein.
»Was hatte es dort zu suchen? Kaninchen lässt man nicht einfach so herumlaufen. Jetzt war ich es, der es erwischt hat, aber genauso gut hätte eine Katze kommen können.«
Da hatte er recht. Tom war vor einigen Tagen aus seinem Auslauf entwichen, und man hatte erfolglos nach ihm gesucht. Jetzt wurde Yop alles klar: Es war Tom gewesen, der das Loch von vorhin gebuddelt hatte.
»Da wird sie aber traurig sein«, meinte er.
»Sie hätte ja besser aufpassen können«, sagte Yak.
Dieser Kommentar machte Yop wütend. Yak bemerkte es, und die beiden Hunde starrten sich lange an. Yop war wirklich aufgebracht, er hätte seine Zähne in Yak schlagen können. Er sah, dass Yak es spürte, aber dabei völlig ruhig blieb. Diese vollkommene Ruhe machte Yop Angst; ein solcher Hund war ihm wirklich noch nie begegnet.
»Wir werden uns doch nicht wegen eines toten Karnickels beißen«, sagte Yak.
Yop antwortete darauf nicht. Der andere Hund hatte gar nichts begriffen. Wenn sie sich gebissen hätten, dann doch nicht wegen Tom – den hatte Yop immer total uninteressant gefunden –, sondern wegen der Tochter des Präsidenten, die nun Kummer haben würde. Aber am besten beendete man diese Diskussion.
»Wir lassen ihn hier liegen«, sagte Yop.
»Nein«, entgegnete Yak, »ich habe ihn getötet, da gehört er mir.«
»Wie du willst.«
Es brachte nichts, mit diesem Hund zu diskutieren, und außerdem war Yop gerade ein Gedanke gekommen: Wenn sie das tote Kaninchen dort herumliegen lassen hätten, dann hätten die Leute (und ganz besonders Dorothy) am Ende noch geglaubt, er, Yop, hätte es zur Strecke gebracht.
Sie näherten sich wieder dem Haus, und Yak hielt das Kaninchen in der Schnauze. Wie man sich hätte ausmalen können, gerieten die Menschen bei diesem Anblick in helle Aufregung. Man öffnete ihnen die Türen, und eine der Wachen des Präsidenten wollte Yak das Kaninchen abnehmen, begriff aber gleich, dass es nicht möglich war.
Man ließ sie ins Büro.
»O mein Gott«, sagte Yops Präsident, »das ist ja Tom!«
»Was denn?«, fragte der andere Präsident. »Sie geben hierzulande Kaninchen richtige Vornamen?«
»Es ist das Kaninchen meiner Tochter«, sagte Yops Präsident und sah dabei ausnahmsweise verärgert aus.
»Oh, das tut mir leid«, sagte der andere Präsident, aber dabei verzog er, wie Yop bemerkte, keine Miene.
»Es stimmt schon, es hätte nicht frei im Garten herumlaufen sollen«, sagte sein Präsident, der die Situation offenbar entschärfen wollte. »Will Ihr Hund es noch lange so halten? Es wird den Teppich bekleckern.«
Und tatsächlich tropfte Tom etwas Blut aus dem Maul und besprenkelte den Teppich.
Der andere Präsident erteilte einen knappen Befehl, und Yak ließ das Kaninchen fallen. Eine der Wachen, die den Hunden ins Büro gefolgt war, hob es auf und schaffte es fort.
»Wir haben in Sibirien sehr schöne Kaninchen«, sagte der andere Präsident. »Darf ich Ihrer Tochter ein solches schenken?«
»Ich glaube, da würde sie nicht Nein sagen. Danke.«
Der andere Präsident schaute auf die beiden Hunde und sagte: »Ich glaube, sie bleiben besser in unserer Nähe. Yak ist es nicht so gewohnt, ohne mich herumzulaufen.«
»Sie haben recht. Und ich möchte auch nicht, dass er beim nächsten Mal einen toten Gärtner anschleppt.«
Die beiden Präsidenten lachten, und Yop sagte sich, dass sein Präsident sehr begabt darin war, gute Stimmung zu verbreiten. Das war ihm schon öfter aufgefallen. Aber als er an Dorothy dachte, machte ihn das doch wieder traurig. Er blickte zu Yak hinüber, der seinem Herrn zu Füßen saß und vollkommen ruhig wirkte.
Schließlich schlug sein Präsident dem anderen Präsidenten vor, eine kleine Besichtigungstour durchs Haus zu machen. Die Leute kamen aus ihren Büros und stellten sich entlang der Korridorwände auf, um die beiden Präsidenten mit einem dezenten Nicken zu begrüßen. Manchmal hielt Yops Präsident inne, um dem anderen Präsidenten eine wichtige Person vorzustellen, und dann wechselten sie lächelnd ein paar Worte. Sogar der andere Präsident hatte jetzt ein Lächeln auf den Lippen. Es war wie eine kleine Prozession, denn außer den beiden Hunden folgten ihnen auch die Leute, die mit Yops Präsident häufig in dessen Büro arbeiteten, und außerdem ein Leibwächter, den Yop gut kannte, sowie zwei weitere, die ihm unbekannt waren, denn sie gehörten zum anderen Präsidenten.
Yak hielt sich ganz eng an seinen Herrn, ohne ihn auch nur ein einziges Mal anzuschauen. Das fiel Yop gleich auf, denn er selbst konnte es sich nicht verkneifen, seinem Herrn oft forschend ins Gesicht zu blicken. Aber nein, Yak schaute lieber jeder Person in die Augen, die man seinem Präsidenten vorstellte, und bisweilen warf er auch einen Blick auf die Männer und Frauen, welche die Wände der Korridore säumten.
Yop bemerkte, dass die Präsidenten ein wenig länger mit einer blonden jungen Frau sprachen, der auch die anderen Menschen viel hinterherschauten, wenn sie ihnen gerade den Rücken zudrehte, und diesmal sah er, dass der andere Präsident so richtig lächelte. Offenbar sagte er lustige Dinge zu der jungen Frau, denn sie lachte kurz auf und errötete. Yak hingegen schaute sie überhaupt nicht an, er folgte mit seinen Blicken lieber zwei Männern in Arbeitsanzügen, die mit Werkzeugkisten in den Händen an ihnen vorbeigekommen waren.
»Kennst du die?«, fragte er Yop.
»Nein, diese beiden nicht, aber hier kommen oft Leute arbeiten, die so angezogen sind.«
Yak schaute den beiden Männern hinterher, während sie sich entfernten.
»Kein Grund zur Unruhe«, meinte Yop, »das ist hier ganz üblich. Sie kommen, um irgendwas zu reparieren.«
Yak entgegnete nichts darauf.
Am Ende nahmen sie Kurs auf die Präsidentenwohnung, und das kam gerade zur rechten Zeit, denn Yop verspürte langsam Hunger, und in der Küche hatte man ihm seinen Fressnapf hingestellt, in dem sein Lieblingsessen war: Würstchen aus Hühnerfleisch, Tofu und Süßkartoffeln.
»Willst du das wirklich fressen?«, fragte Yak ungläubig.
»Ja, ich freue mich immer, wenn Hähnchentag ist.«
Eigentlich hätte er Yak gern angeboten, die Mahlzeit mit ihm zu teilen, aber ihn hielt die Vorstellung zurück, dass seine Schnauze dann ganz nahe an Yaks Schnauze sein würde – Yaks Schnauze, die sich in sein Futter bohrte.
In diesem Augenblick näherte sich der Leibwächter des anderen Präsidenten mit einem Teller und stellte ihn vor Yak ab. Ein großes Stück rohes Fleisch lag darauf, noch nicht vom Knochen gelöst. Yak stürzte sich darauf, ließ den Knochen krachen und schlug seine Zähne in den Fleischbrocken, als würde der noch leben und müsste erst getötet werden.
Yop erinnerte sich, so etwas auch schon einmal gefressen zu haben, aber die Frau des Präsidenten hatte rotes Fleisch vom Speisezettel der Familie gestrichen, außer wenn Gäste kamen; der Präsident aß selbst keines mehr, und da Yop mehr oder weniger den Ernährungsgewohnheiten der Familie folgte, hatte auch er keines mehr im Fressnapf. Er hatte begriffen, dass es schlecht war, Fleisch zu verzehren, wenn es auch anders ging, und hier hatte man natürlich alle Möglichkeiten, sich anders zu ernähren. Auf jeden Fall wusste er, dass die Frau des Präsidenten immer recht hatte.
Wenn er allerdings beobachtete, wie das rote Fleisch zwischen Yaks Fangzähnen verschwand, spürte er, dass er selbst gern davon gekostet und vielleicht gar ein ganzes Stück gefressen hätte. Aber gleich danach machte er sich wegen dieses Gedankens Vorwürfe; es war ein bisschen, als hätte er plötzlich Lust bekommen, auf den Teppichboden zu pinkeln.
Die Präsidenten redeten noch immer im Salon miteinander; man hatte sogar Holzscheite im Kamin angezündet, und die beiden Hunde legten sich unweit des Feuers nieder.
»Das erinnert mich an meine Welpenzeit«, sagte Yak plötzlich.
»Hast du da an einem Kamin geschlafen?«
»Nein. Wenn die Nacht hereinbrach, wurde ein großes Feuer angezündet, und man legte mich in die Nähe, damit ich es nicht zu kalt hatte.«
»Aber war es ein großes Haus?«
Yak schaute ihn an. »Es war überhaupt kein Haus, sondern draußen.«
»Willst du damit sagen, du hättest die Nacht unter freiem Himmel zugebracht?«
»Nein, später am Abend haben die Menschen Zelte aufgestellt.«
Was Zelte waren, wusste Yop: Der kleine Sohn des Präsidenten hatte auf dem Rasen ein Zelt, in dem er manchmal mit anderen kleinen Jungen spielte, aber nachts blieb er dort nie. Die Nacht im Freien zu verbringen, wenn Schnee lag – was für eine sonderbare Idee! Yaks Leben war wirklich ganz anders verlaufen als seines.
»Erinnerst du dich an deine Mutter?«, fragte er, denn er wollte Yak besser verstehen.
»Ja, sie war Leithündin.«
»Leithündin?!«
Yak schaute ihn schon wieder groß an, und Yop sah, dass auch er allmählich begriff, dass sie ein sehr unterschiedliches Leben gehabt hatten.
»Wenn man einen Schlitten über den Schnee zieht, gibt es ganz vorn immer einen Leithund, der die Befehle des Herrn am schnellsten ausführt und dem die anderen folgen müssen.«
»Und dein Vater?«
»Der war der Anführer der Meute.«
»Und ebenfalls Leithund?«
»Nein, das ist fast nie der Fall. Wenn du Chef von anderen Hunden wirst, dann gehorchst du den Menschen nur selten so richtig. Und du musst wachsam sein, denn es gibt immer ein anderes Männchen, das deinen Platz einnehmen will.«
Es war eine andere Welt, dachte Yop. Er selbst hatte nie darum kämpfen müssen, Chef der anderen Hunde zu sein, und seine Besitzer erteilten ihm niemals Befehle, außer wenn er aus ihrem Bett verschwinden oder nicht so stürmisch um sie herumspringen sollte. Ansonsten mochte er die gleichen Dinge, die auch ihnen Spaß machten: gemeinsam spazieren gehen, mit den Kindern spielen oder die Bälle fangen, die man ihm zuwarf.
Und jetzt war die Zeit herangerückt, zu der die Kinder von der Schule kamen!
Dorothy und Jason betraten das Zimmer, und Yop begrüßte sie, indem er um sie herumsprang und versuchte, ihnen die Pfoten auf die Schulter zu legen und mit der Zunge über ihr Gesicht zu fahren, was die Kinder lachend abwehrten.
Yak und der andere Präsident verfolgten dieses Schauspiel, ohne eine Regung zu zeigen, aber dann trat die Frau von Yops Präsident ein, und der andere Präsident erhob sich unverzüglich. Sie wechselten ein paar nette Worte, und erneut lächelte der andere Präsident. Er wandte sich den Kindern zu, um ein Gespräch mit ihnen zu beginnen, doch sie waren vor allem an Yak interessiert und stellten viele Fragen zu ihm. Ihn zu berühren wagten sie aber nicht, denn er saß reglos da und wedelte nicht mit dem Schwanz. Yop spürte, dass der Präsident und seine Frau besorgt waren. Der andere Präsident erklärte ihnen, dass Yak Kindern nichts tat, aber Yop sah deutlich, dass es nicht ausreichte, um Dorothy und Jason zu beruhigen; sie traten nicht näher an Yak heran.
»Du könntest sie ja mal begrüßen, indem du ein bisschen mit dem Schwanz wedelst«, schlug Yop vor.
»Aber ich bin gar nicht so begeistert, sie zu sehen«, erwiderte Yak. »Außerdem wird das Mädchen gleich erfahren, dass ich es war, der ihr Kaninchen getötet hat.«
»Stimmt, das wird ihr Kummer bereiten. Aber gerade deshalb solltest du nett zu den beiden sein.«
»Es wäre vielleicht klüger, ihr von dem Kaninchen nichts zu sagen«, meinte Yak.
»Warum?«
»Das Tier war doch verschwunden. Da kann sie immer noch denken, dass es lebt und irgendwo glücklich ist.«
»Einverstanden«, sagte Yop, »aber es wäre trotzdem besser, wenn du den lieben Hund spielst.«
Yak stellte sich seufzend auf die Pfoten. Die Kinder wichen zurück, aber er begann mit dem Schwanz zu wedeln und zum Zeichen des Willkommens ein wenig zu bellen und zu schnuppern.
»Das sehe ich bei dir zum ersten Mal«, sagte Yop.
»Ich mach es dir einfach nach«, erwiderte Yak.
Danach durften sie noch einmal in den Garten, diesmal mit den Kindern, und Yak spielte seine Rolle als »freundlicher und kinderlieber Hund« recht gut.
Jedenfalls so lange, bis er erneut die beiden Männer in Arbeitskluft bemerkte, die mit ihren Werkzeugen durch den Garten gingen. Er schoss auf sie zu.
»Halt!«, rief Yop und rannte ihm hinterher, denn er fürchtete, dass Yak sich auf sie stürzen könnte. Aber nein, er blieb vor ihnen stehen und knurrte fürchterlich; sein ganzes Fell hatte sich aufgerichtet, und das beängstigte sogar Yop, der noch nie einen so schreckenerregenden Hund gesehen hatte.
Auch die beiden Männer bekamen es mit der Angst zu tun; sie wollten kehrtmachen, aber Yak rannte auf die andere Seite und versperrte ihnen jedes Mal den Weg, wenn sie fortzugehen versuchten.
Die Türen des Hauses öffneten sich, und hinaus traten die Präsidenten und sämtliche Leibwächter. Sie gingen auf Yak und die beiden zu Tode erschrockenen Männer zu. Am Ende erteilte der andere Präsident Yak einen Befehl, und der gab sofort Ruhe und lief zu seinem Herrn hinüber, wobei er die Männer nicht aus den Augen ließ.
»Was ist denn bloß in Ihren Hund gefahren?«, fragte der Präsident in leicht verärgertem Ton.
»Er hat etwas gewittert. Sie sollten mal nachprüfen lassen, wer die beiden Männer sind.«
»Alle, die hier arbeiten, sind hundertmal durchgecheckt.«
»Sie sollten es trotzdem mal überprüfen lassen«, sagte der andere Präsident.
»Wenn Sie meinen …«, sagte der Präsident seufzend. Er sprach mit einem Sicherheitsmann, und man führte die Männer ins Innere des Hauses.
Später schlummerten die beiden Hunde am Feuer, während die Präsidenten in großen Sesseln saßen, immer noch miteinander redeten und dabei eine goldfarbene Flüssigkeit tranken, die Yops Präsident aus einer schönen Flasche ausgeschenkt hatte.
»Warum bist du ihnen nachgerannt?«, fragte Yop.
Die Frage beschäftigte ihn schon die ganze Zeit. Er wusste, dass manche Hunde keine Männer in Uniform ausstehen konnten, aber das waren meistens ziemlich dumme Tiere, und Yak war doch ein intelligenter Hund. Außerdem waren sie im Laufe des Tages an anderen Männern und sogar Frauen in Uniform vorbeigekommen, und Yak hatte nicht reagiert.
Yak öffnete die Augen. »Sie haben nach Angst gerochen.«
»Nach Angst?«
»Ja, Angst hat einen ganz besonderen Geruch. Und hier war das leicht zu wittern.«
»Weshalb?«
»Weil in diesem Haus niemand wirklich Angst hat. Von allen Menschen, die mir heute über den Weg gelaufen sind, hat keiner nach Angst gerochen – nur diese beiden.«
»Glaubst du, sie wollten meinem Präsidenten etwas Böses?«, fragte Yop, und bei dieser Vorstellung richteten sich ihm die Haare über dem Rückgrat ein wenig auf.
»Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten sie etwas zu verbergen.«
»Und im Haus deines Präsidenten? Hast du da schon solche Leute erwischt?«
»Dort ist es viel schwieriger, sie ausfindig zu machen.«
»Warum?«
»Weil dort fast jeder Angst hat.«
Yak und sein Präsident kamen wirklich aus einer anderen Welt, dachte Yop. Und als er den anderen Präsidenten anschaute und seinen blauen, harten Blick sah, wurde ihm plötzlich bewusst, dass dieser Mann Yak ähnelte!