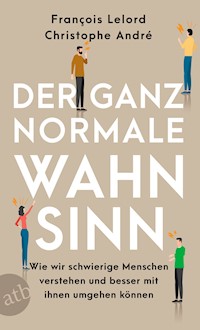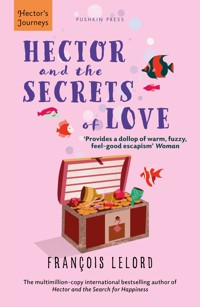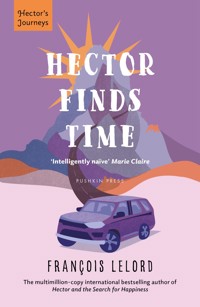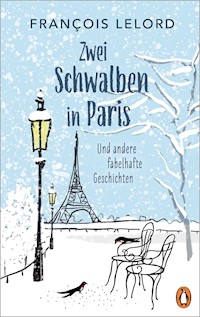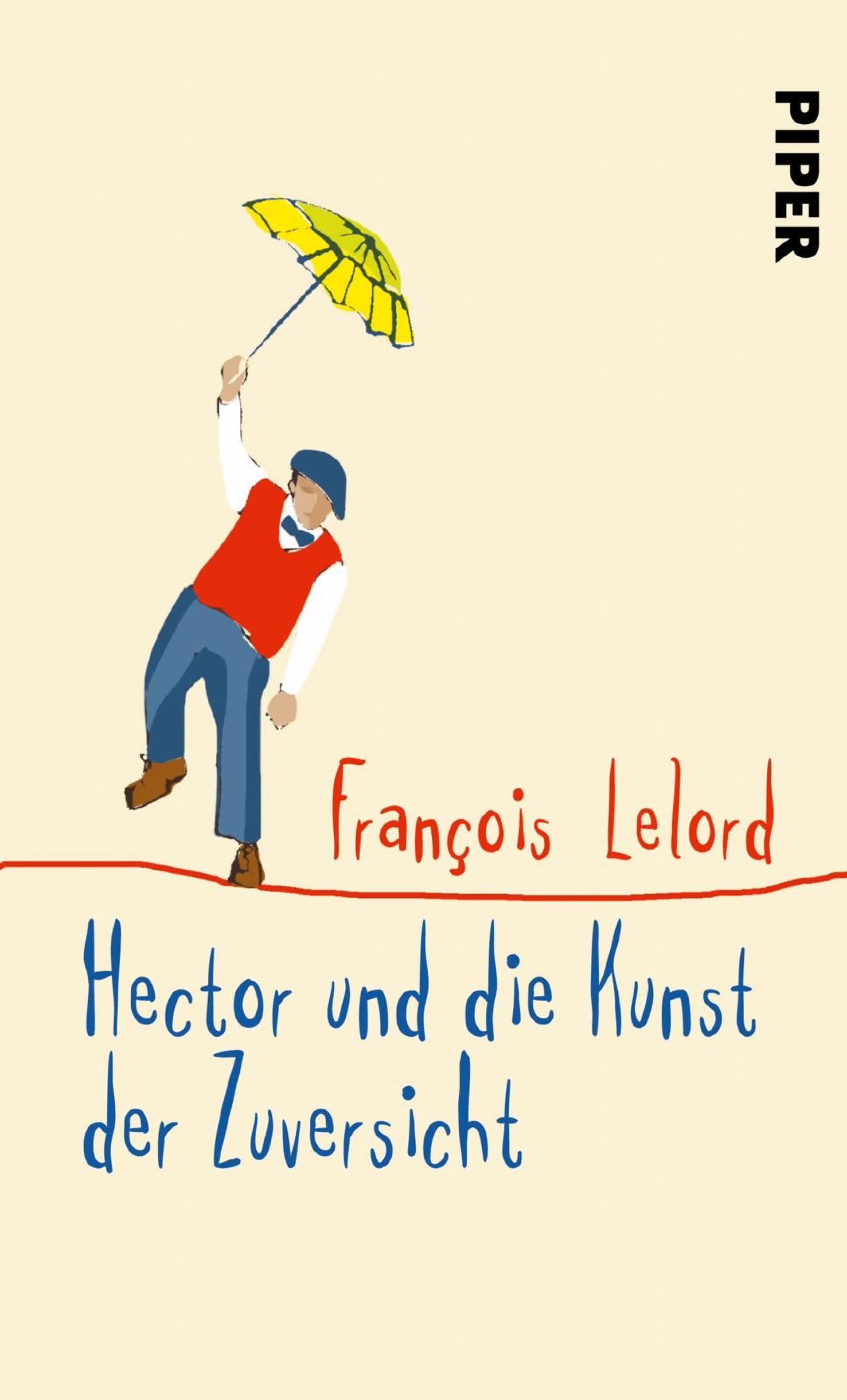
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Große Philosophie trifft pure literarische Lebensfreude: Hector sucht erneut das Glück Zum achten Mal ist Psychologe Hector auf der Suche nach Lebensweisheiten. Und dieses Mal wird es persönlich. Ein Buch voller Optimismus und Inspiration. Positives Denken lässt sich lernen. Vor allem, wenn der Lehrer Hector heißt. Der einfühlsame Psychologe aus der Feder von Bestsellerautor François Lelord nimmt die Leser mit auf eine Sinnsuche, an deren Ende mehr Lebensfreude und Resilienz stehen. In »Hector und die Kunst der Zuversicht« wird der Lehrer jedoch selbst zum Schüler. Seine Ehe bröckelt, seine Hoffnung schwindet, alles läuft schief. Anstatt zu verzweifeln, fragt er seine zahllosen Freunde auf der ganzen Welt nach ihrer Vorstellung vom Glück und erfährt nach und nach, dass alles eine Frage der Perspektive und Einstellung ist. »Lektion 20: Glück ist die Sichtweise auf die Dinge.« – François Lelord Die Hectors-Abenteuer-Reihe ist ein Juwel der literarischen Alltagsphilosophie und eine leichtfüßige Aufforderung zu mehr Achtsamkeit. Charmant und poetisch nimmt François Lelord seine Leser an die Hand und zeigt ihnen behutsam einen Weg, den sie mit Freude selbst beschreiten werden. »Lektion 29: Machen Sie so oft wie möglich das, was Sie am besten können.« – François Lelord François Lelord ist ausgebildeter Psychiater widmet sich mit Hectors Abenteuern den unterschiedlichsten Lebensthemen, denen er in seiner Praxis und in seiner Umgebung begegnet. So vermischt sich auch in »Hector und die Kunst der Zuversicht« professionelle psychologische Lebenshilfe mit einem sprudelnden Erzähltalent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
Aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch
ISBN 978-3-492-99103-2
Deutsche Erstausgabe
April 2018
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung- und motiv: Cornelia Niere
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Hector als Brillenmacher
Hector und die Brille von Pauline
Hector und die Brille von Ronald
Hector stellt sich Fragen
Hector hat auch eine rosa Brille in der Tasche
Hector und seine graue Brille
Hector auf Sendung
Hector lässt sich über die neuen Brillen der jungen Leute aus
Hector und Clara
Hector hat einen neuen Fan
Hector macht einen Test
Hector wird verreisen
Hector hebt ab
Hector im Krieg
Jean-Michels Brille
Keewas Brille
Hector unterm Zeltdach
Hector bekommt Besuch
Hector tritt aus dem Rahmen
Hector denkt nach
Hector findet zu seinem Beruf zurück
Hector und Clara
Hector findet vielleicht einen neuen Freund
Géraldine ist nicht einverstanden
Hector will sich nützlich machen
Hector auf dem Beckengrund
Hector wird Hotelpsychiater
Hector schläft wieder ein
Hector erfindet ein neues Sprichwort
Hectors Sprechstunde in der Bar
Hector am Büfett
Hector und die beschlagene Brille
Hector, Jean-Michel und die Liebe
Hector an alter Stätte
Édouard will die Welt verändern
Hector erlebt ein Spektakel
Géraldine ist in Topform
Hector und die rosa Brille eines anderen Herstellers
Hector entdeckt ganz neue Talente in sich
Hector und Clara (Fortsetzung)
Hector und die Zuversicht
Ein Überraschungsgast
Géraldine bekommt einen Exklusivtermin
Édouards Philosophie
Hector verliert den Faden
Édouard pfeift auf den Tod
Édouard und sein Befund
Hector und die Elektroschocks
Die Nacht der Zombieschweine
Hector im Schein der Flammen
Die Rückkehr der Zombieschweine
Hector und Géraldine basteln am Beckenrand Brillen
Hector widersteht erneut der Versuchung
Édouards Ratschläge
California Dreaming
Hector bei einem richtigen Ehepaar
Hector denkt an eine andere mögliche Zukunft
Hector tanzt auf einem Vulkan
Der Fall Hector
Géraldine und ihre alte Suppe
Epikur und Epiktet gehen ans Meer
Die rosa Brillen
Tom und seine Lieblingsbrille
Édouard ist fort
Hector hat eine Idee
Hector startet neu
Dank
Quellennachweis
Hector als Brillenmacher
Es war einmal ein Psychiater namens Hector, der dachte, sein Beruf bestehe darin, rosa Brillen zu verfertigen.
Denn wenn er seinen Patienten dabei half, ihre Sicht auf die Dinge, auf sich selbst und auf die Welt zu verändern, war das so, als würde er sie mit neuen rosa Brillen ausstatten – oder jedenfalls mit welchen, die nicht so düstere oder verzerrte Bilder lieferten wie die, die sie gewöhnlich trugen und mit denen sie auf den Treppenstufen des Lebens ins Straucheln gerieten.
Aber aufgepasst, Hector wollte seinen Patienten nicht die allzu rosaroten Brillen verschaffen, mit denen man nicht mehr sah, dass man bestimmte Probleme angehen musste, also solche Brillen, wie sie einem beispielsweise auf der Nase wachsen können, wenn man ein paar Gläschen zu viel trinkt.
Und auch nicht die rosaroten Brillen von Patienten, die gerade in ihrer überdrehten Phase sind und deshalb meinen, sie könnten alles tun und dabei noch Spaß haben – woraufhin sie sich auf dem Polizeirevier oder im Krankenhaus wiederfinden.
Und ebenso wenig die Art von rosaroter Brille, die uns das Bild vermittelt, alle Welt sei ja so nett zu uns und möge uns so sehr, während man sich in Wahrheit doch manchmal vorsehen muss.
Nein, Hector wollte den Menschen dabei helfen, sich Brillen zu basteln, die rosa genug sind, um einen erkennen zu lassen, dass man zwar nicht perfekt ist, aber letztendlich doch gar nicht so übel. Die einem dabei helfen, sich vielleicht etwas mehr anzustrengen, um die eigenen Probleme zu lösen oder an den persönlichen Schwächen zu arbeiten, aber die es einem auch leichter machen, diese Probleme und Schwächen hinzunehmen und einfach woanders hinzuschauen, falls man nach ehrlichen Versuchen feststellt, dass man nichts an ihnen ändern kann.
Er hatte sogar daran gedacht, ein Buch über dieses Thema zu schreiben: Wie bastele ich mir meine rosa Brille? Darin hätte er erklärt, was er und die meisten seiner Kollegen überall auf der Welt mit ihren Patienten machten. Er hätte es aber auf seine ganz eigene Art erzählt.
Natürlich wäre so etwas kein Ersatz für ein paar Sitzungen beim Psychiater gewesen, wenn man dessen Hilfe wirklich brauchte. Für viele andere Menschen aber hätte das Buch durchaus nützlich sein können.
Das Problem war bloß, dass Hector an dem Punkt, wo diese Geschichte beginnt, es nicht mehr hinbekam, sich seine eigene rosa Brille zu basteln.
Hector und die Brille von Pauline
Eigentlich hätte Hector mit sich zufrieden sein können. In seinem Beruf schaffte er es oft, den Menschen, die seinen Rat suchten, wirklich zu helfen – Pauline beispielsweise.
Pauline war eine ziemlich künstlerisch veranlagte junge Frau, die denn auch für die Gestaltungsabteilung eines großen Verlagshauses arbeitete. Ihre Aufgabe bestand darin, den richtigen Umschlag für ein Buch zu finden. Manchmal wählte sie dafür ein Foto aus, das gut zur Geschichte passte, ein andermal zog sie eigens einen Illustrator heran. Pauline entschied auch darüber, wie die Buchstaben auf dem Umschlag aussehen sollten; sie musste also ganz allgemein ihr Bestes tun, damit jemand, dem der Umschlag ins Auge fiel, eine erste Ahnung davon hatte, worum es in dem Buch ging, und gleichzeitig Lust bekam, darin zu blättern.
Damit sich Hector ein Bild von ihrer Arbeit machen konnte, hatte ihm Pauline einige Bücher mitgebracht, bei denen sie für die Umschlaggestaltung verantwortlich gewesen war, und Hector hatte sofort gesehen, dass Pauline ein Talent für ihren Beruf hatte, der es erforderlich machte, ein Buch zu verstehen, ohne es bis zur letzten Seite gelesen zu haben.
Aber Pauline hatte ein Problem: Sie zweifelte immerzu an sich, und zwar sowohl im Beruf als auch im übrigen Leben. So neigte sie zu der Ansicht, ihre Kollegen wären besser als sie, und das, wo ihr Chef doch oft Paulines Gestaltungsideen auswählte.
Manchmal traute sich Pauline nicht, bei einer Sitzung eine Idee vorzubringen, denn sie dachte, dass sie nicht passen würde, und hinterher schlug jemand anderes genau diese Sache vor, und alle einigten sich darauf.
»Aber wenn Ihre Umschlagentwürfe oft angenommen werden«, sagte Hector, »dann bedeutet das doch, dass Sie gute Ideen haben.«
»Oh, aber das ist vor allem der Fall, wenn man mir ziemlich leichte Bücher gibt.«
»Und wenn Ihre Umschlagideen nicht berücksichtigt werden?«
»Dann wird mir klar, dass ich nicht wirklich gut bin.«
Sie haben sicher schon verstanden, wie das meistens lief: Wenn Pauline etwas gelang, fand sie, sie habe vor allem Glück gehabt, oder die Latte habe sowieso nicht gerade hoch gelegen. Wenn sie aber scheiterte, war das immer ihr eigener Fehler und ein Beweis dafür, dass sie ihren Aufgaben nicht gewachsen war.
Hector überraschte das nicht: Viele Menschen, die zum Psychiater kommen, neigen zu einem solchen Denken. Er sagte sich, dass Pauline praktisch zwei Spezialbrillen hatte, mit denen sie immer traurig blieb: eine Lupenbrille, die ihre Irrtümer und Schwachstellen enorm vergrößerte, und eine andere, die ihre Erfolge ganz klein erscheinen ließ – so, als wenn man verkehrt herum durch ein Fernglas schaut.
Nach und nach brachte Hector Pauline zu Bewusstsein, welche Nachteile ihre Sicht auf die Dinge hatte, und half ihr, die gewohnten Brillen abzulegen und sich eine zu suchen, mit der sie besser sehen konnte. (Die Lupenbrille für die Irrtümer konnte Pauline im Beruf dennoch nützlich sein: Wenn man ihr einen Umschlagentwurf zeigte, sah sie schneller als die anderen, was damit nicht stimmte, und Hector dachte, dass sie sich diese Brille wenigstens für solche Zwecke aufbewahren könnte.)
Manchmal machten sie einen kleinen Umweg über Paulines Kindheit, jene Lebensphase, in der man sich die Brille fabriziert, durch die man die anderen und sich selbst sieht. Ihr Vater war häufig arbeitslos gewesen und hatte ständig Alkoholprobleme gehabt, und als kleines Mädchen hatte sie sich jedes Mal für ihn geschämt, wenn er sie von der Schule abholen kam und man sehen konnte, dass er wieder getrunken hatte. (Jedenfalls konnte die kleine Pauline das sehen.) Wenn ihre Mutter es satthatte, den Vater zu kritisieren, begann sie, Pauline zu tadeln, und sagte ihr, dass sie nicht zu groß was tauge – und zwar ganz wie ihr Vater, wie sie bisweilen hinzufügte.
Hector notierte in sein kleines Merkheft:
Rosa Brille Nr. 1: Setzen Sie, wenn Sie Ihre Fehler und Schwachstellen betrachten, nicht die Lupenbrille auf.
Rosa Brille Nr. 2: Blicken Sie auf Ihre Erfolge und Ihre Qualitäten, ohne sie wie mit einem umgedrehten Fernglas klein zu machen.
Aber natürlich genügte es nicht, so etwas nur zu sagen. Die Brille zu wechseln, war ein bisschen, als wenn man eine neue Sprache lernte: Man musste jeden Tag üben, und Hector half seinen Patienten dabei, das nicht zu vergessen.
Hector und die Brille von Ronald
Aber Hector hatte nicht nur so sympathische Patienten wie Pauline.
Ronald beispielsweise trug eine ganz andere Brille: Sie vergrößerte seine Erfolge und bewies ihm unablässig, dass er ein ganz außergewöhnliches Wesen war. Gleichzeitig ließ sie seine seltenen Fehlschläge kleiner erscheinen, aber an denen waren aus seiner Sicht sowieso die anderen schuld, jene mittelmäßigen Typen, die ihn einfach nicht verstanden.
Seine Frau konnte diese Sicht offenbar nicht teilen, und so steckte Ronald gerade mitten in einem Scheidungsverfahren. Als Hector seine Bekanntschaft gemacht hatte, sah Ronald seine Kinder nur jedes zweite Wochenende, und seine Frau kommunizierte mit ihm nur noch über einen Anwalt. Das machte Ronald sehr zornig; er schlief nicht mehr und hatte Mühe, sich in den Beratungen zu konzentrieren, in denen entschieden wurde, mit welcher Kampagne der Verkauf einer Joghurtmarke oder eines Autos angekurbelt werden sollte. Ronald hatte nämlich eine bedeutende Führungsposition in der Werbebranche inne.
Seine Freunde hatten es satt, sich immer wieder anzuhören, was für ein unmoralisches Geschöpf seine Frau doch sei, was für ein Ausbund an Undankbarkeit, was für eine blöde Kuh in Personalunion mit einer dämlichen Ziege – sie hatten Ronald also empfohlen, all das doch einem Psychiater zu erzählen.
»Aber beim Weggang Ihrer Frau«, fragte Hector, »wo sehen Sie da Ihren eigenen Anteil?«
»Meinen Anteil?!«, rief Ronald und starrte Hector ungläubig an. »Aber Sie verstehen meine Situation nicht im Geringsten!«
Hector hätte beinahe gesagt, dass er ihn vielleicht wirklich nicht so gut verstand und dass es besser wäre, wenn Ronald schnell einen von Hectors Kollegen aufsuchte.
Aber er riss sich zusammen, denn als Psychiater muss man sich ziemlich oft ins Gedächtnis rufen, dass die Leute gar nicht selbst dafür verantwortlich sind, wie sie sind, und dass sich niemand seine Persönlichkeit aussucht, also seine ganz eigene Brille, durch die er die anderen, sich selbst und die Welt sieht. Hector erinnerte sich an einen Satz, den eines Tages einer seiner Chefs ausgesprochen hatte – vor langer Zeit, als er ein schüchterner Student gewesen war und ein Jahr in Amerika verbracht hatte: People don’t choose what they are.
Wenn Ronald da war, musste sich Hector diesen Satz oft ins Gedächtnis rufen.
Das hatte schon bei ihrer ersten Sitzung begonnen, als Ronald zu spät gekommen war und sich nicht etwa entschuldigt, sondern nur in genervtem Ton gesagt hatte: »Ich habe jetzt eine Viertelstunde damit zugebracht, einen Parkplatz zu suchen! Warum zum Teufel haben Sie Ihre Praxis in einem Viertel, in dem man so schlecht parken kann?«
Und diese beiden Sätze hatten ausgereicht, um Hector an eine ganz bestimmte Diagnose denken zu lassen.
Aber nach und nach hatte Hector Ronalds Vertrauen gewonnen und damit beginnen können, dessen Sicht auf die Dinge zu verändern – und ganz zuerst einmal seine Sicht auf die Mitmenschen.
Man musste Ronald dabei helfen, ein wenig über die eigenen Fehlschläge nachzudenken, über seine Scheidung beispielsweise, und ihm begreiflich machen, dass die Inhaber der Füße, auf denen er sein ganzes Leben lang mit aller Heftigkeit herumgetrampelt war, zwar gewiss nicht solche außergewöhnlichen und talentierten Geschöpfe waren wie er, aber doch empfindungsfähige und mit ihrem eigenen Stolz versehene Menschen.
»Stimmt schon«, hatte Ronald eines Tages endlich eingeräumt, »die Sichtweise der anderen ist mir ein bisschen schnurz. Ist ja auch normal – ich denke, dass ich recht habe, und ich habe schließlich auch recht.«
»Einverstanden«, sagte Hector, »aber ich möchte Ihnen eine Übung vorschlagen: Versuchen Sie einmal, die Situation aus der Sicht der anderen zu betrachten. Ein bisschen so, als würden Sie deren Brille aufsetzen, um die Welt so zu sehen wie sie.«
Für Ronald war das nicht einfach. Seine Brille ähnelte nämlich der von Terminator im Film: Sie taxierte unablässig die Leute, um dann zu entscheiden, wen man vernichten musste und wer am Leben bleiben konnte. Bei Ronald riskierte man nur dann nichts, wenn man sich ihm unterwarf oder ihn bewunderte.
Aber nach und nach akzeptierte Ronald die Übungen, und weil er Hector vertraute, gab er sich dabei Mühe und machte auch Fortschritte, jedenfalls ein paar.
Danach hätte Hector eine zweite Etappe ins Auge fassen können – er hätte Ronald dann helfen müssen, sich selbst besser zu erkennen und zu sehen, dass sich hinter seinem Gefühl der Überlegenheit vielleicht die Angst verbarg, von anderen beherrscht zu werden. Dabei hätte Ronald begreifen müssen, wie er sich in der Kindheit diese besondere Sicht auf sich selbst und die Welt zusammengebastelt hatte. Aber Ronald brachte nicht die Motivation auf, noch weiter zu gehen: Er wollte einfach nur zu seiner gewohnten Form zurückfinden, die es ihm erlaubte, die anderen bei Beratungen zu dominieren und nachts besser zu schlafen.
Mit dem Schlafen klappte es übrigens auch wieder besser, denn dank Hector war er nicht mehr ganz so böse auf seine Frau.
»Im Grunde stimmt es schon«, sagte er eines Tages zu Hector, »sie und ich, wir konnten einfach nicht dieselbe Perspektive haben.« Und das war für jemanden wie Ronald bereits ein großer Fortschritt.
Später schrieb Hector in sein Notizbüchlein:
Rosa Brille Nr. 3: Ehe Sie sich über jemanden aufregen, sollten Sie seine Brille aufsetzen und mit ihr die Situation betrachten.
Hector stellt sich Fragen
Nach Begegnungen mit Patienten wie Ronald fühlte sich Hector inzwischen erschöpfter als früher, als er noch ein junger Psychiater gewesen war.
Außerdem fand er, dass sich seine Kundschaft ronaldisierte.
In seinem Sprechzimmer schienen immer häufiger Ronalds und Ronaldinen aufzutauchen. Er erkannte sie sehr schnell: Bei ihnen ging es immer damit los, dass sie sich über andere beklagten – über ihre Kollegen, ihre Freunde oder Lebenspartner. Und sogar über ihn, Hector, weil sie fanden, dass er sie nicht verstand, und manchmal auch, indem sie seine Methoden kritisierten oder seine Honorarsätze.
Die Jüngeren von ihnen wollten Hector an ihrer Befriedigung darüber teilhaben lassen, dass sie viele schmeichelhafte Kommentare und viele Follower in sozialen Netzwerken hatten, von denen Hector kaum die Namen kannte – was die Ronalds und Ronaldinen noch mehr aufbrachte, wenn sie es merkten.
Eines Tages – wahrscheinlich, um sich zu rächen – sagte eine solche junge Ronaldine zu Hector, dass sie die Dekoration seines Sprechzimmers ziemlich angestaubt finde. Dabei gab es in diesem Raum nur Dinge, die Hector mit Liebe ausgewählt und von seinen Reisen in ferne Weltgegenden mitgebracht hatte.
Aber zum Glück kamen in sein Sprechzimmer noch immer etliche neue Patienten, die er sofort sympathisch fand: Menschen wie Pauline, die an sich zweifelten, die sich fragten, ob sie ihre Erfolge wirklich verdient hatten, und die sich, wenn eine Freundschafts- oder Liebesbeziehung schlecht lief, den Kopf darüber zerbrachen, ob es nicht ein wenig ihre eigene Schuld war.
Aber er musste sich auch um eine dritte Kategorie von Patienten kümmern, und zu dieser gehörten vielleicht die meisten. Sie war wie eine Mischung aus den beiden anderen – Menschen, die an sich zweifelten und durchaus ein gutes Herz haben konnten, aber von einer Art Ronalditis befallen zu sein schienen. Auch sie träumten von Erfolg und verglichen sich immerzu beunruhigt mit den anderen, auch in den sozialen Medien. Die Jüngeren von ihnen waren voller Ängste oder niedergeschlagen, wenn sie ihre Freunde auf Fotos von angesagten Partys sahen oder auf Selfies vor grandiosen Landschaften. Dann nämlich fühlten sie sich von ihnen übertrumpft.
Hector fand, dass diese Patienten und Patientinnen ihre Pauline-Tage hatten und ihre Ronald-Tage, und er musste darauf achten, an dem Brillenmodell zu arbeiten, das zu ihrem aktuellen Zustand passte.
All das hört sich ziemlich interessant an, aber weshalb schaffte es Hector dann nicht, sich selbst eine rosa Brille zu basteln oder sie immer auf der Nase zu behalten?
Hector hat auch eine rosa Brille in der Tasche
Wenn Hector gut geschlafen hatte, gelang es ihm durchaus, seine eigene rosa Brille zu finden und mit ihr den Tag in Angriff zu nehmen. Meistens jedenfalls.
Beim Zähneputzen dachte er oft über sein Leben nach.
Zunächst einmal hatte er zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die inzwischen zu glücklichen und unabhängigen jungen Erwachsenen geworden waren. Wenn Hector guter Stimmung war, fand er, dass allein dies schon ausreichte, damit man sich sagen konnte, man habe ein gelungenes Leben gehabt. Er hätte sich wie Pauline auch einreden können, dass er einfach Glück gehabt habe, denn immerhin hatte er im Moment der Zeugung die Gene für seine Kinder nicht sorgsam selbst zusammengesucht; er hatte einfach nur ihre Mutter ausgewählt. Und trotzdem dachte Hector, dass all die Aufmerksamkeit, die Clara und er danach ihren Kindern geschenkt hatten, für das Endergebnis durchaus von Belang gewesen war: zwei junge Erwachsene, die sich in ihrem Leben gut zu Hause zu fühlen schienen.
Ein weiterer Grund, das Leben in rosigen Farben zu sehen: Auch wenn Hector nicht mehr jung war (er merkte es zum Beispiel daran, dass es seine jungen Kollegen nicht mehr fertigbrachten, ihn zu duzen), war er doch bei ziemlich guter Gesundheit; er hatte – bisher noch – keines der Probleme, die manchen seiner einstigen Studienfreunde Sorgen zu machen begannen, und nach dem Zähneputzen bekam er immer noch ein paar Liegestütze hin.
Und wenn Hector auf dem Weg zur Arbeit den Blick über die Straße schweifen ließ, sagte er sich auch, dass er das große Glück hatte, in einer Stadt zu wohnen, die er liebte und die von Menschen aus der ganzen Welt besucht wurde.
Wenn er dann in seiner Praxis ankam, blieb die Brille manchmal rosa: Der Beruf des Psychiaters entsprach recht gut Hectors natürlichen Talenten – der Fähigkeit, anderen Menschen zuzuhören, einer gewissen Beobachtungsgabe (jedenfalls wenn er in seinem Psychiatersessel saß, denn im normalen Leben war Hector nicht unbedingt scharfsinniger als der Durchschnitt) und einem Grundstock an Freundlichkeit, sodass es ihm Befriedigung verschaffte, andere Menschen ein wenig glücklicher zu machen und damit die Welt ein kleines bisschen besser.
Und so hatte sein Beruf einen Sinn für ihn, er war kein bloßer Broterwerb – anders als bei vielen Leuten, die nicht das Glück hatten, sich ihre Arbeit aussuchen zu können.
Dies war die rosa Brille, die Hector am häufigsten aufsetzte: Sie ließ einen ein paar Schritte zurücktreten, um die eigene Lebenslage im Ganzen zu betrachten und zu sehen, in welchen Dingen man es gut erwischt hatte.
Das hatte Hector übrigens auch schon in seinem Notizheft vermerkt:
Rosa Brille Nr. 4: Treten Sie ein paar Schritte zurück und schauen Sie auf alles, worin Sie Glück haben.
Hector und seine graue Brille
Aber an Tagen, an denen Hector seine Rosa Brille Nr. 4 nicht finden konnte (und man muss hinzufügen, dass dies häufig, wenn auch nicht immer, am Morgen nach einer Feier oder einem Restaurantbesuch der Fall war, wenn er sich zu oft Wein hatte nachgießen lassen), da hatte er eher graue Brillengläser vor den Augen.
Ob er als Vater Erfolg gehabt hatte, war nicht so sicher. Bisher war keines seiner Kinder verheiratet. Sein Sohn flatterte von einer Freundin zur nächsten und ließ manch eine Partnerin ziehen, die eine wunderbare Ehefrau abgegeben hätte – so dachte jedenfalls Hector, der sich aber nie getraut hatte, das vor seinem Sohn auszusprechen.
Was seine Tochter betraf, so arbeitete sie derart hartnäckig an ihrer Dissertation in Internationalem Recht, dass sie gar keine Zeit für ein Liebesleben zu haben schien. Vielleicht begnügte sie sich auch mit flüchtigen Abenteuern, die keine Zukunft hatten. So war es bei immer mehr jungen Frauen, was Hector aus den Berichten seiner jungen Patientinnen wusste, bei denen er immer aufpassen musste, dass ihm nicht die Kinnlade hinunterklappte, wenn er ihnen zuhörte.
Nun ja, versuchte er sich zu sagen, so ist es eben, das Leben der Jugend von heute.
Aber im Grunde dachte er, dass er trotzdem einen Anteil daran hatte. Vielleicht war seine Ehe mit Clara kein so überzeugendes Vorbild gewesen, dass auch seine Kinder sich zu diesem schönen Sakrament entschließen oder zumindest eine dauerhafte Partnerbeziehung eingehen konnten.
Als Ehemann fand er sich nämlich nicht gerade brillant.
Es war nun schon mehr als zwei Jahre her, dass der Konzern, in dem Clara arbeitete, sie für ein paar Wochen dienstlich nach Amerika geschickt hatte. Hector hatte zugestimmt, denn er war schließlich ein moderner Ehemann, der wollte, dass sich seine Frau voll entfaltete. Aber dann hatten die Amerikaner Clara nicht mehr gehen lassen wollen und ihr eine schöne Beförderung versprochen, und auch da hatte Hector nicht gewagt, Nein zu sagen, denn Clara freute sich offensichtlich, dass sie so beachtet und gewürdigt wurde. »Vielleicht hat sie das an meiner Seite nicht ausreichend gespürt?«, hatte sich Hector damals gefragt. Und tatsächlich hatte Clara ihm das oft vorgeworfen: Hector höre ihr nicht mehr so zu wie früher, hatte sie gesagt.
Womöglich lag es daran, dass es ihn inzwischen viel mehr anstrengte, den lieben langen Tag seinen Patienten zuhören zu müssen?
Und danach war es so, dass einer von beiden ein großes Opfer hätte bringen müssen, wenn sie weiterhin zusammenleben wollten: Hector hätte für Clara seine spannende Arbeit aufgeben, seine Praxis schließen und seine Lieblingsstadt verlassen müssen. Sie hatten zu Beginn einmal mit vagen Worten darüber gesprochen, nun aber schon lange nicht mehr. Sie sahen sich nur noch im Urlaub, um ihre Kinder zu besuchen, und dann stritten sie sich meistens.
»Wie lange kann das noch so weitergehen?«, fragte sich Hector manchmal. Wäre es nicht an der Zeit, mit Clara einmal ganz ernsthaft über diese Situation zu reden? Aber er verschob es immer auf den nächsten Tag.
Als Psychiater machte sich Hector auch über seinen eigenen Fall Sorgen. Als Clara nach Amerika gegangen war, hatte er eine Weiterbildung gemacht und neue Therapien kennengelernt, mit denen er seinen Beruf interessanter gestalten konnte und ganz auf der Höhe war, wenn es darum ging, seinen Patienten zu helfen.
Aber trotz dieser neuen Gesprächsmethoden und all der neuen Pillen, welche die Pharmafirmen Jahr für Jahr auf den Markt brachten und von denen manche wirklich einen Fortschritt bedeuteten, fand Hector, dass ihm seine Arbeit nicht mehr so viel Spaß machte wie früher.
Natürlich hörte er es lieber, wenn ein Patient ihm sagte: »Ja, Herr Doktor, wir haben wirklich eine ganz schöne Wegstrecke gemeinsam zurückgelegt – es geht mir jetzt viel besser, und ich habe eine andere Sicht auf die Dinge«, als wenn er zu hören bekam: »Also, Herr Doktor, mir geht es richtig mies, Ihr Medikament hat keine Wirkung, und überhaupt verstehen Sie immer noch nicht, wo meine Probleme liegen.«
Aber er war nicht mehr so zufrieden wie früher. Er wusste, dass dies ein Anzeichen füreinen Burn-out war. Das war jene besondere Form von Erschöpfung, die oftmals Menschen befällt, deren Beruf es ist, anderen Menschen zu helfen. Doch fand Hector, dass es sich in seinem Fall eher um ein Cold-in handelte: Er fühlte, dass er seinen Patienten gegenüber kälter geworden war, und das gefiel ihm gar nicht.
»Bin ich eigentlich noch zu etwas gut?«, fragte er sich an einem schlechten Morgen beim Aufstehen manchmal.
Vater: in Anbetracht der Resultate wahrscheinlich nicht so toll.
Ehemann: nicht gerade prächtig.
Psychiater: einigermaßen annehmbar, aber mit einem starken Bedürfnis nach Ruhe (oder nach etwas anderem?).
Liebhaber? Besser erst gar nicht daran denken.
Wenn er an einem solchen Morgen die graue Brille aufhatte, dachte er manchmal daran, es selbst mit den kleinen Pillen zu versuchen, die er bestimmten Patienten verschrieb, um ihre Brillengläser aufzuhellen. Aber weil er sich an manchen Tagen immer noch gut in Form fühlte, sagte er sich, dass er einem Patienten, dem es so ging, keine Medikamente verordnet hätte. Als Psychiater wissen Sie natürlich schon im Vorhinein um alle erdenklichen Nebenwirkungen, die solche Pillen haben können, und so schluckte Hector lieber keine.
Hector auf Sendung
Eines Tages wurde Hector ins Radio eingeladen.
Eigentlich war er nur die Vertretung für einen Kollegen und Freund, der älter und berühmter war als Hector. Dieser Freund redete gern, und die Leute vom Fernsehen und Radio luden ihn oft ein, damit er seine »Psychokommentare« zu allen möglichen aktuellen Themen abgab. Dafür hatte er nämlich Talent.
»Ich bin mir sicher, dass du das gut hinkriegst«, hatte dieser Kollege und Freund zu Hector gesagt, »es wird um die Jugend gehen und um den Sinn des Lebens.« Er selbst konnte nicht in die Sendung kommen, weil er sich beim Ballspielen mit den Enkelkindern den Ischiasnerv eingeklemmt hatte.
Hector fragte sich, wie es ihm selbst wohl gehen würde, wenn er Enkelkinder hätte. Vielleicht würde es ihm nicht nur den unvermeidlichen Bandscheibenvorfall bescheren, sondern seinem Leben auch neuen Sinn verleihen.
Er begab sich zur vereinbarten Zeit ins Studio, immer noch mit Anzug und Krawatte, wie er sie in der Sprechstunde trug. Dann entdeckte er mit einiger Überraschung, dass der Journalist, der ihn erwartete, ein wenig nachlässig gekleidet war – mit einem Rollkragenpullover, der schon bessere Tage gesehen hatte. Hector hatte nicht daran gedacht, dass man fürs Radio nicht schick angezogen zu sein brauchte, und besser noch, man musste sich nicht schminken lassen. Das nämlich war Hector einmal vor einer Fernsehsendung passiert, und seitdem verspürte er ein tiefes Mitgefühl mit den Frauen, die sich tagtäglich diesem Ritual unterziehen.
Im Radio ging es heute um die Schwierigkeiten junger Leute, ihren Platz im Leben zu finden. Die Studiogäste saßen um einen runden Tisch herum. Da war der Moderator der Sendung, ein magerer, alter Journalist, der in jüngeren Jahren ein berühmter Reporter aus allen möglichen Kriegsgebieten dieser Welt gewesen war. Hector fragte sich, wie er es verkraften konnte, jetzt in einem fensterlosen Studio eingeschlossen zu sein, selbst wenn er vermutlich nicht den ganzen Tag über dort bleiben musste. Hector selbst hatte ja schon seit Beginn seines Berufslebens in einem Sprechzimmer gesessen, also war er es gewohnt, und trotzdem fragte er sich, wie er es ertragen hätte, wenn es ihm erst am Ende seiner Laufbahn widerfahren wäre. Er sah, dass vor dem alten Journalisten nicht nur die übliche kleine Mineralwasserflasche auf dem Tisch stand, sondern auch ein Glas mit einem Fingerbreit Whisky darin und Eiswürfeln. Seine persönliche rosa Brille, dachte Hector.
Zeitgleich mit Hector traf eine Politikerin im Studio ein, eine etwas rundliche Frau mit selbstsicherem Blick, die schon mehrere Projekte ins Leben gerufen hatte, um jungen Leuten, die keine guten Schüler gewesen waren und Dummheiten angestellt hatten, eine zweite Chance zu geben. Sie sollten eine hinreichend gute Ausbildung bekommen, um danach die schlecht bezahlten Jobs zu machen, die von anderen jungen Leuten links liegen gelassen wurden. Man hoffte, das würden sie am Ende interessanter finden, als mit Drogen zu handeln oder Geschäfte zu überfallen.
Hector fand die Frau sympathisch; sie schien wirklich an das zu glauben, was sie tat, und er spürte sehr wenig Ronalditis in ihr.
Schließlich fiel ihm eine junge Frau ins Auge, die schon neben dem Journalisten saß. Dieser stellte sie als »Géraldine, unsere Kolumnistin« vor. Wie er hinzufügte, wurde sie oft in die Sendung eingeladen, damit sie ein bisschen Pfeffer in die Runde brachte.
Géraldine kam Hector sehr jung vor, jünger noch als seine Tochter. Sie hatte einen langen Hals, ein breites, etwas kindliches Lächeln, schalkhaft blitzende Augen und abstehende Ohren, die aus ihren kurzen, zerzausten Haaren hervorschauten. Ihre etwas schlaksige Magerkeit war die einer Jugendlichen, die vielleicht noch nicht zu wachsen aufgehört hatte, und sie hatte lange Hände, mit denen sie beim Sprechen heftig gestikulierte. Sie war nicht wirklich hübsch, aber sehr lebendig, und hatte, wie Hector sofort dachte, auch etwas leicht Verrücktes an sich. Später erfuhr er, dass Géraldine schon sechsundzwanzig war; sie wirkte jedenfalls jünger.
Der Journalist stellte Hector den Zuhörern vor: »Wir haben in unserer Runde auch einen Psychiater, der uns seine Meinung kundtun wird über die Schwierigkeiten der jungen Leute, die er in seinen Sprechstunden empfängt.« Bei diesen Worten zwinkerte Géraldine Hector zu, als habe jemand einen Scherz gemacht, den nur sie beide verstanden.
Die Politikerin trug ein streng geschnittenes graues Kostüm, ein schönes Halstuch und eine dezente Perlenkette; ein Samtbarett hielt ihre Haare zurück, und ohne zu wissen warum, dachte Hector, dass sie bestimmt katholisch war und ihren Glauben auch praktizierte.
Géraldine trug einen hautengen schwarzen Pullover, ohne dass sie viel gehabt hätte, was sich darunter hätte abzeichnen können. Ihr Rock hätte aus einem orangen Teppichboden geschneidert sein können, aber Hector wusste ja, dass er von solchen Dingen keine Ahnung hatte – was Géraldine trug, war unter jungen Leuten vermutlich gerade angesagt. Und auch auf ihre Ohrringe schien das zuzutreffen: kleine weiße Korallenstückchen. Er wartete schon darauf, dass sie am Ende der Sendung vom Tisch aufstand, denn er wollte auch ihre Schuhe sehen und so ein bisschen mehr über die Mode der jungen Leute erfahren.
»Und welche Ansicht haben Sie als Psychiater dazu?«
Wieder einmal hatte Hector nicht zugehört. Aber schon in seiner Kindheit hatte er die wunderbare Fähigkeit entwickelt, den letzten Satz abzuspeichern, der an sein Ohr gedrungen war, ohne dass er wirklich hingehört hatte. Das half ihm manchmal bei der Gruppe von Patienten, von der wir noch gar nicht gesprochen haben – bei denen, die ihn langweilten. An Géraldines letzten Satz jedenfalls konnte er sich noch erinnern: »Aber vor allem wollen sich die jungen Menschen nicht langweilen.«
»Die Jugend trägt nicht mehr die gleichen Brillen wie früher«, sagte Hector.
»Wie bitte?!«
Hector merkte, dass ihn alle anschauten. Diese Geschichte mit den Brillen war ohne ein paar Erläuterungen nicht ganz klar.
»Ich meine damit, dass sie ihr Leben nicht mehr so sehen, wie es die Generationen vor ihnen getan haben«, sagte Hector. »Langeweile ist für sie beispielsweise der Beweis dafür, dass sie nicht das richtige Leben führen. Wir waren damals viel besser darauf vorbereitet, die Langeweile als Bestandteil unseres Lebens zu akzeptieren.«
»Langeweile akzeptieren?«, rief Géraldine. »Aber das kommt überhaupt nicht infrage!«
Hector lässt sich über die neuen Brillen der jungen Leute aus
Wie Hector erklärte, war seine Generation seit dem zartesten Kindesalter gut darin geübt, sich zu langweilen. Man langweilte sich im Klassenzimmer, wenn man den Lehrern zuhören musste, ohne selbst reden zu dürfen (außerdem gab es damals noch mehr langweilige Schulfächer als heute); man langweilte sich zu Hause, weil es nur einen einzigen Fernseher gab und man ihn nicht oft benutzen durfte; man langweilte sich in der Messe, falls man einer Familie angehörte, die noch in die Kirche ging; und die jungen Männer langweilten sich beim Militärdienst, zumindest in Friedenszeiten, wo man Stunden und ganze Tage darauf wartete, dass irgendetwas Interessantes passierte. Und sogar in den Ferien langweilte man sich, denn die Eltern wollten ihren Urlaub immer am gleichen Ort verbringen, wo es keinen Fernseher gab – und das Internet war sowieso noch nicht erfunden!
»Stimmt«, sagte Géraldine, »ein Leben ohne Internet kann man sich schlecht vorstellen.«
»Wir wussten also«, fuhr Hector fort, »dass Langeweile so etwas wie ein Regentag war: Man konnte nichts dagegen machen, und eine etwas öde Arbeit konnte einem dann beinahe interessant vorkommen. Aber für junge Leute wie Sie gilt das nicht mehr – Ihnen erscheint die Langeweile wie eine finstere Wolke, vor der man sich in Sicherheit bringen muss, ein bisschen wie vor dem Schmerz, wenn Sie so wollen.«
Géraldine lächelte Hector zu und reckte den Daumen in die Luft, als wollte sie auf diese Weise »Bravo!« sagen.
»Ja«, meinte sie, »Langeweile ist wirklich schmerzhaft! Im Englischen sagt man übrigens bored to tears – zu Tränen gelangweilt!«
»Aber wenn die Jugend heutzutage keine Langeweile mehr erträgt«, sagte die Politikerin, »dann liegt das auch daran, dass sie Autorität nicht mehr akzeptiert. Die jungen Leute, um die ich mich kümmere, haben keinen Respekt vor der Autorität gelernt!«
»Das kann auch etwas Gutes haben«, meinte Hector.
»Etwas Gutes? Wie denn das?«, fragte die Politikerin mit schockierter Miene. Sie warf Hector den Blick einer Lehrerin zu, die geglaubt hatte, einen artigen und guten Schüler vor sich zu haben, und plötzlich entdecken muss, dass ausgerechnet dieses Kind den Radau angestiftet hat, als sie sich zur Tafel drehte.
Hector versuchte, sie zu beruhigen, indem er erklärte, dass in früheren Generationen die sensibelsten Menschen von der autoritären Erziehung bisweilen erdrückt wurden und sie hinterher zu Hector und seinen Kollegen kommen mussten, mitunter jahrelang, um sich davon freizumachen und es endlich zu schaffen, sich im Leben zu behaupten und das zu tun, wozu sie wirklich Lust hatten. Heute aber seien solche Fälle seltener geworden, und die Leute starteten glücklicherweise mit weniger Verboten ins Leben.
Aber prompt steigt auch die Zahl der Ronalditis-Fälle in der Bevölkerung, hätte er beinahe hinzugefügt, aber er verkniff es sich im letzten Moment, denn niemand hätte ihn verstanden.
Nun ging das Wort an die Zuhörer, deren Anrufe man im Studio ausgewählt hatte. Man vernahm die Stimme eines wohlerzogenen jungen Mannes namens Fabrice, der ein ordentliches Studium absolviert hatte und in den Büros einer berühmten internationalen Firma arbeitete. Viele junge Leute hofften, dort ihre Karriere beginnen zu können, aber Fabrice sagte, dass er die Nase voll habe; er langweile sich, und damit sei er auch nicht der Einzige. Und warum war das so?
»Ich bin nur ein Rädchen im Getriebe, ich empfange und sammle Daten für andere, ich überwache die Abläufe … Na ja, das ist jetzt nicht so spannend zu erklären.«
»Allerdings!«, sagte Géraldine mit einem Lachen.
»Das ist es ja«, meinte Fabrice. »Ich möchte einen Job, den ich anderen Leuten erklären kann und bei dem ich die Resultate meiner Arbeit sehe! An manchen Tagen sage ich mir, dass das alles überhaupt keinen Sinn hat …«
»Warum machst du dich dann nicht als Handwerker selbstständig?«, fragte Géraldine.
»Daran hätte ich vorher denken sollen«, sagte der junge Mann. »Na ja, eines Tages vielleicht …«
Ende der Leseprobe