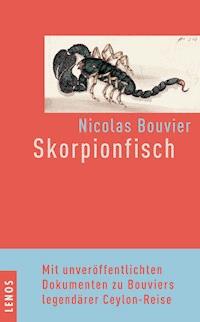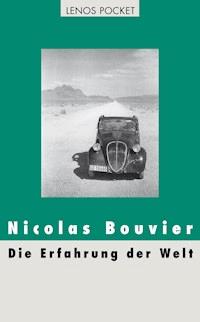12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lenos Voyage
- Sprache: Deutsch
Unveröffentlichte Texte aus beinahe einem halben Jahrhundert versammelt dieser Band, aufgezeichnet in Ländern, über die Nicolas Bouvier zu Lebzeiten nie etwas publizierte. 1948, im Alter von neunzehn Jahren und voller Träume, verfasst er auf der Fahrt von Genf nach Kopenhagen seinen ersten Bericht. 1992 streift der mittlerweile berühmte Schriftsteller durch Neuseeland, müde zwar, doch mit unvermindertem Staunen. Dazwischen begleiten wir ihn zu so unterschiedlichen Reisezielen wie Frankreich und Nordafrika (1957/58), Indonesien (1970), China (1986) und Kanada (1991). »Die Aufzeichnungen sind zwar historische Zeugnisse, doch vor allem sind sie das Echo einer ganzen Reihe von Reisen mit initiatorischem Charakter in unterschiedlichen Lebensaltern, und als solche bilden sie eine Art unfreiwillige Autobiographie. Aus einer üppigen Stofffülle tauchen Momentaufnahmen des Reisens und des Lebens auf, von denen einige in ihrer minimalistischen Poesie nicht zuletzt an Haikus erinnern« (Mario Pasa). Die Texte, sorgfältig zusammengestellt von François Laut, lassen Nicolas Bouviers vielseitiges Talent sichtbar werden: ein unvergleichlicher Beobachter und Porträtist, aber auch ein Reporter, Ethnograph, Historiker, Fotograf und Dichter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Autor
Nicolas Bouvier (1929–1998) wuchs in Genf auf und machte schon als 16jähriger erste Reisen nach Frankreich und Italien. Nach dem Studium der Geistes- und Rechtswissenschaften in Genf fuhr er 1953 mit Thierry Vernet im Auto über Jugoslawien, die Türkei und Iran nach Afghanistan. 1955 Weiterreise nach Japan. In den sechziger Jahren unternahm Bouvier mehrere ausgedehnte Reisen, u.a. nach Japan, China und Korea. Der Schriftsteller, Fotograf und Journalist publizierte mehrere Bücher, darunter Die Erfahrung der Welt und Skorpionfisch.
Die Übersetzerin
Yla Margrit von Dach, geboren 1946, lebt seit 1977 als freischaffende Übersetzerin und Schriftstellerin in Paris und Biel. Sie hat unter anderem Sandrine Fabbri, Nathacha Appanah, Marie-Claire Dewarrat, Henri Roorda, Catherine Colomb, Sylviane Chatelain (Prosa), Isabelle Daccord und Michel Beretti (dramatische Texte) übersetzt und wurde 2000 mit dem Prix Lémanique de la Traduction ausgezeichnet.
Der Verlag dankt dem Migros-Kulturprozent und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia für die Unterstützung.
Titel der französischen Originalausgabe:
Il faudra repartir. Voyages inédits
Copyright © 2012 by Editions Payot & Rivages, Paris
E-Book-Ausgabe 2015
Copyright © der deutschen Übersetzung
2013 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich
Coverfoto: Keystone/Photopress-Archiv
www.lenos.ch
ISBN 978 3 85787 915 9 (EPUB)
ISBN 978 3 85787 916 6 (Mobipocket)
Inhalt
Geleitwort von Mario Pasa
Genf–Kopenhagen Sommer1948
Frankreich 1957/58
Nordafrika Herbst1958
Indonesien Sommer1970
China Sommer1986
Kanada Herbst1991
Neuseeland Sommer1992
Nachwort von François Laut
Geleitwort
Von Mario Pasa
Diese unveröffentlichten Reisenotizen von Nicolas Bouvier (1925–1998) aus Ländern, die in seinem publizierten Werk nicht oder kaum vorkommen, vermitteln ein Gefühl von Neuheit und postumer Intimität. Das ist auch der Mitarbeit von Madame Eliane Bouvier und von Barbara Prout, Archivarin der Abteilung Manuskripte der Bibliothèque de Genève, in der die hier versammelten Texte aufbewahrt sind, zu verdanken. Für seine Arbeit an der Biographie des Autors (Nicolas Bouvier. L’œil qui écrit. Paris: Payot 2008) hatte sich François Laut, der die Texte bereits kannte, von diesen nicht immer leicht zu entziffernden Aufzeichnungen inspirieren lassen. Abgesehen davon, dass er damit ganz natürlich seine Forschungsarbeit weiterführte, gab es fast eine familiäre Verpflichtung, diese Perlen zusammenzutragen, denn Ende der 1980er Jahre hatte sich zwischen dem Genfer Autor und den Editions Payot, die namentlich so unumgängliche Titel wie L’Usage du monde und Chronique japonaise in der »Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs« herausbrachten, eine starke Beziehung entwickelt.
Als Reisender geht Nicolas Bouvier weit über die Kanons des Travel Writing hinaus, das mit seinem Boom aber doch dazu beitrug, dass er zu Anerkennung gelangte. Die vorliegenden Aufzeichnungen sind zwar historische Zeugnisse (über das Deutschland von 1948, Frankreich und Nordafrika im Jahr 1958, Indonesien 1970, China 1986), doch vor allem sind sie das Echo einer ganzen Reihe von Reisen mit initiatorischem Charakter in unterschiedlichen Lebensaltern, und als solche bilden sie eine Art unfreiwillige Autobiographie. Man könnte Skrupel haben, etwas zu veröffentlichen, was ein Autor nur für sich selbst schriftlich festgehalten hat, doch die herausgeberische Arbeit hat es möglich gemacht, ohne an ihm Verrat zu üben, eine Verzettelung zu vermeiden, gewisse allzu sehr im Telegrammstil gehaltene Passagen wegzulassen, da und dort eine Stelle durch Anmerkungen zu präzisieren und für die 1950er Jahre mehrere Abschnitte in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. So tauchen aus einer üppigen Stofffülle Momentaufnahmen des Reisens und des Lebens auf, deren einige in ihrer minimalistischen Poesie nicht zuletzt an Haikus erinnern.
IL FAUDRA REPARTIR
et vous, ravissements, ciels gonflés d’étoiles, poissons, morsures du cœur, lumière embrasante des regards, échos et prestiges, serez-vous encore là?
ES WIRD KEIN BLEIBEN GEBEN
und ihr, Entrückungen, gebauschte Sternenhimmel, Fische, Bisswunden des Herzens, Brandfackellicht der Blicke, Echos und Prestigegefunkel, werdet ihr noch da sein?
Nicolas Bouvier, Frankreich, 1958
Genf–Kopenhagen
Sommer 1948
Dienstag, 13. Juli. Abreise nach Finnland. Bei mir ziemlich trist. Ich rauche die flämische Pfeife, die ich gestern aus Bern zurückgebracht habe. Meine Freunde haben dem Abschied gestern einen derartigen Anstrich von Letzter Ölung gegeben, dass ich mich heute Morgen nicht traue, sie anzurufen. Keinerlei familiäre Empfehlung, ich möchte sehr lange verreisen. Treffe Assaël1 im Hôtel de Russie und hole mit ihm den Wagen. Feudaler blauer Chevrolet, mit Zigarettenanzünder und Monogrammen auf den Türen. Fahren mit C., reserviert, zuvorkommend, wahrscheinlich ganz Geschäftsmann, und B., sehr rund im Gesicht und im Charakter sogar sehr angenehm, ungemein belesen, hat sich ein bisschen zum Reisen zwingen müssen vor dem Krieg, ist viel gereist, hat sich seither beruhigt, »wegen des Militärdienstes«, sagt er; muss mit seiner Mutter sehr nett und als Onkel sehr beliebt sein.
Verlassen Genf um Viertel nach 9. Ziel Saint-Cergues. Zoll im Grenzgebiet mit riesigen roten Spassvögeln von Beamten, die ausnahmsweise diese Arbeit machen und noch ein Vergnügen erster Güte dabei finden, einen Pass auf- und zuzuklappen.
Der Jura, wie er leibt und lebt, hässlich, trist, grün, trübsinniges Grau. Alle Kinder sehen aus wie Greise, vor den Blechhäusern saugen sich Holzhaufen mit Regen voll.
Nachdem wir gut gefahren sind, Ankunft in Dijon um 1 Uhr. Der Wagen ist äusserst komfortabel. In Dijon bereitet man sich natürlich auf den 14. Juli vor. Mittagessen bei Racouchot, Restaurant, das von einem antiquierten Ruf lebt und wo die letzte Pomme frite schlecht frittiert und weihevoll daherkommt.
Essen ziemlich bescheiden, zum Verdruss mehrerer Lakaien von sehr überholtem Gebaren, die sich zu dritt bemühen, uns ein Stück Brot zu bringen. Monsieur Assaël ist zu viel gereist, um sich von diesen alten Fallstrickrestaurants hereinlegen zu lassen. Er erzählt uns auf fesselnde Art von seinem Aufenthalt in den Klöstern des Berges Athos. Klosterrepublik, zu der kein weibliches Wesen, Tier oder Frau, Zutritt hat.
Treffen um 4 Uhr 30 in Joinville ein. Der siebenhundertste Jahrestag des Aufbruchs ihres Herrn zum Kreuzzug Ludwigs des Heiligen. Alle sind zwischen zwei Räuschen, der Regen kann sich an doppelt so vielen Fahnen auslassen.
Erreichen Reims über Châlons-sur-Marne. Zunächst sehr schöne, grüne und einsame Landschaft, von reglosen Kanälen durchzogen, Weiden und Pappeln. Dann riesige flache Getreideebenen mit atemberaubenden Lichteffekten und Wolken. Lassen Paris in 60 Kilometer Entfernung linker Hand liegen. Reims um 8 Uhr abends. Die Kathedrale scheint sehr schön zu sein, der Rest nicht, die Franzosen sind unübertroffen im Unterbringen von Garagen in Häusern im Stil des Louis-quatorze und im Organisieren von Tanzabenden auf Plätzen mit Grammophonen und im Regen zerfliessenden Papierrosen, wo eine ziemlich alte Jugend tanzt, und die mich sofort trübe stimmen. Daran ist nicht der Krieg schuld.
Wohnen im Hôtel du Lion d’or. Hässliches, aber komfortables Zimmer mit Telefonskeletten und einigen Klingeln. Prachtvolle gestreifte Samtvorhänge, deren dekorative Qualitäten die Besitzer bestimmt nicht zu schätzen wissen. Riesiges Bett, fast viereckig, mit Schlummerrolle.
In meinem Zimmer, das auf den Hof hinausgeht, höre ich den öffentlichen Tanzabend, der von Tangos über Blasmusik langsam dem Morgen entgegendudeln wird. Es ist wirklich so, dass Paris ganz Frankreich ausgepumpt hat, alles, was in der Provinz erschaffen wird, ist dazu verurteilt, aus der Mode zu sein, bevor es überhaupt das Licht der Welt erblickt, ausser, dünkt mich, im Süden.
Morgen früh werde ich die grosse Messe besuchen.
Mittwoch, 14. Juli. Exquisites Erwachen in einem riesigen weichen, warmen, leichten Bett. Um 8 Uhr gefrühstückt. In der Eingangshalle mit Assaël, graues Wetter.
Spaziergang durch Reims, voller Flics und voller Offiziere in zweifelhaften, zerknitterten Parademonturen.
Die Kathedrale ist eine Pracht, doch keiner kommt hin, sie ist umstellt von Baracken, Büros, Garagen usw. Unerhörte Reinheit der Linien und der Dekoration, das Licht der Rosetten spiritualisiert und abstrahiert die Architektur; es ist weniger menschlich als die italienischen Kirchen. Brechen um 10 Uhr auf, nachdem wir die Militärzeremonie zum 14. Juli gesehen haben, bei der mir alles verschossen und zwecklos vorkam, bis zu den Witwen, die man mit postumen Medaillen auszeichnet.
Im Grunde genommen ist das, was den 14. Juli kaputtmacht, die Tatsache, dass ein gutes Drittel Frankreichs unbewusst das Verschwinden eines Königs bedauert, der vorteilhaft die gegenwärtige Sauwirtschaft ersetzen würde. Die republikanische Armee hat nur eine magere Vorgeschichte.
Fahren an Vervins, Laon, Maubeuge, an riesigen Getreidefeldern und riesigen Militärfriedhöfen aus dem Ersten Weltkrieg vorbei. Beim Chemin des Dames weiden zwischen den Schützengräben und den Granatlöchern, die man unter dem wildwuchernden Gras ausmachen kann, lautlos ein paar Kühe. Es ist kein Mensch auf der Strasse, wir fahren im Schnitt mit 80 Stundenkilometern, mein Sitznachbar B. ist über jede Bruchbude in höchstem Masse beglückt.
Viel Ärger an der französischen Grenze mit streikenden Zöllnern, die sich erst nach endlosen Einwänden dazu herbeilassen, auf dem Triptychon die für den Übertritt nach Belgien notwendigen Stempel anzubringen. Sie wollen nicht den mindesten Koffer anschauen, und wäre er voller Gold, und wir passieren mit unserem Wagen vom Typ übler Geschäftemacher die Grenze wie ein unsichtbarer Lufthauch. Der belgische Zöllner, der uns irrtümlicherweise oder übereifrig sinnlose Schwierigkeiten bereitet hat, schämt sich dermassen, dass er nicht wagt, unsere Koffer anzuschauen.
Mittagessen nach der Grenze, alles ist sogleich fett, sauber, blutig und schwer.
Im Hintergrund, gegen Mons hin, unwahrscheinliche Kohle- oder Schlackenhügel, riesig, in merkwürdig regelmässigen Formen, die die Landschaft bedecken. Trostlos schwarzes, aber reiches Land.
Erreichen Brüssel im Regen.
Tisch im riesigen Hôtel Métropole, wo Bedienstete aller Abteilungen herumrennen wie müde gelbe Hunde.
Studentenwohnheim, grosse, trostlose Kaserne, grau, aber durchdacht konzipiert.
Die belgischen Studenten plump und hässlich, aber nicht bösartig, ihre Schirmmütze rasselt von etwas Cabochonartigem, das man an ihren Rand hängt. Sie sind innerlich viel weiter von Frankreich entfernt als wir, und was ihnen am meisten fehlt, ist der Charme, sie essen bestimmt zu viel, um leichte Ideen zu haben. Ich mache mein Bett in einer Art kahler, einfacher Zelle, wo ich Ruhe habe; am Abend, als ich zurückkomme, finde ich einen oder vielmehr zwei riesige Dänen vor, deren einer im zweiten Bett schlafen muss, beide sind angenehm und sprechen ziemlich schlecht Deutsch.
Ich nehme entzückt ein Bad in einem grossen, modernen Badezimmer.
15. Juli. Spät aufgestanden, scheussliches Wetter, vor dem Fenster sehe ich Studentinnen durch die Alleen gehen, Pferdeprofil, Füsse nach innen, so ein Jammer! Freue mich, T. zu sehen.
Reichhaltiges Frühstück in einem riesigen Speisesaal. Still und leer. Alte, natürlich hässliche, aber mütterliche Kellnerinnen.
Am Vormittag führe ich die Dänen in Brüssel spazieren.
Gewaltiges Gewitter und wolkenbruchartiger Regen um 2 Uhr, stelle mich in einer Apotheke unter, in der dreissig tropfnasse Kerle in einem Weltuntergangslicht langsam Brüsseler Dialekt reden.
Am Vorabend schreibe ich nach Hause in einem Café an der Grand-Place, ein wahres Wunder, voller alter Bilder und alter Karten. Das Lokal ist ein regelrechtes Museum und gehört einem Liebhaberklub, ich bin allein hier, am andern Ende sitzt ein englischer Oberst, macht Kartenkunststücke für drei hübsche, elegante und verblüffte Damen.
Treffe mich nach dem Gewitter mit Assaël in seiner riesigen Bonbonschachtel, er wird von einem seiner Freunde eskortiert, holländischer Edelsteinhändler, das absolute Porträt von F. Wir machen eine endlos lange Fahrt mit dem Auto, um Brüssel im Regen zu sehen. Endlos und trübselig. Auf dem See im Bois de la Cambre überrascht uns ein Sonnenstrahl, der über die Boote streicht, die hier seit einem Monat im schlechten Wetter verrotten.
Um 6 Uhr gehe ich zu den Windhundrennen. Sehr merkwürdig und pöbelhaft. Zahlreiche Halunken rund um den Totalisator. Man spürt genau, dass es ein Nationalsport ist und dass jeden Tag Rennen stattfinden.
Neun Hunde sind am Start, in neun Boxen, deren Öffnung elektrisch durch das Vorbeiflitzen des künstlichen Hasen gesteuert ist, den die Hunde über ein paar Runden verfolgen, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Stundenkilometern. Sie haben eine ungeheure Sprungkraft beim Start, der eher an einen Schwarm auffliegender Waldschnepfen erinnert. Während des Rennens springen sie manchmal über ihre Konkurrenten hinweg und fallen ihnen oft auf die Schnauze; Purzelbäume, Balgereien usw. Andere, bulligere laufen nicht los, warten, bis die Hasenschleppe anhält, schnappen sich das Hasenfell und führen es mit befriedigter Miene auf der Rennbahn spazieren.
Ich wette 10 Franc auf eine Windhündin namens Polly2, sie wird beim Start abgeschüttelt, holt jedoch in der zweiten Runde mit unglaublicher Geschwindigkeit auf der ganzen Linie auf, erreicht als Erste das Ziel, und ich gewinne 104 Franc.
Nachtessen in der Taverne d’Egmont et de Horn, zu deren Eingang man zwanzig Treppenstufen hinuntersteigen muss. Am Abend einen sehr guten Film mit Paul Muni, Claude Rains und Anne Baxter gesehen.3 Zurück endlos langer Fussmarsch, es fahren keine Trams mehr; wir nehmen die äusseren Boulevards; Wohnwagen, Lastkähne, Gaslaternen, niemand kilometerlang geradeaus, die Gitter der Parks triefend von Regenwasser, Rimbaud hat sicher auf ihren komplizierten, rostigen Bänken geschlafen.
Auf dem Weg predigt mir mein Gefährte B. eine enttäuschende Philosophie der Unbeweglichkeit, der Gleichgültigkeit und des Scheiterns. Er ist interessant, und ich halte ihn für absolut ehrlich. Er behauptet, ich hätte Illusionen, das ist durchaus der Fall. Ich habe viele, die nur auf mich warten, um sie wahr werden zu lassen; ich befürchte, dass er auf seine ein bisschen zu früh verzichtet hat. Er behauptet, es gebe keine Freude. Ich gestehe ihm zu, dass sie weg ist, wenn man sie gepackt zu haben glaubt, doch wie den Kontrabass eines Orchesters ahnen wir sie, wenn sie uns fehlt.
Morgen gehe ich ins Museum, das Wetter ist zu scheusslich, um nach Brügge zu fahren.
16. Juli. Morgens um 8 aufgestanden. Es giesst noch immer, Engländer spielen hinten im Park im Regen Tennis. Ich habe kein belgisches Geld mehr und will nicht welches kaufen. Bis 10 Uhr geschrieben, mit dem Doppelgänger von Christian D. in einer Art Untergeschoss Tischtennis gespielt; er lädt mich ein, ihn zu Hause zu besuchen; habe leider keine Zeit. Ich verteile erfolglos Schweizer Schokolade, um ein paar urwüchsig-derbe Studenten aufzuheitern. Erfolglos; Stendhal hätte diese Leute nicht ausstehen können.
Finde einen charmanten Brief von zu Hause in meinem Fach.
An den Paten und an Polly geschrieben.
Der Regen ist monoton und dieses Moderklima absolut deprimierend. Am Mittag gehe ich in die Stadt, ein langer Weg ins Zentrum, alle Strassen sind wegen Reparaturarbeiten aufgerissen und mit nassem Sägemehl bedeckt. Hungrig spaziere ich durch Brüssel, ohne einen Heller. Wunderbarer, freier Spaziergang. Ich gehe zu Sarma, eine Art riesiger, sehr amerikanischer Supermarkt, in dem es mehr Reklame als Waren gibt, und esse absolut gut für 12 Franc in der Restaurant-Bar, die Pommes frites werden hier in regelrechten Schnellkochtöpfen frittiert, und zwölf »Neger« garnieren am laufenden Band kleine Brötchen, Pistolets genannt, mit Crevettensauce. Ein alter Brüsseler hat gestern mit dem obligaten Akzent zu mir gesagt: »Wenn Sie kein Geld haben, gehen Sie zu Sarma. Da sind die Pistolets knuspriger als anderswo, aber man muss es wissen, weisst du, na dann!«, und auf diese sibyllinischen Worte hin liess er mich stehen. Ich habe den Versuch gemacht und bin froh drüber. Während dieser Mahlzeit, die man stehend einnimmt, lädt mein Tischnachbar mich ein, mit ihm einen Kaffee zu trinken. Er heisst Helvétius, ist ein Nachkomme des Enzyklopädisten und leitet ein Spitzengeschäft in Zoute, wo die Saison dieses Jahr katastrophal ist. Er ist belesen, äusserst liebenswürdig, aber ach, er hat ein starkes Bedürfnis, sein Herz auszuschütten.
Er folgt mir ins Museum, das ich nochmals sehen will. Hinreissende Ansammlung von Meisterwerken, die meine kühnsten Hoffnungen übersteigt. Ich verbringe die Stunde vor drei weiblichen Akten von Cranach, sie gehören zu den schönsten Gemälden, die ich je sah, Frauenkörper von schwanenhafter Eleganz, völlig nackt und mit grossen roten Hüten à la François Ier auf dem Kopf. Wunderbare Heilige Jungfrau von Metsu, rotgoldener Brokat auf wassergrünem Grund, Farben, die wohl keine Woche gealtert sind. Pünktlich um 5 Uhr organisieren die Aufseher eine Art Hetzjagd, bar jeder Eleganz, um die Gebäulichkeiten zu räumen. Gehen auf der Grand-Place etwas trinken, und mein sehr desillusionierter Gefährte erklärt mir: »Wir Belgier sind eine Promenadenmischung wie kein anderes Volk in Europa: weder Franzosen noch Deutsche, noch Engländer, nicht einmal Holländer, sondern ein bisschen was von allen.« Ich gehe mit ihm einig. Zum Trost zeigt er mir das Foto einer Person, die »beinahe seine Frau« ist.
Am Abend ein amüsantes Vaudeville gesehen, mit Frauen, die so vulgär wie bezaubernd sind, die einzigen in Brüssel.
Meine Gefährten brüten, fröhlich und gutgelaunt, allerhand nächtliche Pläne aus, sie hätten ihren Spass daran, mich ganz und gar in die Ausschweifung hineinschlittern zu lassen. Ich erkläre, dass ich gern alles perfekt mache und ein wenig begabter Festbruder bin; also … nehme ich die letzte Tram. Im Studentenwohnheim hat der Nachtportier, ein versierter alter Militär, ein redseliges Naturell, er holt drei Schweizer Uhren hervor, hält sie mir unter die Nase und sagt: »Die hier habe ich seit fünfzehn Jahren, die hier seit fünfundzwanzig Jahren und die da noch viel länger, ich schlage sie überall an, jeden Tag, um zu schauen, und sie laufen noch, aber schlecht, es sind sehr gute Uhren.« Ich nicke zustimmend und gehe schlafen.
17. Juli. Ich bin mit Assaël um 8 vor dem Métropole verabredet, doch die würdige, mit dieser Aufgabe betraute Frau vergisst mich zu wecken. Um 8 Uhr 20 mache ich ein Auge auf. Wutgeheul, hastig der Koffer, mich waschen … Wie ich an der Loge vorbeilaufe, erinnere ich sie an das Versäumnis, vor Verzweiflung brüllt sie ein grässliches Wort und fährt sich mit der Hand ins weisse Haar. Ich komme verspätet zur Verabredung; militärisch angehauchte Scherze, dann mache ich ein paar Fotos, wir verabschieden uns von unserem Kameraden B. und brechen nach Holland auf, über Antwerpen, es ist 9 Uhr morgens, und wir sind schon 850 Kilometer gefahren.
Kurz vor der Grenze laden wir zwei dicke Deutschschweizer auf, die mit einer Schweizerfahne Autostopp machen. Fahren durch R. Langwierige Geldformalitäten, sind um 12 Uhr auf holländischem Boden.
Halt in Rotterdam, schönes Wetter. Die Leute sind hässlich, die Radfahrer unglaublich zahlreich, sprechen nur Holländisch. Dagegen arbeiten sie ungeheuer viel, überall rauchen die Fabriken, es sind kolossale Arbeiten im Gang. Im Stadtzentrum erinnern mehrere saubere, mit Blumen bepflanzte grosse Esplanaden an die 1940 bombardierten Stadtviertel, die ganz geschliffen wurden. Wir überqueren die Brücke bei Hochbetrieb und fahren weiter Richtung Den Haag. Kuriose Landschaft, in der sich Fabriken mit weissen Mohnfeldern abwechseln. Selten ein Kanal und wunderschöne Brücken.
Den Haag ist entzückend, strahlendes Wetter, das beflaggte Rathaus schläft vor einem See, von dem alle Kanäle der Stadt ausgehen. Die Giebelhäuser sind reich mit Blumen geschmückt, man glaubt ständig, morgen müsse ein Umzug stattfinden.
Ausgezeichnetes Mittagessen in einem entzückenden Restaurant, wo wir »einen Bols4 auf die Gesundheit des Autos trinken, das wunderbar läuft«.
Im Mauritshuis, wohin man mich mehr aus Höflichkeit denn aus Lust begleitet hat, nehme ich mir Zeit und lasse auf mich warten, während ich vor prachtvollen Rembrandts (Die Anatomie des Dr. Tulp), vor einer Frau mit blauem Turban von Vermeer, die Chardin vorwegnimmt, vor unvergleichlichen Holbeins und Memlings verweile. Wir fahren durch Scheveningen, grosses, altmodisches Seebad, auf allen Seiten windig, aber sympathisch und Zoute ziemlich ähnlich, abgesehen davon, dass die Leute hier alle überaus hässlich sind. Erreichen auf der Fahrt nach Haarlem den tausendsten Kilometer. Entzückende Landschaft, von unzähligen erhöhten und unsichtbaren Grachten durchzogen. Darauf sind Regattasegler oder grosse Fischerboote unterwegs. Die Schiffsrümpfe werden durch die seitlichen Böschungen verdeckt, man sieht die roten, schwarzen und weissen Segel, die mitten in den Feldern auf halber Höhe der Bäume und Kirchtürme vorbeigleiten und die Wiesen schmücken wie riesige Wäschestücke.
Während wir durch Haarlem fahren, wo es keine Tulpen hat und nicht einmal Kinder, um einen heroischen Zeigefinger in die Löcher der Deiche zu stecken, sagt man sich, dass sie wahrhaftig vorbei ist, die Belle Epoque, in der die Chevaulegers des Hauses Turenne dem König von Spanien mit so viel Eleganz seine schönsten Provinzen wegnahmen und über die hallenden Kopfsteinpflaster tänzelten.5
Heute ist Holland das Reich einer zu sauberen Königin, in dem man einen Kanonenschuss abfeuert, wenn sie ein Kind kriegt.
Das einzige Land der Welt, wo die Frauen den Reitern von ihrem Balkon aus Tulpen zuwarfen anstatt Rosen; heute gibt es keine Reiter mehr, dafür Radfahrer, und die Balkonblumen blühen in Töpfen; hübsch ist es trotzdem.
Wir kommen am riesigen Flughafen Schiphol vorbei, wo Flugzeuge vom Ende der Welt um Windmühlen herumkurven, und treffen in Amsterdam ein. Über eine Reiseroute, die ich verkompliziere, wie es mir gefällt (ich habe den Plan in den Händen), erreichen wir den prächtigen Dam. Die Altstadt – Uferdämme, Grachten, schmale Gässchen mit bizarren Namen, gewölbte, von grünen, roten, gelben und blauen Fuhren verstopfte Brücken – ist so lärmig und chaotisch, dass man, in kälterer Version, das Venedig von Volpone6 oder der Tolldreisten Geschichten7 erlebt. Wir fahren stundenlang in der Stadt im Kreis herum, und dass man mich wegen meiner Unbeholfenheit ausschimpft, quittiere ich mit einem Lächeln.
Wir nehmen die Strasse nach Utrecht, und ich schlafe in einer traumhaften Landschaft ein.
Erwache vor einem hohen braunen Dom, der von seinem Turm merkwürdigerweise durch einen menschenleeren kleinen Platz getrennt ist. Ein Blasorchester weckt mich vollends auf, und ich sehe Hunderte als Gardehusaren verkleidete Kinder vorbeidefilieren, schwarze Tschakos, Jacken mit blauem Besatz, ernsthafter als Bleisoldaten. Es ist ein riesiges Fest für irgendeinen Heiligen oder Bürgermeister im Gange. Das glückliche Holland ist wohl vor dem Krieg eingeschlafen wie Dornröschen, um taufrisch zur gleichen Zeit wieder aufzuwachen wie ich.
Ich kaufe eine Pfeife, und wir fahren in einen Rotbuchenwald hinein, der weit hinter dem Horizont endet; das Auto singt auf einer unendlich geraden, frisch gewaschenen Strasse, und wenn wir andere kreuzen, machen wir schöne grosse Terzen. Damwild läuft frei um herrschaftliche weisse Häuser herum, die nur auf Marlborough und seinen Tross von Köchen warten.8
Mysteriöse Karnickel, die raketenschnell durch diesiges Unterholz flitzen, künden den nahenden Abend und den deutschen Wald an.
Die Heidelandschaften von Arnheim sind von entsetzlicher Einsamkeit, es ist 6 Uhr abends. Wer würde ahnen, dass man hier so viel gestorben ist?9
Arnheim ist schwer zerstört.
Um 8 Uhr, es ist schon fast dunkel, halten wir vor einem von dämmerigen Teichen umgebenen Landgasthof an, ringsum kilometerweit nichts als Bäume. Dieses Refugium mitten im Wald ist weit weg von jeder Realität, Bibeln mit rötlich glimmenden Zinnschliessen, schwere, geräuschlose Teppiche, und kein Mensch. 20 Kilometer von hier beginnt Deutschland. Ich schreibe an Henri10, nach Hause, an Thierry11 und viele andere, sitze einen Moment mit Assaël zusammen bei einem traditionellen Bols. Er erzählt mir von seiner Kindheit in Hamburg, dem er sich bei jeder Durchfahrt anzunähern fürchtet, dann gehe ich auf mein Zimmer. Ich öffne mein Fenster den Nachtfaltern, dem gewaltigen Gewisper des Waldes. Andersen ist nicht weit.
Heute haben wir 500 Kilometer zurückgelegt.
18. Juli. Wir verlassen das Waldhotel um 9 Uhr morgens, scheussliches Wetter. Drei tropfnasse Kühe grüssen uns bei unserer Abreise.
Deutsche Grenze um 9 Uhr 45 in R. Es regnet weiterhin auf zwei traurig abgewetzte Pariser Reisebusse herunter, die nach Stockholm unterwegs sind und uns voranfahren, Gedränge von schüchternen, schlechtgekleideten Provinzlern, die neben dem Ofen picknicken, ihre Klamotten dampfen in einem Geruch von nassem Holz. Die deutschen Beamten, kurzsichtig, korrekt und extrem höflich, werden von einem englischen Marineoffizier sekundiert; obwohl jung, scheinen sie seit Jahrhunderten hier zu sein, mit Kleidern, die nie neu gewesen sind. Selbst ihre Stempeltinte ist blass und abgenutzt.
Der Soldat, der das Auto kontrolliert, hat ein furchtbares, schönes Dürer-Gesicht, er wahrt einen gewissen Stil, trotz seiner ausgewaschenen Uniform.
Bei Assaëls Pass zieht er die Stirne kraus.
»Spanisch?«12
»Ja.«
»Ich war zwei Jahre dabei!«
Er hält einen Moment inne, dann nickt er: »Ach ja! Die Sonne jeden Tag!«
Seine Mütze tropft im Dauerregen, doch er lächelt. Er zeigt mit einer müden Geste nach Osten und sagt noch: »Die Zukunft ist finster«, dann: »Gute Reise.« Ich möchte etwas zu ihm sagen, aber ich kann nicht, und wir überschreiten die Grenze zu Deutschland.
Wird es für diese verblichene »Grosse Armee« einen Balzac geben? Wir fahren weiter; keine Ruinen, kein sichtbares Elend, doch eine unglaubliche Menge Kinder, winzig, maisblond, die gruppenweise winken am Strassenrand, während sie dem Auto nachschauen, das silbern und blau wie die Karosse eines verflossenen Königtums vorbeifährt. Diese ländliche Gegend vor den Toren Hollands profitiert offensichtlich vom Schmuggel und von einem wunderbar fruchtbaren Boden. Man sieht am Rand der Sumpfgebiete sehr schöne Pferde weiden, aber wenige Bauern. Es sieht im Übrigen so aus, als hätten sie nichts zu tun, als wäre das Jahr für sie ein endloser Regensonntag der Langeweile. Es gibt welche, die radeln auf alten Fahrrädern vorbei, machen ein paar Meter, halten an, wenden, wenden erneut, sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen; die Deutschen wissen nicht mehr, wohin sie gehen sollen.
Es gibt zwar Sachen in den Läden, aber alle scheinen den gleichen Artikel zu verkaufen: kleine, dürftig in grobes, tristes Papier eingewickelte Pakete; alle scheinen Nägel zu verkaufen. Im Schaufenster einer Modistin sitzen, rosa, grün, blau, drei kleine Strohhüte auf drei Stangen, tragisch aus der Mode gekommen, warten und verstauben ganz sacht.
Wer möchte die denn?
Durch eine endlose, durchwegs bestellte, aber menschenleere Ebene erreichen wir Bremen.
Es ist nichts davon übrig als ein prachtvoller Platz in barbarischem Barockstil, mit dem Dom, der Börse, dem Haus der Kaufmannschaft und einer grossen schwarzen Treppe, die unversehrt inmitten einer Flut von Backsteinen und verbogenem Alteisen steht, die seit je da zu sein scheint, blinde Häuser, aufgerissene Stuckaturen, Schutt, Geranien, die auf Balkonen toter Fassaden verkehrt herum wachsen; es ist wie eine sehr eigenartige, komplizierte Mode, die man seit langem aufgegeben hätte.
Wir essen auf einer Wiese 20 Kilometer von Bremen entfernt zu Mittag, winzige Kinder lassen sich bald mit einem Hund herbei, der noch kleiner ist als sie, und streichen um unsere Körbe herum, ohne etwas zu sagen, rufen den Hund zurück, der vorsichtig eine Wursthaut anschleicht. Ich gebe ihnen etwas Schokolade, bevor sie zu essen beginnen, schauen sie sie lange an, bringen sie an der Sonne zum Glänzen, reiben mit dem Zeigefinger darüber und stecken sie schliesslich in den Mund, die Blicke aufeinandergerichtet. Wir geben ihnen alles, was uns bleibt, es ist viel. Sie sehen nicht unterernährt aus und essen mehr aus Neugierde als mit Appetit.
Der Hund hat sich an Wursthäuten gütlich getan und wärmt sich den Bauch an der Sonne, der Kleinste krault ihm die Ohren und sagt die ganze Zeit: »Oh, du! Maxi!«
Wir verlassen die amerikanische Besatzungszone und kommen in die englische, wo die Soldaten Deutsche, Polen, Jugoslawen und selten Engländer sind.
Fabelhafte Autostrada bis Hamburg. Über 60 Kilometer hinweg fahren wir an einem unglaublichen amerikanischen Materialfriedhof entlang. Nebeneinander am Strassenrand abgestellt Camions, Jeeps, Command Cars, Raupenfahrzeuge, Radpanzer, Tanks, Amphibienfahrzeuge, Krane, Küchenwagen, Kanonen aller Art, verbeult, ausrangiert, mit oder ohne Pneus, verrostet, abgewetzt, einige fast unbeschädigt; die ganze Kriegsgeschichte! Die Zufahrt zur Autostrada ist auf der ganzen Länge dieses Depots verboten, doch wir passieren die Posten, indem wir ihnen ein paar Zigaretten zustecken. Hier und da patrouillieren Wachen durch diese riesige Schrottwüste, in der fünfundzwanzigtausend Gefährte darauf warten, dass der Rost ihnen den Rest gibt.
Hamburg hat jetzt gewaltige Horizonte, der ganze Westen der Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht, niemand wohnt mehr hier, ein grosses Wasserflugzeug überfliegt den stillstehenden Hafen, und wir fahren über eine phantastische Hängebrücke, die ich als Bub auf einem Familienspiel gesehen habe.
Der Osten ist wenig zerstört, und im Zentrum blieb ein ganzes Viertel wie durch ein Wunder verschont. Es ist mit Zwangsmietern vollgestopft, es hat Blumen an den Fenstern und heisere Grammophone, die auf allen Etagen röhren. Die Dämmerung bricht über ein kilometerlanges Chaos und diese irrwitzige Musik herein. In dieser Halbmisere wird alles vom »schlechten Geschmack« wie von einem Unkraut überwuchert. In den Zimmern wimmelt es von unglaublich hässlichen und komplizierten Gegenständen, die man aus irgendeinem Trödel herausgefischt hat, als Ersatz für das, was verschwunden ist. Eine dicke Spanierin, eine Freundin Assaëls, bietet uns Tee und holzharte Kekse an, für die sie sich sehr entschuldigt. Sie kennt Klaus Hauptmann, der in der Nähe ihres Hauses wohnt. Ich rufe von hier aus Eva13 an, die kaum überrascht scheint, und gehe hinüber.
O Wunder, sie wohnt in einem grossen, modernen Haus am Rande eines Parks, in der sechsten Etage. Überraschender noch, der Aufzug läuft, und sie verfügt über ein komfortables Appartement für sich und ihren Mann. Sie empfängt mich sehr ungezwungen. Ich bringe ihr Kaffee, Milch und Schokolade. Sie hat viel Arbeit, ihre Konzerte stehen hoch im Kurs, sie scheint in guten Verhältnissen zu leben. Nach einer halben Stunde verabschiede ich mich und steige ins Auto »nach Dänemark«.