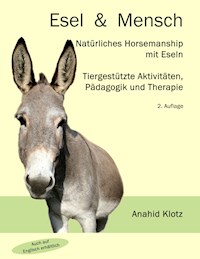
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
ESEL UND MENSCH beschreibt natürliche Kommunikation mit Eseln und daraus abgeleitete Möglichkeiten, Esel in Freizeitaktivitäten, Pädagogik und Therapie einzusetzen. Im ersten Buchteil wird anhand umfassender Theorie und detaillierter praktischer Beispiele aufgezeigt, wie das Training für Esel und Eselhalter gestaltet werden kann. Alle Grundübungen des natürlichen Horsemanship sind im Übungsprogramm mit Bebilderung enthalten. Das auf Esel angepasste natürliche Horsemanship, das einen respektvollen, harmonischen Umgang mit den feinfühligen und klugen Tieren sicherstellt, bildet die Grundlage für Buchteil Zwei. Dieser widmet sich dem variantenreichen Einsatz der geschulten Esel in den Bereichen Freizeitpädagogik, Tiergestützte Pädagogik und Tiergestützte Therapie. Thematisch passende Anwendungsbeispiele und ein Übungskatalog helfen, damit Aktivitäten aus mehr als nur Streicheln bestehen. Die Kapitel sind gut verständlich mit vielen Bildern gestaltet. Geeignet für Eselhalter und Eselfreunde, auch Pferdehalter, Anbieter von Freizeitaktivitäten mit Tieren, Pädagogen, Psychologen, Therapeuten aller Fachrichtungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort zur 2. Auflage
Buchteil 1 – Natürliches Horsemanship mit Eseln
Hinführung zum natürlichen Kommunikationssystem mit einem Esel
Unsere Grundeinstellung
Unterschiede zwischen Esel und Pferd
Ist der Esel ein Fluchttier?
Typische Verhaltensweisen/Eigenschaften von Fluchttier und Raubtier
Motivationen
Evolution der Esel und ihr Sozialleben in freier Wildbahn
Wichtige Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung über Wildesel
Typische Verhaltens- und Stimmungsanzeichen des Esels
Wie gut kennen wir unsere Eselherde?
Ist jeder Esel für Natürliches Horsemanship geeignet?
Wann und wie können Jungtiere gestartet werden?
Einstieg in die Praxis der natürlichen Esel-Partnerschaft
Werkzeuge und Hilfsmittel im Basis-Bereich des Natürlichen Horsemanship
Angepasste Werkzeuge für Kinder
Einsatz von Stimme?
Der Start in die aktive Kommunikation – die Begrüßung
Leckerli oder Belohnung?
Die Körperzonen des Esels
Forschungserkenntnisse über die linke und rechte Gehirnhemisphäre
Die wichtige Bedeutung der Privatzone
Verhaltenskonzepte und Prinzipien in der Partnerschaft Esel - Mensch
Vier Verantwortungen von Esel zu Mensch und von Mensch zu Esel
Den ersten Kontakten Bedeutung geben
Die vier Phasen der Bestimmtheit
Die Am-Seil-Kommunikation
Die freie Kommunikation
Die sieben Kommunikationsspiele
Antwort oder Reaktion?
Hinweis zur Bebilderung
Kommunikationsspiel Eins: *Freundlichkeit & Vertrauen*
Die Wirkung des Rhythmus‘
Ablenkungen
Kommunikationsspiel Zwei: *Stachelschwein*
Das Hufe geben als besondere Variante
Die Energieposition
Kommunikationsspiel Drei: *Bewegung auf Rhythmus*
Phase 4 beim Spiel Drei *Bewegung auf Rhythmus*
Defensive und offensive Hand
Kommunikationsspiel Vier: *Geh-Weg – Komm-her*
Kommunikationsspiel Fünf: *Zirkel*
Kommunikationsspiel Sechs *Seitwärts*
Kommunikationsspiel Sieben: *Engpass*
Warum ist das „Anschauen“ so wichtig?
Ein spezieller Engpass: Der Transporthänger
Weiterführendes
Laterales Biegen und Kopfsenken des Esels
Besondere Variation des Spiels Fünf: „Folge mir“
Besondere Variation aus Spiel Zwei und Drei: „Gehe voraus“
Strategien in Abstimmung auf den Eselcharakter entwickeln
Einspielen der Esel
Zusammenfassung zum Buchteil 1
Ausnahmen für das Sprechen des natürlichen Horsemanship
Übungsverzeichnis Grundlagen zum Natürlichen Horsemanship mit Eseln
Buchteil 2 – Tiergestützte Aktivitäten, Pädagogik und Therapie mit Eseln
Warum Tiere in der Freizeit und als Unterstützung in Pädagogik und Therapie einsetzen?
Reelle und künstliche Welten
Ehrlichkeit – Lüge – Vorurteil
Warum eigentlich Esel?
Seine moderne Rolle als Nutztier
Sein Äußeres
Sein Charakter
Die Therapieesel
Physische Fitness und Zusammenstellung der Eselherde
Mentale Fitness
Ausbildungsstatus
Der Eselhalter
Sicherheitsbewusstsein
Ausbildung, Fähigkeiten
Hört der Esel zu? Wie lange?
Gestaltung der Einsätze
Inhaltliche Gestaltung
Periphere Organisation und Verwaltung
Information
Der Therapeut
Grenzen eselgestützter Einsätze
Vorwort zu den folgenden Kapiteln
Tiergestützte Aktivitäten mit Eseln
Kinderveranstaltungen
Eselwanderungen
Eselwanderungen „Eseltrekking“ für Erwachsene
Eselwanderungen für Familien
Eselwanderungen für Kinder
Eselwanderungen für Reha-Einrichtungen
Eselgestützte Pädagogik
Kinderkurse im natürlichen Horsemanship
Eselgestützte Pädagogik für Kindergärten und Horte
Eselgestützte Pädagogik für Grund-, Haupt- und Realschulen
Eselgestützte Pädagogik für sonderpädagogische Förderschulen und Einrichtungen
Förderschule/Einrichtung für emotionale, soziale und geistige, Lern-, Sprachbehinderungen
Förderschule/Einrichtung mit Schwerpunkt Erblindung, Sehbehinderung
Förderschule/Einrichtung mit Schwerpunkt Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit
Förderschule/Einrichtung mit Schwerpunkt Mehrfache Behinderungen
Eselgestützte Erwachsenenbildung
Eselgestützte Therapie
Zielgruppen und mögliche Fortschritte in der Eselgestützten Therapie
Wahrnehmungen
Eselgestützte Therapie in der Sozialen Arbeit
Unterstützung von Eseln in der Ergotherapie
Eselgestützte Therapie in der Familienarbeit
Reiten für Klienten
Eselgestützte Therapie für Jugendliche in schwierigen Phasen
Eselgestützte Therapie in der Psychosomatik
Eselgestützte Therapie für Senioren
Esel im Hospiz
Anhang
Übungskatalog
Zusammenfassung
Liste „Utensilien“
Prüfliste Übungsgelände
Prüfliste Außenbedingungen bei einer Eselaktivität
Prüfliste: Was muss der Esel als Therapietier können?
Prüfliste: Heranführen des Esels an seine Aufgaben als Therapietier
Prüfliste: Vorbereitungen vor Einsätzen
Vorschläge für Antworten auf unangenehme Begegnungen
Prüfliste: Nachbereitung von Einsätzen
Sonstige Tipps für Eselhalter
Literaturhinweise
Leveltests 1 und 2 im natürlichen Horsemanship
Bilder- und Tabellenverzeichnis
Index
Vorwort zur 2. Auflage
Liebe Leserin, lieber Leser, willkommen zur zweiten Auflage von „Esel & Mensch“! Wir freuen uns, dass Sie Interesse an diesem Buch haben. Es wendet sich an Sie, also an Menschen, die nachdenken. Tierfreunde, Eselfreunde, verantwortungsbewusste Eselhalter, Tier-und-Menschorientierte Freizeitanbieter, engagierte und zukunftsorientierte Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpädagogen und -psychologen, Psychiater, Ärzte, Ergotherapeuten, Heilpädagogen, Pädagogen von Schulen, Förderschulen, Gymnasien, Sozialpädagogen, Angehörige aus Selbsthilfegruppen, Kinderhäuser, Behinderteneinrichtungen, Senioreneinrichtungen, Unternehmer aus Firmen aller Größen können dieses Buch zum Zweck der Anregung und Weiterbildung verwenden.
Die zweite Auflage dieses Buches sollte bereits im Jahr 2011 erscheinen, doch ganz im Sinne der Esel erforderte ihre Bearbeitung Geduld und offene Zeiteinteilung. Sie ist eine umfangreiche Erweiterung der 1. Auflage, sowohl beschreibende Bilder als auch Texte betreffend. Wir hoffen, dass die in der 1. Auflage teils spärlich gehaltenen Abhandlungen einzelner Kapitel nun ausführlicher und verständlicher geworden sind.
Im Buchteil 1 geht es um das Wie des kommunikativen Umgangs mit dem Esel. Natürliches Horsemanship bietet hier weitreichende Möglichkeiten. In Grundzügen ist eine Übertragbarkeit dieses Kommunikationssystems auf den Umgang mit anderen Fluchttieren1 möglich. Hierzu zählen natürlich die Pferde und Maultiere, auch Kühe, ferner Trampeltiere, Schafe oder Ziegen. Sogar ein Reh, das als verwaistes Kitz aufgenommen wurde, konnte am Horsemanhalfter geführt werden.
Alles, was hier theoretisch beschrieben ist, führt nur dann zu Erfolgen, wenn wir regelmäßig hinaus gehen und mit unseren Eseln praktizieren. Asinella bietet ergänzend Basiskurse im natürlichen Horsemanship mit Eseln und Spezialkurse „Esel als Therapietier“ an.
Buchteil 2 baut auf Buchteil 1 auf und behandelt den weitgefächerten Einsatz der Esel in Aktivfreizeit, Pädagogik und Therapie. Wo, wie, für wen können Esel als Pädagogik- und Therapie unterstützende Tiere wirken? Was sind hierbei ihre Besonderheiten und welche Fähigkeiten muss der Esel erlernen? Welche Spezialkenntnisse braucht der Eselhalter, um diese verantwortungsreiche Aufgabe durchführen zu können?
Die vielfältigen Möglichkeiten, die Esel für tiergestützte Aktivitäten, Pädagogik und Therapie bieten, werden noch relativ wenig wahr genommen. Die Erwartungshaltung an Esel ist mit den typischen Vorurteilen, Esel seien stur und eigenwillig, verbunden. „Was?, Esel?, was sollen wir denn mit denen schon machen können?“ Können die mehr als Streicheltier, Lastenträger oder Reittier des armen Mannes sein?
Wir werden manchmal gefragt: „Warum macht ihr das alles?“ Weil wir einen Sinn darin sehen, dass Esel, sind sie schon mal so wunderbare zahme Haustiere, auf neue Art gewinnbringende Nutztiere sein können.
Noch einige Hinweise zur Sprachwahl und Bildqualität:
Die Sprachwahl des Buches ist allgemein verständlich gehalten und verzichtet weitgehend auf medizinische, psychologische oder sonst spezifizierte Fachbegriffe, denn dieses Buch soll für möglichst viele Berufs- und Interessengruppen attraktiv sein. Wir bitten die Bildqualität einzelner Bilder, die Momentaufnahmen aus Esel-Interaktionen zeigen, zu entschuldigen. Es ist nicht leicht, manche Situationen sekundenschnell auf Bild zu bekommen. Da schleicht sich gerne eine Unschärfe oder sonstige unzureichende Bildqualität ein.
Außerdem konnten die Esel nicht immer in perfekt geputztem Zustand aufs Bild gebracht werden .
Dieses Buch spricht sicherlich mehr die Praktiker an, also solche, die lieber TUN anstatt REDEN oder in wissenschaftliche Theorie-Tiefen abtauchen. Die Qualität von tiergestützten Aktionen entwickelt sich am besten weiter über umfangreich vernetzte Praxiserfahrungen und rege Fachkommunikation unter den Anwendern.
Bild 1 Gesichtsausdrücke lesen („Ich will jetzt Spaß und Spiel!“ – „Ich ruhe, lasst Abstand.“)
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre, auf dass sie Ihnen Freude, Motivation und Ideen bringt.
Pähl am Ammersee, Oberbayern, im September 2012
Anahid Klotz
1 Der Begriff "Fluchttier" wird auf Seite → erläutert
Buchteil 1 – Natürliches Horsemanship mit Eseln
Hinführung zum natürlichen Kommunikationssystem mit einem Esel
Esel zu halten bedeutet große Verantwortung. Diese beginnt mit den artgerechten Haltungsbedingungen. Hierzu gibt es zahlreiche Literatur2. Zudem hilft eine Mitgliedschaft in Vereinen oder Interessengruppen für Eselhalter, sich vielfältig in Theorie und Praxis zur Eselhaltung zu informieren. Doch sorgfältiges Abwägen der vielen Informationen, die man erhält, ist geboten: Es ist nicht alles richtig und eselgerecht, was empfohlen oder sogar von Ämtern vorgeschrieben wird. Wenn wir Esel in unser Leben einbeziehen, mit ihnen arbeiten, mit ihnen aktiv sein möchten, brauchen wir Expertenkenntnisse über sie. Das belangt sowohl ihre Gesundheitsund physiologischen Bedürfnisse, als auch die Verhaltensweisen an. Seit Beginn der Domestikation von Eseln vor circa 6.500 Jahren reifen diese Expertenkenntnisse heran. Wenn wir mit dem Esel partnerschaftlich kommunizieren und ihn als kluges Tier an unserer Seite haben möchten, müssen wir sein Sprachsystem lernen. Der Esel kann es in Perfektion, spätestens ab dem Zeitpunkt der Entwöhnung von der Mutterstute und bis ins hohe Alter hinein. Sein Niveau entspricht einer Feinheit und Größe, die wir Menschen nicht erreichen können. Wir können uns auf menschenmögliche Weise Techniken, Prinzipien, Regeln, möglichst viele Bausteine der Kommunikation aneignen, damit uns der Esel natürlicher Weise versteht. Was heißt denn „natürlicher Weise“?
Sehen wir uns das Gegenteil an, also die „künstliche Weise“: Haus- und Heimtiere und Nutztiere3 aller Arten (zur Gewinnung von Fleisch, Tierprodukten (zum Beispiel Wolle, Milch, Eier) und Tiernebenprodukten (zum Beispiel für Medizin und Kosmetik), zu Transport- und Arbeitszwecken) werden sowohl physisch als auch ihr natürliches Verhalten betreffend künstlich gehalten. Nur einige Beispiele hierzu: Gute bis sehr gute Bedingungen haben sicherlich noch viele Freizeitpferde4, Lawinensuchhunde, Freilandgeflügel, Bienen, Rennkamele, artgerecht eingesetzte Jagdhunde, Holzrückepferde. Glimpflich davon kommen vielleicht noch einige Zootiere und Karawanentiere in manchen Ländern, auch einige Kleinhaustiere, wobei besonders im Kleinhaustierbereich die Dunkelziffer an Misshandlungen, sei es aus Unwissenheit oder vorsätzlich, sehr hoch, tendenziell steigend ist. Noch schlimmer sieht es bei der Massenhaltung von Schweinen, Rindern, Geflügel, Fischen in Aquakulturen, Reptilien für die Lederindustrie, Pelztieren und weiteren aus. Extrembeispiele wären Stopfgänse, die nichts als eine möglichst fette Leber bekommen sollen: sie erleben ihr Leben in minimalem Maße artgerecht. Je stärker die Tierhaltung von natürlichen Bedingungen abweicht, umso größer werden die Verhaltensstörungen bei diesen Tieren, wobei sie für einen reinen Massen-Nutztierhalter irrelevant sein mögen, solange das Tierprodukt in der Sache stimmt. Für Luxus-High-Heels verwendet man ja zum Beispiel das Pythonleder, nicht die Seele der Riesenschlange („hat sie überhaupt eine?“). Oder ein Karawanentier, es soll mit aller Kraft transportieren, egal wie es ihm dabei mental geht. Tier an Tier angeseilt und mit Stockhieben vorwärts getrieben hat das Einzeltier keine Chance, seine Bedürfnisse anzumelden.
Für uns, die wir mit den Eseln anerkannte Partner sein möchten, ergeben sich völlig andere Ansprüche an uns selbst und an den Esel. Es stellen sich hohe Anforderungen sowohl an die physische, als auch geistige, seelische und mentale Fitness von uns und unseren Tieren. Diese fördern wir unter anderem, indem wir uns mit den Eseln maximal verständlich unterhalten. Umso mehr fordern wir die geistige Interaktion zwischen ihnen und uns heraus! Das macht Spaß, das gibt viele neue Impulse, das macht die Partnerschaft kurz- und nicht langweilig. Wir möchten dem Nutztier Esel ein bemerkenswertes Output seiner vielen wunderbaren Eigenschaften abgewinnen, und zwar derart, dass auch er daran viel Spaß hat! So können wir ihn als Freizeitpartner, Pädagogik- und Therapie unterstützendes Tier auf sehr freudvolle Art „nutzen“.
Will das der Esel überhaupt? Ja! Er hat so viel überschüssige Energie, sowohl physisch als auch mental, die er zum Leben in freier Wildbahn bräuchte. Diese schlummernden Energievorräte mögen durch seine neuen Aufgaben sinnvoll verbraucht werden.
In einer Beziehung zwischen Mensch und Tier stellt sich stets die Frage, wie viel Realität und wie viel Interpretation in ein Verhalten des Tieres gedeutet wird. Einfaches Beispiel: Wir kommen zum Stall und ein Esel bleibt auf seiner Position stehen. Im einen Fall können wir interpretieren: „Der Esel ist mit heute total beleidigt, weil ich ihm gestern kein Leckerli gegeben habe“. Im anderen Fall könnte die Realität so liegen: Der Esel lag vielleicht gerade eine viertel Stunde im Sand und führt jetzt seine vertraute Ruhepause im Stehen fort.
Das Kommunikationssystem Esel-Mensch gemäß natürlichem Horsemanship ist Ansichtssache. Es ist wie eine philosophische Einstellung, die man hat, die einem gefällt, mit der man leben möchte, die man sich vielleicht auch gar nicht mehr anders vorstellen kann, oder auch nicht.
Das moderne Natürliche Horsemanship wurde in den Jahren um 1980 entwickelt von Pat Parelli und seinen Freunden, vornehmlich in USA und Australien. Aus seinem sehr detaillierten und fein aufeinander aufgebauten System, das wir auch „Sprechbarmachung der Equidensprache“ nennen könnten, entwickelten sich vielerlei neue und oft mit anderen Methoden vermischte Angebote des Horsemanship. Parelli sagt: Natural Horsemanship sei nicht etwas, was er erfunden hätte, sondern schon so alt, dass es wieder neu ist. Es ist also sicher nicht die Neuerfindung des Rades, aber ein neu entwickeltes, wunderbar effektives Mittel, damit das Rad um vieles flüssiger und weicher laufen kann. Solange Esel im häuslichen Umfeld des Menschen leben, gibt es sicherlich Menschen mit und ohne das „gewisse Etwas“ bezogen auf Gefühl und Köpfchen zum Esel. Natürliches Horsemanship mit Eseln ist eine individuell angepasste Form der Equidensprache. „Geflüstert“ wird hierbei nicht! Fragen und Antworten werden deutlich gestellt und nicht ins Ohr geflüstert, wie gerne in romantischen Filmen gezeigt. Echte Tierexperten, sei es für Großkatzen, Vögel, Hunde, Pferde, Kühe, und alle anderen, wollen womöglich nicht so gerne als „Flüsterer“ gelten.
Natürliches Horsemanship ist auch keine ausschließlich „sanfte“ Art der Kommunikation mit dem Esel, denn was Partner Esel so alles im Repertoire hat, sollten wir uns auch aneignen. Dazu gehört durchaus Zwicken und Kicken, wenn es sein muss. Natürlich für uns auf eine andere Art und Weise, denn wir haben weder Hufe, noch einen langen Hals oder kräftige lange Schneidezähne. Zudem gehen wir Menschen ausschließlich auf den Hintergliedmaßen.
Mensch und Esel lernen und verfeinern, eine gemeinsame Basis der Unterhaltung zu schaffen. Basiswissen mit grundlegenden Fähigkeiten ist ein erster Schritt zur wirksameren Kommunikation mit Eseln. Konsequentes Üben und Routine bringt weitere Erfahrungen und kann aus uns Menschen dann respektable, fortgeschrittene Eselkenner machen, was die Voraussetzung für den Einsatz von Eseln als Pädagogik- und Therapietieren ist. Im Laufe der Jahre können wir zu Eselexperten werden und müssen z. B. mit dem Esel nicht mehr mühsam und ermüdend diskutieren, sondern brauchen nur noch minimale, oder auch mal ein großes deutliches Zeichen als Fragestellung, um eine passende Antwort vom Esel zu erhalten. Unsere innere Einstellung wird souverän und sicher.
Natürliches Horsemanship findet seine Anwendung in allen Bereichen des Zusammentreffens mit den Eseln: bei der täglichen Stallarbeit, beim Wandern oder Ausritt, beim Tierarztbesuch, bei der Hufpflege, beim Verladen in den Transporthänger, wenn Freunde zu Besuch kommen, und vielem mehr. Wir praktizieren also natürliches Horsemanship nicht nur auf dem Übungsplatz, sondern immer und überall. Genau so können wir Missverständnissen und Unfällen vorbeugen und stattdessen eine klare und enorm sichere Kommunikation aufbauen. Unser höchster Anspruch muss hierbei an unsere eigene Verantwortung gestellt sein.
Das natürliche Horsemanship wird eine Grundeinstellung zum Esel. Vergleichen wir Eselsprache mit Menschensprache, so finden wir ebenso Vokabeln und Grammatik. Nehmen wir Französisch als Beispiel:
Tabelle 1 Vokabeln und Grammatik der Menschensprache
Und nun nehmen wir Beispiele aus der Eselsprache:
Tabelle 2 Vokabeln und Grammatik der Eselsprache
Je umfangreicher die Gesamtkenntnisse der Eselsprache werden, umso harmonischer gestaltet sich die Kommunikation mit dem Esel. Alle Zahnrädchen aus Vokabeln und Grammatik sollen flüssig ineinander greifen. Je flexibler unsere Vokabel- und Grammatikkenntnisse werden, umso routinierter können wir uns mit dem Esel unterhalten. Es ist daher wichtig, sich nicht auf ein bestimmtes Thema zu versteifen, sondern alle Facetten, besonders die, die uns schwerer fallen, zu üben. Und vergessen wir nicht, dass neben Vokabeln und Grammatik auch Ausdruck, Tonfall und Ausstrahlung eine wirksame Rolle spielen. Bedenken wir auch, dass Vokabeln und Grammatik durchaus gepaukt werden müssen und uns nicht in drei Tagen Kursbetrieb zufliegen. Selbst das größte Sprachtalent lernt Französisch nicht in drei Tagen. Spätestens wenn es an die Spezialvokabeln und detaillierte Grammatik geht, muss ausführlich studiert werden.
Ein gefühlvoller und begabter Eselhalter war stolz darauf, wie sein Esel einige der üblichen Zirkuskunststücke konnte. Er hatte sie ihm intuitiv beigebracht. Er spürte aber, dass sein Esel mehr könnte, nur, wie? Er nahm an einem Basiskurs im Natürlichen Horsemanship, nur für Eselhalter, teil. Deutlich erkennbar war gleich:
Das Vertrauen war da, aber dem Esel war langweilig. Am Ende des Kurses hatten die beiden einen so wunderbar erweiterten Horizont an Vertrauen, Verständnis, Wissen und Können, dass sich völlig neue Dimensionen ihrer Partnerschaft eröffneten!
Einer der vielen Vorteile am natürlichen Horsemanship ist, dass wir dem Esel nichts beibringen müssen, da es weder Dressur noch Unterricht, sondern eine Übersetzung seiner Sprache für den Menschen ist. Je besser er uns zu verstehen lernt, umso bunter können wir uns miteinander unterhalten.
Nicht nur, um mit den Eseln vielfältig aktiv sein zu können, ist das Erlernen der Eselsprache über Natürliches Horsemanship Erfolg bringend – wir erhöhen unser Sicherheitsniveau im Umgang mit den Tieren enorm! Verletzungen aufgrund von Unkenntnis und Unachtsamkeit sind sowohl bei Mensch als auch Tier nicht zu unterschätzen.
Warum: Natürliches Spiel, zu wenig Platzangebot im Stallgelände, falsches Verhalten des Menschen beim Führen der Tiere
Esel an MenschHautabschürfungenHämatome
Quetschungen
Unterkieferbrüche
Gesichtsverletzungen
Knochenbrüche allgemein
Gehirnerschütterungen
An- oder abgebissene Finger
Beckenbrüche
Querschnittslähmungen
Wovon: Durchziehende Führseile, mitgezogen werden, Hufschläge, Tritte von Hufen auf die Füße/Zehen, Bisse, AbwurfWarum: Übersehen von Engstellen, zu wenig Voraussicht und Überblick über Gesamtsituation, zu kurzes Halten des Esels, Festhalten, unsachgemäßes Festbinden, unzureichende Kenntnisse über das Eselverhalten, Einsatz von unnatürlichen Werkzeugen und Hilfsmitteln
Mensch an EselZerrungenQuetschungen
Knochenbrüche
Nasenrückenbrüche
Schnitte, offene Wunden
Hufverletzungen
Genickbruch
Wovon: Losreißen von Anbindungen, Schläge auf Zone 1, Hängerverladen mit Seilwinde, Engpässe mit Druck und GewaltWarum: Übersehen von Engstellen, zu wenig Voraussicht und Überblick über Gesamtsituation, zu kurzes Halten des Esels, Festhalten, unsachgemäßes Festbinden, unzureichende Kenntnisse über das Eselverhalten, Ungeduld, Zeit- und Leistungsdruck, Einsatz von unnatürlichen Werkzeugen und Hilfsmitteln
Tabelle 3 Häufige Verletzungen aufgrund unzureichender Kommunikation
Die Angaben in Tabelle 3 betreffen zum Glück für uns Eselhalter eher die Vorkommnisse aus der Pferde-, nicht so sehr der Eselszene. Trotzdem gibt es sie, wenn auch in oftmals gemilderter Form. Unfälle können beim gewissenhaftesten und kenntnisreichsten Umgang mit Eseln passieren. Glück und Pech gehören schließlich auch dazu. Doch vieles wäre tatsächlich vermeidbar, ließe man sich mehr Zeit und Geduld.
Eine Frau führte ihr Pferd mit einem um ihre Hüften gebundenen Führseil. Als das Pferd erschrak und los rannte, wurde die Frau mitgerissen, schlug gegen einen Baum und verlor durch diesen Leichtsinn ihr Leben.
Tabelle 4 Bereit für natürliches Horsemanship?
5 x „Ja“? Dann kann es los gehen auf der Reise, uns und den Eseln täglich neu eine erfreuende harmonische Partnerschaft zu gestalten. Unsere geduldigen und klugen Freunde begleiten uns dabei Schritt für Schritt. Und keine Sorge: Wenn wir uns zu Beginn noch oft und im Verlauf des Lernens immer weniger versprechen, sind die Esel die Ersten, die uns die Fehler nachsehen.
„Des Esels Gesang: „Bleib cool und entspann!“
Bild 2 Alle sind zufrieden – so ist es gut!
Unsere Grundeinstellung
Bild 3 Ein Zentimeter Spielraum
Eine der wichtigsten Grundeinstellungen zu den Eseln, mit denen wir eine partnerschaftliche Verbindung aufbauen möchten, betrifft die Macht. Macht versus Erlaubnis: Je mehr Macht im Spiel ist, umso weniger wird eine Erlaubnis des Partners zu einer Aktivität abgewartet. Es ist ein großer Unterschied, ob wir dem Esel eine Aktion aufdrängen, oder ob wir sie derart einleiten, dass er Akzeptanz und Spaß dabei zeigt. Jede Partnerschaft bedeutet immer auch eine Form der Abhängigkeit voneinander. Je nach Niveau an Harmonie in einer individuellen Partnerschaft fällt die Abhängigkeit voneinander eher angenehm oder unangenehm aus. Eine angenehme Abhängigkeit beinhaltet geringe Machtanteile (gleichwertige Partnerschaft), eine unangenehme dagegen viel (Diktatur). „Macht“ ist im natürlichen Horsemanship mit Eseln fehl am Platz. Esel kennen aus ihrem natürlichen Umfeld keine Hierarchie in der Herde, sie kennen auch kein dominantes Alphatier und somit auch keinen „Wortführer“ (siehe auch Seite → zur Verhaltensforschung über Wildesel). Da Esel Flucht- und Menschen Raubtiere sind, haben beide eine unterschiedliche Einstellung zu Dominanz, Machtstreben und Überlegenheit. Wir wissen, dass Esel uns in physischer Kraft überlegen sind. Sie könnten uns sogar mit einem gezielten Hufschlag schwer verletzen oder töten, doch hätten sie dabei lediglich, ihr Leben verteidigend, auf ein Raubtierverhalten unsererseits reagiert. Im Wissen darüber wappnen sich viele Menschen mit unterdrückenden, einschnürenden, kraft- und druckvollen Mitteln und Verhaltensweisen gegenüber Tieren. Das können Käfige, gefängnisgleiche Boxenhaltung, Peitschen, Eisenteile, zusammen gekettete Füße, straffe Zaumzeuge, in Stallgassen beidseitige Anbindung und Fixierung, Sedierungsmedikamente, Geschrei, Angriffs- und Verteidigungs-Körpersprache und vieles mehr an Machtdemonstration und Kontrollierung sein.
Wenn Menschen keinen anderen Ausweg sehen, als so zu handeln, haben sie eine für eine Partnerschaft völlig unpassende Einstellung zum Esel. „Bevor der mich schlägt, schlage ich ihn lieber zuerst, und schüchtere ihn so erst einmal gehörig ein. Der wird mir dann schon folgen!“ – dieser Esel wird vermutlich alles tun, um keine weiteren Schläge zu bekommen, und der dazugehörige Mensch demonstriert stolz seine machtvolle Erziehung des gefügigen Esels.
Für uns kluge Eselhalter ist also Grundeinstellung Nummer 1: Wir hinterfragen täglich, ob wir uns gerade unserer menschlichen Machtmittel bedienen, um mit dem Esel vorwärts zu kommen, oder ob wir uns seiner klugen, gelassenen, feinen und konsequenten Sprache bedienen. Mit ihr können wir den Esel als respektierten Partner, nicht als Unterdrückten, ansprechen. Denn genau dann brauchen wir keine Gebisse, Peitschen oder straffen Nasenführketten! Auch doppeltes Anbinden wird völlig unnötig sein, da unser Esel liebend gerne aus freien Stücken ruhig bei uns steht und da bleibt.
Nun zu weiteren Zahnrädern für unsere harmonische Grundeinstellung zum Esel:
Aufgeben
Wir bleiben an einer Aufgabe, an einer Idee, an einer Frage dran und geben nicht auf – das honoriert der Esel in besonderem Maße und steigert seinen Respekt zu uns. Wir geben nicht auf und nehmen uns die Zeit, die wir für den zufrieden stellenden und weiter führenden Erfolg brauchen, auch wenn er noch so ein kleines Zahnrädchen im Großverbund ist.Vom Leichten zum Schweren Natürlich sollten die Aufgabe, Idee oder Frage maßvoll und in Relation zu unserem Können gestellt sein, damit wir nicht unsere oder des Esels Verzweiflung provozieren. Wir schicken ja einen Anfänger-Skischüler auch nicht gleich auf die schwarze Piste.Verantwortung Es ist eine Herausforderung an unser Verantwortungsgefühl, wie leicht oder schwer wir eine Frage stellen, um nicht in eine Sackgasse zu geraten.Spaß Unsere wie des Esels oberste Motivation soll der Spaß sein. Auch wenn eine Übung zur anstrengenden und angespannten Geduldsprobe ausgeufert war, sollen am Ende Spaß, Entspannung und Freude über den Fortschritt überwiegen. Nur so machen wir die einmalige Erfahrung, dass der Esel zu uns mental, emotional und physisch eine echte Beziehung aufbaut. Wir werden besondere Kommunikationsgrundlagen aufbauen, werden mehr Abwechslung und mehr Spaß mit dem Esel erleben, das gegenseitige Vertrauen verbessern und beständig eine mentale Verbindung aufbauen, die stärker ist als jedes straff gezogene Führseil.Beharrlichkeit Beharrlichkeit versus Geduld und Gelassenheit. Ein beharrlicher Standpunkt signalisiert dem Esel: Der Mensch dort ist stur und störrisch und hat eindeutige Raubtiereigenschaften. Anspannung und Entspannung, Annäherung und Rückzug, und Rhythmus sind viel bessere Rezepte als Beharrlichkeit. Durchhaltevermögen + Lächeln ist besonders beim Einstieg in das natürliche Horsemanship gefragt.Vermenschlichung Eine vermenschlichte Sicht auf die Esel werden wir auch beim besten Willen nicht immer vermeiden können. "Wichtig für uns" bedeutet nicht unbedingt "wichtig für den Esel":Wir müssen uns täglich daran erinnern, den Esel nicht zu vermenschlichen, sondern SEINE Bedürfnisse zu achten. Esel lieben ihr Fell staubig und bevorzugen großen Auslauf. Gebissen und geschubbst zu werden gehört zum Herdenleben des Esels dazu. Davor brauchen wir ihn nicht zu bewahren, indem wir jeden Esel in einer Einzelbox halten, sein Fell shamponieren oder versuchen, den schubbsenden Esel zu bestrafen. Er ist auch nicht „beleidigt“, wenn er uns mal den Hintern zuwendet. Er ist nicht „hinterlistig“, wenn er uns zwickt. Je eselsgerechter wir ihn betrachten und ansprechen, umso bereitwilliger integriert er uns in sein Leben.
Tabelle 5 Grundeinstellungen von Mensch zu Esel
Der Prüfer einer Pferdesachkundeprüfung, abgehalten von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, ermahnte die Prüflinge beim Auskratzen der Hufe: „Denkt daran, dass eure Pferde dumm sind! Deshalb müsst ihr die Hufe in immer derselben Reihenfolge auskratzen.“ Ich dachte, das gibt’s doch nicht, wie kommt er nur auf so etwas?! Alle Prüflinge außer mir nickten aber zustimmend. Hätte ich protestiert, so wäre bestimmt das Bestehen der Prüfung gefährdet gewesen. Wenn wir ein intelligentes Säugetier für dumm behandeln, werden wir von ihm auch dumme Antworten erhalten. Um die Ermahnung des Prüfers zu korrigieren: Natürlich kratzen wir die Hufe gerne in verschiedenen Reihenfolgen aus, denn unser kluger Esel hört unsere Ansagen, anstatt sich monotonem Langeweile-Verhalten des Menschen zu ergeben.
2 Siehe Literaturempfehlungen
3 Geläufige Unterteilungen sind: Nutztier – Haustier – Heimtier, oder landwirtschaftliche/nicht landwirtschaftliche Nutztiere
4 Hier sind die Freizeitpferde gemeint, die großen Auslauf und natürliche Herdenlebens-Bedingungen geboten bekommen. Boxenpferde bewegen sich täglich circa 500 Meter weit, addiert aus „1 Schritt vor, 1 zurück“. Im Hinblick darauf, dass Wildpferde täglich bis zu 30 Kilometer Strecke zurücklegen, sind 500 Meter wenig artgerecht.
5 Aus der herkömmlichen Pferde- und Eselszene kennt man das Abklopfen, was Lob und Anerkennung ausdrücken soll. Doch leider wissen die wenigsten Tierhalter, dass Klopfen äußerst unangenehm für das Tier ist. Einfach mal an sich selbst ausprobieren!
6 Bezieht sich nur auf Esel als Haustiere. Bezieht sich auch nur auf Verletzungen durch fehlerhafte Kommunikation mit dem Esel, nicht auf Verletzungen und Krankheiten von Haltungs- und Unterbringungsmängeln, zum Beispiel Verkehrsunfällen, Hufrehe, Überfettung, Bewegungsmangel, falsche Fütterung, und vieles mehr.
7 Je mehr Qualitäts-Zeit wir besonders am Anfang investieren, umso mehr können wir uns über die ersten nachhaltigen Erfolge freuen und darauf aufbauen
8 Nach Tierschutzrichtlinien lautet die Formel: Dem Esel darf zwischen einem Fünftel und einem Siebtel seines Körpergewichtes, abhängig von seiner Kondition, an Last auferlegt werden.
9 Untersuchungen zeigen, dass an Gebissen zu viel gezogen wird. Befragungen der Reiter, darunter zahlreiche Profireiter, die zu stark zogen, ergaben oft, dass diese sich dessen nicht bewusst waren. Ganz im Gegenteil waren sie sogar überzeugt, die Zügel besonders leicht einzusetzen. Sind die Zügel zu 95% locker und nur kurzzeitig zu straff gehalten, reicht dies schon für Schmerz am Tier, und dies an empfindlichsten Stellen im Gesichtsbereich.
Unterschiede zwischen Esel und Pferd
"Der Esel ist KEIN kleines Pferd". Auch wenn noch mancher Tierarzt10, Pferdehändler, Eselhalter, Pädagoge, Therapeut, Eltern, Opa & Oma, oder ganz allgemein, Mitmensch, Esel und Pferd in einen Topf wirft, gibt es meilenweite Unterschiede bei beiden Equiden.
Hier einige Beispiele, die verdeutlichen, wie sich in der Konsequenz auch die Kommunikations- und Einsatzmöglichkeiten mit diesen beiden Equiden unterschiedlich ausprägen.
Physiognomie, Ursprung
Sozialstruktur11
Verhalten bei Gefahr
Tabelle 6 Unterschiede zwischen Esel und Pferd
Weitere interessante Gesichtspunkte zum Unterschied Esel und Pferd, die Medizin und Haltung betreffen12, und die der Eselfreund wissen sollte, sind:
Eine Routinekastration wie beim Pferd kann bei Eseln und Maultieren zu so extremen Nachblutungen führen, dass die Tiere sterben
Pferdegerechte Fütterung führt beim Esel zu Hufrehe, Stoffwechselstörungen, Übergewicht und Fruchtbarkeitsstörungen
Eselhufe sind kleiner und haben eine dickere Hufwand und einen steileren Hufwinkel
Der Widerrist des Esels ist in Relation niedriger und das Brustbein ragt weiter nach vorne. Das Becken hat eine andere Form. Der Unterkiefer ist dicker und aus dichterem Knochen und die Unterkieferäste liegen näher beieinander
Esel haben 31 und Pferde 32 Paarchromosomen
Die Trächtigkeit der Esel dauert ungefähr 365 – 370 Tage und länger, die der Pferde 335 – 346 Tage
Esel sind langlebiger als Pferde. Alter über 45 Jahre ist keine Seltenheit. Die Zahnalterslehre des Pferdes lässt sich nicht einfach auf die Esel übertragen. Esel erscheinen dann viel jünger als sie sind
Im 19. Jahrhundert wurde entdeckt, dass der Kehlkopf des Esels sich von dem der Pferde unterscheidet. Man hat festgestellt, dass die Esel nicht nur das Pferde - Wiehern nicht wollen, sondern auch nicht können, da sie anders ausgebildete Stimmbänder haben und sich die ganze Topographie des Kehlkopfes unterscheidet
Esel haben 5, Pferde 6 Lendenwirbel
Im Blutbild haben Esel weniger, dafür größere rote Blutkörperchen. Die durchschnittliche Rektaltemperatur ist 37°C, variiert jedoch sehr stark. Bei kühlen Morgentemperaturen werden manchmal nur 35,5°C gemessen und bei Außentemperaturen über 40°C steigt die Temperatur auf um die 39°C.
Selbst bei schwerer körperlicher Anstrengung haben die Esel keine Schwierigkeit, die Körpertemperatur dann auf ca. 39° zu halten
Da der Stoffwechsel der Esel sich vom Stoffwechsel des Pferdes unterscheidet, sind auch die Medikamenten-Abbauzeiten sehr unterschiedlich
Penicillin wird vom Esel sehr schnell abgebaut. Wenn bei einer Infektion diese Eigenart nicht beachtet wird, kann es zu großen Behandlungsschwierigkeiten kommen. Andere Substanzen werden nur sehr langsam abgebaut, wie z. B. das Phenylbutazon, das bei Erkrankungen des Bewegungsapparates eingesetzt wird. Mit einer regelmäßigen Pferdedosierung kann es dann zu Vergiftungserscheinungen kommen. Ähnliche Unterschiede in den Abbauzeiten der Medikamente kommen auch bei der Narkose zum Tragen. Deshalb empfiehlt es sich, zum Wohl des Esels lieber vor einem Eingriff, als danach Informationen einzuholen
Ist der Esel ein Fluchttier?
Ja, er ist. Menschen sind Raubtiere13, Equiden sind Fluchttiere. Der Begriff „Fluchttier“ kann eng oder weit ausgelegt werden. Es geht hauptsächlich um die Art der Wahrnehmung und folglich der instinktiven Reaktion auf Gefahr. Nimmt eine Großkatze ein Zischgeräusch wahr, wird sie situationsbedingt in Kauerstellung verharren und lauschen. Ein Esel hingegen wird nicht gegen seinen Fluchtinstinkt ankämpfen können und rennt davon. Es sei denn, er ist ein cooler Partner zu demjenigen Menschen, der die Zischgeräusche auslöst. Folglich können wir Menschen höchstens freundliche Raubtiere für den Esel sein. Auch nach langjähriger freundlicher und respektvoller Partnerschaft bleiben wir aus Esel-Sicht ein Raubtier für ihn, das sich jedoch sehr angenehm und vertrauenswürdig benimmt.
Wir gehen mit dem Esel im Wald spazieren und führen ihn locker am durchhängenden Führseil. Wir kennen uns ja schon seit Jahren! Wir stolpern unverhofft über eine Wurzel und fallen automatisch in eine Großkatzen (Raubtier)-Körperhaltung. Noch dazu kommt plötzlicher Zug aufs Führseil, da wir uns mit der Hand auf dem Boden abstützen und das Seil nicht lang genug ist. Unser Reflex ist ja, fest zu halten, anstatt los zu lassen. Der Esel wird nun um einen Fluchtreflex gar nicht umhin können! Wie stark er ausfällt, wird an seiner Einstellung zu uns liegen.
Bild 4 Abhängig von unserer Körperhaltung vertraut oder misstraut der Esel
Bild 4 zeigt uns, dass der Esel zunächst, wie gewohnt, unsere Freundlichkeit genießt und sich dabei entspannt. Gehen wir jedoch in die Raubtierposition über, in der Regel aus Unachtsamkeit, so kann der Esel eben nicht sagen: „Ach, diese Person kenne ich schon seit Jahren als immer freundlich und partnerschaftlich, die kann ich als harmlos einstufen, auch wenn sie momentan eine bedrohliche Pose einnimmt.“ Und wir dürfen adäquat dazu nicht sagen: „Ach, Esel, du kennst mich doch schon so lange und weißt doch, dass ich dir nichts Böses will, auch wenn ich gerade gestolpert und in einer Raubtierposition gelandet bin.“
Vielmehr muss der Esel die Bedrohung von Natur aus ernst nehmen. Dafür dürfen wir ihm keinen Vorwurf machen. Das gäbe unserer Partnerschaft mit dem Esel klar einen Minuspunkt! So verständlich und einfach das Verhaltensgesetz, kein Raubtier für den Esel sein zu dürfen, klingen mag, so große Disziplin und Bemühung erfordert es von uns. Hier werden wichtige Weichen für Partnerschaft versus Misstrauen gestellt.
Bild 5 Kanaldeckel: für viele Menschen, auch einige Esel, normal, für viele Esel ein Gefahrenindiz
Was uns Menschen Angst macht, muss nicht unbedingt einem Fluchttier Angst machen, und umgekehrt. Genau das führt oft zu unglücklichen Kommunikationsverläufen zwischen Esel und Mensch. Wir müssen in Bild 5 akzeptieren, dass der Esel rechts Angst vor dem Kanaldeckel hat. Es gibt viele Esel, die mit etwas Training keine Angst mehr haben. Doch muss sich häufiges Üben nicht immer dahin entwickeln, dass der Esel schrittweise seine Angst abbaut. Solange Eselhalter und Esel individuell ihre Gewohnheiten und persönlichen Charakterneigungen kennen und respektieren, können sie sich miteinander eine freundschaftliche Partnerschaft gestalten.
Nun zu einigen typischen optischen Merkmalen von Flucht- und Raubtier. Ein Fluchttier muss in einem Sekundenbruchteil erkennen können, ob sich aus der Distanz ein Verwandter oder eine Gefahrenquelle nähert. Die beiden sich begegnenden Tiere können nicht erst aufeinander zugehen und riechen, ob der eine nach Fleisch, der andere nach Pflanzen riecht. Aus 200 Metern oder noch größerer Entfernung müssen sie bereits abprüfen können, um wen es sich handelt.
Ob, wie lange, wie intensiv und in welchem Bewegungsmuster dann die Fluchthandlung ausfällt, unterscheidet sich bei jedem Fluchttier. Der Feldhase flüchtet anders als die Gazelle, der Esel flüchtet anders als das Pferd.
Bild 6 Fluchttiere erkennen sich untereinander sofort als solche
Die Einteilung in Raub- und Fluchttiere ist nichts Absolutes. Viele Beutegreifer können selbst zur Beute werden. Wird Beutegreifer Fuchs, der auf eine Maus lauert, beispielsweise von einem Steinadler angegriffen, wandelt sich sein Raubtierverhalten blitzschnell um und er flüchtet um sein Leben.
Grundsätzlich sind Pflanzenfresser zu den Beutetieren, hingegen Alles-, Fleisch- und Aasfresser zu den Beutegreifern beziehungsweise Raubtieren einzuteilen.
Eine Maus kann sofort erkennen, ob Gefahr über ihr fliegt: Gans oder Ente (keine Gefahr) haben einen langen Hals, ein Mäusebussard (Gefahr) einen kurzen.
Bild 7 Fluchttier- und Raubtiermerkmale im Gesichtsbereich
Natürlicher Weise hat der Mensch typische Raubtiermerkmale, zum Beispiel:
Flächiges Gesichtsfeld
Nach vorne gerichtete Augen mit direktem Blick
Schläfen von vorne sichtbar
Kurze, wenig sichtbare, fest anliegende Ohren (bei Raubtieren auch beweglich!)
Kurzer Hals
Die Nasenrückenpartie ist schmäler als die Wangenpartie (von vorne gesehen)
Der Abstand Auge - Nase ist in Relation zum Abstand Nase - Mund viel kürzer
Sichtbare Kinnpartie
Natürlicher Weise hat der Esel typische Fluchttiermerkmale, zum Beispiel:
konkaves Gesichtsfeld
Seitlich angeordnete Augen mit Panoramablick
Schläfen von vorne nicht sichtbar
lange, rundum bewegliche Ohren
langer Hals
Die Nasenrückenpartie ist breiter als die Wangenpartie (von vorne gesehen)
Der Abstand Auge - Nase ist in Relation zum Abstand Nase - Mund viel länger
Kinnpartie nicht sichtbar, sondern nur Unterlippe
Typische Verhaltensweisen/Eigenschaften von Fluchttier und Raubtier
Um wieder einen Schritt weiter zu kommen im hilfreichen Lesen unseres Esels führen wir uns vor Augen, wie Flucht- und Raubtiere sich typischer Weise in Schlüsselsituationen verhalten.
Vertikal und horizontal schwankende Ganzkörperbewegung
Direkt nach vorne gerichtet Eher vertikal schwankende BewegungenAnnäherung an etwas UnbekanntesMit Annäherung und Rückzug, in großen Halbkreisen bzw. Schleifen, mit hoch gestrecktem Hals und maximaler KopfhöheMit Panoramablick; Kopf schwenkt öfters zur Seite, damit volle 360° einsehbar sind
Mit Annäherung und Stopps, auf einer geraden Linie, geduckte Körperhaltung (Hals wird noch kürzer!)Mit direkt fokussierendem Blick
Überblick, SichtfeldCa. 340°; leichte Neigung des Kopfes ergibt schon Überblick über 360° (siehe auch Seite →)Ca. 200°Plötzlicher Angstimpuls überrascht das Tier (verschiedene Möglichkeiten)Möchte unbedingt flüchtenFalls er angebunden ist: Zurückziehen, Herumtänzeln
Muss sofort die Beine bewegen
Geht sofort in hohes Tempo
Hält Kopf maximal hoch, für maximalen Überblick
Augen und Nüstern werden groß
Schwanzschlagen oder -einziehen
Zwicken oder Beißen
Heftiges Zurückziehen
Lautes, kurz gepresstes Schnauben
Kopfschlagen
Ausschlagen (Hinterhand)
Nicht mehr ansprechbar
Bewegt sich keinen Schritt mehr
Zugepresstes Maul/Lippen
Zittern und Starre, falls eingesperrt
Bleibt starr stehen (Innehalten)Macht sich klein, duckt sich
Kneift die Augen zusammen
Zieht den Kopf ein
Nimmt eine insgesamt eingezogene
Körperhaltung ein
Hält Gegenstand in der Hand fest (z. B. Führseil!)
Atmet kaum (bevor die angstbedingte Hyperventilation beginnt)
Langanhaltendes Schreien
Unkontrolliertes Um-sich-Schlagen
Fußtritte, Faustschläge
Kann, wenn er davon rennt, kein hohes Tempo gehen
Tabelle 7 Verhaltensunterschiede zwischen Fluchttier Esel und Raubtier Mensch
„Ich kann das nicht“, „ich will das nicht“, „ich tue das nicht“
Zu 95% resultieren Verhaltensweisen des Esels wie Widersetzlichkeit, Zurückziehen, Huftritt, Starrheit, „das-mache-ich-nicht“ oder „das-kann-ich-nicht“ aus Angst oder Schmerz. Es ist also schlichtweg eine Beleidigung, dem Esel zu unterstellen, er hätte keine Lust oder mag nicht, weil er stur sei. Das ist genau das Urteil, das er am allerwenigsten braucht.
10 Tierärzte lernen noch heute im Studium der Veterinärmedizin kaum über Esel
11 Ausführlicher im Kapitel Evolution der Esel und ihr Sozialleben in freier Wildbahn (Seite →)
12 Quelle: Tierarztpraxis Dr. Manfred Stoll, D-65329 Hohenstein – Breithardt Siehe auch Literaturempfehlungen
13 Die Bezeichnung „Raubtier“ ist ebenso wie „Raubvogel“ unter Fachleuten nicht mehr zeitgemäß. „Beutegreifer“ oder „Carnivore“ wären fachgerechter. Doch bleiben wir hier im Buch der Einfachheit halber, und weil der Begriff gebräuchlich ist, beim „Raubtier“.
Motivationen
Bild 8 Die Motivations- und Bedürfnispyramide
Angelehnt an die berühmte Bedürfnispyramide nach Maslow, die im Jahr 1970 noch dahingehend erweitert wurde, dass über „Selbstverwirklichung“ eine sechste Motivation für den Menschen, nämlich „Transzendenz“ liegt, leiten wir für die Esel vier Motivationen ab:
(Für den Menschen: Individualbedürfnisse)
Spielen, Stallutensilien verziehen, Schubkarren umwerfen, Stubbsen, Reißverschlüsse öffnen, Zäune oder Holzwände anknabbernHöhere Wertschätzung, Status, Respekt, Anerkennung (Auszeichnung, Lob), Wohlstand, Einfluss, Erfolg, körperliche und mentale StärkeSelbstverwirklichung/Individualität, Talententfaltung, Perfektion, Erleuchtung, SelbstverbesserungTranszendenz/Suche nach Gott, nach einer das individuelle Selbst überschreitenden Dimension oder nach etwas außerhalb des real beobachtbaren SystemsTabelle 8 Motivations- /Bedürfnishierarchie für Esel und Mensch
Die ersten drei Stufen in der Motivations- und Bedürfnispyramide nennt man auch Defizitbedürfnisse. Diese Bedürfnisse müssen befriedigt sein, damit man zufrieden ist, aber wenn sie erfüllt sind, hat man keine weitere Motivation, diese zu befriedigen (wenn der Esel zum Beispiel nicht mehr durstig ist, versucht er nicht mehr zu trinken). Um die Stufe „Sicherheit“ zu befriedigen, muss der Esel hohen Energieaufwand aufbringen: Fluchtartiges Rennen, sich und sein Fohlen verteidigen und mit allen Gliedmaßen ausschlagen, mit der Vorhand angreifen, immer 360° Sichtfeld überblicken, alle Sinnesorgane auf höchste Empfangsstufe stellen, Komfort- oder Sicherheitszonen ausfindig machen, auf Entspannung verzichten.
Für den Menschen werden die Bedürfnisse ab Stufe 5, also ab der Selbstverwirklichung, als unstillbar eingestuft. Sie können nie wirklich befriedigt werden. Bezogen auf den Umgang vieler Menschen mit Tieren könnten hier zwei Beispiele gelten:
Ein Hundehalter stellt seine Zuchthunde auf Ausstellungen aus, peppt sie dazu mit Haarschleifchen und Dekorationsmaterial auf. Sein Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstverwirklichung definiert er über seine Hunde (Zucht- und Schönheitserfolge), und dieses Bedürfnis ist nach einer bestimmten Anzahl Pokalen nicht gestillt.
Ein Pferdehalter schwört auf eine bestimmte Pferderasse und sucht stets nach einem noch perfekteren Tier, das die vorgegebenen Rassestandards noch vollkommener in sich vereinigt. Hat er ein in seinen Augen noch ansprechenderes Tier gefunden, wird das schlechtere verkauft
14
.
Wenn wir uns bewusst machen, dass die Motivationspyramide streng und unveränderbar, aufgebaut auf Millionen Jahren der natürlichen Evolution, von unten nach oben läuft, verstehen wir auch: Wir können einen ungeübten Esel, der von Natur aus klaustrophobisch ist, nicht mit Leckerli in einen engen und für ihn lebensbedrohlich wirkenden Transporthänger locken. Da in diesem Moment sein erstes und zweites Bedürfnis an vorderster Stelle stehen, werden ihn spaßvolle Leckerlis kaum motivieren, in den furchtbar beängstigenden Käfig zu steigen, in dem er, so befürchtet er, gleich sterben wird.
Wirkungsvolle Kommunikation für beide Beteiligten, also Esel und Mensch, verlangt, dass wir uns in die Motivationskonstellation des Esels hinein denken. Diese mag aus Menschensicht einfach und spärlich erscheinen. „Der Mensch steht über dem Tier“ ist die Überzeugung vieler Menschen weltweit. Abschalten können wir unsere allzu menschliche fünfte und sechste Motivation „Selbstverwirklichung“ und „Transzendenz“ sicherlich nicht, da diese im Laufe der Evolution des Homo Sapiens Sapiens fest in unseren Denkstrukturen verankert werden. Das auszuführen würde für dieses Buch zu sehr in philosophische Bereiche führen.
Zwei Beispiele mögen der Veranschaulichung zur je obersten Motivation von Mensch und Esel dienen:
Heute, im Jahre 2012, ist es bereits für Kinder im Grundschulalter enorm wichtig, nicht nur ein Mobiltelefon mitzuführen, sondern auch das der richtigen Herstellermarke. Im Vergleich dazu, was ein Kind im Alter von 9 Jahren tatsächlich lernen sollte, um altersgerecht mithalten zu können in einem natürlichen Familien- und Sozialverband seiner Umgebung, hat ein Mobiltelefon nur spärlich effektive Funktion. Es bietet weder körperliche Bewegung, Spiel mit Förderung von Körper UND Geist, gesunde Nahrung (die sich auf die körperliche Verfassung bis ins hohe Alter auswirkt), Erlernen von später lebenswichtigen Techniken, Gleichgewichtssinn, Muskelaufbau, gesunde Verhaltensweisen, Sprachfähigkeiten, logisches Denken für ein selbständiges Leben, Entwicklung gesunder Sozialbeziehungen.
„Für den Notfall“ ist ein häufiges Argument dafür, dass Kinder bereits Mobiltelefone besitzen sollen. Dabei sind Marke und hoher Preis des Gerätes entscheidend für das kurzfristige und realitätsferne Wohlfühlen des Kindes, auch der Eltern, die sich darüber definieren und sich in Bedürfnisebene 5 aufhalten. Es werden vielfach höhere Geldbeträge, also auch übertragener Energieaufwand, ausgegeben, als für ein natürliches, altersgerechtes Motivationssystem (oberste Stufe: „Spiel und Spaß im Wald“) ausreichen würde.
Im Vergleich dazu hätte es für den Esel keine Bedeutung, aus einer Futterraufe mit Werbeaufschrift „Heuberger“ (teuer!) oder „Strohtotal“ (billig) zu fressen. Für ihn zählt, sein echtes Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme erfüllt zu bekommen. Frisst er nur aus „Heuberger“, wird seine partnerschaftliche Anerkennung in der Herde nicht anwachsen.
Der Trend im Freizeit(sport)bereich nimmt in einigen Sparten immer gewagtere und riskante Formen an. Besonders ungeschulte Quereinsteiger begeben sich teils auf gefährliches Terrain. Der soziale und normative Druck veranlasst sie zu Handlungen, die weit über ihrer Fähigkeit zur Einhaltung ihrer individuellen Stufe „Sicherheit“ liegen. Nicht selten erleiden sie nach einem Unfall schwere Versehrtheiten.
Esel hingegen werden immer der Reihe nach, auf der Bedürfnis- und Motivationspyramide von unten nach oben, handeln, und nur bei überlebenswichtiger Notwendigkeit riskante Engpässe gehen. Sie würden nie spaßeshalber ein großes Gesundheitsrisiko wagen, um ihr herdeninternes Image als „cooler Gefährte“ aufzupolieren.
Wie weit menschliches Verhalten bereits von den natürlichen Bedingungen und Anforderungen an gesunde Lebensführung abgewichen ist, wird aber besser in philosophischen Kreisen ausgeführt. Die Motivationspyramide des Esels könnte hier gut zum Verständnis der „Leichtigkeit des Seins“ beitragen.
Nun wenden wir uns wieder der Praxis bei „Esel und Mensch“ zu. Hilfreich ist, uns immer wieder zu fragen, in welcher Motivationsebene wir und der Esel sich jeweils gerade befinden, um uns und den Esel besser lesen zu lernen und zu erkennen, was im Moment machbar oder eher zu vermeiden wäre.
14 Unter streng vorgehaltener Hand, als Tabuthema in unserer Gesellschaft, wird das Verbleiben vieler Tiere, die nicht mehr gut weiterverkauft werden können, gehandhabt. Nicht selten landen sie in der Schlachtung oder werden euthanasiert, obwohl sie gesund sind.
Evolution der Esel und ihr Sozialleben in freier Wildbahn
Vor circa 60 Millionen Jahren gingen die Pferdeähnlichen aus primitiven fünfzehigen Urformen hervor. Das Urpferd hatte nur Fuchsgröße, ernährte sich von Blättern im Wald, besaß hinten drei und vorne vier Zehen. Es folgten dann Entwicklungen in Nordamerika und Eurasien.
Heute können sich sieben Arten der überlebenden Equidenvertreter finden15: Grevyzebra, Steppenzebra, Bergzebra, Afrikanischer Wildesel, Halbesel, Kiang, Przewalskipferd.
Die drei Zebraarten sowie der afrikanische Wildesel leben heute in Afrika und stammen von Einwanderern aus Asien ab. Halbesel, Kiang und Przewalskipferd sind in Asien beheimatet. Es gab ursprünglich auch in Europa ein Wildpferd und einen europäischen Wildesel. Dieser verschwand vor ca. 7000 Jahren. Der Europäische Wildesel lebte in einem Gebiet zwischen Spanien und Türkei, das im Norden auf zirka dem 52. Breitengrad (Höhe Berlin) begrenzt war. Die historischen Verbreitungsgrenzen der Wildesel reichen im Norden sogar bis in den Ural (die nördliche Uralgrenze verlief zirka nördlich des 50. Breitengrades). Heute werden die Wildesel wie folgt eingeteilt:
Taxonomische Einteilung in der Biologie am Beispiel Europäischer Hausesel:
15 Quelle: Denzau, Wildesel
16 Stand: Frühjahr 2012, siehe auch www.zootierliste.de
Wichtige Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung über Wildesel
Aus historischen Berichten über Wildesel beziehungsweise wild lebende Equiden, von der Antike bis in die Neuzeit reichend, geht hervor, dass die Sozialverhalten innerhalb derselben Familie und auch Gattung teilweise stark differieren. Bei Pferden erobert ein Leithengst eine Stutenherde und bewacht sie wie einen Harem. Berg- und Steppenzebras verhalten sich ebenso, Grevyzebras dagegen nicht. Wildesel, Halbesel und Grevyzebras haben in etwa dasselbe Sozialsystem.
Der Bestand kommt auf circa 6 Tiere pro Quadratkilometer und zeigt sich in verschiedenen Gruppierungen:
Einzeltiere
Hengstgruppen
Stutengruppen mit Fohlen
Stutengruppen ohne Fohlen
Gemischter Verband aus Hengsten und Stuten
In keiner der Gruppierungen bei Wildeseln, Halbeseln und Grevyzebras waren Rangordnungen oder permanente Leittiere zu erkennen. Lediglich zwischen Stuten und Fohlen im Alter bis zu zwei Jahren bestehen enge Bindungen.
Hengste verhalten sich territorial und behaupten ihr Territorium ganzjährig. Es gibt einen Territoriumsbesitzer, der fremde erwachsene männliche Tiere duldet, allerdings nur, wenn diese sich nicht den rossigen Stuten nähern. In diesem Fall werden sie bis 100 Meter weit fortgetrieben. Innerhalb des Territoriums eines Besitzers verhalten sich die Junggesellen-Hengste unterlegen. Junggesellen-Hengstgruppen bestehen aus maximal 20 Hengsten. Stutengruppen und Gruppen mit Stuten und Fohlen können zwischen zehn und 40 erwachsene Stuten umfassen. Große gemischte Herden können bis zu 200 oder 400 Tiere umfassen. Milchgebende Mutterstuten gehen täglich zur Wassertränke, Stuten ohne Fohlen teils nur jeden zweiten Tag. Stut- und Hengstfohlen werden von den Müttern gleich behandelt. Es dauert bis zu einem Monat, bis Fohlen ihre Mütter sicher erkennen. Stuten bleiben mit ihren Fohlen die ersten Tage beziehungsweise Wochen separiert von der übrigen Herde. Dies hat zwei Gründe: Zum einen kann das Fohlen sich noch nicht so schnell fortbewegen, um das Tempo der Herde stets mitzuhalten. Zum anderen möchte die Stute ihr Fohlen exakt auf sich prägen. Das Fohlen braucht genügend Chancen, seine Mutter jederzeit zu erkennen. In einer größeren Herde wäre dieses Lernen nicht möglich. Fohlen spielen meist nur mit ihrer Mutter und nicht so sehr mit ihren gleichaltrigen Artgenossen.
Der Aktionsraum eines Territoriums kann zwischen vier und 100 Quadratkilometern liegen. Der Bewegungsradius der Tiere wird umso kleiner, je üppiger die Vegetation gedeiht. Das Sozialverhalten von Hauseseln ist zu dem von Wildeseln im Vergleich stark abgeschwächt, was sicherlich eine Folge ihrer Jahrtausende währenden Domestikation ist. Eselhengste finden sich nur zur Rosszeit der Stuten bei den Stutenherden ein. Der Eselhengst hat nicht die für Pferdehengste typischen Drohgebärden und den Zusammentreibe-Instinkt. Das Rossigkeitsgesicht17 der Eselstute gibt es bei den Pferden nicht.
Für uns interessant ist weiterhin die einheitliche Beobachtung, dass Wildesel bei der Verfolgung innehalten. Auch was die Töne betrifft, scheint beim domestizierten Hausesel alles gleich wie beim Wildesel geblieben zu sein: Den klassischen I-Aah-Ruf18 hat man ebenso beobachtet, wie auch die zwei verschiedenen Schnaub-Weisen: Kurzes hohes Schnauben bedeutet eine Warnung, oder schlichtweg das Herausblasen einer Fliege aus der Nase. Langanhaltendes Schnauben bedeutet Wohlbefinden.
Wildesel im Allgemeinen bewohnen sowohl die kältesten als auch die heißesten Wüsten der Welt19. Kiangs leben beispielsweise in den Hochgebirgstälern von Tibet bis auf 5.500m Höhe. Dort kann es nachts bis zu -40°C werden. Tagsüber im Sommer wird es maximal 25°C warm. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt dennoch unter 0°C. Der Somali-Wildesel lebt in Höhen bis 1.500m auf steinigen Böden. Für ihn beträgt die mittlere Jahrestemperatur 30°C.
Die Bezeichnungen für Halbesel, Wildesel, asiatische Wildesel, afrikanische Wildesel, Kulan oder Kiang, werden gerne durcheinander gebracht und sprachlich von einzelnen Ländern auch verschieden ausgelegt. Der Laie glaubt gerne, dass der Halbesel eine Kreuzung aus Hausesel und Hauspferd sei. In der russischen Fachliteratur werden oft alle Asiatischen Wildesel als Kulane bezeichnet. In der englischen Fachliteratur werden zum Teil alle Halbesel als Onager bezeichnet. Begriffe, Bezeichnungen und Zuweisungen zu den jeweiligen Tieren werden international wild durcheinander gewürfelt.
Der allgemeine Wildeselbestand ist seit 1900 stark geschrumpft. Hauptgründe dafür sind Bevölkerungswachstum, Jagd und Verdrängung von Weidegründen, auch bedingt durch hohe Nahrungskonkurrenz zu Haustieren, desweiteren die steigende Unzugänglichkeit von Wasserstellen.
Wildesel in Afrika kommen immer wieder in Konflikt mit Siedlungen, Anbau, Landwirtschaft oder Bewässerungsflächen entlang von Flüssen. Deshalb schaffen es manche Wildtiere nicht mehr zum Wasser. Sie müssen aufgrund von großer Nahrungskonkurrenz durch Haustiere auf karge Weidegründe zurück weichen und werden zudem erbarmungslos bejagt.
In Afrika wurden immer wieder einzelne Esel aus dem Herdenverband heraus gefangen und mit den Hauseseln verkreuzt. Vom Afrikanischen Wildesel, genauer gesagt vom Somali-Wildesel, gibt es noch Restbestände in Äthiopien, Eritrea und Somalia. In den letzten 20 Jahren ist der Bestand um circa 90% zurück gegangen.
Zur drastischen Reduzierung der Wildeselbestände in Afrika tragen auch die vielen Bürgerkriege bei. Das Militär hat systematisch Jagd auf vielerlei Wildtiere gemacht. Wilderer und Touristen veranstalten Hetzjagden auf die Tiere. Einzige Überlebenschance des afrikanischen Wildesels sind die felsigen Gebiete, in die sich der Esel zurückziehen kann. Eine der Hauptverhaltensweisen des Esels, nämlich das kurze Anflüchten und dann Stehenbleiben, rührt daher, dass der Esel sich in felsigen Gebieten als Rückzugsort aufhält. Seine graue Farbe mit Aalstrich und Schulterkreuz kann auch der Tarnung in Felsumgebung helfen.
Betreffend die Herkunft unserer typischen grauen Hausesel ist erwähnenswert, dass sie am ehesten von den drei afrikanischen Wildeselarten Somali-Wildesel, nubischer Wildesel und Equus Asinus Taeniopus stammen. Optisch am nähesten kommt unser liebenswerter grauer Zwergesel dem nubischen Wildesel, der in Nord-Ost-Afrika, Ägypten und am roten Meer beheimatet ist/war. Allerdings sind sich die verschiedenen Forscher uneins darüber, was die exakten geografischen Zuordnungen, Zuordnungen von Farbunterschieden, Mähnen, Aalstrich und Schulterkreuz, Gebäude, Fell, Abzeichen betrifft.
17 Kopf gesenkt, Ohren angelegt, Nüstern erweitert, Maul geöffnet, vertikale Kaubewegungen
18 Kommt durch unterschiedliche Kehlkopfanatomie zustande; Esel erzeugen sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen einen lauten Ton, Pferde wiehern nur beim Ausatmen
19 Als kälteste Wüste gelten die Wüste Gobi und die Hochgebirgsregion des Himalaya. Die heißeste Wüste der Welt ist die Danakilwüste in Äthiopien
Typische Verhaltens- und Stimmungsanzeichen des Esels
Zuerst sollten in diesem Kapitel viele Bilder und dazugehörige Beschreibungen aufgeführt werden. Doch wir beschränken uns hier auf eine Liste einiger wichtiger Verhaltenszeichen, denn Bilder kommen in den jeweiligen Kapiteln zur Praxis des Natürlichen Horsemanship zahlreich. Zudem lernen wir die Verhaltens- und Stimmungszeichen über die Beobachtung der Esel am besten kennen. Die Zeichen treten nicht einzeln, sondern in Kombinationen auf. Es gibt sicherlich für jedes Esel-Individuum besondere Verhaltens-Spezialitäten, die der Eselhalter im Laufe des Partnerschaftsaufbaus immer feiner erkennt. Beispielsweise strecken manche Esel beim Trinken oder auch in Ruhephasen die Zunge heraus. Jungtiere zeigen manchmal Beschwichtigungskauen gegenüber den älteren „erziehungsberechtigten“ Herdenmitgliedern.
Tabelle 10 Typische Verhaltens- und Stimmungszeichen beim Esel (Auswahl)
Wie gut kennen wir unsere Eselherde?
Liebevolle Eselhalter werden bestätigen, dass jeder einzelne Esel ein Individuum ist:
Äußerlich, im Charakter, in seinen Aktionen/Reaktionen auf Inputs, in Stimme, Ausdrucksweise, Körpersprache, Aufmerksamkeit, Beziehungsstärke, weisen alle Esel Besonderheiten auf. Sie müssen nicht immer nur introvertiert sein, wie man ihnen gerne nachsagt. Es gibt weitaus genauere Charakterausprägungen:
Wie wir uns bei der Anwendung der sieben Kommunikationsspiele hinsichtlich solcher Charakterspezialitäten verhalten können, wird im Kapitel „Feinabstimmung auf den Eselcharakter“ auf Seite → erläutert.
Unter Menschen gibt es die Weisheit, dass wir an einen Mitmenschen zwar sehr genau hin schauen, aber nicht in ihn hinein schauen können. Die Gedanken sind frei, und doch können <innen liegende> Gedanken und innere Einstellungen unweigerlich <äußerlich sichtbare> Körperreaktionen hervorrufen, aus denen folglich auf das Gedankenkostüm rück geschlossen werden kann. Hier entstehen viele Missverständnisse. Wie verlässlich, ehrlich und authentisch wir unsere Beobachtungen an einem Mitmenschen für uns persönlich verwerten, liegt sicherlich auch an unserer Beobachtungsgabe. Übertragen auf unsere Esel gilt es also, sie intensiv in ihrem Herdenverband zu beobachten.
Aus Tabelle 10 können wir ersehen, dass ein Zeichen mehreres, sogar gegensätzliches, bedeuten kann. Zum Beispiel kann Ohren-Anlegen Spiel oder Kampf bedeuten. Wann machen unsere Esel was, aus welchem Anlass, wie oft, wie ausgeprägt, in welcher Reihenfolge, in welchen Zusammenhängen, wiederholt oder nicht mehr, mit wem schon und mit wem nicht, was machten sie früher oft und heute gar nicht mehr? Wer wird schnell nervös, wer kaum? Wer zeigt Unruhe an, wer nicht? Wer möchte beim Fressen nicht gestört werden, wer lässt sich beim Fressen gerne bürsten, wer frisst gerne neben wem? Je besser wir die Individualität unserer einzelnen Esel kennen, umso effektiver können wir als Partner in ihre Kommunikationsnetze einsteigen.
Bild 9 Bei Eseln gibt es keinen Chef – jeder darf voraus oder hinterher gehen
Bild 9 sagt uns zum Beispiel, dass der große braune Esel nicht Chef ist, nur weil er voraus geht. Die Reihenfolge innerhalb der Eselgrupe variiert von Mal zu Mal.
Bildreihe 10 Spiel sieht oft aus wie Streit
Auf Bildreihe 10 sehen wir, wie zwei Esel miteinander spielen und Gefallen daran haben. Der Spiel- und Spaßtrieb sollte nie unterbunden werden. Er fördert die engen Bindungen zwischen den Tieren, zudem haben die Esel dabei gesundheitsfördernde Bewegung und Gymnastik, und ihre geistige Mobilität wird aktiviert.
Wir Menschen können dem Esel nie so viel geistige und körperliche Abwechslung bieten, wie sich die Esel diese lebenswichtige Komponente in einem gesunden Herdenverband täglich aufs Neue heraus spielen. Natürlich wird hier auch deutlich, warum Esel ein großes Aufenthaltsgelände brauchen. Es wird leider manchmal argumentiert, dass sich Esel bei den teils grob verlaufenden Spielen auch verletzen könnten. In der Pferdehaltung ist diese Sorge noch viel größer. Das Tier deshalb in einer Box unterzubringen, um ja keine Verletzung von einem anderen zugefügt zu bekommen, steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Lebensqualität für das Tier. Genügend Platz und räumliche Aktions- und Rückzugsmöglichkeit ist dabei Voraussetzung.
Einer der vielen Vorteile, unsere Eselherde oft und detailliert zu beobachten, ist auch, dass wir erstaunt und immer wieder aufs Neue überrascht sehen, zu was die Esel fähig sind.





























