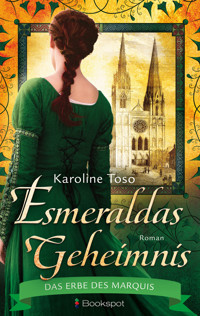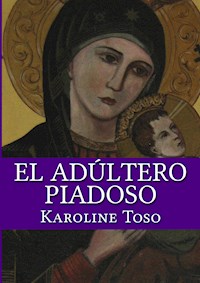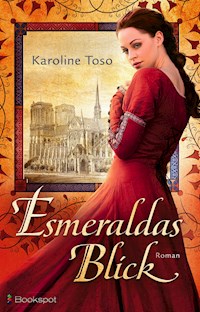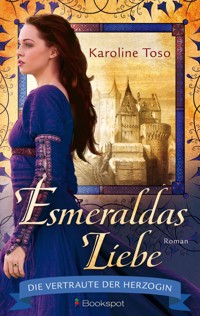
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der langersehnte Erbe, Felix de Valois, erreicht nun das zweite Lebensjahr. Doch die Freude seiner Mutter Agnès wird getrübt, als sie als Esmeralda enttarnt wird - eine Bedrohung, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre geliebten Kinder und das Ansehen des gesamten Hauses de Valois zu Chartres gefährdet. Unter königlichem Auftrag begibt sich Agnès mit ihren Kindern in die freie Bretagne, um die verwaiste Herzogin Anne für Frankreich zu gewinnen. Doch am Hof der Bretagne wird sie mit Missachtung behandelt und als Persona non grata abgestempelt. Die düstere Situation wird noch komplizierter, als eine verheerende Masernepidemie nahe Chartres ausbricht. Währenddessen plant das Königshaus einen unerbittlichen Angriff auf die Bretagne, und Duc Raphael de Valois wird an den Hof beordert, um König Karl VIII. bei seinem Vorhaben zu unterstützen. Die Helden rund um den ehemaligen Glöckner von Notre-Dame stehen vor gewaltigen Herausforderungen und müssen sich den Stürmen der Zeit stellen. Werden Agnès und ihre Kinder enttarnt und müssen fliehen? Kann sich Anne de Bretagne gegen Karl VIII. behaupten? Entdecken Sie die Antworten auf diese Fragen und mehr in diesem atemberaubenden dritten Band der Trilogie: Ein unvergessliches Abenteuer erwartet Sie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© TKaroline Toso
Die österreichische Schriftstellerin Karoline Toso lebt als Religionspädagogin in Wien. Nach zahlreichen Kurzgeschichten und Gedichten veröffentlichte sie ihren ersten Roman »Der fromme Ehebrecher«, erschienen bei BC Publications. Es folgte »DASDA«, ein Band mit Geschichten und Gedichten der Autorin.
»Esmeraldas Blick« war ihr erster historischer Roman, der Auftakt zu einer Trilogie rund um die Figuren aus »Der Glöckner von Notre-Dame«. Bei Karoline Toso gehen Victor Hugos Charaktere ganz neue Wege, packend und unterhaltsam erzählt. Nach »Esmeraldas Geheimnis«, der Fortsetzung, schließt diese Trilogie mit »Esmeraldas Liebe« ab. Alle Bände erschienen im Bookspot Verlag.
Mehr über die Autorin unter www.karolinetoso.jimdofree.com
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Copyright © 2023 bei Edition Aglaia, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH, Planegg
1. Auflage 2023
Lektorat: Jara Dressler, Yvonne Schmotz
Korrektorat: Andreas März
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Covergestaltung/Einband: Nele Schütz Design
Covermotiv unter Verwendung von: © Shutterstock/Faestock, Yuliya Blonska, Antiqua Print Gallery/Alamy Stock Foto
eISBN 978-3-95669-140-9
www.bookspot.de
Für Dora mit ihrem selbstbewussten Flüstern, und für alle Kinder, die mir als Pädagogin ihr Vertrauen schenkten.
Vorwort
Mit Esmeraldas Liebe – Die Vertraute der Herzogin ist die Trilogie rund um den Glöckner von Notre-Dame vollendet. Auf den Beginn zurückzublicken, lässt mich auch Victor Hugo wiederbegegnen, dessen Werk mich inspirierte. So ist der erste Band, Esmeraldas Blick – Die Ketzerin von Notre-Dame, eine erweiterte Nacherzählung des Originals. Wie Hugo habe ich fantasievolle Elemente mit historischen Fakten verwoben, beispielsweise Esmeraldas Tanz mit dem Ziegenbock Djali oder auch die Bedeutung der damaligen Pariser Unterwelt aus dem Hof der Wunder. Durch Esmeraldas Schicksal vereinen sich aristokratische Etikette mit dem oft angeprangerten aber auch freien Leben von Gauklern. Konflikte, die daraus entstehen, bilden die Würze der Erzählung ebenso wie der Blick auf Victor Hugos Protagonisten beim Erstellen neuer Figuren.
Im zweiten Band, Esmeraldas Geheimnis – Das Erbe des Marquis, verkörpert Esmeralda eine neue Rolle als Duchesse Agnès de Valois. Darin findet sie Zuflucht, muss ihre Identität aber verbergen. Das Haus de Valois prägte Frankreich in Haupt- und Nebenlinien vom Ende des 13. bis Ende des 16. Jahrhunderts. Diese Tatsache mit Personen aus Victor Hugos Werk zu verbinden, war eine interessante Erfahrung für mich als Autorin. Im Anhang jedes Bandes sind historische Fakten und deren Abweichungen beschrieben. Nachschlagen zu können, welche der Figuren historisch oder dem Glöckner von Notre-Dame entnommen sind, ist ein bereicherndes Detail dieser Trilogie.
Entscheidungen, die Esmeralda im ersten Band getroffen hat, holen sie im dritten ein. Sie wird von jemandem erkannt. Die Tarnung als Duchesse droht aufzufliegen, womit die gesamte Familie de Valois gefährdet ist. Muss die Protagonistin erneut fliehen, um ihre Kinder zu schützen? An der Schwelle zur Renaissance erfährt Frankreich Turbulenzen verschiedenster Art. Seuchen suchen die Menschen heim, und rund um die freie Bretagne kommt es wiederholt zu Kampfhandlungen. Jeder beansprucht diese reiche Region für sich. So wird Agnès de Valois zur jungen Herzogin Anne de Bretagne geschickt. Unterschiedlicher können Frauen kaum sein.
Geschichte und Fiktion begegnen einander wie Licht und Schatten in der Dämmerung. Dies ist meine Auffassung des Mittelalters und kann von historischen Tatsachen abweichen. Wenn diese der Handlung geschuldet sind, werden auch sie im Glossar verdeutlicht.
Nun lasse ich Victor Hugo selbst sprechen aus Der Glöckner von Notre-Dame, Seite 123:
Im Angesicht dieser alten Königin unter unseren Kathedralen findet sich neben einer Runzel immer eine Narbe. Tempus edax, homo edacior, was ich gern so übersetzen möchte: Die Zeit ist blind, der Mensch aber ist töricht. Wenn wir Muße hätten, mit dem Leser die Spuren der Zerstörung, die dieser alten Kirche zugefügt worden ist, eine nach der andern zu untersuchen – der Anteil der Zeit würde der geringste, der der Menschen der schlimmste sein, vor allem derjenige der Fachleute.
Karoline Toso
Kapitel 1
Seit Tagen schon hatte er es gespürt. Das Herz bäumte sich auf, rebellierte, war gebrochen. Mit dem eigenen Blut schien der Vertrag von Sablé unterzeichnet worden zu sein. Franz II. hatte damit sein Volk und seine Tochter der Gier Frankreichs verkauft. Aber noch war nicht alles verloren, noch konnte er auf England zählen, auch auf den erstarkenden Duc Louis d’Orléans und auf die getreuen Bretonen. Den Kampf um Unabhängigkeit würden sie nicht so schnell aufgeben. Anne ist ja noch so jung, dachte er bei seinem letzten Atemzug.
Mit einem Knall klappte das Buch zu. Ungehalten warf Albert Alden es von sich. Als ob seine Erschöpfung und gleichzeitige Ruhelosigkeit die Schuld der Bücher wäre, stierte er den Haufen verschiedener Werke an, der neben dem Couchtisch lag. Auch der Tisch quoll von Büchern über, allerdings in geordneten Stapeln. Rechts und links auf der Couch neben Albert gab es ebenfalls wohlsortierte Bücher und Manuskripte. Zu seinen Füßen verstreute Notizen, auf denen man nur allzu leicht ausrutschen konnte. Er schnaubte. Das war’s also? Nach all den Kämpfen in diesem verrückten Krieg starb der bretonische Herzog an einem Herzinfarkt. Vollkommen unerwartet!
»Das Leben schreibt die schlechtesten Romane!«, grummelte Albert vor sich hin.
Was soll denn nun aus der Bretagne werden? Die einzige Tochter ist ja noch nicht mal zwölf Jahre alt!
Als er in die Küche schlurfte, knacksten seine Gelenke, der Rücken schmerzte. Wie lange hatte er auf der Couch gesessen? Hatte er das halbe Buch in einem gelesen? Er warf einen Blick auf die Zeitanzeige am Backofen, es war 3:44 Uhr morgens. Welcher Tag? Standen Vorlesungen an? Hoffentlich verschlief er sie nicht wieder. Alberts Kopfhaut juckte, sein Haar fühlte sich fettig an und er roch nach Schweiß. Und wenn schon. Nicht einmal Zähne putzen schaffte er noch. Schlafen, alles vergessen, den Wecker stellen, denn mittlerweile wusste er, dass die erste Online-Vorlesung dieses Dienstags um 9:00 Uhr beginnen würde. Was war noch mal das Thema? Ach ja, sprachliche und gesellschaftliche Veränderungen in Spanien durch die Mauren. Die Augen fielen ihm zu. Doch kaum begann er selig in den Schlaf zu gleiten, schnellte Albert hoch. Habe ich den Wecker gestellt? Die Augen brannten vor Müdigkeit, er sah alles verschwommen. Irgendwann sank er endlich in erholsame Leere.
Im Schlosshof zu Chartres löste die Morgensonne letzte Nebelschleier auf. Vereinzelt leuchteten goldgelbe Blätter an Sträuchern, doch die Bäume standen noch im Grün, am Boden lag kaum Laub. Knechte und Mägde bemerkten trotz all ihrer Tätigkeiten die Schönheit des Morgens. So ging ihnen die Arbeit gut von der Hand. Auch Agnès de Valois freute sich über die kühle Morgenluft, als sie mit ihrer Tochter am Fenster saß und ihr das Haar kämmte.
»Claudine! Sieh mich an. Bitte! Schenke mir einen Blick«, schmeichelte sie.
Doch die Prinzessin entwand sich ihrer Mutter und begann das immer wiederkehrende Ritual. Mit langsamen Schritten ging sie zur Truhe, kniete sich davor hin und legte den Kopf auf den Deckel. Einige Augenblicke presste sie ihr Ohr gegen das Holz. Es rauschte geheimnisvoll, als hätte sich Wind in der Truhe verborgen. Das Gleiche machte sie mit der Tür, die anders rauschte, nicht so drängend. Die Wand rauschte fast gar nicht, aber sie ließ alles rund um Claudine verstummen, sodass sie kaum wahrnahm, ob sich andere im Raum aufhielten. Wenn das Kind sein Ohr auf den Boden drückte, wurde aus jedem Schritt Lärm. Vor dem Sessel blieb Claudine nur stehen und blickte ihn erwartungsvoll an. Konnte sie dieses Ritual ungestört durchführen, ließ sie sich anschließend zum Frühmahl geleiten. Fasste man sie aber ungeduldig an der Hand, kreischte sie, riss sich los und rannte davon, um sich irgendwo zu verstecken. Oft dauerte es lang, bis man die Prinzessin dann wiederfand. Manchmal stand sie hinter einem Vorhang, dann wieder hockte sie inmitten eines Gebüschs im Park.
Mittlerweile hatten sich ihre Muskeln von der Erkrankung erholt und Claudine war flinker denn je. Schon ein zu lautes Wort konnte sie erschrecken, am meisten aber unerwartete Berührungen oder gar, wenn man sie festhalten wollte. Diesmal drängte sie niemand. Nachdem sie den Klängen der Dinge nachgespürt hatte, ging sie ruhig neben ihrer Mutter in den kleinen Speisesaal. Die Dienerinnen blieben bei Felix in den Gemächern der Duchesse Agnès und ihrer Kinder. Mit seinen vierzehn Monaten hatte Felix schon sechs Zähne, ein siebenter kündigte sich an und quälte das sonst eher ruhige Kleinkind vor allem nachts. Er mochte es nicht, wenn seine Schwester ihn alleinließ, doch an diesem Morgen schlief er länger und sah ihr nur verschlafen zu, während sie ihr Horchritual durchführte. Eine Magd schürte das Feuer im Kamin, eine andere brachte warmen Brei für Felix.
Duc Raphael de Valois erhob sich von der Tafel, als seine Gemahlin die Schwelle zum kleinen Speisesaal überschritt. Ebenso erhob sich sein Berater, Baron Julien de Bonarbre, und verneigte sich leicht. Die Verbundenheit zwischen ihrem Gemahl und seinem Berater strahlte wie ein unsichtbares Licht, das Agnès ausschloss. Gleichzeitig milderte es die Kälte, die von ihrer Schwiegermutter, Madame Veronique, ausging. Claudine blieb an der Schwelle stehen. Manchmal wagte sie es nicht, eine solche zu überschreiten. Der Raum war viel größer als das Wohngemach. Neben der Anrichte standen zwei Mägde mit ernsten Gesichtern.
»Guten Morgen, meine Damen«, sagte der Duc, kam rasch um den Tisch herum, neigte sich der Prinzessin zu und bot ihr den Arm zum Geleit.
»Mademoiselle Claudine, erweist Ihr mir die Ehre?«, fragte er spielerisch.
Nun lächelte das Kind, blickte dem Vater kurz in die Augen und hakte sich dann bei ihm unter. Das bedeutete allerdings, dass der hochgewachsene Duc mit gebeugtem Rücken zum Tisch zurückkehrte. Seine Mutter verdrehte ob solcher Spielereien die Augen.
Durch die farblosen Butzenscheiben drang Morgenlicht herein und verlieh dem edel möblierten Raum die ihm zugedachte Würde. Madame Veronique erwartete hier Etikette, doch ihr schien, als würde die junge Duchesse absichtlich alles Vornehme missachten. Manchmal leistete sich auch Duc Raphael solche Albernheiten.
»Guten Morgen, Madame! Messieurs!«, grüßte Agnès. Dann setzte sie sich mit Claudine an den Tisch. Während sie an ihrem warmen Aufguss nippte, fuhr sie fort: »Felix war heute Nacht sehr unruhig. Er zahnt.«
»Wozu habt Ihr neben Anouk zwei weitere Dienerinnen für die Kinder, wenn Ihr solch profane Angelegenheiten offenbar selbst überwacht?«, konnte sich Madame Veronique nicht enthalten zu sagen.
Dabei dachte sie vorwiegend an ihre entfernte Verwandte, Paulette de Cendre, wegen der sie lange mit dem Duc verhandelt hatte, um ihren Enkeln wenigstens eine aristokratische Erzieherin zu ermöglichen, nachdem Madame Agnès darauf bestand, dafür neben Anouk eine weitere einfache Magd einzustellen. Claudine, die still ihren Brei löffelte, hielt mitten in der Bewegung inne und starrte ihre Großmutter an. Ihr Tonfall ängstigte das Kind. Alle bei Tisch bemerkten die Reaktion der Prinzessin, obgleich sie versuchten, es nicht zu zeigen. Man hörte das Aufsetzen eines Bechers, ein Kratzen in der Breischale. Die Magd neben der Anrichte wagte kaum zu atmen, so unangenehm still war es plötzlich geworden.
»Gestern Abend war der Bote mit mehreren Briefen da«, sagte Madame Veronique.
»Ich werde mich gleich nach dem Frühmahl darum kümmern«, versprach Raphael und wandte sich an Agnès: »Madame, ist es Euch heute möglich, ebenfalls im Beratungsraum mitzuwirken? Ich erwarte Anfragen aus Paris, aber auch aus Mortain des Prés, dabei ist mir Eure Einschätzung wichtig.«
Mortain des Prés zu erwähnen war eine kleine List, denn Agnès’ Madre lebte in diesem Gebiet. Beide bemerkten seine Absicht und lächelten einander an. Julien warf ihr ebenfalls einen freundlichen Blick zu. Agnès fragte sich zuweilen, ob er ihre Gegenwart schätzte oder eher mied, um Raphaels Aufmerksamkeit für sich allein zu haben. Solche Gedanken aber waren bloß Hirngespinste, das wusste sie und tadelte sich selbst ob ihres Misstrauens, denn weder Julien und schon gar nicht Raphael gaben je Anlass dazu. Gleich nach dem Frühmahl brachte Agnès Claudine wieder in ihre Gemächer. Felix lachte vergnügt auf, als seine Schwester zurückkam. Eine Weile blieb sie bei ihren Kindern, doch der Arbeitsalltag im Besprechungsraum hatte wohl bereits begonnen. Sie küsste Felix auf die Stirn, blickte zu Claudine hinüber, die ganz versunken zum Fenster starrte. Offenbar versuchte sie, den Geräuschen von draußen nachzuspüren.
»Anouk, heute werde ich wohl einige Stunden im Beratungsraum verbringen«, wandte sie sich an ihre Vertraute.
Leicht errötend wollte die Kammerdienerin etwas erwidern, doch Agnès lächelte.
»Natürlich werde ich unserem Schreiber Grüße von dir ausrichten«, sagte sie. »Vielleicht treffen wir uns nach dem Mittagsmahl hinter dem Schloss bei der Linde oder auf der großen Wiese bei den Hühnern.«
Im Besprechungsraum erwarteten sie zu diesem Zeitpunkt keine Bittsteller. Unauffällig richtete Agnès dem Schreiber Jean Anouks Gruß aus. Er freute sich darüber. Der Duc und Madame Veronique bemerkten nichts davon. Auch Julien de Bonarbre hob nur kurz grüßend den Blick. Der Raum war schlichter eingerichtet als der kleine Speisesaal und wirkte daher größer. Hier versammelten sich mitunter bis zu acht Vertreter bei Standesversammlungen. Nun standen mehrere Stühle an den Wänden, der große Arbeitstisch war bedeckt von offenen und noch verschlossenen Schriftstücken. Jean hatte sein Schreibpult neben einem der hohen Fenster, die viel Licht durchließen.
An diesem Tag wirkte Madame Veronique angesichts schwieriger Briefe besonders ungeduldig. Sie wandte sich mit einem der Schreiben an den Baron.
»Unser Haus sollte Anne de Bretagne einen Kondolenzbesuch abstatten«, erklärte sie. »Sie ist nun Vollwaise und wird wohl bald gewinnbringend vermählt werden. Ob ihre Wahl auf einen Bretonen oder einen französischen Fürsten fällt, ist für Frankreich bedeutsam.«
Agnès hörte kaum zu. Sie beugte sich über den Arbeitstisch und überblickte die ungeöffneten Schreiben. Da erkannte sie an einem davon Sophies Handschrift.
»Sophie!«, sagte sie bei sich und brach sofort das Siegel.
Meine sehr verehrte Madame Agnès de Valois,
ich hoffe, es geht Euch und Eurer Familie gut. Hier auf dem Hügel rund um Mortain des Prés blicken wir auf Stoppelfelder, abends fühlt sich der Wind schon herbstlich an. Das erinnert mich an unser Treffen kurz nach Claudines Erkrankung. Wir alle denken viel an sie, aber auch an den kleinen Felix und an Euch, liebe Madame Agnès. Simon hat eine neue Taubendressur entwickelt, die Claudine gefallen könnte. So wäre es uns eine große Freude, auf ein baldiges Wiedersehen hoffen zu dürfen.
Mit den besten Wünschen für das ganze Haus de Valois verbleibe ich ergebenst
Eure Sophie de Sanslieu
Ehrfürchtig mit »Madame« angesprochen zu werden befremdete Agnès, denn im Herzen blieb Sophie immer ihre Madre.
»Sophie und Simon werden uns besuchen«, murmelte sie und überflog die Zeilen noch mal.
»Wie schön!«, sagte Jean.
Obwohl er wie Madame Agnès bereits vierundzwanzig Jahre zählte, wirkte sein Gesicht jungenhaft, weil der Bart bei ihm nicht so recht sprießen wollte. Die blonden Locken und seine strahlend blauen Augen verliehen ihm zudem das Aussehen eines Jünglings. Mit Madame Agnès verband ihn ein Geheimnis, das sie acht Jahre zuvor nach Chartres gebracht hatte. Schon bei ihrer Bemerkung war Madame Veronique aufmerksam geworden, nun aber wandten sich auch Raphael und Julien der jungen Duchesse und Jean zu. Dieser errötete. Seine Aufgabe war es, Notizen zu machen, aber nicht zu kommentieren, zumindest nicht im Beisein der Madame Veronique.
»Solch eine Entscheidung trefft Ihr doch wohl nicht allein, Madame Agnès. Zumindest den Zeitpunkt eines so ungewöhnlichen Besuches habt Ihr zu besprechen. Nicht auszudenken, wir hätten gerade hohen Besuch vom Königshaus zu beherbergen und ein buckliger Hüne liefe gestikulierend durch den Park. Ich weiß gar nicht, was Ihr an diesen Leuten findet. Und dann auch noch diese verwirrte Person, wie hieß sie doch gleich? Baguette? «
Madame Veronique kicherte. Der Duc ignorierte ihren ironischen Ton und wandte sich an seine Gemahlin.
»Lasst sehen.« Er blickte ihr über die Schulter, um das Schreiben zu lesen. »Solange die Tage noch warm sind, wäre es für Claudine bestimmt von Vorteil, mit Simon draußen bei den Tauben und Hühnern zu sein. Madame, wir wollen doch nur das Beste für die Prinzessin, nicht wahr?«, wandte er sich an seine Mutter.
Sein Tonfall ließ keine Widerrede zu. Tatsächlich schrumpfte Madame Veronique etwas zusammen und nickte nur. Sie mied den Blick ihrer Schwiegertochter, deren Augen sich schon wieder mit Tränen füllten. Seit Claudines Erkrankung konnte sie nur daran denken, wie sie ihr am besten helfen könnte.
»Na geht schon zu Martins Taubenschlag hinunter und heißt Sophie mit allen, die sie begleiten, auch in meinem Namen willkommen«, sagte Raphael.
Julien lächelte Agnès zu, als diese aus dem Raum eilte. Draußen atmete sie tief durch. Das Gras war noch taunass, der Frühnebel bereits verschwunden. Ein paar bunte Blätter lagen auf der Wiese. Mit nassen Schuhen kam sie beim Hühnergehege an, musste aber gleich weiter zu den Brieftauben. Einige Schritte hinter den kleinen Stallungen stand der Taubenschlag, doch er wirkte wie entvölkert. Agnès spürte einen Stich in der Brust.
»Martin?«, rief sie.
Sie fühlte sich unwohl. Seit ihrer Rückkehr aus Paris vor über zwei Jahren wirkte jegliche unerwartete Situation bedrohlich auf Agnès. Es versetzte sie stets in den Schock, den sie damals erlitt, als Claudine bei ihrer Ankunft aus Paris nicht im Schloss gewesen war. Todkrank war das Kind im Kloster gelegen. Wäre sie damals doch nicht weggefahren!
»Martin?«, rief sie erneut und wandte sich in Richtung Schweinegehege.
»Madame! Ist etwas passiert? Wie kann ich helfen?«, hörte sie dessen raue Stimme hinter sich.
»Gott lob! Da bist du ja, Martin!«, entfuhr es der Duchesse.
Sie lief einige Schritte auf den Knecht zu, der mit einer riesigen Mistgabel bei den Stallungen stand. Hinter ihm ein Karren voller Mist, nicht weit davon entfernt der Misthaufen. Er selbst in schmutzigen Stiefeln und Arbeitsgewand. Dennoch erschien er ihr wie ein rettender Engel. Hochgewachsen, hager, aber sehnig und stark stand er da, als könne er sie vor allem Unbill schützen.
»Geht es dir gut?«, fragte sie vollkommen unerwartet, während sie auf ihn zueilte. Fast hätte sie ihn vertraut am Unterarm berührt.
»Ich danke für Eure Freundlichkeit, Madame! Ja, es geht mir gut. Darf ich die Frage auch an Euch richten? Seid Ihr wohlauf? Geht es der Prinzessin gut?«
»Danke, Martin, sie freut sich bestimmt schon darauf, später mit Anouk hierherzukommen. Ich allerdings habe eine dringende Nachricht an Madame Sophie zu verschicken und brauche deine Hilfe.«
Martin verneigte sich mit den Worten: »Es wird mir eine Ehre sein.« Er blickte an sich herab. »Wenn Ihr mich kurz entschuldigt, Ihr seht mich in einem zu unwürdigen Aufzug, um mit Euch zum Taubenschlag zu gehen.«
»Es reicht, wenn du dir die Hände wäschst, Martin«, sagte sie. »Zudem sollten künftig andere Knechte die Stallarbeit verrichten. Du bist mir bei den Tauben und Hühnern wichtiger.«
Wieder verneigte sich der Knecht. Die Worte der Duchesse ehrten ihn, beschämten aber auch. Er liebte seine Arbeit so, wie sie war, und wollte vor den anderen nicht als Protegé dastehen. Allerdings verband ihn mit der Duchesse die Liebe zur Prinzessin. Auch er war unendlich traurig über ihre große Veränderung, konnte sich aber über jeden Moment mit ihr freuen, ohne dabei mit früher zu vergleichen. Beim Wasserbottich wusch er sich die Hände und die Arme bis zu den Ellbogen. Agnès beobachtete ihn, ohne sich dessen ganz bewusst zu sein.
»Als ich dich beim Taubenschlag suchte, war alles ruhig. Es geht den Tauben doch gut? Sind denn überhaupt welche da? Vor allem solche aus Mortain des Prés, damit ich eine Nachricht an Madame Sophie verschicken kann«, plapperte Agnès atemlos weiter.
»Die meisten Tauben jagen morgens rund ums Schloss, suchen sich ihre Raupen und Käfer. Und jene, die wir im Verschlag halten, weil sie sonst gleich zurück in ihre Heimat fliegen würden, halten vielleicht noch im Verborgenen Nachtruhe«, erklärte Martin.
Auf seine gurrenden Rufe hin kamen sie auch gleich herbei, antworteten teilweise auf sein »Guru« und pickten ihm Körner aus der Hand. Es gab zugeschnittene Papierstreifen und schmale Federn, die nur Tinte für zwei bis drei Lettern fassten, aber besonders zarte Striche zeichnen ließen. Damit verfasste Agnès rasch die Antwort für Sophie. Sie vergaß auch nicht das herzliche Willkommen im Namen des Duc. Als sich die Taube in die Lüfte erhob, atmete Agnès auf.
»Danke«, sagte sie und fasste den Knecht nun doch freundschaftlich am Oberarm. Er lächelte.
Als Anouk mit der Dienerin Paulette und den beiden Kindern zur Hintertreppe ging, kamen sie am Besprechungsraum vorbei. Die Tür zu diesem Raum stand offen, nur Julien de Bonarbre war noch da und las in einer Gerichtsnotiz des Vogts. Es ging um die Räumung eines Bauernhofes wegen ausstehender Steuern. Im Vorbeigehen bemerkte Claudine, wie vertieft der Baron war. Sie ging neben Paulette, die aber vollauf mit Felix zu tun hatte. Anouk schritt voran und reckte den Hals, um auf dem Gang vielleicht Jean zu erblicken. Zwei rasche Schritte, schon war Claudine im Besprechungsraum. Niemand bemerkte ihr Verschwinden. So machte sie es oft, blieb einfach mitten im Gehen hinter einer Säule stehen oder bog in einen Seitengang ab, hockte sich zuweilen hinter eine Truhe und freute sich darüber, so rasch unsichtbar zu werden.
Nun stand sie an die Wand gelehnt im Besprechungsraum neben dem Türrahmen und betrachtete den Freund ihres Vaters. Er griff nach der Feder. Ständig las oder schrieb er etwas. Er war so vertieft und still wie Claudine selbst, die ihn beobachtete und wusste, dass er sie nicht bemerkt hatte. Das war ihr Trick, wenn sie unsichtbar sein wollte: Langsam atmend bewegte sie sich nicht, ihr Blick ruhte auf einem Ziel und sie dachte dabei an das, woran sie gerade lehnte oder wo sie sich gerade versteckte. In diesem Augenblick dachte sie Wand, Wand, sonst nichts. Manchmal suchten die Dienerinnen sie und gingen doch an ihr vorbei. Claudine allerdings bemerkte alles rund um sich. Sie hörte das Kratzen von Juliens Feder auf dem Papier, sein Innehalten, wenn er nach der richtigen Formulierung suchte. Gerade blickte er auf, sah gedankenverloren zur Tür. Da wünschte sich Claudine seine Nähe. Erst in diesem Augenblick bemerkte er sie und zuckte zusammen.
»Na? Was machst du denn da?«, fragte er.
Sie blickte ihm lange ins Gesicht, betrachtete seinen breiten Oberkörper und wollte wissen, ob es auch ihn ihm rauschte wie in der Gewandtruhe in ihrem Wohngemach. Zielstrebig ging sie auf ihn zu, legte das Ohr an seine Brust und horchte.
Gern hätte Julien sie an sich gedrückt. So nah war ihm das Kind selten gekommen, schon gar nicht nach seiner Erkrankung. Doch es reagierte meist panisch auf unerwartete Berührungen, darum verharrte er still und genoss diesen Augenblick.
Claudine horchte auf sein pochendes Herz. Es war wie ein kleines Tier in ihm, dem »guten Baum«, den sie mochte. Nach einer langen Weile stellte sie sich auf die Zehenspitzen, er beugte sein Haupt zu ihr hinunter.
»Schön«, flüsterte sie in sein Ohr. Dann schenkte sie ihm noch einen kurzen Blick und ging hinaus. Am Gang rief Anouk bereits nach ihr.
Julien starrte mit offenem Mund zur Tür. Claudine hatte gesprochen, zu ihm! Das wollte er Raphael sofort mitteilen. Doch dieser hatte sich mit Madame Veronique längst zurückgezogen. Sie wollte wegen des bevorstehenden Besuches der Madame Sophie mit ihm unter vier Augen sprechen. Auch Jean schrieb bereits in seiner Schreibstube Notizen ins Reine. Auf Julien warteten noch einige Bittschreiben, die er durchsehen und entscheiden sollte, doch er konnte sich nicht sammeln. Die erstaunliche Begegnung mit Claudine wollte er jemandem mitteilen, aber wem? Er öffnete das Fenster und atmete tief durch. Was für ein prächtiger Herbsttag. Man sollte die Sonne noch nutzen, bevor der Winter einen in allzu lange Klausur zwang. Weit unten erblickte er Madame Agnès. Sie kam vom Taubenschlag herauf. Ohne zu überlegen, eilte Julien hinunter und ging ihr entgegen.
»Madame, ich möchte Euch von einer erfreulichen Begegnung mit Claudine erzählen«, rief er schon von Weitem.
Verwundert hielt Agnès inne. Der sonst zurückhaltende Baron wirkte freudig erregt.
»Claudine spricht! Ich freue mich ja so! Sie hat mir etwas ins Ohr geflüstert. Seit wann kann sie denn wieder sprechen?«
Agnès blickte ihn verwundert an. Zunächst brachte sie kein Wort heraus.
»Das wäre wahrlich zu schön«, sagte sie mehr zu sich selbst. »Ich hatte leider noch nicht das Glück. Wie kam es denn dazu, dass meine Tochter Euch etwas zuflüsterte?«
Im Detail erzählte er die Begegnung, von seinem Schreck, als die Prinzessin plötzlich wie von Zauberhand neben der Tür stand bis hin zu dem geflüsterten Wort. Agnès hatte schon öfter beobachtet, wie ruhig Claudine in ihren Verstecken verharrte.
»Das ist wunderbar, Julien«, meinte sie. »Habt Dank.«
Julien und Agnès verweilten noch eine Weile auf der sonnigen Wiese, Wind fuhr Julien durchs Haar. In der Ferne sah er die Linde. Einige ihrer kleinen Blätter hatten sich schon goldgelb gefärbt. Nun wirbelten sie wie trunkene Schmetterlinge durch die Luft. Von dort hörte man die Dienerinnen rufen, Felix vor Vergnügen quietschen. Bestimmt spielte Claudine bei ihrer Linde, man hörte aber nichts von ihr. Am liebsten hätte sich der Baron zu den Fröhlichen gesellt.
Madame Agnès wandte sich von ihm ab und steuerte auf die Linde zu. Claudine hatte ein Wort gesprochen, das sollte sie doch freuen, doch ein Schmerz verätzte diese Freude. Warum sprach ihre Tochter mit Julien? Warum nicht mit ihr, der Mutter, die sie aus der Lethargie geholt und in unzähligen Stunden das Gehen mit ihr neu erlernt hatte? Jedes Mal, wenn sich Claudine von ihr abwandte, sich nicht von ihr berühren ließ, fühlte Agnès diesen Schmerz. Und nun, wie zum Hohn, sprach das Kind mit dem Mann, der bereits die Liebe ihres Gemahls genoss. Sollte Julien nun auch die Liebe ihrer Tochter bekommen? Als Felix ihr mit ausgebreiteten Armen zujauchzte, ebbte der Schmerz ein wenig ab. Claudine schenkte ihr einen freundlichen Blick, da atmete Agnès tief durch und konnte wieder lächeln.
Währenddessen sprach sich Madame Veronique in ihrem Gemach entschieden dagegen aus, Madame Sophie mit ihrem missgestalteten Sohn einzuladen. Alle Fürstenhäuser waren vom Tod des Duc de Bretagne benachrichtigt worden. Auf die Entwicklung dort sollte das Augenmerk gelenkt werden. Die Duchesse-Mutter versuchte, ihrem Sohn klarzumachen, dass es neben dieser Dringlichkeit keine Ablenkungen durch unerwünschten Besuch geben sollte. Auf die wiederholten Auseinandersetzungen wegen der Bretagne, an denen der Duc Louis d’Orléans beteiligt war, sollte Raphael de Valois dringend reagieren. Chartres lag zwischen diesen Unruheherden und das Königshaus würde nicht lange mit Anweisungen für den Duc zögern, um sich womöglich die freie Bretagne zu sichern. Mit der Erbin Anne würde man schon fertig werden, schließlich zählte diese noch keine zwölf Jahre. Inmitten dieser aufziehenden Unsicherheiten käme der Besuch aus Mortain des Prés mehr als ungelegen.
»Madame, die Vergangenheit hat gezeigt, dass Simon de Sanslieu den allerbesten Einfluss auf meine Tochter hat. Niemanden, außer vielleicht die Kammerdienerin Anouk, lässt Claudine so nah an sich heran wie diesen sanften Menschen. Er mag auf den ersten Blick durch sein Aussehen erschrecken und wegen seiner undeutlichen Sprache weniger klug wirken, als er in Wahrheit ist, aber seine gute Wirkung auf Claudine ist unverzichtbar. Ich bin dankbar und freue mich auf seinen Besuch bei uns. Und wenn das Königshaus meiner Dienste bedarf, so wird es mich das zur gegebenen Zeit wissen lassen. Aber ich werde den Besuch nicht aus lauter vorauseilendem Gehorsam unterbinden. Madame Agnès hat bestimmt schon eine Taube zu dem Anwesen de Cercueilclou schicken lassen. Von Euch erwarte ich, meinen Gästen mit gebührendem Respekt zu begegnen!«
Er sah seine Mutter dabei nicht an.
»Wenn Ihr es nur nicht bereut, Eurer Gemahlin ständig die seltsamsten Launen zu gestatten«, sagte sie und begann aufzählen, was sie allein in den vergangenen Wochen alles an Unschicklichem beobachtet hatte: »Man berichtete mir von Hühnern, die der Prinzessin zum Spielen aufs Gemach gebracht wurden. Reigentänze mit beiden Kindern und den Dienerinnen bei der Linde konnte ich selbst beobachten und einmal sogar Jonglierkünste mit Äpfeln. Ich frage mich, ob man solches bei den Klarissen in Paris lernt.«
»Schweigt endlich, Madame!«, fuhr der Duc sie an, sein Blick durchbohrte sie. »Das Einzige, was ich bereue, ist, Euch Claudine anvertraut zu haben.«
Sie senkte das Haupt. Da war er wieder, der Stich ins Herz, die Schuld, mit der sie leben musste.
Schon wenige Tage nach dieser Unterredung kamen drei Kutschen vom Anwesen de Cercueilclou in Chartres an. Sophie und Agnès konnten sich kaum aus der Umarmung lösen. Dann betrachtete Agnès ihre Madre, als müsse sie sich jede kleine Sommersprosse einprägen. Ihr weizenblondes Haar war wie bei einfachen Weibern zu einem Knoten gesteckt, der von einer kleinen weißen Haube fixiert wurde. Die blaugrauen Augen strahlten sie an wie damals, als sie noch mit Zigeunerkarren unterwegs gewesen waren. Für Agnès wirkte Sophie stets jung und mütterlich zugleich. Etwas schüchtern kletterte Simon vom Kutschbock. Über ihm kreisten einige Tauben und eine silbrig-graue saß ihm auf der Schulter. Claudine beobachtete ihn und vor allem seine Tauben.
»Claudine!«, rief Simon und breitete seine kräftigen Arme aus.
Das Kind versteckte sich hinter Anouk, die aber herzlich darüber lachte.
»Aber Claudine«, sagte sie, »erkennst du Simon nicht mehr?«
Neugierig spähte Claudine hervor, klammerte sich aber umso fester an Anouks Beine und Gewand. Simon kannte ihre Scheu. Er streckte der Taube auf seiner Schulter den Zeigefinger hin, damit diese wie auf eine kleine Stange steigen konnte. Dann hockte er sich vor Claudine und neben Anouk hin und setzte die Taube auf die Schulter des Kindes.
»Für dich!«, sagte er.
Sofort löste sich Claudine von Anouk und betrachtete das Geschenk. Die Taube fühlte all die Aufregung, flatterte nervös und ließ einen Patzen auf Claudines Kleid fallen.
»Sie kann nicht gut fliegen«, erklärte Simon in seiner lauten, polternden Art, während er ein Büschel Gras abriss und den Patzen von ihrem Gewand wischte, womit der Fleck nur noch größer wurde. Aus der Innentasche seines Umhangs nahm er ein paar Körner und legte sie in Claudines Hand. Sie formte eine Schale und hielt diese der Taube hin, die sofort zu picken begann. Das kitzelte, Claudine lachte laut auf. Als alle Körner aufgepickt waren, bedankte sich das Tier mit einem weiteren Patzen.
Anouk war sich nicht sicher, ob sie sich über dieses Geschenk für ihren Schützling freuen sollte, doch da sagte Claudine leise: »Meine Silbertaube.«
Sophie und Agnès hatten zugesehen. Alle hielten den Atem an. Claudine sprach. Unbeachtet kletterte inzwischen Paquette aus der ersten Kutsche. Noch magerer und verwelkter als je zuvor blickte sie sich um.
»Was für ein Aufruhr«, murmelte sie vor sich hin und drängte sich nahe an Sophie. Diener brachten das reichliche Gepäck in die Gemächer. Immer wieder zeigte Claudine zu den Stallungen hinunter, wo sich auch der Taubenschlag befand, bis Agnès zu Anouk sagte, sie könne mit Claudine und Simon zu den Hühnern und Tauben gehen. Währenddessen begleitete sie Sophie und Paquette in deren Räumlichkeiten im Westflügel des Schlosses.
»Ich freue mich so sehr, deinen Felix wiederzusehen. Bestimmt läuft er schon herum«, meinte Sophie im Hineingehen.
»Nein, er ist in allem etwas später dran, als es Claudine damals war, aber du wirst ihn lieben«, antwortete Agnès voller Freude.
Die Dienerinnen Paulette und Louise waren während der Begrüßung bei Felix geblieben. Paulette diente noch nicht lang genug im Hause de Valois, um die Freunde aus Mortain de Prés zu kennen. Als Aristokratin, wenn auch von niederem Adel, fiel es ihr schwer, sich Anouk unterzuordnen. Es war ihr nicht entgangen, dass es Madame Veronique gewesen war, die sie für die Kinder einstellen wollte und die sich damit gegen Madame Agnès durchgesetzt hatte. Die Welt war für Paulette voller Ungerechtigkeiten, denn eigentlich sollte der Duc ihre Schwester Elise ehelichen. Warum nur hatte er sich letztlich doch für Agnès entschieden, die bereits zehn Jahre vergeblich im Kloster auf seine Zusage gewartet hatte? Statt die Schwester einer Duchesse zu sein, war Paulette nun deren Kinderfrau. Vom geöffneten Fenster aus beobachtete sie die Ankommenden. Solchen Gästen wollte Paulette auf keinen Fall dienlich sein, doch wenn sie ihr die Mühe mit der Prinzessin etwas abnahmen, war ihr das dann doch recht.
Auch Madame Veronique blickte aus ihrem Gemach auf die Gäste hinab. Ihre stets gut geheizten Räume mit den schweren Eichensesseln, der geschnitzten Truhe und vor allem dem Tisch, auf dem stets Pergamente und die Bibel lagen, waren ihre Zuflucht, oft auch ihre Residenz für Gespräche mit ihrem Sohn. Am meisten liebte sie aber den weiten Ausblick auf den Vorhof und von ihrem Schlafgemach aus auf den Zufahrtsweg. Nur ein dreiarmiger Kerzenhalter am Tisch erhellte jetzt den abgedunkelten Raum. Madame stand halb verborgen hinter den schweren Vorhängen. Dass sogar Paquette wieder mitgekommen war, ärgerte sie besonders.
»Mein Schloss ist zum Tollhaus geworden«, grummelte sie vor sich hin.
An diesem Tag verließ sie ihre Gemächer nicht mehr und ließ sich die Speisen nach oben servieren.
Es blieb mild. Der Morgennebel lichtete sich bald, die Blätter der Bäume begannen sich zu färben und wirbelten rot und goldgelb durch die Luft. Felix machte seine ersten Schritte und Claudine rannte über die Wiesen, um die Blätter zu fangen. Dabei lachte sie laut und freute sich, wenn auch Simons Tauben sie überallhin begleiteten. Immer wieder zog sie ihn am Ärmel, damit er ihr das Ohr zuneigte, weil sie ihm etwas sagen wollte. Er fühlte ihren Atem, es kitzelte.
»Gerade einem Menschen, der nicht hören kann, flüstert die Prinzessin etwas zu«, wunderte sich Paulette. »Bestimmt sagt sie keine echten Wörter, sondern tut nur so als ob.«
»Was zählt, ist Claudines Freude und wie sehr sie Simon vertraut. Außerdem lieben beide Tiere«, sagte Anouk.
Sie zweifelte daran, ob Paulette als zweite Dienerin für die Kinder geeignet sei. Madame Veronique bestand aber darauf, ihre entfernte Verwandte als Aristokratin für die Erziehung einzustellen. Eigentlich wäre Anouk damit Paulettes Untergebene, doch Madame Agnès hatte es durchgesetzt, sie als erste Hofdame zu behalten und ihr die Hauptverantwortung für die Kinder zu belassen. Anouk durfte mit Louise sogar eine weitere Magd aus ihrem Dorf einstellen.
Die Gäste, Kinder und Madame Agnès verbrachten viel Zeit im Freien. Das entlastete die Dienerinnen, denn nur eine von ihnen musste sie jeweils begleiten.
»Du hast mir so gefehlt«, gestand Agnès Sophie bei einem dieser Spaziergänge.
»Und du mir erst. Andererseits bist du eine wahrhaftige Duchesse, hast zwei Kinder, einen liebevollen Gemahl. Zu wissen, wie gut es dir geht, erfüllt mich mit Freude.«
Sophie begann von Daniel und dem Leben auf ihrem Heimatschloss zu erzählen, das nun dem Hause de Cercueilclou gehörte.
»Wir sind eine große Familie geworden, Martha de Cercueilclou, ihre beiden Kinder und Daniel, Simon, Paquette und ich.«
Agnès hatte nie das Gefühl, als sei Paquette ihre Mutter, obwohl sie das tatsächlich war. Ihre wahre Madre blieb Sophie. Paquette trippelte stets in deren Nähe herum. Auch sie erkannte in der Duchesse de Valois nicht ihre Tochter, allerdings nannte sie Claudine manchmal Agnès.
Um die Mittagszeit wärmte die Sonne noch gut. Vor ihnen sprang Claudine immer wieder an Simon hoch. Schon wieder war Silbertaube von ihrer zu Simons Schulter geflattert. Claudine wollte nach der Taube greifen, doch diese flatterte aufgeregt und ließ einen Patzen auf die Hand der Prinzessin fallen. Simon lachte laut auf und half ihr, die Hand im Gras abzuwischen.
»Warum kann die Taube denn nicht fliegen?«, fragte Agnès.
»Sie wurde von einer Katze am Flügel verletzt«, erzählte Sophie. »Da war sie noch recht jung. Simon hat sie gesund gepflegt.«
»Seit ich gehört habe, wie Claudine ›meine Silbertaube‹ gesagt hat, liebe ich das Tier. Simon tut meiner Tochter so gut. Anscheinend kommen nur er und Anouk richtig an sie heran. Manchmal ist mir sogar, als nehme mich mein eigenes Kind gar nicht richtig wahr.«
Sophie legte den Arm um ihre Schultern und drückte sie an sich.
»Wenn ihr doch immer hierbleiben könntet!«, sagte Agnès.
Die Gäste weilten nun bereits über eine Woche auf dem Schloss, und es wurde um die Mittagszeit fast sommerlich warm. Madame Veronique traf nach dem Mahl im Besprechungsraum nur auf Baron de Bonarbre und einen Gutsherrn. Sie sprachen über den Saatwechsel auf den Feldern und die Ruhewiesen dazwischen. Als Madame Veronique weder den Schreiber Jean noch den Duc vorfand, blieb sie für einen Moment perplex im Türrahmen stehen. Wegen des anwesenden Gutsherrn konnte sie ihrem Ärger jedoch nicht gleich Luft machen. Sie hörte kaum zu, als der Baron darüber sprach, dass einige Grundbesitzer des niederen Adels die Ruhephasen der Felder abschaffen wollten. Der Baron verwies auf die Bestimmungen des Landes und darauf, dass es dem Ernteertrag letztlich schaden würde, auf kurzfristige Gewinne zu setzen. Seit jeher wurden die Felder im Rhythmus von sechs Jahren abwechselnd brachgelegt, damit sich der Boden erholen konnte.
Während sie noch diskutierten, kam Jean mit wehenden Rockschößen herein. Als er Madame Veronique erblickte, mäßigte er seine Schritte sofort. Seine Wangen waren gerötet, an den Schuhen klebten Grashalme. Madame Veronique blickte genauer hin und glaubte, sogar etwas Taubenmist daran zu erkennen. Ihr tadelnder Blick sagte alles. Jean verneigte sich und verzichtete auf entschuldigende Worte. Der Gutsherr blickte kurz auf, wandte sich dann aber wieder dem Dokument zu, das ihm der Baron vorlegte. Mit einem kleinen Lächeln begrüßte Julien den Schreiber.
Bald darauf verabschiedete sich der Gutsherr und versprach, sich an die Ruhezeiten der Felder zu halten. Kaum hatte er den Raum verlassen, gab Madame Veronique einen Schreckenslaut von sich. Im Durchsehen der noch verschlossenen Briefe hatte sie einen mit königlichem Siegel entdeckt, brach es und las. Sie erblasste. Julien nahm das Schreiben und las halblaut:
An den Duc zu Chartres, Raphael de Valois
Wir erlauben Uns, anlässlich wichtiger Besprechungen bezüglich der Bretagne einen Besuch in den nächsten Tagen anzukündigen.
In Vertretung Seiner Königlichen Hoheit Karl VIII. werden die Schwester des Königs, Madame Anne de Beaujeu, und Bischof Guillaume Briçonnet Eure Gastfreundschaft in Anspruch nehmen. Für die Begleitung durch Hauptmann Phoebus de Châteaupers und seiner Ritter möget Ihr ebenfalls eine angemessene Unterkunft zur Verfügung stellen.
Hoch lebe der König zur Ehre Frankreichs!
Gezeichnet,
Pierre II. de Bourbon
Madame Veronique lehnte sich zurück. Ihr fehlten die Worte. Solch eine Ankündigung kam einem Befehl gleich und verhieß nichts Gutes.
»Die Verrückten aus Mortain des Prés müssen sofort abreisen! Es sind Vorkehrungen für den königlichen Besuch zu treffen. Ein Zusammentreffen mit, mit … diesen Leuten wäre entsetzlich!«, hauchte sie. Julien war zu erschrocken über die Ausdrucksweise der Duchesse, um zu reagieren, auch Jean musste sich beherrschen.
»Und veranlasst augenblicklich eine Unterbringung der Prinzessin im Westturm«, fügte Madame Veronique hinzu.
Beide Männer starrten sie entgeistert an. Madame bemerkte deren Reaktion.
»Der Duc! Augenblicklich!«, kreischte sie.
Doch keiner der beiden reagierte.
Außer sich und doch kraftlos schlug Madame Veronique mit der Faust auf den Tisch. Da erst eilte Julien hinaus. Er nahm die Hintertreppe, denn wenn der Duc mit den anderen nicht bei der Linde war, dann bestimmt unten bei den Tauben. Einige davon kreisten wie ein Signal über den Stallungen. Schon von Weitem hörte er fröhliches Rufen und sogar Claudines lautes Lachen über die Wiese heraufschallen. Als Raphael ihn heraneilen sah, schwante ihm nichts Gutes.
»Monseigneur! Madame wünscht Euch zu sprechen«, rief ihm Julien zu.
»Ach Julien, so wichtig kann es doch gar nicht sein. Bleibt doch ein wenig hier draußen bei uns«, bat Raphael. »Seht Ihr nicht, wie gut Simon und die Tauben unserer Claudine tun? Richtet Madame lieber aus, sie möge doch auch die letzten Sonnenstunden hier draußen genießen, bevor uns der November in die Kammern zwingt.«
Julien blieb nah bei Raphael stehen und erklärte leise: »Soeben kam ein Brief vom Königshof. Madame de Beaujeu wird uns dieser Tage besuchen. Eure Mutter wünscht die sofortige Abreise unserer Gäste aus Mortain des Prés.«
Für einen Augenblick schien es, als habe der Duc nicht zugehört. Er schaute zu den Kindern, Dienerinnen, zu Simon und den Tauben. Und er lächelte.
»Claudine ist mit Simon wie ausgewechselt. Ich glaube sogar daran, dass er sie zum Sprechen bringen könnte. Stell dir vor, ausgerechnet mit jemandem, der sie nicht hören kann, spricht sie.« Unbefangen blickte er Julien an.
»Auf keinen Fall lasse ich unsere Gäste abreisen, solange sie es nicht von sich aus müssen!«
Alle spürten die Vertrautheit der beiden Männer, taten aber so, als hätten sie nichts bemerkt. Paulette und Louise hatten strengste Anweisungen, diskret über dergleichen hinwegzusehen. Dennoch entfernte sich Julien einen Schritt von seinem Freund.
»Was darf ich der Duchesse melden?«, fragte er förmlich.
Ratlos blickte sich Raphael nach Agnès um.
»Geh nur. Die Pflicht ruft«, sagte diese lächelnd. Ihr Du an den Gemahl war für öffentliche Ohren eigentlich zu vertraulich, aber in dieser Runde fühlte sich Agnès heimisch. Vor Julien durfte sie sein, wie sie wollte. Er bewegte sich leichtfüßig auf dem aristokratischen Parkett der Etikette und erkannte doch, genau wie sie selbst, deren Schein. Vornehme Darstellung und vertraute Begegnung verhielten sich zueinander wie Gaukelei und Wahrheit. Allerdings schien es Agnès oft, als sei sie die Einzige, die ständig etwas vorspielen musste.
»Ihr seid zu beneiden«, entgegnete Raphael. »Genießt den Tag.« Er neigte sich zu Felix hinab und küsste ihn auf die Stirn, dann winkte er Claudine zu. Sie schenkte ihm ein Lächeln.
Julien eilte in Richtung Schloss, er wusste, wie ungeduldig Madame Veronique schon wartete. Der Duc zügelte seine Schritte. So unbeschwert wie zuvor mit den Kindern auf der Wiese war er schon lange nicht gewesen. Kurz nach Julien betrat er den geräumigen Besprechungsraum, eilte zu einem der drei großen Fenster und öffnete es. Ein erfrischender Windstoß drang in den Raum. Erst nach einigen Augenblicken wandte sich der Duc seiner Mutter zu.
»Mich angesichts der königlichen Ankündigung so lange warten zu lassen, ist unerhört, Monseigneur!«, fuhr ihn diese an. Da er nicht darauf reagierte, unterbreitete sie kurzerhand ihre Entscheidungen. »Die Leute aus Mortain des Prés haben unverzüglich das Schloss zu verlassen und Claudine wird in den nächsten Wochen im Westturm wohnen. Die beiden neuen Dienerinnen sollen sie dort überwachen und vor allem darauf achten, dass ihrer keiner unserer hohen Gäste aus Paris gewahr wird. Zudem wird der ganze Ostflügel für unserem Besuch bereitstehen, selbstredend mit ausreichend Gesinde. Lasst unbedingt alle Kamine säubern, die wurden dort schon lange nicht mehr benutzt. Nicht auszudenken, wenn die Schwester des Königs von einer Rußwolke empfangen würde, sobald sie sich in ihre Gemächer zurückzieht. Ach ja, schärft Eurer Gemahlin ein, sich zurückhaltend zu benehmen. Keine vorlauten Äußerungen und vor allem keine Besuche bei den Kleintieren. Auch Felix soll während der nächsten Zeit nur von Anouk betreut werden. Es ist schlimm genug, dass der Erbe vorwiegend von einfachen Mägden erzogen wird! Aber wie immer hatte da ja Madame Agnès das Sagen.«
Sie wollte schon fortfahren, doch Duc Raphael unterbrach sie: »Madame! Ihr sprecht von meiner Familie, von meinen Kindern und meiner Gemahlin. Unterlasst also abwertende Bemerkungen und versteht endlich, dass ich es nicht dulden werde, Claudine wegzusperren. Niemals! Sie hat heute wieder zu sprechen begonnen, gerade vorhin. Sie macht durch Simon de Sanslieu erstaunliche Fortschritte. Seine Tauben öffnen ihre Sinne, sie hört zu und blickt auf. Ihre Verschlossenheit weicht endlich. Wollt Ihr diese erfreuliche Entwicklung denn wirklich unterbrechen? Auf keinen Fall sollen die Freunde meiner Gemahlin jetzt abreisen. Das Schloss bietet schließlich Platz genug, außerdem glaube ich kaum, dass die Visitation aus Paris lange währen wird. Was will die Schwester des Königs überhaupt von uns?«
Wortlos reichte sie ihm das Schreiben.
»Und was haben wir mit der Bretagne zu schaffen?«, rutschte es ihm heraus.
Madame Veronique schnappte nach Luft.
»Ihr beliebt zu scherzen, Monseigneur! Schlimm genug, wie wenig Ihr Euch in all den Jahren um die Scharmützel rund um die freie Bretagne gekümmert habt, nun kommt die eigentliche Regentin Frankreichs zu uns, und Ihr nehmt es nicht ernst. Madame de Beaujeu war es, die ihren Bruder als König einsetzte und Louis d’Orléans damit die Krone streitig machte. Dieser wird alles daransetzen, sich die Bretagne anzueignen. Um nichts Geringeres wird es bei diesem Besuch gehen!«
Raphael setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. Die Worte seiner Mutter erschütterten den Duc nun doch, denn er wusste nur zu gut, wie recht sie hatte. Madame de Beaujeu war ihrem Vater, dem verstorbenen König Ludwig XI., nicht nur im Aussehen gleich. Ihre Macht im Hintergrund auszuüben machte sie sogar noch gefährlicher.
»Ich stimme Euch zu, Madame, dass mich die kriegerischen Ambitionen des Louis d’Orléans wenig kümmerten«, sagte Raphael. »Auch das Ableben des Duc de Bretagne erachtete ich nicht direkt als Verpflichtung meinerseits. Allerdings hat man gewiss längst einen hochrangigen Bretonen als Gemahl für seine Tochter bestimmt. Somit wird das Herzogtum weiterhin unabhängig bleiben. Daran kann auch die Schwester des Königs nichts ändern.«
»Ihr wisst nicht, wovon Ihr sprecht!«, warf Madame ihm an den Kopf. »Anne de Bretagne wird vom nächstbesten Feind Frankreichs geehelicht werden und ihr Herzogtum somit eine offene Pforte sein, die es ermöglicht, unser Reich zu bedrohen, vielleicht sogar zu besetzten. König Maximilian von Habsburg hat nach dem Tod seiner Gemahlin nicht wieder geheiratet. Was glaubt Ihr wohl, warum?«
»Weil er sie so sehr liebte? Es ist allseits bekannt, wie sehr er nach wie vor um Maria von Burgund trauert.«
»Ihr seid ein unverbesserlicher Träumer! Als ob Liebe eine Rolle spielen würde«, höhnte Madame Veronique. »Maximilian hat seine Tochter Margarete dem damaligen Dauphin Karl zur Frau gegeben, um sich mit Frankreich zu verbünden. Wenn er nun auch noch Anne de Bretagne ehelicht, kann er Einfluss in unserem ganzen Reich geltend machen. Das muss verhindert werden!«
»Nun gut«, räumte Raphael ein. »Madame Agnès und ich werden während des Besuchs der Eisernen Anne und dieses aufgeblasenen Bischofs Briçonnet so aufmerksam und entgegenkommend wie nur irgend möglich sein. Aber unsere Gäste aus Mortain des Prés bleiben hier und werden weiterhin Kontakt zu den Kindern pflegen. Wenn Ihr wollt, können ja alle einstweilen im Westflügel untergebracht werden, der ohnehin näher bei den Stallungen liegt als das Hauptgebäude.«
»Ich halte es für falsch, nur wegen dieser Leute Madame de Beaujeu womöglich zu brüskieren«, sagte Madame müde. »Aber Ihr seid der Duc. Ihr tragt die Verantwortung.«
Grußlos verließ sie den Besprechungsraum.
»Könnt Ihr Euch darum kümmern, die Räumlichkeiten im Ostflügel für die Gäste aus Paris vorbereiten lassen?«, bat Raphael seinen Berater.
»Gleich nach Durchsicht der restlichen Schreiben«, antwortete Julien.
Der Duc ging anschließend direkt zur Linde hinter dem Schloss, dort lehnte er sich an den rauen Stamm. Von Weitem hörte er die Dienerinnen rufen, zwischendurch auch Simons dumpfes Lachen und ein helles Auflachen von Felix. Sie kamen wohl gerade vom Taubenschlag herauf. Er wünschte, einfach hier stehen bleiben zu können, unter der Linde.
Im Louvre beobachteten Anne de Beaujeu und ihr Gemahl Pierre de Bourbon von den hohen Fenstern aus das sogenannte Palmenspiel unten im Park. Annes Bruder, der junge König Karl VIII., spielte wie so oft mit Adeligen seines Alters und stach als besonders eifrig hervor. Die kränkliche Konstitution seiner Kindheit kompensierte er gern durch Spiele, welche Geschicklichkeit erforderten.
Da fiel Madame de Beaujeus Blick auf ein Spinnennetz am unteren Eck des offenen Fensters. Es wäre ihr nicht aufgefallen, hätte sich nicht gerade ein Falter darin verfangen. Je mehr er zappelte, desto enger umschloss ihn das zarte Gespinst. Die Spinne selbst beobachtete dieses Schauspiel scheinbar ungerührt am Rand des Netzes. Anne de Bretagne muss jemanden aus dem Hause de Valois ehelichen, dachte Madame de Beaujeu. Was für ein ständiges Ärgernis, diese Bretagne! Als ob es nicht wesentlich besser wäre, sich dem großen Reich anzuschließen, sich darin sicher zu fühlen.Sie verstand das müßige Streben nach Unabhängigkeit nicht. Während der König draußen wie ein Kind den festen Lederball zwischen die sogenannten Palmen warf und dabei einen Gegner hart an der Schulter traf, ballte Anne de Beaujeu die Hände zu Fäusten. Warum hat der Duc zu Chartres noch keinen Bericht über die verräterischen Ambitionen des Louis d’Orléans an mich gesandt, fiel ihr ein. Auch der eigens dort eingesetzte Pfarrherr, Dom Frollo, schwieg beharrlich. Ob er mit der Bretagne ein Abkommen hatte? Schließlich war er dort lange Zeit als Einsiedler tätig gewesen. Niemandem konnte sie vertrauen. Da! Siegesgewiss näherte sich die Spinne dem inzwischen erschöpften Falter.
Sich ihrer verschwörerischen Macht bewusst, lächelte die Eiserne Anne, wie man sie gern nannte, als man ihr meldete, dass Hauptmann de Châteaupers eingetroffen sei.
»Habt Dank für Euer Kommen, Hauptmann«, sagte sie und gab ihm ein Zeichen, sich aus der Verbeugung zu erheben.
»Ich habe zu danken und versichere Euch, mein Bestes zu geben, was immer Eure Befehle sein mögen«, antwortete er. Seine Stimme klang nicht so forsch wie beabsichtigt. Madame de Beaujeus eiskalte Augen schüchterten ihn ein.
»Nehmt Platz, Hauptmann de Châteaupers, wir haben einiges zu besprechen«, forderte sie, die mit ihrem Gemahl, Pierre de Bourbon, an einem polierten Tisch aus Kirschholz saß, auf dem bereits Wein und Gläser standen. Phoebus ließ sich auf einen Stuhl den beiden gegenüber nieder. Ein Diener kredenzte den Wein.
»Hauptmann de Châteaupers, ich habe lange überlegt, wer wohl der geeignetste Mann für meinen heiklen Auftrag sei, denn was ich Euch anvertraue, erfordert vollkommene Diskretion und auch diplomatisches Geschick«, kam Madame de Beaujeu gleich zur Sache.
»Seid Ihr bereit, alles für das Wohl Frankreichs zu geben, Hauptmann de Châteaupers?«, unterstrich Pierre de Bourbon die Worte seiner Gemahlin.
Unfähig, etwas zu sagen, nickte Phoebus. Anne amüsierte sich über seine Unsicherheit. Tatsächlich hatte sie ihn längere Zeit bespitzeln lassen und in ihm eine Mischung aus Ehrgeiz und jugendlicher Sinnesfreude entdeckt. Auf den ersten Blick wirkte er harmlos wie ein Kind, verfolgte seine Ziele aber mit verschlagener Beobachtungsgabe.
»Ich habe berechtigte Zweifel an der Treue des Duc de Valois’ dem König gegenüber«, erklärte sie. »Ihr sollt mir Beweise dafür liefern.«
Ihre Pupillen verengten sich, als sie seine Irritation beobachtete.
»Traut Ihr Euch das zu?«, fragte Pierre de Bourbon auf sein Schweigen hin.
Der Hauptmann räusperte sich, straffte den Rücken und blickte beiden ins Gesicht.
»Leider muss ich gestehen, dass ich den Duc nicht kenne«, antwortete er. »Daher wird es mir wohl nicht möglich sein, ihn aufzusuchen. Doch will ich mich gern in seinem Umfeld diskret umhören.«
»Nicht nötig. Demnächst werde ich dem Duc in Chartres einen Besuch abstatten«, sagte Madame de Beaujeu. »Mein Begleiter wird Bischof Briçonnet sein und Ihr, Hauptmann de Châteaupers, sollt uns mit einigen Rittern Geleitschutz geben. Somit bekommt Ihr Unterkunft im Schloss und werdet auch nach meiner Abreise in Chartres bleiben.«
Phoebus wurde es warm ums Herz. Dieser Auftrag führte ihn für mehrere Wochen weg aus Paris, weg aus dem Palais de Lys, weit weg von seiner Gemahlin und ihrer Familie. Die Eiserne Anne bemerkte das Aufblitzen in seinen Augen.
»Da gibt es noch etwas. Es mag Euch verwundern, aber auch innerhalb der Kirche treiben zuweilen Vipern ihr Unwesen. Eine davon hat einst sogar die Gunst meines Vaters erschlichen, wenn sich dieser auch bestimmt nicht von ihr blenden ließ«, sprach sie salbungsvoll.
Das verfehlte seine Wirkung nicht. Gespannt neigte sich der Hauptmann etwas in ihre Richtung.
»Ein Benediktinermönch«, fuhr sie fort, »der vorgab, in der Bretagne als frommer Einsiedler Gutes zu tun, hat sich dort womöglich mit anderen Verrätern gegen das Königshaus verschworen. Mir ist noch nicht klar, wie weit dieser vermeintliche Pfarrherr von Chartres auch den Duc de Valois schon mit königsfeindlichem Gedankengut vergiftet hat. Jedenfalls berichtete man mir, dass zwischen diesem Pfarrherrn und dem Hause de Valois ein allzu reger Kontakt herrschen soll.«
Das Vertrauen der Eisernen Anne gab dem Hauptmann ein Gefühl von Bedeutung.
»Madame de Beaujeu, Monseigneur de Bourbon, Ihr werdet die nötigen Beweise erhalten. Es ist mir ein Anliegen, den Sumpf trockenzulegen, zur Ehre des Königs und zum Wohle Frankreichs«, sagte er.
Beide lächelten ihn an. Pierre de Bourbon zuckte mit dem Finger in Richtung des Dieners, der am Rand stand und offenbar darauf gewartet hatte. Er hob eine Schatulle aus einem reich verzierten Schrank und stellte sie auf den Tisch. Madame de Beaujeu öffnete den Deckel und entnahm dieser eine doppelt genähte rot samtene Geldkatze.
»Diese Geldkatze enthält hundert Louis d’or. Damit entlohnt Ihr die Ritter, welche mit Euch in Chartres bleiben werden. Der Rest ist Euer Sold für gute Beobachtungen und vor allem für regelmäßige Berichte an mich«, sagte sie und überreichte ihm die Geldkatze. »Ich lasse es Euch rechtzeitig wissen, wann wir nach Chartres aufbrechen.«
Der Hauptmann verneigte sich so tief, dass er fast seine Knie hätte küssen können. Dann verließ er den Salon und steuerte sofort auf das Quartier in der Bastille zu, um seinen Schatz zu verstecken. So karg die Räumlichkeiten auch waren, fühlte er sich dort wohl und vor allem frei. Im ehelichen Palais war er nichts weiter als ein Gefangener. Nun aber konnte er sich reich schätzen, nicht nur wegen der hundert Louis d’or, sondern auch, weil er im Auftrag der Eisernen Anne handeln würde.
Kapitel 2
Schluss jetzt, Wolf! Ich will davon nichts hören, und das weißt du ganz genau!«, sagte Maximilian zu seinem Freund. »Neben all meinen Sorgen kann ich nicht auch noch den Brautwerber mimen.«
Sie ritten im Schritt nebeneinander. Seit ihrer letzten Rast in einer Schenke teilten sich die gedungenen Söldner in kleine Gruppen. Durchgehender Nieselregen färbte die Landschaft grau.
»Ich weiß, arm wie eine Kirchenmaus mutest du deinem Volk lieber plündernde Söldner zu«, sagte Wolf von Polheim, »statt eine reiche Braut zu ehelichen, um wenigstens mit deren Geld Soldaten zu bezahlen.«
»Aber versteh doch, Wolf, die Verhandlungen mit den Ungarn fangen ja erst an. Ich hätte gar keine Zeit zu heiraten, selbst wenn sich die Braut vor meiner Nase befände.«
»Wenn du dir die Herzogin der Bretagne nicht schnappst, nimmt sie ein anderer!«, insistierte Polheim.
»Den Franzosen sollte man sie jedenfalls nicht überlassen. Von denen habe ich ohnehin ein saures Aufstoßen. Ludwig XI. hat sich unsere Margarete für seinen Sohn ausbedungen. Ich kann dir nicht sagen, Wolf, wie sehr mich das noch immer schmerzt. Meine Margarete nach Frankreich zu verschachern, werde ich den Gentern nie verzeihen.«
Gesenkten Hauptes hörte Polheim zu. Sie ritten gerade an kleineren Feldern entlang zum vereinbarten Stützpunkt vor Wien. Der ungarische König Matthias Corvinus war dort mit seinen Mannen einmarschiert und forderte Unabhängigkeit und die Rückgabe allzu hoher Abgaben.
»Ja, dieser Vertrag von Arras war ein übler Schachzug der Ständeversammlung in Gent. Die Burgunder haben sich damit zwar mit Frankreich verbündet und deine Ländereien als Mitgift vergeben, aber dadurch steht dir Karl VIII. ja auch in der Pflicht«, erwiderte Polheim. »Spiel einfach die angeheiratete Verwandtschaft mit dem französischen Königshaus für dich aus. Frankreich kann dir nicht verbieten, Anne de Bretagne zu ehelichen, nachdem der König mit deiner Tochter vermählt ist. Du musst deine neue Gemahlin gar nicht erst zu Gesicht bekommen, wichtig ist nur der gültige Ehevertrag.«
»Und wie soll das gehen?«, fragte Maximilian. »Willst du das Ehebett mit Anne de Bretagne teilen, in Vertretung für mich, sozusagen als mein Freund?«
»He! Was für ein guter Gedanke! Eine Eheschließung per Procurationem«, rief Polheim. »Also dafür bist du mir was schuldig!«
Maximilian grummelte nur ein lakonisches »Du spinnst!« vor sich hin. Gleichzeitig ahnte er aber, dass er sich wohl in irgendeiner Weise in diese Heirat fügen würde müssen. Nicht nur sein Vater saß ihm im Nacken, auch Gläubiger und Versprechungen dem Volk gegenüber verpflichteten ihn. Die Menschen litten Hunger, sie erwarteten Sicherheit. Das vermögende und einflussreiche Herzogtum der Bretagne wäre seine Rettung.
Bald darauf verfasste Maximilian den Antrag auf Eheschließung und schickte eine Notiz an seinen zweiten Kämmerer, in den kargen Beständen der Schatzkammer nach einem Brautgeschenk zu suchen und dieses an Maximilians und Wolfs Freund Albrecht Dürer nach Nürnberg zu bringen. Diesem wurde ebenfalls ein Schreiben beigelegt. Albrecht möge mit Pergament und Zeichenkohle umgehend nach Wien reisen, um das Konterfei des Königs anzufertigen, damit Anne de Bretagne wenigstens ein Bild ihres Gemahls habe. Das Geschenk aus der Schatzkammer brachte Albrecht ebenfalls mit, als er zu den Freunden in Wien stieß. Es war eine zart geschmiedete Goldbrosche, kaum größer als die Blüte einer Margerite.
Das Wiedersehen galt Maximilian und Wolf als Aufatmen inmitten aussichtsloser Verhandlungen mit den Ungarn.
»Wirke ich für einen Brautwerber nicht zu trübsinnig? Und für meine einunddreißig Jahre nicht zu jung auf dem Bild?«, fragte Maximilian, als Albrecht sein Werk vollendet hatte.
»Wie immer am Nörgeln«, entgegnete dieser. »Aber du wirkst nicht trübsinnig, du bist es, und jugendlich leider auch. Unverschämt, wie gut du aussiehst nach all deinen Gelagen und tollkühnen Kämpfen.«
»Der Heiratsantrag in die Bretagne sollte bald abgeschickt werden, gemeinsam mit dem Bild und meinem bescheidenen Geschenk«, meinte Maximilian. »Und du, wagemutiger Wolf, könntest gleich den Boten machen. Wirst ja eh statt meiner die Ehe mit der Herzogin über die Bühne bringen.«
Albrecht wurde aufmerksam.
»Eine Ehe über die Bühne bringen?«, merkte er an. »Das klingt nicht gerade romantisch.«
»Pscht! Darüber sprechen wir lieber nicht«, flüsterte Wolf.
Sofort verstand Albrecht den Hinweis. Obwohl er um zwölf Jahre jünger war als Maximilian, hatte ihm dieser viel über Maria von Burgund erzählt, hatte immer wieder ihren tragischen Reitunfall geschildert. Die Trauer darüber erfüllte den Habsburgerkönig. Nichts konnte ihn trösten.
»Und wie soll das gehen?«, fragte Albrecht weiter, um Melancholie gar nicht erst aufkommen zu lassen. »Polheim heiratet an deiner Stelle Anne de Bretagne?«
»Ja und nein«, lallte Wolf, der Weinkrug an ihrem Tisch war längst geleert. »Ich erledige den langweiligen Teil in der Kirche und später kommt Maxl und sieht zu, dass die Ehe bestätigt wird. Also du weißt schon. Mit der Braut, also … wie soll ich sagen ...«
»Keine Sorge, ich kann’s mir denken!«, wehrte Albrecht weitere Erklärungen ab.
»Du hast leicht reden«, maulte Maximilian. »Kannst heiraten, wen du willst. Unsereins ist ein armer Hund und muss nehmen, wen das Land braucht.«
»Das denkt sich die Braut wohl auch«, entgegnete Albrecht.
Es dauerte dann doch einige Wochen, bis die Lage in Wien eine Abreise Wolfs von Polheim erlaubte. Darum entsandte Maximilian seinen Heiratsantrag mit dem Bild bereits früher, denn er war nicht allein mit dem Wunsch, sich die Bretagne zu sichern. Zu lange währten bereits die Kämpfe um das freie, reiche Herzogtum. Wer es sich nun durch eine Vermählung zu eigen machte, konnte sogar dem französischen Königshaus die Stirn bieten. Maximilian dachte nicht nur an seine Schulden, die er als Regent der Bretagne begleichen könnte, er würde damit auch endlich gegen den Widerstand der Gilden und Zünfte aus Burgund ankommen.
Im Schloss zu Nantes bemühte sich Anne de Bretagne, den Ausführungen ihrer Hofdame zu folgen. Die hochgewachsene Madame de Dinan-Laval wirkte zugleich aufgekratzt und müde. Ihre fahle Haut und die Tränensäcke hatten Anne als Kind Furcht eingeflößt. Was sie erzählte, kannte die fast Dreizehnjährige auswendig und beherzigte es, so gut es ging. Ich bin die Herzogin der freien Bretagne und diene meinem Volk. Mit diesem Satz war Anne aufgewachsen. Für diese Position hatte sie verschiedene Sprachen gelernt und die Melodien der Bretagne auf der Laute zu spielen. Die geräumige Studierstube lag im oberen Stockwerk. An diesem milden Herbsttag standen alle Fenster offen. Vom Park drang gedämpftes Lachen herauf.
»Madame, wäre es nicht ein geeigneter Tag, um die Flora des Herbstes zu studieren?«, fragte Anne. »Um zu beobachten, welches Getier sich auf den nahenden Winter vorbereitet, und um …«
»Und um Unfug zu treiben, wie es Eure Geschwister tun?«, tadelte die Hofdame. »Mademoiselle Anne, ist Euch entgangen, dass Ihr jetzt als Duchesse Euer Land zu regieren habt? Da bleibt keine Gelegenheit für Spiel und Spaß!«
Anne blickte auf.
»Wie könnte ich den Tod meines Vaters vergessen?«
»Nach der Krönung seid Ihr die ranghöchste Person der Bretagne, Mademoiselle«, fuhr Madame de Dinan-Laval fort. »Anders als im Rest Frankreichs gilt hier das Erbrecht auch für weibliche Nachkommen. Ihr seid also ein Vorbild für alle Weiber der Bretagne.«
»Seit meinem fünften Lebensjahr halte ich mich an Höflichkeit und Etikette, Madame.«
»Fühlt Euch nicht ständig angeprangert«, schimpfte Madame de Dinan-Laval. »Ihr solltet Euch im Übrigen auch mit dem Gedanken vertraut machen, dass jetzt viele nach den Vorteilen und dem Reichtum der Bretagne schielen werden.«
»Was meint Ihr?«
»Das liegt doch auf der Hand! Bald nach Eurer Krönung solltet Ihr Euch mit einem hochrangigen Bretonen vermählen!«
Anne verschlug es die Sprache. Es war ihr kaum vergönnt gewesen, um ihren Vater zu trauern, da sollte sie schon heiraten? Angst kroch in ihr hoch.
»Das geht nicht!«, wehrte sie sich.
Die Hofdame achtete nicht darauf.
»Ein Jammer, dass uns die Pestfälle an der Küste so lang daran hinderten, dem Land Eure Krönung zu schenken.«
»Madame!«, rief Anne. »So hört doch! Ich kann mich nicht vermählen. Mein Vater ist vor wenigen Monaten von uns gegangen und vor zwei Jahren meine Mutter! Ich dachte, erst in vielen Jahren Duchesse zu werden!«
»Ich, ich, ich!«, schimpfte die Hofdame, »Kind, Ihr müsst vor allem Bescheidenheit lernen, sonst werdet Ihr Eurem Volk nie gerecht!«
In dem Gefühl, niemanden mehr zu haben, dem sie wirklich vertrauen konnte, besuchte Anne gleich nach der Unterweisung im Studierraum die Kathedrale von Nantes. Ihre Kammerdienerin Elaine begleitete sie. Anne wollte mit ihren Eltern allein sein, wenigstens ihnen den Kummer und die Einsamkeit anvertrauen. Die Statue des Vaters lag noch nicht auf dem Grabmal, doch die ihrer Mutter. Es fiel Anne schwer, sich die Körper der beiden in dem großen Steinsarkophag vorzustellen.