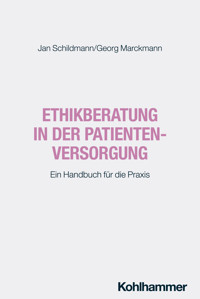
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ethikberatung bietet Unterstützung bei ethischen Fragen, Konflikten oder Unsicherheiten in der Patientenversorgung. Dieses Handbuch präsentiert den aktuellen Stand von Organisationsformen und Arbeitsfeldern der Ethikberatung sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Betreuung von Patientinnen und Patienten. Zudem führt das Buch - in dieser Form erstmals - detailliert in die Methode der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion ein. Die Anwendung der Methode wird anhand typischer Entscheidungssituationen aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen erläutert. Dabei werden auch aktuelle Herausforderungen wie beispielsweise die Ethikberatung bei Anfragen nach Suizidassistenz erörtert. Kapitel zu organisationsethischer Beratung, rechtlichen Fragen der Ethikberatung sowie zur Evaluation und Qualitätssicherung vervollständigen das Praxishandbuch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial
Danksagung
Zur Einführung
1 Grundlagen der Ethikberatung
1.1 »Ethikberatung«: Ein Begriff, viele Bedeutungen
1.2 Ziele von Ethikberatung: Mit welchen Themen sollte sich Ethikberatung (nicht) befassen?
1.3 Eine kurze Geschichte der Ethikberatung
1.4 Aktuelle Entwicklungen (in) der Ethikberatung
1.5 (Wie) wirkt Ethik(fall)beratung?
2 Organisationsformen der Ethikberatung
2.1 Ethikkomitees
2.2 Ethikberater*innen
2.2.1 Zentral verortete Ethikberater*innen
2.2.2 Dezentrale Ethikberater*innen und Liaison-Strukturen
2.3 Integrierte Modelle
3 Implementierung von Ethikkomitees: Ein Vorschlag in drei Phasen
3.1 Phase 1: Vorbereitung
3.1.1 Formierung einer Projektgruppe Ethikkomitee
3.1.2 Abstimmung mit Einrichtungsleitung
3.1.3 Berufsgruppen und Arbeitsbereiche sondieren, Interessenkonflikte reflektieren
3.1.4 Ziele und Aufgaben festlegen
3.1.5 Satzung entwickeln
3.2 Phase 2: Konstituierung des Ethikkomitees
3.2.1 Mitglieder ernennen
3.2.2 Geschäftsführung festlegen
3.2.3 Vorstand formieren
3.2.4 Konstituierende Sitzung
3.2.5 Mögliche Arbeitsschwerpunkte zu Beginn der Arbeit eines Ethikkomitees
3.3 Phase 3: Etablierung des Ethikkomitees
3.3.1 Mittelfristige Zeit- und Arbeitsplanung
3.3.2 Dokumentation und regelmäßige Prüfung der Angebote
3.3.3 Ergänzung und Ausdifferenzierung von Angeboten der Ethikberatung
3.3.4 Weiterentwicklung ethischer Kompetenzen in der Einrichtung
3.3.5 Berichterstattung
4 Arbeitsfelder der Ethikberatung
4.1 Welche Ethikberatung für wen? Vorschlag für eine Bedarfsanalyse
4.2 Fallbezogene Ethikberatungsangebote
4.2.1 Ethikfallberatung auf Anfrage
4.2.2 Ethikvisiten
4.2.3 Weitere fallbezogene Beratungsangebote
4.3 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
4.3.1 Aus- und Fortbildungen für Vertreter*innen der Gesundheitsberufe
4.3.2 Integration von Themen der Ethikberatung in die Pflegeausbildung
4.3.3 Studentische Lehre
4.4 Weitere Veranstaltungsformate
4.4.1 Niedrigeschwelliges Angebot: Das Ethik-Café
4.4.2 Informationen und Diskussionen für ein breiteres Publikum: Der Ethiktag
4.5 Ethische Empfehlungen
4.6 Advance Care Planning: Ein Beispiel für ein angrenzendes Arbeitsfeld
5 Ethikfallberatung: Grundlagen und Einführung in die prinzipienorientierte ethische Falldiskussion
5.1 Grundlagen der Ethikfallberatung
5.2 Ausgewählte methodische Ansätze der Ethikfallberatung
5.2.1 Prinzipienorientierte Ansätze
5.2.2 Hermeneutisch-ethische Ansätze
5.3 Methode der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion
5.3.1 Normative Grundlage: Die prinzipienorientierte Medizinethik
5.3.2 Die vier medizinethischen Prinzipien
5.3.3 Die Methode der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion in der Übersicht
5.4 Die prinzipienorientierte ethische Falldiskussion in der Praxis: Eine Anleitung
5.4.1 Anlass und Fragestellung ethischer Fallberatung
5.4.2 Vorbereitung und organisatorische Durchführung der Ethikfallberatung
5.4.3 Medizinische Aufarbeitung
5.4.4 Ethische Verpflichtungen gegenüber der Patient*in
5.4.5 Verpflichtungen gegenüber Dritten
5.4.6 Synthese
5.4.7 Kritische Reflexion
5.4.8 Exkurs: Individuelle Werthaltungen der Teilnehmenden an einer Fallbesprechung
5.5 Moderation der Ethikfallberatung
5.5.1 Rolle der Moderator*innen
5.5.2 Aufgaben der Moderation
5.6 Herausforderungen bei der Durchführung von Ethikfallberatung
5.6.1 Typische inhaltliche Herausforderungen
5.6.2 Typische Herausforderungen bei der Moderation
5.7 Dokumentation von Ethikfallberatungen
6 Umsetzung der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion in spezifischen Kontexten
6.1 Ethische Fallberatung in der vorgeburtlichen Medizin
6.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen des Schwangerschaftsabbruchs
6.1.2 Grundlagen ethischer Entscheidungen in der Pränatalmedizin
6.1.3 Die Methode der prinzipienorientierten Falldiskussion in der Pränatalmedizin
6.1.4 Ethische Herausforderungen bei der Umsetzung eines späten Schwangerschaftsabbruchs
6.1.5 Prozedurale Anforderungen an die Ethikfallberatung in der Pränatalmedizin
6.2 Ethische Fallberatung in der Kinder- und Jugendmedizin
6.2.1 Ethische Grundlagen der Entscheidungsfindung in der Kinder- und Jugendmedizin
6.2.2 Die prinzipienorientierte Falldiskussion in der Kinder- und Jugendmedizin
6.2.3 Prozedurale Aspekte der Fallberatung in der Kinder- und Jugendmedizin
6.2.4 Besonderheiten der Fallberatung bei Frühgeborenen in der Neonatologie
6.3 Ethische Visite auf der Intensivstation
6.3.1 Inhaltliche Grundlagen für die prinzipienorientierte Strukturierung ethischer Visiten auf der Intensivstation
6.3.2 Leitfaden für die prinzipienorientierte Ethikvisite auf Intensivstation
7 Ethikberatung bei Anfragen nach Assistenz bei der Selbsttötung
7.1 Mögliche Arbeitsfelder für Ethikberatung im Kontext von Anfragen nach Assistenz bei der Selbsttötung
7.1.1 Ethische Empfehlungen zum Umgang mit Anfragen nach Suizidassistenz
7.1.2 Fortbildungen zu ethischen Aspekten im Kontext von Anfragen nach Suizidassistenz
7.1.3 Ethikfallberatungen bei Anfragen nach Suizidassistenz
7.2 Grenzen der Ethikberatung im Kontext von Anfragen nach Assistenz bei der Selbsttötung
8 Ethikfallberatung kompetent durchführen: Qualifizierung und Demonstration erworbener Kompetenzen
8.1 Anforderungen an kompetente Ethikfallberatungen: Vielfältig und anspruchsvoll
8.1.1 Kenntnisse für die Ethikfallberatung
8.1.2 Fertigkeiten für die Ethikfallberatung
8.2 Qualifizierung für Ethikfallberatungen: Prozess und Methoden
8.3 Kompetenzen demonstrieren: Keine einfache Aufgabe
9 Ethikberatung im ambulanten Sektor und in stationären Pflegeeinrichtungen
9.1 Anlässe für Ethikberatung im außerklinischen Kontext
9.2 Strukturelle und organisatorische Besonderheiten der außerklinischen Ethikberatung
9.3 Vorschläge zur Implementierung außerklinischer Ethikberatung
9.3.1 Sondierung bestehender regionale Angebote der Ethikberatung
9.3.2 Organisatorische Anbindung der außerklinischen Ethikberatung
9.3.3 Durchführung außerklinischer Ethikberatung
10 Organisationsethik in Gesundheitseinrichtungen
10.1 Organisationsethische Handlungsperspektiven in Gesundheitseinrichtungen
10.2 Organisationsethische Beratung durch Ethikkomitees
10.3 Methodisches Vorgehen bei einer organisationsethischen Beratung
11 Rechtliche Aspekte der Ethikberatung
11.1 Institution »Ethikberatung« und Beratungscharakter
11.2 Berufliche Schweigepflicht
11.2.1 Grundzüge der Schweigepflicht
11.2.2 Schweigepflicht und Ethikberatung
11.3 Haftungsfragen
11.3.1 Grundlagen zivilrechtlicher Haftung
11.3.2 Haftung im Rahmen der Ethikberatung
11.4 Strafrecht
11.5 Ethikberatung und Rechtsberatung
Weiterführende Literatur zu medizinrechtlichen Fragestellungen in der Ethik(fall)beratung
12 Evaluation von Ethikfallberatung und Qualitätssicherung
12.1 Gegenstand, Ziele und Ansätze der Evaluation
12.2 Methoden der Datenerhebung und Auswertung
12.3 Praktisches Vorgehen bei der Evaluation und Beispiele
12.3.1 Planung der Evaluation: Ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag für die Praxis
12.3.2 Praxisbeispiele zur Evaluation und Qualitätssicherung
13 Anwendung der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion bei ausgewählten klinischen Konstellationen
13.1 Maximaltherapie oder Therapiebegrenzung?
13.1.1 Patientin mit einer Subarachnoidalblutung
13.1.2 Patient mit lebensbedrohlichem Zustand bei chronisch myeloischer Leukämie
13.2 Patientenwohl durch Zwangsbehandlung? – Ethikfallberatung bei einem Menschen mit psychischer Erkrankung
13.2.1 Patient mit einer therapierefraktären Schizophrenie
13.3 »Unser Kind soll nicht sterben« – Ethikfallberatung bei einem Kind
13.3.1 Ein Kind mit irreversibel fortschreitender neurologischer Erkrankung
Literaturverzeichnis
Zusatzmaterial zum Download
Stichwortverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Die Autoren
Univ.-Prof. Dr. med. Jan Schildmann, MA, ist Internist und Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Themen der klinischen Medizinethik, ethische Aspekte digitaler Technologien sowie methodische Aspekte der Verbindung empirischer und normativer Analysen. In der Lehre und Fortbildung liegt ein Schwerpunkt auf der integrierten Vermittlung ethischer und kommunikativer Kompetenzen.
Univ.-Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH, studierte Medizin und Philosophie an der Universität Tübingen und Public Health an der Harvard Universität in Boston. Seit 2010 leitet er das Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat maßgeblich die Methode der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion für die Ethikberatung in Deutschland etabliert und arbeitet als Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen.
Unter Mitarbeit von
Dr. iur. Kim Philip Linoh, M. mel., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitand am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Augsburg und dem juristischen Referendariat im OLG-Bezirk München folgte ein Masterstudium Medizin – Ethik – Recht und die Promotion an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Dr. Linoh verfasste für dieses Werk den Beitrag »Rechtliche Aspekte der Ethikberatung« (▸Kap. 11).
Jan SchildmannGeorg Marckmann
Ethikberatung in der Patientenversorgung
Ein Handbuch für die Praxis
Mit einem Beitrag von Kim Philip Linoh
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043516-2
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043517-9epub: ISBN 978-3-17-043518-6
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial
Den Weblink, unter dem die Zusatzmaterialien zum Download verfügbar sind, finden Sie ganz hinten in diesem Buch unter dem Kapitel »Zusatzmaterial zum Download«.
Muster als Orientierung für die Formulierung einer Satzung
Beispiel für einen Jahresbericht
Prinzipienorientierte ethische Falldiskussion Übersicht
Leitfragen für die prinzipienorientierte ethische Falldiskussion
–
Erwachsenenmedizin
–
Kinder- und Jugendmedizin
–
Pränatalmedizin
Protokollbogen für die prinzipienorientierte ethische Falldiskussion
Feedbackbogen zur Moderation einer prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion
Danksagung
Dieses Buch wäre ohne die sehr gute Zusammenarbeit vieler Beteiligter nicht möglich gewesen.
Zunächst danken wir Nadine Wäldchen und Nicole Adam für die unzähligen, immer zeitnahen und sehr sorgfältigen formalen Bearbeitungen sowie Rebecca Martin für ihre Unterstützung beim Layout und bei weiteren Arbeiten. Sinah Wiborg danken wir für die redaktionelle Bearbeitung des Manuskripts.
Weiterhin danken wir folgenden Menschen für die konstruktiven und unterstützenden Hinweise zu einzelnen Kapiteln des Buchs: Katharina Ille, Alexander Kremling, Hannah Mrozynski, Andre Nowak, Caspar Radunz, Theresa Schneider, Jutta Schrezenmeier und Christiane Vogel. Kim Philip Linoh danken wir für sein fundiertes und umfängliches Kapitel zu rechtlichen Aspekten der Ethikberatungen.
Schließlich möchten wir dem Kohlhammer Verlag und hier insbesondere Anita Brutler und Ruprecht Poensgen für das Vertrauen danken, dass wir nach zwei erfolgreichen Auflagen des Buches »Klinische Ethikberatung« (Hrsg. Andrea Dörries, Gerald Neitzke, Alfred Simon, Jochen Vollmann) dieses Handbuch »Ethikberatung in der Patientenversorgung« verfassen durften.
Zur Einführung
Wenn Sie dieses Buch in der Hand halten (oder am Bildschirm lesen), haben Sie vielleicht gerade an einer Schulung zur Qualifizierung als Ethikberater*in teilgenommen oder sind Mitglied eines Klinischen Ethikkomitees und überlegen, wie die Ethikarbeit in ihrer Einrichtung am besten organisiert werden kann. Möglicherweise sind Sie aber auch mit dem Management einer Gesundheitseinrichtung betraut und interessieren sich für den professionellen Umgang mit ethischen Herausforderungen bei der Versorgung von Patient*innen in Ihrer Einrichtung. Vielleicht fragen Sie sich dabei auch, warum es nun ein weiteres Buch zum Thema gibt, wo doch bereits eine Vielzahl englischsprachiger und auch einige deutschsprachige Bücher zur Ethikberatung vorliegen.
Für unsere Entscheidung, ein »Handbuch für die Praxis« zum Thema Ethikberatung zu verfassen, waren vor allem drei Gründe maßgeblich. Zum ersten wurden wir in Fortbildungen, die wir in den letzten Jahren zur Qualifizierung von Ethikberater*innen durchgeführt haben, immer wieder nach ergänzenden Materialien »zum Nachlesen« gefragt. Diese Anfragen betrafen insbesondere konkrete Hinweise zur Moderation ethischer Fallbesprechungen und Fallbeispiele zum Vorgehen bei der ethischen Fallanalyse, aber auch praktische Aspekte der Implementierung oder Qualitätssicherung. Zum zweiten hat sich fünfzehn Jahre nach Erscheinen der zweiten Auflage des Buches »Klinische Ethikberatung« in diesem Verlag einiges im Feld verändert. Belege hierfür sind die methodische Ausdifferenzierung von Ethikfallberatung oder auch neue Organisationsformen und Arbeitsfelder der Ethikberatung. Ethikberatung geht heute weit über die klassische Trias von Fallberatungen, Fortbildungen und Erstellung ethischer Leitlinien hinaus. Dies ist notwendig, um bedarfsgerechte Angebote für die Praxis zu machen, gleichzeitig sind diese neueren Entwicklungen nach unserer Kenntnis bislang nicht gebündelt in einem Buch zu finden. Der dritte und vielleicht wichtigste Grund ist, dass es nach unserer Kenntnis keine deutschsprachige Publikation gibt, in der eine konkrete Methode der Ethikfallberatung – in diesem Fall die wesentlich von Georg Marckmann in Deutschland etablierte prinzipienorientierte ethische Falldiskussion – normativ begründet, detailliert dargestellt und auf typische Fallbeispiele angewendet wird.
Die Methode der Ethikfallberatung ist zentral. Die Ziele, die im Rahmen von Ethikfallberatungen erreicht werden können, hängen auch von der jeweils gewählten Methode ab. Weiterhin bestimmt die Wahl der Methode ganz wesentlich die erforderlichen Kompetenzen. Auch die Kriterien für eine angemessene Moderation, Dokumentation, Evaluation und Qualitätssicherung werden beeinflusst von der Methode der Ethikfallberatung. Vor diesem Hintergrund stellt dieses Buch neben generischen Aspekten der Ethik(fall)beratung eine Methode – und damit in Zusammenhang stehende praktisch relevante Aspekte der Ethikfallberatung – in detaillierter Form vor. Wir sind uns bewusst, dass in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, viele unterschiedliche Methoden zur Ethikfallberatung eingesetzt werden. Nur für einen Teil liegen allerdings detaillierte Beschreibungen der Methodik vor.
Wir möchten mit diesem Buch die bestehenden Wissenslücken zumindest in Bezug auf die Methode der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion schließen. Die Methode orientiert sich im Ablauf an der Struktur medizinischer Behandlungsentscheidungen und an den weithin zustimmungsfähigen Prinzipien biomedizinischer Ethik. Sie erfüllt damit auch wesentliche medizinisch-fachliche und medizinrechtliche Anforderungen an gute Entscheidungen in der Patientenversorgung. Verschiedene Elemente der Methode, wie bspw. die Analyse der Behandlungsoptionen mit ihrem weiteren Verlauf, die strukturierte Ermittlung des Patientenwillens oder die begründete Abwägung konfligierender ethischer Verpflichtungen können nach unserer Einschätzung auch auf andere Vorgehensweisen übertragen werden. Wir würden uns freuen, wenn die Darstellung generischer Inhalte zur Ethik(fall)beratung in Verbindung mit den detaillierten Ausführungen zu einer spezifischen Methode der Ethikfallberatung für eine breite Leser*innenschaft von Interesse ist.
Entsprechend der an uns herangetragenen Bedarfe soll das vorliegende Buch einen auf die Praxis der Ethik(fall)beratung ausgerichteten Einstieg in die Thematik bieten. Es kann als Ergänzung und zur Vertiefung von Fortbildungen dienen, die entsprechend den Zertifizierungsanforderungen für Ethikfallberatung von Seiten der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) an vielen Orten in Deutschland angeboten werden. Das Buch ist keine Einführung in die Medizin- bzw. Gesundheitsethik. Weiterhin werden keine medizinrechtlichen Grundlagen referiert, die für die verschiedenen Themen der Ethikberatung relevant sind. Leser*innen finden hierzu allerdings entsprechende Hinweise auf einschlägige Literatur.
Wir haben uns entschieden, Struktur und Inhalte des Buches an unsere Fortbildungen zur Ethikfallberatung und unsere Tätigkeit als klinische Ethiker an den Universitätskliniken Halle/Saale und LMU München anzulehnen. Die ein oder andere Wiederholung ist dabei unvermeidbar, da die einzelnen Kapitel auch unabhängig von den anderen Teilen des Buchs verständlich sein sollen.
Nach einem kurzen einführenden Kapitel zu Grundlagen, Entwicklungen und Zielen der Ethikberatung (▸ Kap. 1) bilden die Darstellung von unterschiedlichen Organisationsformen der Ethikberatung, praktischen Hilfestellungen zu Aufbau und Implementierung von Ethikkomitees sowie die verschiedenen Arbeitsfelder der Ethikberatung den Fokus von ▸ Kap. 2, ▸Kap. 3 und ▸Kap. 4. Neben etablierten Arbeitsfeldern, wie etwa Fortbildungen oder die Entwicklung ethischer Empfehlungen, werden auch neuere und an die Ethikfallberatung angrenzende Arbeitsfelder, wie bspw. das Advance Care Planning (ACP), vorgestellt. ▸ Kap. 5 und ▸Kap. 6 widmen sich der Ethikfallberatung. Nach einer Einführung und kurzen Übersicht über ausgewählte methodische Ansätze der Ethikfallberatung stellen wir die prinzipienorientierte Methode der ethischen Falldiskussion detailliert vor. Angesichts der auch in unserer eigenen Arbeit zunehmenden Aktivitäten von Ethikberatung bei Anfragen nach Assistenz bei der Selbsttötung widmen wir diesem Thema ▸ Kap. 7. Die weiteren Kapitel umfassen übergeordnete Themen der Ethikberatung: ▸ Kap. 8 befasst sich mit Qualifizierung und Kompetenzen von Ethikberater*innen, ▸ Kap. 9 mit dem zunehmend angefragten Bereich der Ethikberatung in außerklinischen Versorgungsbereichen. Ergänzend zu den auf die unmittelbare Patientenversorgung ausgerichteten Kapitel stellen wir in ▸ Kap. 10 die Bedeutung der Ethikberatung unter organisationsethischen Gesichtspunkten dar. ▸ Kap. 11 umfasst eine von Kim Philip Linoh ausgearbeitete ausführliche Darstellung rechtlicher Aspekte der Ethikberatung und ▸ Kap. 12 Ausführungen zu Zielen und Methoden der Evaluation und Qualitätssicherung. Den Abschluss des Handbuchs bildet in ▸ Kap. 13 eine Sammlung typischer Fallbeispiele, anhand derer wir Schritt für Schritt die Anwendung der prinzipienorientierten ethischen Falldiskussion darstellen.
Wir hoffen, dass dieses Buch die Umsetzung von Ethikberatung in den verschiedenen Organisationsformen und Arbeitsfeldern unterstützen kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Rückmeldungen zur Weiterentwicklung dieses Handbuchs für die Praxis der Ethikberatung.
Halle/Saale und München, im August 2025Jan Schildmann und Georg Marckmann
1 Grundlagen der Ethikberatung
Jan Schildmann
1.1 »Ethikberatung«: Ein Begriff, viele Bedeutungen
Der Begriff Ethikberatung wird nicht einheitlich und bisweilen auch etwas vage verwendet. Während manche den Begriff für fallbezogene Beratungen (»Ethikfallberatung«) in Gesundheitseinrichtungen verwenden, nutzen ihn andere für ein ganzes Spektrum an ethischen Unterstützungsangeboten, das auch Fortbildungen oder ethische Empfehlungen umfasst. Darüber hinaus wird der Begriff Ethikberatung für die Politikberatung zu ethisch relevanten Fragen verwendet. Eine Klärung der Begriffsverwendung in diesem Buch ist notwendig, da wir andernfalls nicht sinnvoll Ziele und Methoden von Ethikberatung oder auch praktische Fragen der Implementierung und Evaluation erörtern können.
Mit dem Begriff Ethikberatung beziehen wir uns in diesem Buch auf alle Aktivitäten zur Unterstützung der Versorgung von Patient*innen1 in Bezug auf ethische Aspekte. Wir fokussieren uns dabei auf ethische Beratungsangebote auf der Mikroebene der Gesundheitsversorgung (Interaktion zwischen Gesundheitspersonal und Patient*innen) bzw. auf der Mesoebene (Krankenhaus oder andere Gesundheitseinrichtung).
Unter Organisationsform der Ethikberatung verstehen wir diejenigen Strukturen, mit denen die verschiedenen Aktivitäten der Ethikberatung umgesetzt werden. Im deutschsprachigen Raum ist das Ethikkomitee die am häufigsten etablierte Organisationsform. Ein anderes Beispiel für eine Organisationsform der Ethikberatung sind Ethikberater*innen, die als Einzelpersonen ethische Entscheidungsunterstützung anbieten.
Mit den Arbeitsfeldern der Ethikberatung bezeichnen wir die unterschiedlichen Aktivitäten im Rahmen der Ethikberatung. In der Literatur werden als Arbeitsfelder häufig die Trias von Ethikfallberatung, Fortbildungen und Entwicklung ethischer Empfehlungen benannt (AEM 2022a). Zwischenzeitlich wurden allerdings zahlreiche weitere Arbeitsfelder der Ethikberatung erschlossen. Wir werden einige hiervon in ▸ Kap. 4 näher vorstellen.
Merke
Ethikberatung: Unterstützung bei der Suche nach ethisch gut begründeten Entscheidungen in der PatientenversorgungOrganisationsform der Ethikberatung: Strukturen, mit denen Ethikberatung umgesetzt wird; eine häufige Organisationsform ist das Ethikkomitee.Arbeitsfelder der Ethikberatung: Aktivitäten in verschiedenen Formaten und unter Anwendung unterschiedlicher Methoden der Ethikberatung; ein häufiges Arbeitsfeld sind Ethikfallberatungen.
1.2 Ziele von Ethikberatung: Mit welchen Themen sollte sich Ethikberatung (nicht) befassen?
Das Ziel der Ethikberatung, wie wir sie vorstehend definiert haben, ist die Unterstützung bei ethischen Fragen oder Herausforderungen in der Patientenversorgung2 durch eine strukturierte medizinische und ethische Analyse und Identifizierung ethisch begründeter Handlungsoptionen. Ethikberatung bietet bei korrekter Anwendung einer normativ fundierten Methode zuverlässig eine ethisch begründete Antwort auf die Frage, welche Vorgehensweise bei moralischer Unsicherheit zu bevorzugen ist. Dabei kann es bei schwierigen ethischen Entscheidungssituationen durchaus vorkommen, dass es nicht die eine zu bevorzugende Vorgehensweise gibt. Allerdings kommt dies nach unserer Erfahrung in der Praxis zum einen eher selten vor und zum anderen bietet selbst in diesen Fällen Ethikberatung den Mehrwert einer strukturierten Herausarbeitung der verschiedenen ethisch begründeten Vorgehensweisen. Trotz Unterschieden hinsichtlich ethisch-theoretischer Fundierung und methodischer Vorgehensweise können Gemeinsamkeiten der Ethikberatung festgehalten werden: Erstens sind alle ethisch relevanten Sachverhalte für die Beratung zu klären. Zweitens muss die Ethikberatung inhaltlich alle relevanten ethischen Werte und Normen berücksichtigen. Drittens muss die Beratung auch hinsichtlich des Prozedere, etwa mit Blick auf die Zusammensetzung der an der Beratung Beteiligten, ethisch begründet sein.
Die Ein- und Abgrenzung der Ethikberatung von anderen Aktivitäten in Gesundheitseinrichtungen ist in der Praxis bisweilen nicht ganz einfach. Es gibt Gesundheitseinrichtungen, in denen Ethikkomitees bspw. zur Beratung bei Konflikten zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen angerufen werden. Auch wenn Teamkonflikte auf unterschiedlichen ethischen Bewertungen beruhen können, kann Ethikberatung nur dort sinnvoll eingesetzt werden, wo ethische Fragestellungen im Mittelpunkt stehen, d. h. Fragen, die sich auf ethische Verpflichtungen der beteiligten Personen beziehen. Es ist nicht immer einfach, bei einer Anfrage nach Ethikberatung zu erkennen, ob hinter dem geschilderten Konflikt oder der erlebten Unsicherheit tatsächlich eine ethische Herausforderung steht. Bei bestehender Unklarheit sollte zumindest ausgeschlossen werden, dass es sich erkennbar und primär um ein »anderes Problem« handelt. Zu klären ist also: geht es bei einer Anfrage tatsächlich um die Begründung des »guten« oder »richtigen« Handeln im ethischen Sinne? Bisweilen sind ethische Fragestellungen auch hinter medizinischen Fachfragen »versteckt«. Ein typisches Beispiel hierfür sind Diskussionen im Team über die Indikation für die Durchführung diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen. Diese Diskussionen basieren häufig auf unterschiedlichen Bewertungen von Nutzen und Schaden bestimmter Maßnahmen und beziehen sich damit auf die beiden wichtigen ethischen Prinzipien Wohltun und Nichtschaden.
Wir werden in ▸ Kap. 5 auf konkrete Techniken und Methoden eingehen, die dabei helfen können, eine ethisch begründete Fragestellung von Anfragen an angrenzende Fachgebiete zu unterscheiden. Diese Klärung ist auch deshalb wichtig, damit Anfragen, die bspw. primär auf Unsicherheiten in Bezug auf psychische oder soziale Aspekte beruhen, zeitnah an die entsprechenden fachlichen Stellen weitergeleitet werden. Zudem sollten zwischenmenschliche Konflikte im Team primär durch eine (Team-)Supervision behandelt werden. Die multiprofessionelle Besetzung von Ethikkomitees kann helfen, zeitnah die geeignete Stelle zur Bearbeitung einer »nicht primär ethischen« Anfrage zu identifizieren.
Merke
Das Abgrenzungskriterium für den angemessenen Einsatz von Ethikberatung ist das Vorliegen von Fragen, Unsicherheiten oder Konflikten, die sich auf das »richtige« bzw. »gute« Handeln in der Patientenversorgung hinsichtlich ethischer Werte und Normen beziehen.
1.3 Eine kurze Geschichte der Ethikberatung
Die Entwicklung der Ethikberatung wird in der Literatur mit unterschiedlichen Akzenten nachgezeichnet (vgl. Bruns 2012, Frewer 2012). Während an dieser Stelle keine historische Aufarbeitung erfolgen soll, können wir festhalten, dass die ersten Gremien, in denen Aufgaben der Ethikberatung wahrgenommen wurden, bereits in den 1960er und den 1970er Jahren vorrangig in den USA gegründet wurden. Beispiele sind sogenannte »Kidney Dialysis Selection Committees« (Alexander 1962), »Optimum Care Committees« oder das Bioethics Committee am Montefiore Center in New York (Rothman 2003, zitiert nach Bruns 2012, Übersicht bei Tulsky & Fox 1996). Auf nationaler Ebene in den USA ist weiterhin die 1978 initiierte President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research zu nennen, die in der Folge für die Entwicklung der Ethikberatung relevante Stellungnahmen veröffentlichte (Hesters 2007).
Für das Entstehen und die Verbreitung von Ethikberatungsangeboten können inhaltliche Gründe sowie weitere Anforderungen angeführt werden. Als ein inhaltlicher Grund wird häufig der Bedarf an ethischer Reflexion angesichts neuer medizinischer Möglichkeiten und dadurch hervorgerufenen Unsicherheiten oder Konflikte benannt. Exemplarisch hierfür stehen die technologischen Entwicklungen im Bereich der intensivmedizinischen Versorgung, wie etwa die Intubation und künstliche Beatmung Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die dazu führten, dass Menschen, die zuvor gestorben wären, am Leben erhalten werden konnten. Mit diesen technologischen Veränderungen ergaben sich ethische Fragen in Bezug auf die Abwägung von Nutzen und Schaden der entsprechenden lebenserhaltenden Maßnahmen, die bis heute Gegenstand vieler Ethikfallberatungen (nicht nur) auf Intensivstationen sind. Als weiterer inhaltlicher Grund für die Entwicklung von Ethikberatung wird häufig der Wertepluralismus angeführt, der sich auch auf Fragen eines ethisch guten bzw. richtigen Handelns in der Patientenversorgung erstreckt. Unterschiedliche individuelle Werthaltungen bei Patient*innen, etwa in Bezug auf eine angemessene Gestaltung der Behandlung bei fortgeschrittenen Erkrankungen, können ethische Fragen aufwerfen. Gleiches gilt für unterschiedliche Werthaltungen von Mitgliedern im Behandlungsteam, die das professionelle Verhalten durchaus beeinflussen und nach unserer Erfahrung bisweilen für heftige Konflikte im Team sorgen können. Als dritter inhaltlicher Grund für das in den letzten Jahrzehnten gestiegene Interesse an Ethikberatung werden häufig historische Veränderungen im Verhältnis von Ärzt*innen und Patient*innen genannt. Die rechtliche Stärkung der Patientenautonomie gab und gibt bis zum heutigen Tage Anlass zur Ethikberatung. Beleg hierfür sind Anfragen nach Ethikfallberatungen in Situationen, in denen Patient*innen oder deren Stellvertreter*innen lebenserhaltende Maßnahmen ablehnen. Es ist davon auszugehen, dass die Stärkung der Autonomie von Bürger*innen in Bezug auf Entscheidungen über das eigene Leben, wie dies das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 in seinem Urteil zur Verfassungswidrigkeit des strafrechtlichen Verbotes der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (Bundesverfassungsgericht 2020) erneut betont hat, auch für die Ethikfallberatung zunehmend von Relevanz sein wird (siehe auch ▸ Kap. 7). Dies nicht zuletzt deshalb, weil im Unterschied zur rechtlichen Argumentation bei ethischen Analysen der Assistenz bei der Selbsttötung häufig auch am Wohlergehen der Patient*innen orientierte Argumente von Bedeutung sind.
Neben den vorstehend genannten inhaltlichen Gründen können weitere Faktoren identifiziert werden, die die Entwicklung von Ethikberatung befördert haben. Dies gilt insbesondere für Anforderungen an die Qualität der Versorgung von Patient*innen. So wurde in den USA die Einrichtung ethischer Unterstützungsangebote von der Rechtsprechung sowie von der bereits erwähnten US President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavorial Research (US President's Commission 1983) in Sinne der Förderung ethischer Qualität in der Gesundheitsversorgung befürwortet. Weiterhin empfahl die mit der Akkreditierung US-amerikanischer Gesundheitseinrichtungen betraute Joint Commission on Accredition of Health Care Organizations (JCAHO) bereits in den 1990er Jahren Angebote zur angemessenen Bearbeitung ethischer Konflikte in der Patientenversorgung (Schyve 1996, Hesters 2007).
Entwicklung der Ethikberatung in Deutschland
Die 1997 in einer gemeinsamen Erklärung der beiden großen konfessionellen Krankenhausverbände (Deutscher Evangelischer Krankenhausverband und Katholischer Krankenhausverband 1997) empfohlene Einrichtung Klinischer Ethikkomitees wird häufig als erster wichtiger überregionaler Impuls für die Entwicklung der Ethikberatung in Deutschland benannt. Das Thema Ethikberatung war an einzelnen Orten in Deutschland allerdings schon deutlich früher präsent. Ein Beleg hierfür ist etwa das bereits 1987 veröffentlichte Heft Nr. 4 der Medizinethischen Materialien des Bochumer Zentrums für Medizinische Ethik mit dem Titel »Ethische Expertise und Ethische Komitees in der Medizin« (Sass 1989, 2. Auflage). Etwa fünf Jahre nach der gemeinsamen Erklärung der beiden konfessionellen Krankenhausverbände wurde im Rahmen der freiwilligen Zertifizierung nach KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) ein Anreiz für die Einrichtung von Ethikstrukturen gesetzt. Analog zu Zertifizierungsvorgaben in den USA wird die Einrichtung von Ethikkomitees oder vergleichbaren Strukturen seitdem bei der Zertifizierung positiv berücksichtigt. 2006 forderte die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer (ZEKO) in einer Stellungnahme Krankenhäuser und andere Institutionen zur Versorgung von Kranken und der Pflege bedürftigen Menschen in Deutschland zur Implementierung von Strukturen zur Ethikberatung auf (ZEKO 2006). Diese Stellungnahme der ZEKO wurde 2020 um Empfehlungen zur außerklinischen Ethikberatung ergänzt (ZEKO 2020). Die Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) veröffentlichte erstmals 2010 und erneut 2023 Standards zur Methodik und Umsetzung von Ethikberatung (AEM 2023). Diese Dokumente werden durch weitere Veröffentlichungen zur Ethikberatung von Seiten der AEM ergänzt. Neben einem Curriculum zur Fortbildung von Ethikberater*innen (AEM 2022a) wurden unter anderem Empfehlungen zur Dokumentation (AEM 2011) und Evaluation veröffentlicht (AEM 2013).3 Im Unterschied zur forschungsethischen Beratung bei Studien zur Prüfung von Arzneimitteln oder Medizinprodukten ist die Ethikberatung in der Patientenversorgung in Deutschland rechtlich nicht eigens geregelt (vgl. auch ▸ Kap. 11). Eine Ausnahme bildet das Bundesland Hessen. In § 6 des dortigen Krankenhausgesetzes ist seit 2011, erstmals und bis heute als einziges Bundesland, rechtlich verpflichtend geregelt, dass in hessischen Krankenhäusern eine Ethikbeauftragte*r bestellt werden muss (Hessisches Krankenhausgesetz 2011).
Empirische Untersuchungen zeigen, dass in den vergangenen Jahrzehnten ein Anstieg an Strukturen für die Durchführung von Ethikberatung in Deutschland zu verzeichnen ist. So verfügten laut einer im Jahr 2005 durchgeführten Umfrage 312 Institutionen des Gesundheitswesens in Deutschland über Angebote zur Ethikberatung (Dörries & Hespe-Jungesblut 2007). Einer 2014 durchgeführten nationalen Erhebung zufolge hatte 912 Krankenhäuser in Deutschland eine Organisationsform der Ethikberatung implementiert (Schochow et al. 2019). Für den Bereich der psychiatrischen Akutkrankenhäuser und Maßregelvollzugskliniken wurden 2019 Zahlen zur Häufigkeit von Ethikberatungsstrukturen publiziert. Demnach halten 92 % der an der Studie teilnehmenden psychiatrischen Akutkrankenhäuser und 29 % der Maßregelvollzugskliniken Strukturen zur Ethikberatung vor (Gather et al. 2019).
Merke
Für die Verbreitung von Ethikberatung können als inhaltliche Gründe erstens ethische Herausforderungen im Kontext neuer (technologischer) Entwicklungen in der Medizin, zweitens Wertepluralismus sowie drittens die zunehmende Bedeutung der Patientenautonomie genannt werden. Darüber hinaus befördern Einflussfaktoren wie Vorgaben bei der Zertifizierung von Gesundheitseinrichtungen die Entwicklung von Ethikberatungsstrukturen.
1.4 Aktuelle Entwicklungen (in) der Ethikberatung
Ethikkomitees in Krankenhäusern, die Angebote zur Fallberatung, Fortbildung und Entwicklung ethischer Empfehlungen machen, dominierten lange das Bild von Ethikberatung. Die Ausweitung von Ethikberatung auf den außerklinischen Bereich, etwa im ambulanten Sektor, ist eine der in den letzten Jahren zu beobachtenden Neuerungen. Bereits 2008 wurde auf dem 111. Deutschen Ärztetag darauf hingewiesen, dass Angebote der Ethikberatung auch für den ambulanten Bereich von Bedeutung sind. Die Zunahme medizinischer Maßnahmen, für die ein stationärer Aufenthalt nicht oder nur noch kurzfristig erforderlich ist, erhöht die Komplexität der Versorgung im außerklinischen Setting. In diesem Kontext entstehen neben bekannten ethischen Fragestellungen der Versorgung, wie etwa zur Begrenzung der Ernährung via PEG-Sonde, auch neue ethisch relevante Themen. Ein Beispiel sind ethische Herausforderungen bei der Durchführung bzw. Begrenzung außerklinischer Beatmung. Ethikberatung außerhalb einer Klinik ist organisatorisch mit einigen Besonderheiten verbunden. Als Mitglieder einer Arbeitsgruppe der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer durften wir an einer Stellungnahme zu diesem Thema mitwirken (ZEKO 2020) und werden uns dem Thema in ▸ Kap. 9 detaillierter zuwenden.4
Die Diversifizierung von Angeboten der Ethikberatung kann als zweite neuere Entwicklung benannt werden. Allein das Angebot der Ethikfallberatung hat in den letzten Jahren allerdings eine Ausdifferenzierung erfahren. So werden fallbezogene Beratungen teils proaktiv angeboten, etwa in Form von vorab festgelegten Visiten auf den Intensivstationen oder im Rahmen der in der Palliativmedizin etablierten Fallbesprechungen. Ein Treiber für neue Beratungsangebote war die COVID-19-Pandemie. Vertreter*innen der Ethikberatung sahen sich mit neuen Themen, wie etwa der ethisch begründeten Priorisierung von Impfstoffen für die Mitarbeitenden einer Einrichtung, konfrontiert. Die Etablierung von Angeboten zur Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen (engl. Advance Care Planning, ACP) im Kontext von Ethikberatungsstrukturen ist eine weitere Neuerung. Obgleich ACP keine Form der Ethikberatung, wie sie von uns eingangs definiert wurde, darstellt, kann ACP die Ethikberatung unterstützen – vor allem angesichts der häufig bestehenden Unsicherheit hinsichtlich des Willens von Patient*innen bei der Ethikfallberatung. In ▸ Kap. 4 werden wir etablierte und neuere Arbeitsfelder der Ethikfallberatung und angrenzender Angebote vorstellen.5
Als dritte neuere Entwicklung in Bezug auf die Ethikfallberatung sei das verstärkte Augenmerk auf Qualifizierung, Evaluation und Qualitätssicherung der verschiedenen Angebote erwähnt. Die Durchführung einer Ethikfallberatung kann die Versorgung von Patient*innen in weitreichender Weise beeinflussen. Auch vor diesem Hintergrund sollte gefordert werden, dass für Ethikberatung die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität nachgewiesen werden kann. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die etablierten Qualitätsparameter aus Medizin und Gesundheitsforschung nur teilweise auf die Ethikberatung übertragen werden können. Wir werden in ▸ Kap. 12 sowohl methodische Herausforderungen als auch pragmatische Handlungsstrategien zur Evaluation von Ethikfallberatungsangeboten erörtern. Weiterhin werden wir uns in ▸ Kap. 8 mit Aspekten der Qualifizierung als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Ethikfallberatung befassen.
Ergänzend zu den vorstehenden strukturellen und prozessualen Veränderungen werden aktuell auch neue Inhalte Bestandteil der Arbeit mancher Ethikkomitees in Deutschland. Ein Hintergrund ist das bereits zitierte Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020, das die Rechtmäßigkeit auch der geschäftsmäßigen Assistenz bei der Selbsttötung unter der Voraussetzung einer freiverantwortlichen Entscheidung festschreibt. Dieses Urteil hat bereits jetzt erkennbare Auswirkungen auf die Praxis der Ethikberatung. So haben einzelne klinische Ethikkomitees bereits an der Entwicklung von Handlungsempfehlungen zum angemessenen Umgang mit Anfragen nach assistierter Selbsttötung mitgewirkt (Universitätsklinikum Bonn 2023). Aufgrund internationaler Entwicklungen ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Anfragen in Deutschland erheblich zunehmen wird. In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen zur Expertise und Funktion von Ethikberatungsstrukturen, die wir in ▸ Kap. 7 erörtern werden.
Merke
Neuere Entwicklungen der Ethikberatung betreffen insbesondere die Umsetzung außerklinischer Ethikberatungsangebote, bspw. im ambulanten Setting, die Ausdifferenzierung von Arbeitsfeldern der Ethikfallberatung sowie Initiativen zur Qualitätssicherung und Evaluation.
1.5 (Wie) wirkt Ethik(fall)beratung?
Der Mangel an Evidenz für die Effektivität von Ethikberatung ist schon seit längerer Zeit Gegenstand der Diskussion (Strätling & Sedemund-Adib 2013, Wiesemann 2013). Ein 2019 veröffentlichtes Cochrane Review zur Wirksamkeit von Ethikfallberatung zeigt, dass auf der Grundlage der berücksichtigten Studien keine verlässlichen Aussagen über die Wirkung von Ethikfallberatungen gemacht werden können (Schildmann et al. 2019).
Dies scheint zunächst prominent zitierten Studien, wie etwa der bereits 2003 im Journal of the American Medical Association publizierten multizentrisch randomisiert kontrollierten Studie von Schneiderman et al. (2003) zu widersprechen. Die Autor*innen konnten damals unter anderem zeigen, dass nach Ethikfallberatung weniger intensivmedizinische Maßnahmen vor dem Tod durchgeführt wurden als in der Kontrollgruppe, in der keine Ethikfallberatung proaktiv angeboten wurde. Dieses Ergebnis wurde insofern positiv gewertet, als weniger intensivmedizinische Maßnahmen mit weniger Belastungen für die Patient*innen und auch weniger Kosten verbunden waren.
Der vermeintliche Widerspruch zwischen dem Ergebnis der systematischen Übersichtsarbeit und der vorstehenden Studie löst sich auf, wenn die methodischen Anforderungen einer solchen Metaanalyse und damit verbundenen Einschränkungen etwa beim Einschluss von Studien reflektiert werden. Für eine solide Aussage über die Wirksamkeit von Ethikfallberatung sind mehrere vergleichbare und methodisch hochwertige Studien erforderlich. Weiterhin muss auch klar definiert werden, was im Rahmen einer Ethikfallberatung passiert. Sowohl das Cochrane Review als auch begleitende Forschung zeigen, dass diesbezüglich erhebliche Defizite bestehen. Dies betrifft zunächst den Mangel an methodisch hochwertigen Studien. So wird die »Intervention Ethikfallberatung« in vielen Studien nur vage beschrieben. Damit bleibt häufig unklar, wie Ethikfallberatung wirkt bzw. wirken soll. Die Unterschiede in der Praxis der Ethikfallberatung beziehen sich nicht nur auf strukturelle und prozedurale Aspekte, sondern teilweise auch auf die ethisch-normativen Prämissen der Ethikfallberatung und die davon abgeleitete Zielsetzung. Dabei macht es auch für die Bewertung der Wirksamkeit einer Ethikfallberatung selbstverständlich einen großen Unterschied, ob bspw. primär ein Konsens hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten oder eine ethisch begründete Entscheidung entsprechend einer spezifischen Methode angestrebt werden soll (Haltaufderheide et al. 2022).
Zu bedenken ist schließlich, dass die Wirksamkeit im Sinne der Ergebnisqualität ein wichtiger, aber nicht der einzige Maßstab für die Bewertung der Qualität von Ethikfallberatung ist. Wir werden auf die Bedeutung von Struktur- und Prozessqualität als weitere wichtige Parameter für die Qualität von Ethik(fall)beratung in ▸ Kap. 12 zur Evaluation und Qualitätssicherung eingehen. Darüber hinaus spielt die Qualifizierung sowie die Prüfung von Kompetenzen für die Qualität der Ethikfallberatung eine große Rolle. Dies werden wir in ▸ Kap. 8 thematisieren.
Merke
Die Bewertung der Wirksamkeit von Ethikfallberatung erfordert methodisch hochwertige Studien. Herausforderungen bei der Evidenzgenerierung betreffen unter anderem die genaue Beschreibung der Interventionen, der möglichen Wirkweise sowie die Auswahl geeigneter Evaluationskriterien.
Endnoten
1Sofern nicht explizit vermerkt, sind immer alle Geschlechter gemeint; so bezieht sich bspw. »die Patient*in« trotz des aus Gründen der Lesbarkeit verwendeten Pronomens »die« nicht nur auf das weibliche Geschlecht, sondern auf alle Geschlechter.
2Insbesondere die Ethikberatung im außerklinischen Kontext bezieht sich nicht immer auf »Patient*innen« im engeren Sinn, sondern bspw. auch auf ethische Konflikte, die im Kontext der Betreuung von Bewohner*innen in Pflegeeinrichtungen bestehen. Zur Vereinfachung und mit Blick auf die große Mehrheit von Anlässen für Ethikberatung verwenden wir in diesem Buch den Begriff der Patientenversorgung.
3Die Standards und Empfehlungen der AEM finden Sie online unter https://aem-online.de/standards-und-empfehlungen-fuer-ethikberatung/.
4Informationen zur außerklinischen Ethikberatung von Seiten der Akademie für Ethik (AEM) finden Sie unter https://aem-online.de/ausserklinische-ethikberatung/.
5Einen Überblick über die verschiedenen Angebote von Ethikberatung einschließlich Beispielen für Leitlinien, Falldarstellungen sowie Kontaktdaten von Einrichtungen mit ethischen Unterstützungsangeboten finden Sie unter der Website www.ethikkomitee.de. Stellungnahmen und weitere Dokumente der Akademie für Ethik (AEM) sind unter https://aem-online.de/standards-und-empfehlungen-fuer-ethikberatung/ zu finden.
2 Organisationsformen der Ethikberatung
Jan Schildmann
Ethikberatung kann in unterschiedlichen Strukturen oder, wie eingangs definiert, Organisationsformen umgesetzt werden. Bei der Wahl der jeweiligen Organisationsform ist einerseits darauf zu achten, dass diese für die avisierten Zielsetzungen funktional ist. So eignet sich bspw. ein monatlich tagendes Ethikkomitee gut für die Diskussion übergeordneter ethisch relevanter Themen an der jeweiligen Einrichtung. Dagegen erfordert die Durchführung prospektiver Ethikfallberatungen im Sinne der Unterstützung bei ethischen Anfragen in der laufenden Versorgung eine flexiblere Organisationsform. Andererseits muss bei der Wahl der Organisationsform bedacht werden, dass diese unterschiedlichen Anforderungen an Qualifikation sowie Personal- und Zeitaufwand stellen. Wenn bspw. ein Ethikkomitee eine Arbeitsgruppe einsetzt, die flexibel an einem Krankenhaus Ethikfallberatung durchführen soll, muss vorab geklärt werden, ob hierfür ausreichend qualifizierte Ethikberater*innen verfügbar sind, die die zeitlichen Ressourcen haben, um diese Aufgabe zu übernehmen.
In diesem Kapitel werden wir drei Organisationsformen – Ethikkomitees, Ethikberater*innen und integrierte Modelle – kurz beschreiben und unter Berücksichtigung von Zielsetzung, Arbeitsweise und Funktionen abgrenzen. Im Unterschied zu anderen Darstellungen geht es uns dabei nicht um unterschiedliche Modelle der Ethik(fall)beratung (vgl. z. B. Neitzke in Dörries et al. 2010), sondern um unterschiedliche Strukturen, mithilfe derer die verschiedenen Arbeitsfelder der Ethikberatung in Gesundheitseinrichtungen umgesetzt werden können. Uns ist dabei bewusst, dass sich die Bezeichnungen für die verschiedenen Organisationsformen unterscheiden. Weiterhin existieren in der Praxis eine Vielzahl von Varianten bzw. Kombinationen von Organisationsformen. Die Darstellung in diesem Kapitel fokussiert sich auf Organisationsformen in Kliniken. Wir werden auf Besonderheiten der Organisationsformen von Ethikberatung im außerklinischen Kontext in ▸ Kap. 9 eingehen.
2.1 Ethikkomitees
Das Ethikkomitee ist im deutschsprachigen Raum und nach unserer Kenntnis auch in vielen anderen Ländern die häufigste Organisationsform der Ethikberatung (Schochow et al. 2019). Die Struktur und Arbeitsweise von Ethikkomitees sind häufig in einer Satzung festgelegt (ein Muster als Orientierung für die Formulierung einer Satzung finden Sie im Kap. »Zusatzmaterial zum Download«). Diese umfasst auch die Festlegung bestimmter Rollen, wie bspw. die einer Geschäftsführung und des Vorstandes des Ethikkomitees mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten. Die Arbeitsweise von Ethikkomitees ist charakterisiert durch regelmäßige, vorab terminierte Sitzungen, in denen eine zuvor festgelegte Tagesordnung behandelt wird. Ethikkomitees bilden häufig Arbeitsgruppen für spezifische Arbeitsfelder, wie bspw. die Durchführung von Ethikfallberatungen.
Zielsetzungen, Arbeitsweise und Funktionen: Ethikkomitees verfolgen in der Regel die übergreifende Zielsetzung, die Ethikarbeit an einer Gesundheitseinrichtung zu organisieren. Insbesondere bieten sie die Möglichkeit, das breite Spektrum ethisch relevanter Fragen, die sich bei der Versorgung der Patient*innen oder Bewohner*innen stellen, mit Mitarbeitenden unterschiedlicher Berufsgruppen zu erörtern und gut begründete Handlungsoptionen zum Umgang mit diesen Fragen zu entwickeln. Die Aufgaben sind vielfältig und umfassen konkrete inhaltliche Themenstellungen, wie bspw. die Entwicklung einer Handreichung zum Umgang bei Anfragen nach späten Schwangerschaftsabbrüchen oder auch strukturelle Maßnahmen, wie bspw. die Einrichtung eines oder mehrerer Räume für Gläubige unterschiedlicher Religionen.
Nach unseren Erfahrungen variieren die Arbeitsschwerpunkte und Arbeitsweisen einzelner Ethikkomitees in der Praxis erheblich. Als ein gemeinsamer Nenner kann der Austausch von Informationen zu klinisch-ethischen Fragestellungen über die verschiedenen Berufsgruppen an einer Einrichtung hinweg ausgemacht werden. Eine zweite Funktion der meisten Ethikkomitees ist die Abstimmung bezüglich übergeordneter Entscheidungen. Beispiele hierfür sind die Konsentierung von ethischen Empfehlungen oder auch die Festlegung von Themen von Veranstaltungen des Ethikkomitees. Die Mitglieder von Ethikkomitees können darüber hinaus als wichtige Multiplikator*innen für die Weiterleitung ethischer Themen in ihre Bereiche dienen. Der Informationsfluss läuft im besten Fall auch in die andere Richtung, sodass ein ethisches Thema, das sich bspw. auf einer Station ergibt, in das Ethikkomitee eingebracht wird.
Die Arbeitsweise von Ethikkomitees unterscheidet sich. Während manche Ethikkomitees in ihren Sitzungen inhaltlich an konkreten Aufgabenstellungen arbeiten oder Fälle diskutieren, empfiehlt es sich aus unserer Sicht, wenn Ethikkomitees konkrete (und zeitaufwendige) detaillierte Arbeiten an Arbeitsgruppen delegieren, die dann bspw. Arbeitsentwürfe erstellen und zur Diskussion an das Ethikkomitee »zurückspielen«. Die Gestaltung der Arbeitsweise muss sich aber letztlich an den Möglichkeiten einer Gesundheitseinrichtung orientieren. Dies hat auch Auswirkungen auf die Häufigkeit der Treffen (und damit auch auf den Zeitaufwand für die Mitglieder von Ethikkomitees). So trifft sich das gesamte Ethikkomitee am Universitätsklinikum Halle/Saale bspw. regulär zweimal pro Jahr. Ergänzend gibt es mehrere Arbeitsgruppen, die je nach Thematik längerfristig (z. B. Durchführung von Ethikfallberatungen) oder auch kurzfristig (z. B. Erstellung einer ethischen Empfehlung) arbeiten. Diese Arbeitsgruppen stehen sowohl Mitgliedern des Ethikkomitees als auch weiteren interessierten Mitarbeitenden offen. Andere Ethikkomitees treffen sich häufiger, bspw. einmal monatlich, und besprechen dann die Themen überwiegend im Gesamtkomitee. Häufigere Treffen des Ethikkomitees können vor allem in der Anfangsphase nach Implementierung sinnvoll sein, damit die Mitglieder sich hinsichtlich Aufgaben und Arbeitsweise besser abstimmen und einen gemeinsamen Arbeitsstil entwickeln können. Die Häufigkeit der Sitzungen kann dann im weiteren Verlauf reduziert und inhaltliche Arbeit zunehmend durch sich dann häufiger treffende Arbeitsgruppen unterstützt werden.
Wie im vorstehenden Abschnitt skizziert, sind beim Aufbau und bei der Etablierung von Ethikkomitees eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen, um Organisationsform und Arbeitsfelder gut aufeinander abzustimmen. Wir werden diese Entscheidungen sowie konkrete Arbeitsschritte bei der Etablierung eines Ethikkomitees in ▸ Kap. 3 ausführlich darstellen.
2.2 Ethikberater*innen
Ethikberater*innen sind als Einzelpersonen oder im Team in einer Gesundheitseinrichtung tätig. Ihre Aufgaben unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Verortung in der jeweiligen Einrichtung. Während einige von ihnen zentral für die gesamte Gesundheitseinrichtung zuständig sind, sind andere dezentral für einen bestimmten Bereich der Einrichtung, etwa eine Klinik oder den Bereich der Verwaltung, tätig. In einigen Einrichtungen gibt es auch Kombinationen beider »Typen« von Ethikberater*innen.
2.2.1 Zentral verortete Ethikberater*innen
In einigen Einrichtungen werden eine oder mehrere Einzelpersonen ernannt, um die Ethikberatung zentral zu koordinieren bzw. unterschiedliche Arbeitsfelder der Ethikberatung, wie bspw. die Ethikfallberatung, umzusetzen.6 Wesentliches Strukturmerkmal dieser Organisationsform ist die Etablierung einer oder mehrerer Ansprechpersonen für ethische Belange in der gesamten Einrichtung. Zentral verortete Ethikberater*innen verfügen zumeist über eine Qualifikation in Medizin, Pflege und weiteren Gesundheitsberufen oder in philosophischen, juristischen oder theologischen Studiengängen. Hinzu kommt häufig ein Aufbaustudiengang in Medizin- bzw. Gesundheitsethik sowie eine Zertifizierung als Koordinator*in (K2) oder auch als Trainer*in für Ethikberatung im Gesundheitswesen (K3) entsprechend den Vorgaben der AEM.7
Zielsetzungen, Arbeitsweise und Funktionen
Die Ziele und Arbeitsweise zentraler Ethikberater*innen hängen einerseits von den Vereinbarungen mit der Einrichtung und andererseits von den individuellen Arbeitsschwerpunkten ab. Ergänzend zu den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Ethikberatung – bspw. Ethikfallberatung oder Durchführung von Fortbildungen – besteht auch die Möglichkeit, ergänzende Organisationsformen zu gründen, wie bspw. ein Ethikkomitee mit unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Dies ist insofern sinnvoll, als sich mit einer Unterstützung von Mitgliedern eines Ethikkomitees eine bessere Durchdringung in der Einrichtung erreichen lässt. Weiterhin bietet diese Vorgehensweise den Vorteil, dass unterschiedliche fachliche Kenntnisse sowie professionsethische Perspektiven in die Ethikberatung eingebracht werden können. Wichtig ist bei einer Kombination von Organisationsformen eine klare Festlegung von Zuständigkeiten.
2.2.2 Dezentrale Ethikberater*innen und Liaison-Strukturen
Dezentrale Ethikberater*innen werden, wie vorstehend skizziert, häufig in Kombination mit einer zentralen Organisationsform – also einem Ethikkomitee und/oder einer zentralen Ethikberater*in – benannt. So werden bspw. am LMU Klinikum in München in den einzelnen Kliniken Ethikbeauftragte benannt, die sowohl für das Ethikkomitee als auch für die Mitarbeitenden vor Ort Ansprechpersonen für ethische Themen sind. Nach dem Tübinger Modell der »Ethikbeauftragten der Station« stehen speziell geschulte Pflegekräfte auf allen Stationen des Universitätsklinikums Tübingen als Ansprechpersonen für ethische Fragen zur Verfügung und erweitern damit die etablierten Top-down-Strukturen der Ethikberatung (Ranisch et al. 2021). Das wesentliche Strukturmerkmal ist die Etablierung von ethisch interessierten und qualifizierten Ansprechpersonen in unterschiedlichen Bereichen einer Gesundheitseinrichtung. Dies können bspw. Pflegende oder Ärzt*innen in den unterschiedlichen klinischen Abteilungen oder Angehörige anderer Berufsgruppen in der Verwaltung einer Gesundheitseinrichtung sein.
Sind Ethikberater*innen fest in das jeweilige Behandlungsteam integriert, spricht man auch von Liaison-Strukturen, Ethik-Liaisondienst oder Liaison-Angeboten8, weil die ethischen Beratungsangebote eine enge Verbindung zwischen den Teams vor Ort und der von der ethischen Entscheidungsstützung durch die eingebundene Ethikberater*in vorsehen (Richter 2016b). Im Rahmen des Ethik-Liaisondienstes nehmen die Ethikberater*innen meist nicht nur regelmäßig an den Visiten teil, sondern stehen darüber hinaus auch für das jeweilige klinische Team als Unterstützung in schwierigen ethischen Entscheidungssituationen zur Verfügung. Die Qualifikation dezentraler Ethikberater*innen variiert. Insbesondere dann, wenn vor Ort ethische Falldiskussionen moderiert werden sollen, empfiehlt sich die Zertifizierung entsprechend der K1-Stufe nach den Vorgaben der AEM als Mindeststandard.
Zielsetzungen, Arbeitsweise und Funktionen
Dezentrale Ethikberater*innen können als wichtige Multiplikator*innen für die Arbeit, die in zentralen Ethikstrukturen geleistet wird, fungieren. So können sie Themen oder Arbeitsergebnisse aus dem Ethikkomitee, wie bspw. die Inhalte einer neuen Ethik-Empfehlung, auf den Stationen bekannt machen. Dezentrale Ethikberater*innen können weiterhin auf Veranstaltungen des Ethikkomitees hinweisen, wie etwa den Ethiktag oder Fortbildungen. Die Mittlerrolle dezentraler Ethikberater*innen kann auch dazu dienen, Themen aus den verschiedenen Bereichen einer Gesundheitseinrichtung an das Ethikkomitee oder eine andere zentrale Ethikstruktur heranzutragen. Ein Beispiel aus der eigenen Praxis ist die Erörterung technischer Möglichkeiten zur Dokumentation von vorausverfügten Entscheidungen hinsichtlich Wiederbelebung auf den Intensivstationen im Ethikkomitee. Der Impuls hierfür kam von Teilnehmenden an einer K1-Schulung zur Ethikfallberatung im Universitätsklinikum Halle. Das geplante Prozedere inklusive Abstimmung mit den zuständigen IT-Beauftragten wurde im Ethikkomitee erörtert, an die mit der Thematik bereits befassten Mitarbeitenden wieder zurückgegeben und von diesen dann umgesetzt. Weiterhin können dezentrale Ethikberater*innen Fälle für die Ethikberatung identifizieren. Sofern eine entsprechende Qualifizierung vorhanden ist und eine externe Ethikfallberatung nicht erforderlich scheint, bietet die dezentrale Organisationsform auch eine Möglichkeit ethische Falldiskussionen intern und ohne externe Moderation durchzuführen.
2.3 Integrierte Modelle
In einigen Einrichtungen wurden integrierte Modelle der Ethikberatung entwickelt. Darunter verstehen wir Ethikberatungsangebote in einer Einrichtung, die verschiedene Organisationsformen abgestimmt verbinden. Grundgedanke ist eine bestmögliche Passung zwischen unterschiedlichen Bedarfen an ethischer Unterstützung in der Praxis sowie den Beiträgen, die Ethikberatung in unterschiedlichen Organisationsformen leisten kann. Ein im deutschsprachigen Raum bekanntes integriertes Modell ist das in Basel entwickelte METAP-Modell (Albisser Schleger et al. 2014). Das Akronym steht für Module, Ethik, Therapieentscheide, Allokation und Prozess und umfasst ein mehrstufiges Angebot, innerhalb dessen ethische Fragestellungen in der Patientenversorgung entlang eines »Eskalationsmodells« bearbeitet werden. Infobox 1 fasst die Stufen des Modells nach Albisser Schleger et al. (2014) zusammen.
Infobox 1: Stufen des Eskalationsmodells METAP nach Albisser Schleger et al. (2014)*
Stufe 1: Unterstützung von Kolleg*innen vor Ort, bspw. auf Station, bei der Bearbeitung eines ethischen Problems mithilfe von ethischen Empfehlungen oder anderen Materialien, die von einem Ethikkomitee oder Mitarbeitenden einer anderen Ethikstruktur erstellt werden
Stufe 2: Erörterung des ethischen Problems mit den benannten und zu diesem Zweck befähigten Mitarbeitenden der Einrichtung
Stufe 3: Hilfestellungen zur strukturierten Durchführung einer ethischen Fallbesprechung auf Station unter Leitung der dezentralen Ethikberater*innen
Stufe 4: bei Bedarf Unterstützung durch zentrale Ethikstruktur, bspw. dem Ethikkomitee oder zentral verorteten Ethikberater*innen
* In Abhängigkeit von der Anfrage an die Ethikfallberatung kann auf Stufe 1 oder auch gleich auf einer höheren Stufe begonnen werden.





























