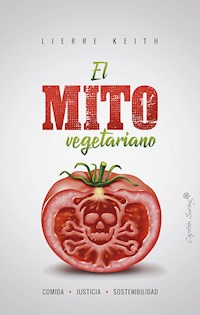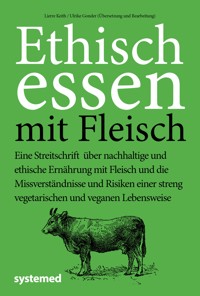
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ethisch essen mit Fleisch Der Mythos Vegetarismus kritisch beleuchtet. Mit verantwortungsbewussten Tipps für ein nachhaltiges Leben – mit Fleischgenuss Das sorgt für Zündstoff: Eine ehemalige Veganerin plädiert für Gerechtigkeit, Mitgefühl, Weltverbesserung – und tierische Lebensmittel! Lierre Keith weiß, wovon sie spricht: Sie war selbst 20 Jahre Veganerin, erkrankte ernährungsbedingt und isst heute wieder Fleisch, Milch und Eier. Dennoch bekennt sie sich zu einer gerechten Verteilung der Ressourcen, wendet sich gegen Agrarfabriken und tierquälerische Haltungsformen. Allerdings räumt sie zugleich schonungslos mit den Mythen des Vegetarismus auf. Nicht zerstörerisch, doch kämpferisch und mit dem Ziel, einen nachhaltigen Vorwärtskurs aufzuzeigen. Hierbei setzt sie sich mit den Irrtümern, Missverständnissen und Risiken der vegetarischen Ernährung auseinander. Alles fundiert und ausführlich mit vielen medizinischen, politischen und ökologischen Fakten untermauert. Lierre Keith plädiert für eine verantwortungsbewusste, nachhaltige und dabei ethisch korrekte Ernährung und spricht sich genau aus diesen Gründen gegen den (strengen) Vegetarismus aus. Ein engagiertes Buch, das Befürwortern wie Gegnern zu denken gibt. • Eine glaubhafte und engagierte Auseinandersetzung mit der Weltanschauung »Ernährung«. • Die Risiken einer streng vegetarischen Ernährung fundiert dargelegt. • Gerecht und nachhaltig essen – eine Positionsbestimmung über moralisch, politisch und gesundheitlich motivierte Vegetarier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lierre Keith / Ulrike Gonder (Übersetzung und Bearbeitung)
Ethisch essen
mit Fleisch
Lierre Keith / Ulrike Gonder (Übersetzung und Bearbeitung)
Ethisch essen
mit Fleisch
Eine Streitschrift über nachhaltige und ethische Ernährung mit Fleisch und die Missverständnisse und Risiken einer streng vegetarischen und veganen Lebensweise
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2022
© 2021 by systemed im by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Originalausgabe: The Vegetarian Myth, © 2009 Lierre Keith, ursprünglich erschienen bei PM Press, Oakland, CA 94623, USA, www.pmpress.org.
© 2013–2015 systemed Verlag, Lünen
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
[ ] Eckige Klammern im Text kennzeichnen Anmerkungen, Auslassungen oder Ergänzungen der Bearbeiterin, die dem besseren Verständnis und der Anpassung an die Gegebenheiten in Deutschland dienen sollen.
Redaktion: systemed Verlag, Lünen
Redaktionsleitung: Ulrike Gonder
Übersetzung und deutsche Bearbeitung: Ulrike Gonder
Umschlaggestaltung: Catharina Aydemir
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/Morphat Creation
Satz: A flock of sheep, Lübeck; Andreas Linnemann, München
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95814-335-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95814-336-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95814-337-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Annemarie Monahan,eines meiner Lieblingstiere, undzum Gedenken an Terry Lotz
Inhalt
Vorwort
Warum dieses Buch?
Moralische Vegetarier
Politische Vegetarier
Gesundheit lich motivierte Vegetarier
Die Welt retten
Anhang
Quellen
Anmerkungen
Literatur
Die Autorin
Die Übersetzerin
[ ] Eckige Klammern im Text kennzeichnen Anmerkungen, Auslassungen oder Ergänzungen der Bearbeiterin, die dem besseren Verständnis und der Anpassung an die Gegebenheiten in Deutschland dienen sollen.
»Die Wahrheit ist auch, dass das Leben ohne den Tod nicht möglich ist, dass, egal, was du isst, jemand sterben musste, um dich zu ernähren.«
— Lierre Keith
Vorwort
Ernährung neu denken
Diese Streitschrift ist keine Abrechnung mit dem Vegetarismus, dies ist eine Aufrechnung unserer Ernährungskultur. Was unter dem Strich steht, ist negativ. Dabei ist es fast egal, ob es unter dem Segel vegetarischer Kost daher kommt, unter dem Logo der Steakhäuser oder dem Banner der Fast-Food-Ketten. Es ist das Grundprinzip der industriellen Land- und Ernährungswirtschaft, das uns und unseren Planeten zugrunde richtet. Das ist die Botschaft dieses Buches und sie wird vielen nicht schmecken, weder den Pflanzenköstlern noch den Fleischessern und erst recht nicht den Produzenten und Verarbeitern in unserer industriellen Nahrungskette. Sie alle hören hinweg über die Warnrufe: dass unsere Art von Landwirtschaft und Ernährung die Grundlagen unserer Existenz zerstört, das Klima aufheizt, den Boden vernichtet, die Fruchtbarkeit verzehrt, die Wasservorräte vergeudet, die Vielfalt der Schöpfung ausradiert. Und dies mit einem gewaltigen Einsatz an Öl, Gas und Strom. Die industrielle Kette verschlingt zehn Kalorien, um eine Nahrungskalorie zu erzeugen. Auch der künstliche Dünger, der Treibstoff des Hightech-Agrarsystems, geht seinem Ende entgegen, weil die Vorräte nicht wieder aufgefüllt werden können.
Bei Licht besehen haben wir die Sicherheit unserer Ernährung einem System anvertraut, das geradewegs in den Abgrund fährt. Ein Selbstmordkommando, das seinen Kurs mit lauteren Motiven schmückt: eine Welt ohne Hunger, bezahlbare Lebensmittel, Gesundheit, globale Ernährungssicherheit. Ein Blick in die Statistik zeigt, was von diesen Versprechen zu halten ist: nichts. Weder der Hunger noch die Mangelernährung, weder die Gesundheit noch die Ernährungssicherheit haben sich unter der Regie des industriellen Systems verbessert, das Gegenteil ist der Fall. Seit der ersten Welternährungskrise 2008 wissen wir, der Hunger kehrt zurück, die Zahl der Mangelkranken steigt, die Überernährten erdrücken die Gesundheitssysteme. Die Preise auf den Weltmärkten fahren seit 2008 Achterbahn. Extremwetter, Dürren und Überschwemmungen in den Kornkammern der Welt stellen Ernte um Ernte infrage. Und das, was geerntet wird, landet zusehends in den Raffinerien von Agrosprit-Konzernen, in den Biogasanlagen der Energiewirtschaft oder auf dem Müll.
Die Vorratslager und Notreserven für Getreide sind schon seit Jahren so gut wie leer gefegt. Diese Unsicherheit und die zunehmende Knappheit treiben die Preise und laden ein zur großen Spekulation. Die globale Finanzindustrie und ihre Fonds setzen bei Nahrungsmitteln und Boden auf steigende Gewinne im zweistelligen Bereich. Und sie kauft Millionen von Bauern den Acker unter dem Pflug weg, ohne Rücksicht auf die Kollateralschäden Armut, Vertreibung, Hunger und Elend. Dies vor allem in Ländern des Südens, in denen ein Großteil der Menschen hungert, in denen korrupte Regierungen und Gerichte das Schicksal ihrer Bevölkerung mit Stiefeln treten.
Das System, mit dem wir heute die Welt ernähren, hat abgewirtschaftet: Totalschaden, irreparabel. Wenn es schon nicht in der Lage ist, die sieben Milliarden Menschen heute satt zu machen, wie soll es dann in Zukunft neun oder gar zwölf Milliarden Menschen ernähren?
Wir dürfen nicht auf den GAU, den Foodcrash warten, mir müssen unsere Ernährungswirtschaft neu denken und zwar jetzt, mahnt uns Lierre Keith, sonst verpassen wir den Ausstieg und den Einstieg in eine bessere Ernährungswelt. Lierre Keith kondensiert die Fakten, aus denen sich nur eins ableitet: die Forderung nach einem Systemwechsel. Und damit steht sie nicht allein.
Die gute Nachricht ist: Die Zivilgesellschaft weltweit, allen voran in den Geburtsländern der industriellen Landwirtschaft in Europa und den USA, beginnt bereits umzudenken. Sie erfindet ihre Ernährung neu. Nicht mit einem alternativen Technoset, mehr Chemie, mehr Energie, mehr Computern und ausgefeilteren Maschinen, sondern mit sozialer Intelligenz. Vielfältige Netzwerke entstehen zwischen Berlin und Boston, New York und New Delhi. Eine neue globale Foodbewegung gewinnt seit wenigen Jahren Form und Farbe und breitet sich mit wachsender Geschwindigkeit aus. Gemeinschaftsgärten sprießen aus dem Boden, wachsen auf den Dächern der Großstädte. Neue Konsumgenossenschaften schließen sich zwischen Acker und Teller zusammen. Kleinaktionäre investieren statt in alte Industrien in Äcker und Weiden, Hühner und Enten, Schweine und Rinder und in ihre Kulturlandschaft. Bürger finanzieren ihren Bauern Höfe und deren Ernten voraus. Bauernmärkte übernehmen die lokale Nahrungssicherheit. Selbstversorger nehmen sich der Nahrungskette an und sorgen dafür, dass die Müllströme zwischen Acker und Teller versiegen. Dies sind keine Einzelphänomene, eher Wetterleuchten, eine konzertierte Aktion. Die Zivilgesellschaft ahnt, dass sich der Wind drehen wird und muss. Sie bereitet sich vor auf ein neues Zeitalter der Welternährung. Der neue Plot für die alte Geschichte von immer vollen Schüsseln und Tellern ist schon in Umlauf. Er heißt: Selbstversorger. Es geht um lokale Kreisläufe, regionale Ökonomie, Vertrauen in unsere Lebensmittel, Sicherheit, Bodenhaftung und Nähe zu den Wurzeln unserer Existenz. Es geht um blühende Landschaften, gesunde Menschen und eine intakte Natur. Es geht Lierre Keith um eine neue Vision für unser Essen.
Mit dieser Streitschrift über die Ethik des Essens, ob nun mit oder ohne Fleisch, bringt sie uns dieser Vision ein Stück näher.
Dr. Wilfried Bommert
Institut für Welternährung – World Food Institute e. V., Berlin www.institut-fuer-welternaehrung.org
Dr. Wilfried Bommert, im Bergischen Land nahe Köln geboren (Jahrgang 1950), studierte Agrarwissenschaften an der Universität Bonn. 1977 wurde er dort promoviert und arbeitet seit 1979 als Fachjournalist beim Westdeutschen Rundfunk. Als Leiter der ersten Umweltredaktion im WDR-Hörfunk beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit den Themen Welternährung und Weltbevölkerung.
Zurzeit widmet er sich dem Aufbau eines »Instituts für Welternährung« in Berlin, das als gemeinnütziges Institut durch Analysen, Konzepte und öffentliche Kommunikation einen Beitrag zur Sicherung der Welternährung leisten soll. Für sein Engagement erkannte ihm die Kluge Stiftung der Universität zu Köln den »Human Award 2012« zu.
»Ich frage nicht, wie viele Menschen können ernährt werden? Ich stelle eine andere Frage: Wie kann man die Menschen ernähren? Nicht: Was ernährt die meisten Menschen? Sondern: Was ernährt die Menschen nachhaltig? Wir brauchen eine Gesamtbilanz.«
— Lierre Keith
Kapitel 3
Warum dieses Buch?
Dieses Buch zu schreiben war nicht leicht. Für viele von Ihnen wird es keine leichte Lektüre sein. Ich weiß es. Fast 22 Jahre lang war ich Veganerin. Ich kenne die Gründe, die mich überzeugten, eine extreme Ernährungsform zu praktizieren, und sie sind ehrbar, ja sogar nobel. Es sind Gründe wie Gerechtigkeit, Mitgefühl, ein verzweifeltes und alles umfassendes Verlangen, die Welt zu verbessern, den Planeten zu retten – die letzten Bäume, Zeugen ganzer Zeitalter, letzte Flecken von Wildnis, die noch ein paar aussterbende, stille Arten in ihren Pelzen und Federkleidern ernähren. Die Bedrohten, die ohne Stimme sind, zu schützen. Die Hungrigen zu nähren. Zumindest jedoch: nicht teilzunehmen am Horror der Agrarfabriken.
Diese politischen Überzeugungen entspringen einem so tiefen Verlangen, dass es an Spiritualität grenzt. Sie waren es für mich und sie sind es noch. Mein Leben soll ein Schlachtruf sein, ein Kriegsschauplatz, ein Pfeil, gezielt und abgeschossen ins Herz der Dominanzsysteme: Patriarchat, Imperialismus, Industrialisierung, jedes System der Stärke und des Sadismus. Wenn diese martialischen Bilder Sie irritieren, kann ich es auch anders formulieren. Ich möchte, dass mein Leben – mein Körper – ein Ort ist, wo die Erde gesegnet wird, wo die Sadisten keinen Platz finden und die Gewalt aufhört. Und ich möchte, dass Essen – das nährende Prinzip – ein erhaltender und kein tötender Akt ist.
Dieses Buch wurde geschrieben, um diese Passionen, diesen Hunger weiterzugeben. Es dient nicht dem Versuch, das Konzept der Tierrechte zu verspotten oder jene zu verhöhnen, die eine freundlichere Welt wollen. Nein, dieses Buch ist bestrebt, unser tiefstes Verlangen nach einer gerechten Welt zu würdigen. Dieses Verlangen – nach Mitgefühl, Nachhaltigkeit und gerechter Verteilung der Ressourcen – wird jedoch durch die Philosophie und die Praxis des Vegetarismus nicht erfüllt. Wir sind in die Irre geführt worden. Die vegetarischen »Rattenfänger« haben die besten Absichten. Ich verkünde gleich hier, was ich später wiederholen werde: Alles, was sie über Agrarfabriken und Massentierhaltung sagen, ist wahr. Es ist grausam, verschwenderisch und zerstörerisch. An keiner Stelle in diesem Buch sollen die Praktiken der industriellen Nahrungserzeugung auf irgendeiner Ebene entschuldigt oder unterstützt werden.
Der erste Fehler [der Vegetarier] ist, anzunehmen, dass die Massentierhaltung – eine kaum 52 Jahre alte Methode – die einzige Möglichkeit darstellt, Tiere zu halten. Ihre Kalkulationen zum Energieverbrauch, zum Kalorieneinsatz, zu den hungernden Menschen basieren alle auf der Idee, dass Tiere Getreide essen.
Man kann Getreide an Tiere verfüttern, aber es ist nicht die Nahrung, für die sie geschaffen sind. Es existierte gar kein Getreide, bevor die Menschen vor höchstens 12.002 Jahren einjährige Gräser domestizierten. Auerochsen, die wilden Vorfahren des domestizierten Rindes, gab es schon zwei Millionen Jahre früher. Während des größten Teils der menschlichen Geschichte gab es zwischen grasenden Weidetieren und dem Menschen keine [Nahrungs-]Konkurrenz. Sie aßen, was wir nicht essen konnten – Zellulose – und wandelten sie in für uns Essbares um – in Eiweiß und Fett. Getreide erhöht das Wachstum von Fleischrindern (das ist der Grund für den Ausdruck »maisgemästet«) und die Leistung von Milchkühen dramatisch. [Im Übermaß] bringt es sie außerdem um. Das empfindliche bakterielle Gleichgewicht im Pansen einer Kuh übersäuert und kippt. Hühner bekommen eine Fettleber, wenn sie ausschließlich mit Getreide gefüttert werden; sie brauchen gar kein Getreide um zu überleben. Schafe und Ziegen, ebenfalls Wiederkäuer, sollten das Zeug eigentlich gar nicht anrühren.
Dieses Missverständnis entsteht aus Ignoranz, einer Ignoranz, die sich kreuz und quer durch den Mythos Vegetarismus zieht: über die Prinzipien der Landwirtschaft bis hin zur Natur des Lebens. Wir sind städtische Industrialisten, und wir kennen die Ursprünge unserer Lebensmittel nicht. Das gilt auch für Vegetarier, obwohl sie behaupten, die Wahrheit zu kennen. Es galt auch für mich, 22 Jahre lang. Jeder, der Fleisch aß, war ein Verweigerer; nur ich kannte die Fakten. Sicher, die meisten Menschen, die Fleisch aus Agrarfabriken konsumieren, haben nie gefragt, wer da starb und wie. Aber ehrlich gesagt tun das auch die meisten Vegetarier nicht.
Die Wahrheit ist, dass die Landwirtschaft das Zerstörendste ist, was die Menschheit dem Planeten angetan hat, und mehr Landwirtschaft wird uns nicht retten. Die Wahrheit ist, dass die Landwirtschaft die komplette Zerstörung ganzer Ökosysteme erfordert. Die Wahrheit ist auch, dass das Leben ohne den Tod nicht möglich ist, dass, egal, was Du isst, jemand sterben musste, um Dich zu ernähren.
Ich will eine Gesamtbilanz, die weit über das hinausgeht, was da Totes auf Deinem Teller liegt. Ich frage nach allem, was während des Prozesses starb, nach allem, was getötet wurde, damit dieses Essen auf Deinem Teller landet. Das ist die radikalere Frage, und es ist die einzige Frage, die die Wahrheit ans Licht bringen wird. Wie viele Flüsse wurden mit Dämmen versehen und drainiert, wie viele Prärien umgepflügt und Wälder gerodet, wie viel Mutterboden wurde zu Staub und vom Wind verweht? Ich möchte es von allen Spezies wissen – nicht nur von den Individuen, sondern von ganzen Arten – den Königslachsen, den Bisons, den Heuschreckenammern, den Wölfen. Und ich will mehr als nur die Zahl der Toten und Vergangenen. Ich will sie zurück.
Entgegen dem, was Euch erzählt wurde und trotz aller Ernsthaftigkeit der Erzähler, werden sie durch das Essen von Sojabohnen nicht zurückgebracht. 100 Prozent der amerikanischen Prärie sind verschwunden, verwandelt in eine Monokultur aus einjährigem Getreide. Die Kultur des Pflügens hat in Kanada 101 Prozent des ursprünglichen Mutterbodens zerstört.3 Tatsache ist, dass das Verschwinden der Ackerkrume »mit der globalen Erwärmung als Umweltrisiko konkurriert«.4 Wenn die Regenwälder für Rindfleisch fallen, sind die progressiven Zeitgenossen sich dessen bewusst, sie sind erzürnt und bereit zum Boykott. Unsere Verbundenheit mit dem Vegetariermythos bereitet uns jedoch Unbehagen, wir halten still und bleiben schlussendlich untätig, wenn der Schuldige der Weizen und das Opfer die Prärie ist. Wir halten an dem Glaubenssatz fest, Vegetarismus sei der Weg zur Erlösung, für uns und für den Planeten. Wie könnte er ebenfalls zerstörerisch sein?
Wir müssen uns der Antwort stellen. Im Schatten unserer Ignoranz und Verweigerung lauert eine Abrechnung mit der Zivilisation an sich. Am Anfang mag unser Essen stehen, aber am Ende geht es um die gesamte Lebensweise, um das weltweite Arrangement der Kräfte und um eine nicht unbeträchtliche persönliche Bindung dazu. Ich erinnere mich an den Tag in der vierten Klasse, als Frau Fox zwei Worte an die Tafel schrieb: Zivilisation und Landwirtschaft. Ich erinnere mich, weil ihre Stimme gedämpft und ihre Worte bedeutungsvoll waren und weil die Erklärung dazu fast eine große Rede war. Das war wichtig. Und ich verstand. Alles Gute der menschlichen Kultur hatte hier seinen Ursprung: alle Erleichterung, alle Gnade, alle Gerechtigkeit – Religion, Wissenschaft, Medizin und Kunst wurden geboren und der endlose Kampf gegen Hunger, Krankheit und Gewalt konnte gewonnen werden, nur weil die Menschen herausfanden, wie sie ihr Essen selbst anbauen können.
Die Realität ist, dass die Landwirtschaft zu einem Nettoverlust an Menschenrechten und Kultur geführt hat: zu Sklaverei, Imperialismus, Militarismus, Klassengesellschaften, chronischem Hunger und Krankheiten. »Das eigentliche Problem ist also nicht zu erklären, warum manche die Landwirtschaft so zögerlich einführten, sondern warum überhaupt jemand damit anfing, wenn sie so offensichtlich garstig ist«, schreibt Colin Tudge von der London School of Economics.5 Die Landwirtschaft war zudem zerstörerisch für die anderen Geschöpfe, mit denen wir die Erde teilen, und schließlich auch für die lebenserhaltenden Systeme des Planeten selbst. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn wir eine nachhaltige Welt wollen, müssen wir die Kräftebeziehungen hinter dem grundlegenden Mythos unserer Kultur untersuchen wollen. Tun wir das nicht, werden wir scheitern.
Das Hinterfragen auf dieser Stufe ist für viele Menschen schwierig. Denn der emotionale Widerstand gegen jede Art von Vorherrschaft wird dadurch erschwert, dass wir von unserer Zivilisation abhängig und als Individuen nicht in der Lage sind, sie zu beenden. Die meisten von uns hätten keine Chance zu überleben, wenn die industrielle Infrastruktur morgen zusammenbrechen würde. Und auch unsere Machtlosigkeit beeinträchtigt unser Bewusstsein. Es gibt keine 12-Punkte-Liste im letzten Kapitel, weil es ehrlich gesagt keine zehn einfachen Dinge gibt, um die Erde zu retten. Es gibt keine persönliche Lösung. Es gibt ein verschachteltes Netz hierarchischer Arrangements, riesige Machtgefüge, die hinterfragt und aufgedeckt werden müssen. Wir können darüber streiten, wie das am besten geschehen kann, aber wenn die Erde eine Überlebenschance haben soll, dann müssen wir es tun.
Am Ende wird alle innere Stärke der Welt nichts nützen ohne Informationen darüber, wie man einen nachhaltigen Vorwärtskurs einschlägt, sowohl persönlich als auch politisch. Eines meiner Ziele in diesem Buch ist es, diese Informationen bereitzustellen. Die große Mehrheit der Menschen in den Vereinigten Staaten baut keine Lebensmittel an, schon gar nicht jagt und sammelt sie.6 Wir haben keine Möglichkeit zu beurteilen, wie viel Tod in einer Portion Salat, in einer Schüssel Obst oder in einem Teller Rindfleisch steckt. Wir leben in städtischer Umgebung, wo Wälder nur noch eine Ahnung sind, Tausende Meilen entfernt von den verwüsteten Flüssen, Prärien, Sumpflandschaften und den Millionen von Kreaturen, die für unsere Abendessen starben. Wir wissen noch nicht einmal, welche Fragen wir stellen müssen, um es herauszufinden.
In seinem Buch Long Life, Honey in The Heart [etwa: Langes Leben, Honig im Herzen] schreibt Martin Prechtel über die Maya und ihr Konzept des kas-limaal, das man in etwa mit »gegenseitige Verpflichtung oder wechselseitige Impulse« übersetzen könnte.7 Einer der Älteren erklärte Prechtel: »Das Wissen, dass jedes Tier, jede Pflanze, jede Person, der Wind und die Jahreszeiten den Früchten von allem anderen verpflichtet sind, ist Erwachsenenwissen. Aus dieser Schuld ausbrechen zu wollen bedeutet, nicht mehr Teil des Lebens zu sein, nicht erwachsen werden zu wollen.«
Der einzige Weg aus dem Mythos Vegetarismus ist kas-limaal, das Wissen der Erwachsenen. Wir brauchen solch ein Konzept, vor allem die, die sich leidenschaftlich über Ungerechtigkeit aufregen. Ich weiß, dass ich es brauche. In der Geschichte meines Lebens markiert der erste Bissen Fleisch nach meiner 22-jährigen Abstinenz das Ende meiner Jugend, den Moment, in dem ich die Verantwortlichkeiten des Erwachsenseins annahm. Es war der Moment, in dem ich aufhörte, mich gegen die Grundregel der physischen Existenz zu stellen: Für den, der lebt, muss ein anderer sterben. Diese Akzeptanz, wie leidvoll und bedauerlich sie sein mag, ermöglicht einen anderen, einen besseren Weg.
Engagierte Bauern haben einen ganz anderen Plan als die polemischen Schreiber, um uns von der Zerstörung zur Nachhaltigkeit zu führen. Die Landwirte starten mit ganz anderen Informationen. Ich habe von Vegetarieraktivisten Aussagen gehört, dass ein Acre [6 m4] Land nur zwei Hühner ernähren kann. Joel Salatin, einer der Hohepriester nachhaltiger Landwirtschaft und einer, der tatsächlich Hühner hält, nennt eine Zahl von 252 für diese Fläche.8 Wem glaubt man? Wie viele von uns wissen überhaupt genug, um eine Meinung haben zu können? Francis Moore Lappé sagt, dass man 14 bis 18 Pounds [7 bis 9 Kilo] Getreide benötigt, um [circa] ein halbes Kilo Rindfleisch zu erzeugen.9 Inzwischen zieht Salatin Rinder ohne jegliches Getreide auf, indem er die Wiederkäuer abwechselnd auf mehrjährigen Mischkulturen weiden lässt und so Jahr für Jahr Mutterboden bildet. Die Bewohner städtischer Industriekulturen haben keinerlei Berührungspunkte mit Getreide, Hühnern, Kühen oder mit Humus. Wir haben keine Erfahrungen, um die Argumente der politischen Vegetarier widerlegen zu können. Wir haben keine Ahnung davon, was und wie viel Pflanzen, Tiere oder der Boden essen. Was bedeutet, dass wir auch keine Ahnung davon haben, was wir selbst essen.
Als ich 18 war, wurde die Begegnung mit der Wahrheit über die industrielle Landwirtschaft – ihr quälerischer Umgang mit den Tieren und ihre Belastung der Umwelt – für mich ein ungemein wichtiger Moment. Ich wusste, die Erde würde sterben. Es war der tägliche Notfall, gegen den ich für immer ankämpfen würde. Ich bin 1.966 geboren. »Stiller« und »Frühling« waren untrennbar: [vier] Silben, nicht zwei Worte. In den Ölraffinerien im Norden New Jerseys, im Asphaltinferno der ausgedehnten Vororte, in der anschwellenden Flut von Menschen, die den Planeten ertränkte, zeigte sich die Hölle. […]
Außer Bobby, unserem Hamster, waren Eichhörnchen die einzigen Tiere, denen ich je näher kam. Mein Bruder, sehr maskulin sozialisiert, quälte weiterhin Insekten und zielte mit der Steinschleuder auf Spatzen. Ich wurde zur Veganerin.
Ja, ich war ein äußerst sensibles Kind. Mein Lieblingslied mit fünf […] war Mary Hopkins Those were the days. Welche romantische, tragische Vergangenheit hätte ich als Fünfjährige wohl beklagen können? Aber es war so traurig, so besonders; ich hörte das Lied wieder und wieder, bis ich ganz erschöpft vom Weinen war.
Das mag lustig sein. Doch über meine Hilflosigkeit, mit der ich zusehen musste, wie mein Planet zerstört wird, kann ich nicht lachen. Das war real und es übermannte mich. Die politischen Vegetarier boten hier eine überzeugende Lösung. Bar jeden Verständnisses für das Wesen der Landwirtschaft, der Natur und letztlich des Lebens konnte ich nicht wissen, dass ihr Rezept, so ehrbar ihre Beweggründe sein mochten, eine Sackgasse war, die zur selben Zerstörung führte, für deren Beendigung ich entbrannt war.
Diese Impulse und diese Unwissenheit sind Bestandteil des Mythos Vegetarismus. Zwei Jahre nach meiner Rückkehr zum Fleischkonsum war ich noch überzeugt, die veganen Nachrichtenportale im Internet lesen zu müssen. Ich weiß nicht, warum. Ich suchte keinen Streit. Ich postete nie selbst etwas. Viele kleine, intensive Subkulturen besitzen kultähnliche Elemente, da ist der Vegetarismus keine Ausnahme. Möglich, dass diese Abhängigkeit mit meiner eigenen spirituellen, politischen und persönlichen Verunsicherung zu tun hatte. Möglich, dass ich mir noch einmal den »Unfallort« ansah: Hier hatte ich meinen Körper zerstört. Vielleicht hatte ich Fragen und wollte sehen, ob meine Antworten neben jenen Bestand hatten, an denen ich einst festgehalten hatte. Antworten, die ich einmal für richtig hielt und die ich jetzt als leer empfand. Warum das so ist, weiß ich vielleicht nicht einmal. Es machte mich jedes Mal ängstlich, wütend und verzweifelt.
Eine Notiz brachte dann den Umschwung. Ein Veganer verbreitete seine Idee, wie man Tiere davor bewahren könne, getötet zu werden – nicht von Menschen, sondern von anderen Tieren. Jemand sollte einen Zaun mitten durch die Serengeti bauen und die Raubtiere von ihrer Beute trennen. Töten ist falsch, und keine Tiere sollten jemals mehr sterben müssen, daher würden die großen Katzen und die wilden Hundeartigen auf der einen und die Gnus und die Zebras auf der anderen Seite leben. Er wusste, dass die Fleischfresser zurechtkommen würden, denn sie müssten ja keine Fleischfresser sein. Das war eine Lüge der Fleischindustrie. Er hatte seinen Hund Gras essen sehen: Also können Hunde von Gras leben.
Niemand widersprach. Andere stimmten sogar zu. Meine Katze frisst auch Gras, fügte eine Frau ganz enthusiastisch hinzu. Meine auch! postete jemand anderes. Alle waren sich einig, Einzäunen sei die Lösung gegen das Tiersterben.
Beachten Sie bitte, dass der Ort für dieses Befreiungsprojekt in Afrika lag. Niemand erwähnte die nordamerikanische Prärie, wo Fleischfresser und Wiederkäuer gleichermaßen von eben jenen einjährigen Gräsern verdrängt wurden, die die Vegetarier propagieren. Aber darauf werde ich in Kapitel 5 zurückkommen. […]
Fleischfresser können nicht von Zellulose leben. Sie mögen gelegentlich Gras essen, aber sie nutzen es medizinisch, meist als Brechmittel oder um ihren Verdauungstrakt von Parasiten zu befreien. Andererseits sind Wiederkäuer von der Evolution fürs Grasfressen geschaffen. Sie haben einen Pansen […], den ersten einer Serie mehrerer Mägen, der als Gärbottich dient. Was im Inneren einer Kuh oder eines Gnus eigentlich vorgeht, ist, dass [Pansen-]Bakterien das Gras und die Tiere die Bakterien essen.
Weder Löwen und Hyänen noch Menschen haben das Verdauungssystem eines Wiederkäuers. Von den Zähnen bis hin zum Enddarm sind wir buchstäblich für Fleisch konstruiert. Wir haben kein Werkzeug, um Zellulose zu verdauen. Folglich wird jedes Tier auf der Fleischfresserseite des Zauns verhungern. Manche werden länger leben als andere und sie werden ihre letzten Tage als Kannibalen beenden. Die Aasfresser werden ein Festmahl haben, aber wenn alle Knochen abgenagt sind, werden sie ebenfalls verhungern. Der Friedhof ist damit aber nicht geschlossen, denn ohne die weidenden Grasfresser wird das Land zur Wüste werden.
Warum? Weil es ohne die Weidetiere, die praktisch das Spielfeld frei halten, dazu kommen wird, dass die mehrjährigen Pflanzen reifen und die Wachstumszonen der Gräser überschatten. In einem empfindlichen Umfeld wie der Serengeti kommt es meist aufgrund physikalischer (Unwetter) und chemischer (oxidativer) Einflüsse zum Untergang, weniger durch bakterielle oder biologische wie in feuchter Umgebung. Faktisch übernehmen hier die Wiederkäuer die meisten biologischen Aufgaben eines fruchtbaren Bodens, indem sie die Zellulose verdauen und die Nährstoffe, sobald sie wieder verfügbar sind, in Form von Urin und Kot zurückgeben.
Ohne Wiederkäuer werden die Pflanzen wuchern, das Wachstum wird zurückgehen und sie werden absterben. Dann ist die blanke Erde Wind, Sonne und Regen ausgesetzt, die Mineralien werden ausgeschwemmt und die Bodenstruktur wird zerstört. In unserem Versuch, die Tiere zu retten, hätten wir alles zerstört.
Auf der Wiederkäuerseite des Zauns werden sich die Gnus und ihre Freunde so erfolgreich wie immer vermehren. Ohne die Kontrolle durch Raubtiere wird es bald mehr Grasfresser als Gras geben. Die Tiere werden ihre Nahrungsgrundlage überstrapazieren, sie werden die Pflanzen bis auf den Boden abfressen und dann, eine stark zerstörte Landschaft hinterlassend, verhungern. Die Erkenntnis hieraus ist offensichtlich […]: Wir müssen genauso sehr gefressen werden, wie wir essen müssen. Die Weidetiere brauchen ihre tägliche Zellulose, aber das Gras braucht auch die Tiere. Es braucht ihre Ausscheidungen mit Stickstoff, Mineralien und Bakterien; es braucht die mechanische Belastung durch das Grasen; und es braucht die Ressourcen, die in den Tierkörpern lagern und von den Zersetzern freigesetzt werden, wenn die Tiere gestorben sind. Das Gras und die Grasfresser brauchen einander ebenso wie Jäger und Beute. Deren Beziehungen sind keine Einbahnstraßen, kein Arrangement von Dominanz und Unterordnung. Wir beuten einander nicht aus, indem wir essen. Wir erweisen uns einen Dienst.
Dies war mein letzter Ausflug auf eine vegane Internetseite. Ich erkannte, dass diese Leute so wenig über die Natur des Lebens wissen, über seine mineralischen Kreisläufe und den Austausch des Kohlenstoffs, über die entscheidenden Stellen im uralten Kreislauf von Erzeugern, Konsumenten und Zersetzern, dass ich mich nicht mehr an ihnen orientieren konnte, ja, dass ich hier keine sinnvollen Entscheidungen über eine nachhaltige menschliche Kultur treffen konnte. Indem sie sich vom Erwachsenenwissen abwenden, dem Wissen, dass die Ernährung jeder Kreatur, von den Bakterien bis zu den Grizzlybären, den Tod beinhaltet, wären sie niemals in der Lage, meinen emotionalen und spirituellen Hunger zu stillen, den ich schmerzlich im Inneren verspürte, seit ich dieses Wissen akzeptiert hatte. Vielleicht ist dieses Buch schlussendlich ein Versuch, diesen Schmerz auf eigene Faust zu lindern.
Ich hatte weitere Gründe, dieses Buch zu schreiben. Einer ist Überdruss. Ich hatte die ewig gleichen Diskussionen satt, insbesondere, wenn es keine leichten Diskussionen waren. Vegetarier können ihr Programm in kleine niedliche Häppchen zusammenfassen – Fleisch ist Mord – und in augenscheinlichen Lösungen, wie jene verlockende mit den sieben Kilogramm Getreide [die der Mensch ja selbst essen könnte …]. Da muss ich ganz von vorne beginnen, bei den ersten Proteinen, die sich selbst zu Lebendigem organisierten, weiter zu Photosynthese, Pflanzen, Tieren, Bakterien, Mutterboden und schließlich zur Landwirtschaft. Ich nenne solche Gespräche »Mikroben, Mist und Monokulturen«, und brauche eine gute halbe Stunde für die Hintergründe, die letztlich eine Grundlektion über die Natur des Lebens sind. Diese Informationen – materiell, emotional und spirituell – sollten wir bereits mit vier Jahren bekommen haben. Aber wer kann sie uns noch lehren? […]
Es ist nicht nur die Menge an Informationen, die diese Diskussion so schwierig macht. Oft wollen die Zuhörer sie gar nicht wissen, und der Widerstand kann extrem sein. »Vegetarier« bezeichnet nicht nur, was Du isst oder gar was Du glaubst. Es zeigt wer Du bist, es umfasst die ganze Identität. Indem ich ein umfassenderes Bild der Nahrungsmittelpolitik präsentiere, stelle ich nicht nur eine Philosophie oder ein paar Ernährungsgewohnheiten infrage. Ich bedrohe das Selbstverständnis der Vegetarier. Die meisten von Euch werden mit Abwehr und Wut reagieren. Ich bekam schon Hassmails, kaum dass ich dieses Buch begonnen hatte. Danke nein, mehr davon brauche ich nicht.
Ich schreibe dieses Buch aber auch als abschreckendes Beispiel. Eine vegetarische Kost – vor allem eine fettarme Version und insbesondere die vegane – ist keine ausreichende Nahrung, um den menschlichen Körper langfristig zu erhalten und zu reparieren. Um es frei heraus zu sagen: Sie wird Ihnen schaden. Ich weiß es. Zwei Jahre nachdem ich Veganerin wurde, ging es gesundheitlich bergab und zwar fürchterlich. Ich bekam eine degenerative Gelenkerkrankung, die für den Rest meines Lebens bleibt. Sie begann in jenem Frühling als fremdartiger, dumpfer Schmerz, an einer tiefen Stelle, von der ich gar nicht wusste, dass man dort etwas empfinden kann. Am Ende des Sommers fühlte es sich wie Granatsplitter in meiner Wirbelsäule an.
Es folgten Jahre mit immer schlimmeren Schmerzen und zunehmend frustrierenden Besuchen bei Spezialisten. Es dauerte 17 Jahre, bis ich anstelle eines Schulterklopfens eine Diagnose bekam. Die Wirbelsäule löst sich bei Teenagern nicht einfach so in Wohlgefallen auf, und so dachte trotz meiner perfekten Beschreibung der Symptome keiner der Ärzte an eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung. Jetzt, wo ich Bilder habe, werde ich respektiert. Meine Wirbelsäule sieht wie nach einem Unfall beim Fallschirmspringen aus. Ernährungsmäßig ist so etwas Ähnliches auch passiert.
Nach sechs veganen Wochen machte ich meine erste Erfahrung mit Unterzuckerung. Allerdings mussten 20 Jahre vergehen, in denen sie mein Leben prägte, bis ich wusste, dass man es so nennt. Nach drei [veganen] Monaten hörte ich auf zu menstruieren, was mir hätte zeigen können, dass es keine so gute Idee war. Etwa damals begann auch die Erschöpfung; sie wurde immer schlimmer, zusammen mit der allgegenwärtigen Erkältung. Meine Haut war so trocken, dass sie schuppte, und im Winter juckte sie so stark, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Mit 26 bekam ich eine Magenlähmung, die ebenfalls weder diagnostiziert noch behandelt wurde, bis ich 40 war und einen Arzt traf, der genesende Veganer behandelte. Das bedeutete 17 Jahre ständiger Übelkeit, und bis heute kann ich nach 19 Uhr nicht essen.
Dann gab es die Depression und die Ängste. Ich entstamme einer langen und altehrwürdigen Reihe depressiver Alkoholiker, folglich erbte ich eindeutig nicht die besten Gene für mentale Gesundheit. Mangelernährung war das Letzte, was ich brauchte. Der Veganismus war nicht der einzige Grund für meine Depressionen, aber er trug erheblich dazu bei. Jahrelang bestand die Welt aus einer belanglosen, grauen Masse, endlos das Gleiche, unterbrochen nur durch gelegentliche Panik. Regelmäßig löste ich mich in Hilflosigkeit auf. Wenn ich meine Hausschlüssel nicht finden konnte, saß ich wie ein Häufchen Elend auf dem Wohnzimmerboden, gelähmt am Rand des Nichts. Wie sollte ich weiterleben?
Warum sollte ich es wollen? Die Schlüssel waren verloren und ebenso ich, die Welt, der Kosmos. Alles brach zusammen, war leer und bedeutungslos, fast widerwärtig. Ich wusste, dass es nicht vernünftig war, aber ich konnte es nicht ändern, es nahm seinen Lauf. Und jetzt weiß ich warum. Serotonin [ein stimmungsaufhellender Botenstoff (Neurotransmitter) im Gehirn] wird aus der Aminosäure Tryptophan gebildet. Es gibt aber keine guten pflanzlichen Quellen für Tryptophan. Darüber hinaus würde alles Tryptophan der Welt nichts Gutes bewirken ohne […] Fette, die man braucht, um seine Neurotransmitter tatsächlich senden zu lassen. All diese Jahre mit emotionalen Zusammenbrüchen waren kein persönliches Versagen; sie waren biochemisch, wenn auch selbst auferlegt.
Gibt es etwas Langweiligeres als anderer Leute Krankheiten? Ich werde versuchen, es kurz zu machen. Meine Wirbelsäule kommt nicht zurück. Produkte von Tieren aus Weidehaltung zu essen, hat den Schaden jedoch ein wenig repariert und zu einem moderaten Rückgang meines Schmerzniveaus geführt.
Meine Insulinrezeptoren sind auch am Boden, aber Proteine und Fett halten meinen Blutzucker stabil und fröhlich. Meine Periode hat in fünf Jahren nicht einmal ausgesetzt. Sollte ich je mit Krebs meiner Reproduktionsorgane enden, werde ich Soja dafür verantwortlich machen. Mein Magen ist okay – nicht gut, aber okay – solange ich Betain-Hydrochlorid [ein Magensäuremittel] zu jeder Mahlzeit nehme. Mit meinen spirituellen Übungen und meiner nährstoffreichen Ernährung bin ich die Depressionen jetzt los, und ich bin täglich dankbar dafür. Die Erkältung und die Erschöpfung sind jedoch dauerhaft. An manchen Tagen kostet mich das Atmen mehr Energie als ich habe.
Sie brauchen das nicht selbst auszuprobieren. Sie dürfen aus meinen Fehlern lernen. Alle meine Jugendfreunde waren radikal, redlich, erbittert. Der Vegetarismus war der naheliegende, der Veganismus der edlere Weg daneben. Alle, die ihn langfristig beschritten, wurden krank. Falls ich Ihren Lebensstil infrage stelle, Ihre Identität, empfinden Sie vielleicht Verwirrung, Angst und Wut, wenn Sie dieses Buch lesen. Aber Sie können mir glauben: Sie werden nicht wollen, dass es Ihnen so geht wie mir. Ich bitte Sie, dieses Buch zu Ende zu lesen und die Quellen im Anhang zu erwägen. Bitte. Besonders wenn Sie Kinder haben oder haben möchten. Ich bin nicht zu stolz, darum zu betteln.
[…] Die Werte, die die Vegetarier vorgeben zu achten – Gerechtigkeit, Mitgefühl und Nachhaltigkeit – sind die einzigen Werte, die eine Welt des Miteinanders anstelle der Dominanz erschaffen können. Eine Welt, in der sich Menschen jeder Kreatur – jedem Stein, jedem Regentropfen, allen unseren bepelzten und gefiederten Geschwistern – mit Demut, Ehrfurcht und Respekt nähern. Die einzige Welt, die eine Chance hat, den Missbrauch namens Zivilisation zu überleben. In der Hoffnung, dass eine solche Welt möglich ist, offeriere ich dieses Buch.
»Dieses Buch hat mir das Leben gerettet. The Vegetarian Myth [Ethisch essen mit Fleisch] verdeutlicht nicht nur, wie wir essen sollten, sondern auch, wie das vorherrschende Nahrungssystem die Erde zerstört. Dieses notwendige Buch hinterfragt viele der zerstörerischen Mythen, nach denen wir leben, und zeigt uns einen Weg zurück in unsere Körper und in den Kampf zur Rettung der Welt.«
— Derrick Jensen, Autor von Endgame undA Language Older Than Words
Kapitel 4
Moralische Vegetarier
Beginnen wir mit einem Apfel. Ein Lebensmittel, so gewaltfrei, dass es gegessen werden will, sagen die Fruktarier. Das sind Menschen, die versuchen, ausschließlich von Früchten zu leben oder bei dem Versuch sterben. Manche Pflanzen umgeben ihre Samen mit fleischiger Süße und umhüllen sie mit leuchtenden Farben, um Tiere dazu zu verführen, sie zu essen und somit die Samen in neue, potenziell fruchtbare Erde zu bringen. Tiere erledigen die Arbeit, die Pflanzen, angewurzelt an einen Punkt, nicht bewerkstelligen können: einen geeigneten Platz zu finden, wo ihre Nachkommen wachsen können.
Einen Apfel zu essen ist also in Ordnung für diese moralischsten unter den Vegetariern, weil kein Tod involviert ist. So sagen sie jedenfalls.
Das erste Problem ist, dass die Menschen die Samen nicht einpflanzen. Wir entsorgen sie. Ganz bewusst entfernen wir das Kerngehäuse mit den Samen und werfen sie dann weg – wobei »weg« in industrialisierten Ländern bedeutet: eingeschlossen in eine Plastiktüte, die in einer Müllhalde begraben wird. Oder Fabriken entsaften und zerkleinern die Früchte für uns, verwandeln sie in Saft oder McPies und entsorgen die Schalen, die Pressrückstände und die Samen eben nicht mit einem schönen Dunghaufen in der offenen Landschaft.
Oder, wenn wir ökologisch besonders korrekt sind, werfen wir die Samen auf den Komposthaufen, wo Zeit, Hitze und Bakterien sie töten. Das Ziel jedes guten Kompostierens ist es nun einmal, alle versteckten Samen zu töten.
Nichts davon hatte der Baum im Sinn.
Der Baum offeriert die Süße nicht aus Nächstenliebe. Er bietet einen Handel an. Und obwohl wir eingeschlagen und genommen haben, halten wir unseren Teil des Deals nicht ein.
Das Argument [einen Apfel zu essen, sei okay] zeugt von krassem Anthropozentrismus, und es ist seltsam, dass es von Menschen kommt, die sich explizit für die Freiheit von Tieren einsetzen. »Der Obstbaum gibt mir mein Essen, und ich gebe die Samen der Natur zurück, damit andere Bäume wachsen können«, schreibt ein Vegetarier.4 Ja, aber er gibt die Samen nicht in die Natur zurück. Warum dürfen wir Menschen nehmen, ohne zu geben? Nennt man das nicht Ausbeutung? Oder zumindest Diebstahl? Nicht bei Obst, »dem einzigen freiwillig gegebenen Lebensmittel«5, so wird gesagt. Der Frucht geht es aber nicht um Menschen. Es geht um die Samen. Der Grund, warum der Baum so enorme Ressourcen in die Ansammlung von Ballaststoffen und Zucker investiert, ist, seinem Nachwuchs die bestmögliche Zukunft zu sichern. Und wir nehmen diesen in Süße gewickelten Nachwuchs und töten ihn.
Das wollen Vegetarier nicht hören, jedenfalls nicht jene, die ich als moralische Vegetarier bezeichne. Der Vegetarierbaum hat noch andere Zweige – politische Vegetarier, die glauben, eine pflanzliche Ernährung sei gerechter und nachhaltiger, und gesundheitlich motivierte Vegetarier, die glauben, tierische Erzeugnisse seien die Wurzel allen ernährungsmäßigen Übels – ich werde diese Argumente in späteren Kapiteln behandeln.
Es ist vor allem das moralische Argument, um das sich die meisten Vegetarier versammeln. Es hielt mich lange davon ab, meine vegetarische Ernährung zu untersuchen oder gar zu hinterfragen, obwohl es auf der Hand lag, dass meine Gesundheit schwand. Ich wollte glauben, dass mein Leben – meine physische Existenz – möglich war ohne zu töten, ohne den Tod. Es ist nicht möglich – bei keinem Leben. Da die Märchen jedoch voller Äpfel sind, lassen Sie uns weiter den Spuren der Apfelstückchen […] folgen.
Sie führen uns direkt zum zweiten Problem: In der Natur gibt es keine Äpfel. Äpfel wurden gezüchtet. Den Anfang machte Malus sieversii in den Bergen Kasachstans, und damals waren sie bitter.
»Stellen Sie sich vor, in eine säuerliche Kartoffel oder eine leicht matschige, ledrig umhüllte Paranuss zu beißen.« So beschreibt Michael Pollan den Geschmack echter Wildäpfel. »Beim ersten Bissen versprechen einige dieser Äpfel der Zunge: hier kommt ein Apfel – aber nur, um plötzlich derart bitter zu schmecken, dass sich mir noch beim Gedanken daran der Magen umdreht.«6
Das gilt für die meisten domestizierten Früchte. Ihre Vorfahren waren für Menschen nahezu ungenießbar.
»Der Obstbaum gibt mir mein Essen, und ich gebe die Samen der Natur zurück, damit andere Bäume wachsen können.«7 Wirklich? Von wegen! Die meisten Bäume, die essbare Früchte tragen – und auf jeden Fall Apfelbäume – wachsen nicht aus Samen. Würde man die Samen einpflanzen, wären die meisten der daraus entstehenden Wildlinge für den Menschen ungenießbar. Obstbäume werden gepfropft und nicht aus Samen gezogen.8
Die »natürliche« Nahrung des Menschen existiert in der Natur nicht. Wenn wir uns im ungenießbaren Wald verirren (und verhungern), dann vielleicht, weil unsere moralische Landkarte falsch war.
Zu sagen, es gebe ein »frei angebotenes Lebensmittel«, impliziert, dass es einen Geber gibt – den Baum, das Zuckerrohr, den Getreidehalm. Zu glauben, dass es Nahrung gibt, die »ohne Töten und Diebstahl von Tieren oder Pflanzen«9 zu haben ist, heißt anzuerkennen, dass Tiere und Pflanzen ihr Leben und ihre Körperteile lieben, seien sie aus Fasern oder Muskeln. Und ihren Nachwuchs lieben sie nicht? Das Argument scheitert genau hier. Wenn wir an ihr Empfindungsvermögen glauben, warum dann nicht an das Empfindungsvermögen ihrer Kinder? Wenn es falsch ist, von einer Pflanze zu stehlen, warum ist es dann nicht noch verwerflicher, einen Samen zu töten? Wir können nicht beides haben. Entweder es gibt einen Geber, ein Wesen, das unsere Gegenleistung verdient, oder nicht. Wenn das Töten das Problem ist: Das Schlachten einer Weidekuh ernährt mich ein ganzes Jahr lang. Eine einzige vegane Mahlzeit aus Pflanzenbabys – Reiskörnern, Mandeln, Sojabohnen – gemahlen oder bei lebendigem Leib gekocht, ist mit Hunderten Toden verbunden. Warum zählen die nicht?
»Ich esse nichts, was eine Mutter oder ein Gesicht hat«, war eine meiner Standardbekundungen. Allerdings hat jedes Lebewesen eine Mutter. Manche haben auch Väter. Warum wusste ich das nicht? Was ich meinte, war: Ich esse nichts, das von seiner Mutter genährt wurde, was im Kern bedeutete, keine Vögel und keine Säugetiere, obgleich ich auch keine Meeresfrüchte aß. Manche Kreaturen opfern ihr Leben, um Nachkommen zu erzeugen. Das bedeutet, dass sie nicht da sind, um sie zu nähren, aber bedeutet es, dass sie ihren Nachwuchs weniger lieben? Mutterschaft – und manchmal auch Vaterschaft – als das ultimative Opfer. Würde dieses Verhalten nicht bedeuten, dass sie ihren Nachwuchs über alles lieben? Und mal angenommen, Deine Mutter liebt dich nicht: Ist Dein Leben dann wertlos?
Dann ist da noch die Sache mit dem Gesicht. Warum soll der Besitz eines Gesichts darüber entscheiden, wer zählt und wer nicht? Eigentlich definiert es, wer dem Menschen am meisten ähnelt und wer sich stärker unterscheidet: Sehen sie aus wie wir? Da ist wieder dieser Anthropozentrismus, ein ethisches System, das auf der Menschenähnlichkeit von Lebewesen beruht. Warum sollte das wichtig sein? Warum sind die Menschen der Standard, der darüber entscheidet, wer lebt und wer stirbt?
Ein Apfel fällt vom Baum. Wir essen seine Süße und, entgegen aller unaufrichtigen gegenteiligen Behauptungen, töten seine Samen. [Doch …] Menschen können nicht von Äpfeln leben. Zudem gelten im moralischen Universum der Vegetarier alle Saaten – auch Nüsse und Getreide – als frei verfügbar. Bei diesen Saaten gibt es kein wohlschmeckendes Fruchtfleisch im Tausch gegen ein »Baby-an-Bord«. Was die Menschen essen, sind die Saaten selbst. Ich erinnere mich an meine Begründung: Die einjährigen Gräser sterben bei der Ernte ohnehin, also tötete ich nicht wirklich. Das Problem ist natürlich, dass ich nicht den sterbenden Teil gegessen habe: den Halm. Menschen können keine Zellulose verdauen. Ich aß exakt jenen Teil, der sehr wohl leben wollte: den Samen. Tatsächlich wollen sie so sehr leben, dass manche von ihnen sogar noch nach Tausenden Jahren der Ruhe auskeimen. Wie kann man sagen, dieses Wesen liebe sein Leben nicht?
Ich weiß aus Erfahrung, dass böse Zungen den Vegetariern andauernd die Pflanzen und ihr Empfindungsvermögen vorhalten. Ich weiß, wie selbstgefällig und ablehnend diese bösen Zungen gewöhnlich sind. Für sie ist die Idee, Pflanzen zu respektieren ebenso lächerlich wie Tiere zu achten. […] Mir ist wichtig, diese Bedenken ernsthaft anzugehen. Ich höre ein Flehen in den Worten der Vegetarier, ein Flehen, das an ein Gebet grenzt. Lass mich leben, ohne andere zu schädigen. Lass mein Leben ohne den Tod anderer möglich sein. Dieses Gebet umfasst eine heftige Zärtlichkeit und eine leidenschaftliche Abscheu. Die Liebe gilt allen Wesen, der Horror dem Sadismus, den die Menschen ihnen zufügen. Dieses Gebet pulsiert in mir wie ein zweites Herz. Was mich von den Vegetariern unterscheidet, ist nicht Ethik oder Verpflichtung. Es ist Wissen.
Denn ich habe Äpfel gezüchtet und sah, was man hineinstecken muss. Ich kann im hiesigen Futtermittelladen eine Tüte organischen Dünger für Obstbäume kaufen und keine weiteren Fragen stellen. Es ist jedoch nicht meine Natur, das Kleingedruckte zu überspringen. Ich will wissen. Ich lese die Etiketten. Mein Bestreben, ein gutes, ehrbares und ethisches Leben zu führen, brachte mich dazu, so viel Lebensmittel wie möglich selbst zu ziehen. Ich kannte die drei wichtigsten ökologischen Maßnahmen für Individuen: auf Kinder verzichten, kein Auto fahren und sein eigenes Essen anbauen. Da ich keinen Kontakt zum Hauptauslöser von Schwangerschaften hatte und zu arm für ein Auto war, blieb mir der Anbau meiner Lebensmittel.
Meine ersten Gärtnerversuche geschahen nicht unter Zwang. […] War die Welt ein flaches, chronisches Grau, brachte der Garten Leben. Er floss über vor Grün. Ich wickelte kleine Samenkörner in feuchte Tücher, und zwei Tage später schauten kleine Finger, so zaghaft wie die Hoffnung, daraus hervor. Sie wollten leben, und das wollte ich auch. Ich verbrachte lange Neuengland-Nächte unter schweren Bettdecken, mich sammelnd gegen den körperlichen Schmerz, der niemals endete, nur abebbte, und gegen die allgegenwärtige Depression, die ebenso wie die Erkältung mein stetiger, zehrender Begleiter war. […] Der Garten brachte mir Trost. Dinge wuchsen, kletterten, blühten, bildeten Früchte aus. Ein unaufhaltsames, stilles Lied des Grünens, endlose Sehnsucht, so viel größer als ich und mein Schmerz. Im Garten fand ich Trost und kleine Momente der Freude […].
Ich entdeckte die Zeitschrift Organic Gardening und noch besser war, dass ich in der Bibliothek die alten Ausgaben durchsehen durfte. Ich las sie alle. […] Ich war so ahnungslos. Wusste ich wirklich nicht, dass die Tomaten nicht vor Ende des Frostes ins Freie können? […] Wusste ich wirklich nicht, dass Bohnen nicht umgepflanzt werden dürfen und dass Löwenmäulchen einjährig sind?
Mit meiner Wirbelsäule konnte ich weder graben noch heben und überhaupt nicht viel körperlich arbeiten. Aber das war in Ordnung. Ich suchte sofort nach den radikalsten und nachhaltigsten Gartenbaumethoden. Ruth Stout war eine Offenbarung.10 Ebenso die Permakultur.11 […] Ich würde Mutterboden aufbauen, von oben nach unten, wie die Natur. Es würde keine Fräse geben, keinen nackten Boden, kein doppeltes Umgraben. […]
Es gab noch mehr, was ich nicht wusste, sogar Grundsätzlicheres als Pflanzzonen und Wachstumszeiten. Es gab ein Wissen, das ich suchte, dann aber ablehnte: Ich war nicht die einzige, die aß. Die Pflanzen waren auch hungrig. Und dann war da noch der Boden. Die Gartenbücher drängten mich dazu, den Boden zu ernähren. Was aber aß der Boden? Was war der Boden? War auch er lebendig?
Ein Esslöffel Erdreich enthält mehr als eine Million lebende Organismen, und ja, jeder einzelne isst. Der Erdboden ist nicht einfach Dreck. Ein Quadratmeter Mutterboden kann tausend verschiedene Tierarten beherbergen.12 Dazu könnten 122 Millionen Nematoden gehören, 100.002 Milben, 45.002 Springschwänze, 20.002 Enchyträenwürmer und 10.002 Weichtiere.13
Die kleinen Kreaturen leben alle im und zwischen dem Humus, einer Kombination aus Huminsäuren und Polysacchariden. »Niemand weiß, wie Huminsäure entsteht, aber wenn sie sich gebildet hat, benimmt sie sich wie eine lebende Substanz«, schreibt Stephen Harrod Buhner.14 Überall Leben! Wie tief musste ich graben, um keine lebenden Kreaturen mehr zu finden? Denn was lebte, konnte ich nicht töten. Ich las, dass »sehr kleine Tiere in der Lage sind, ein praktisch aquatisches Leben im Boden zu führen, in dem Wasser, das man an Erdkrümeln haftend fand«.15 Unter meinen Füßen gab es eine ganze Welt, eine Welt mit einem eigenen Ozean. Eine Welt, in der die wirkliche Arbeit des Lebens verrichtet wurde – Aufbauen und Abbauen. Tiere wie ich waren nur Konsumenten, nur Trittbrettfahrer. Ich konnte nicht photosynthetisieren – kein Sonnenlicht in Materie verwandeln – noch konnte ich diese Materie in Kohlenstoff und Mineralien zurückverwandeln. Sie konnten und sie taten es, und ihretwegen war Leben möglich. Das machte mich demütig.
Allerdings hatte ich mein gesamtes moralisches System auf die Idee gestützt, dass mein Leben keinen Tod erfordern würde – meine gesamte Identität beruhte darauf. Je mehr ich lernte, umso mehr Fragen musste ich ignorieren. Wie sonst hätte ich diese ethische Vorgabe retten wollen, die beanspruchte, die Wahrheit zu kennen. War das Leben der Nematoden und Pilze von Bedeutung? Warum nicht? Weil sie zu klein waren, als dass ich sie sehen konnte? Weil sie sich auf der anderen Seite einer imaginären Trennlinie zwischen uns und ihnen befanden? Dabei hielt ich mich für eine jener Tapferen, die sich weigern, diese Linie zu ziehen, die Menschen nicht in einer Hierarchie über die Tiere stellen […]. Aber ich hatte nur Kreaturen einbezogen, die mir in bestimmter, sehr spezieller Weise ähnelten. Ich erkannte das in kleinen Lichtblicken, in denen jede neue Information wie ein Glühwürmchen aufflackerte. Diese kleinen Lichtblicke deuteten auf einen dunklen Wald, den zu betreten ich mich weigerte. Ich gehörte zur Seite der Rechtschaffenen! Und wie jeder Fundamentalist konnte ich dort nur bleiben, wenn ich es vermied, zu wissen.
Also, Huminsäure – eine sehr lebendige, mystische Kreatur – zersetzt pflanzliche Bestandteile und lagert sie in sich ein. Bekommt sie die richtigen Signale aus ihrem Umfeld, verknüpft sie die nötigen Nährstoffe wieder und setzt sie frei. »Durch eng verbundene Rückkopplungsprozesse erreicht die Information über die in Huminsäure gespeicherten chemischen Reserven die oberirdischen Pflanzengemeinschaften. Sie zeigt an, welche Pflanzen in welcher Kombination und in welchem Ökosystem wachsen sollen und welche chemischen Verbindungen sie produzieren sollen, um den Boden gesund zu halten.«16
Der Erdboden war keine Sache, er war eine Million Sachen und sie lebten. Ihre Lebensprozesse – essen, ausscheiden, unterhöhlen, kommunizieren und austauschen – waren es, die den Rest des Planeten bewohnbar machten. Sie bauten tote Materie von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Bakterien ab und machten deren elementare Bestandteile für neues Leben verfügbar. Steven Stoll schreibt, dass Mutterboden »ein Filter ist und ein Behältnis, eine Masse kombinierter Mikro- und Makromaterie sowie eine lebende Substanz, die durch Reduktion nicht verstehbar wird. In fertiger Form enthält er derart viele Mitglieder und symbiotische Beziehungen, dass er nach den Worten des Bodenwissenschaftlers Nyle Brady ‚die Entstehung eines natürlichen Körpers‘ darstellt, ‚der sich von den Elternmaterialien unterscheidet, aus denen er hervorging.‘«17
»Füttere den Boden, nicht die Pflanze«, war das oberste Gebot des organischen Anbaus. Ich musste den Boden füttern, denn er lebte.
Stickstoff, Phosphor, Kalium – NPK – ist die Dreiheiligkeit der Gärtner, die Troika der Elemente, die das Pflanzenwachstum steuern. Was aßen die Erde und die Pflanzen, und woher würde ich diese Substanzen bekommen? Ich hatte den Ausdruck »geschlossenes Kreislaufsystem« nicht gelernt, doch dahinter war ich her. Stickstoff war der Bedeutendste. Es gibt Pflanzen, die Stickstoff binden. Wäre das nicht ausreichend für meinen Garten? Könnte das nicht sein? Ich flehte. Aber ich flehte eine Million lebender Kreaturen an, die sich vor Millionen Jahren in gegenseitige Abhängigkeit begeben hatten. Meine ethischen Qualen kümmerten sie nicht. Keine stickstoffbindende Pflanze konnte all die Nährstoffe ausgleichen, die ich entnahm. Der Boden wollte Dünger. Schlimmer noch, er wollte das Undenkbare: Blut und Knochen.
Es gab andere Stickstoffquellen, die ich hätte einsetzen können. Zurzeit stellen fossile Brennstoffe den Stickstoff für den weltweiten Anbau bereit. Synthetische Düngemittel brachten die Grüne Revolution mit den um 252 Prozent gestiegenen Ernten hervor. Außer der Tatsache, dass nichts aus fossilen Brennstoffen Hergestelltes nachhaltig ist – wir können keine fossilen Brennstoffe anbauen und sie vermehren sich nicht eigenständig –, zerstören synthetische Dünger letztlich den Boden.
Synthetischer Stickstoff kam also nicht infrage. Daher blieb mir nur, mich tierischen Produkten zuzuwenden. Die Ironie der Sache ist freilich, dass jede Art von Stickstoff von Tieren stammt, der synthetische wie der organische. Von den Dinosauriern blieben Öl und Gas übrig. Ich hatte – eigentlich muss man sagen: wir haben – die Wahl zwischen Stickstoff von toten Reptilien oder lebenden Wiederkäuern.
Mein Garten wollte Tiere essen, auch wenn ich es nicht wollte.
So erreichte ich auf meiner Pilgerreise eine weitere Gabelung. Ich konnte eine Packung konzentrierten NPKs kaufen, ausgewogen und komplett biologisch, oder ich konnte mich mit einem Milchbauern anfreunden. Die Packung war verlockend, denn mit ihr konnte ich mich belügen. Nein, nicht wirklich lügen. Ich konnte so tun, als wüsste ich nicht, was ich bereits wusste. Ich könnte die Information ablehnen. Doch ich wusste bereits, was sich in der Packung befand. Die Zutatenliste schimmerte und verlockte wie es die Frucht der Erkenntnis immer tut. Ich war Eva und das war mein Apfel; wie hoch wäre der Preis, ihn zu essen? […]
Ich nahm einen Bissen. Ich las das Etikett. Blutmehl, Knochenmehl, tote Tiere, getrocknet und gemahlen. Ich stellte die Packung zurück und besorgte ein wenig Dung. Freunde einer Freundin hatten eine ehemalige Ziegenscheune voller Mist. Es stellte sich heraus, dass ich die Frau kannte, der die Ziegen gehörten, sie war anständig. Ihre Tiere würden gut versorgt worden sein, ja sogar hingebungsvoll. Ich verabredete mich mit jemandem, der einen Pickup und einen starken Rücken hatte. Der Mist kam an, und mein Garten explodierte. Die Tomatenranken verschlangen ihre Gitter, dann ihr Beet, dann bildeten sie Muster auf der Einfahrt. […] Mit der Ernte ernährte ich drei Haushalte und dennoch schossen einige Salatköpfe, ehe wir sie holten.
Ich blieb sowohl hungrig als auch genährt zurück. Dies war kein Hunger mit der Vorfreude auf den Geruch des Abendessens schon an der Haustür […]. Dieser Hunger nagte ohne Aussicht auf Linderung. In meinem Garten schloss ich jetzt den Kreislauf, aber mein moralisches System war aufgebrochen.
Jahre später würde ich mit einem ernsthaften jungen Veganer diskutieren.
»Sie nehmen tote Hühnerteile und streuen sie auf die Äcker.« Seine Stimme zitterte. Er nahm an, ich würde mitempfinden, ging davon aus, dass jeder mit meiner Einstellung automatisch entsetzt wäre. Seine öko-puristische, gewaltfreie, pflanzenbasierte Diät war von den Mächten des Bösen, vom Tod verletzt worden.
»Pflanzen müssen auch essen«, versuchte ich zu erklären. »Sie brauchen Stickstoff, sie brauchen Mineralien. Du musst ersetzen, was Du herausnimmst. Du hast die Wahl zwischen fossilen Brennstoffen oder tierischen Produkten.«
»Aber – aber …« Sein Körper zitterte nun ebenso wie seine Stimme. Ich wusste, was er sagen wollte. Es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Es gibt einen Ausweg aus dem Tod, und ich habe ihn gefunden.
»Nein«, war das einzige Wort, das er herausbrachte. Dann ging er fort. Wie oft bin ich weggelaufen? Immer und immer wieder. Vor meinem Garten konnte ich jedoch nicht weglaufen, ebenso wenig wie vor meinen Bemühungen, kein Parasit für den Planeten zu sein. Mit dem Wissen, mit dessen Hilfe ich den Nährstoffkreislauf schloss, konnte ich nirgends unterkommen. Ich konnte wegen des Ziegenmistes intellektuell Versteck spielen: Er war ja bereits da, aufgehäuft in der Scheune, warum sollte ich ihn nicht nutzen. Ich war ja nicht diejenige, die Tiere wegen ihrer Milch und ihres Fleisch unterdrückte – aber um das P und das K im NPK kam ich nicht so leicht herum.
Weltweit ist Phosphor nur in extrem kleinen Mengen verfügbar. »Gleich nach sauberem Wasser«, schreibt Bill Mollison, »wird Phosphor eine der unausweichlichen Grenzen für die menschliche Besatzung dieses Planeten werden.«19 Phosphor kommt in Sedimentgestein vor. Für mich waren Steine nicht in derselben Kategorie wie Tiere: Ich hatte nichts dagegen, sie zu benutzen. Das Problem war, sie zu beschaffen.
Sie müssen abgebaut, dann gemahlen und transportiert werden. Wäre das überhaupt möglich ohne eine Riesenmenge an fossilen Brennstoffen?
Was passiert, wenn alles aufgebraucht ist? Ich stand wieder vor demselben Regal im Futtermittelladen. Ich könnte Steinphosphat kaufen, entscheiden, dass ich etwas Gutes, Grünes tue, weil es »organisch« ist, und einfach keine weiteren Fragen stellen. Aber gab es nicht auch eine nachhaltige Quelle, die ich selbst besorgen könnte? Ich stellte die Frage, aber ich hasste die Antwort.