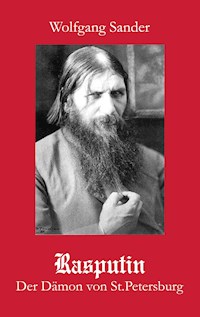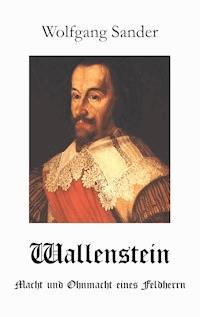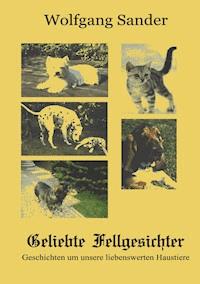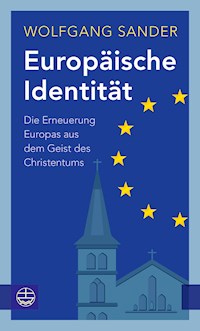
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Christliche Werte haben die Kraft, Europa zu einen! Die Geschichte Europas wurde durch die christliche Tradition geprägt. Doch diese verblasst. Was bedeutet das für den europäischen Gedanken? Wolfgang Sander zeigt mit seinem Essay, dass wir kein neues Narrativ brauchen, sondern eine Rückbesinnung. Er plädiert für eine Renaissance der christlichen Werte. Denn wenn es uns gelingt, sie für heute weiterzudenken, liegen hier die entscheidenden Ressourcen für eine verbindende, zukunftsfähige europäische Identität! - Europa ist mehr als die EU: auf der Suche nach unserem kulturellen Gedächtnis - Unsere Herkunft: die christlichen Wurzeln Europas - Was zeichnet die Einheit des Konstrukts Europa aus? - Die Zukunft der europäischen Einigung und die Erneuerung der christlichen Kirchen In Vielfalt vereint? Was macht den inneren Zusammenhang Europas aus? Wolfgang Sander schärft mit seinen Fragen und Antworten unseren Blick auf Europa und die EU. Wie verhält sich der christliche Glaube zu den Wissenschaften, wie zu den so genannten europäischen Werten, wie zu Diversität und religiöser Vielfalt in modernen Gesellschaften? Wie lässt sich Freiheit anders denken, wie Narzissmus und Egoismus überwinden? Wie sieht die Zukunft der Kirchen aus? Denn eine Entchristlichung Europas wäre nicht Ausdruck einer Modernisierung der europäischen Kultur und Identität, sondern ein Zeichen ihrer Auflösung. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dem entgegenzuwirken!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WOLFGANG SANDER
Europäische Identität
Die Erneuerung Europas aus dem Geist des Christentums
© privat
Wolfgang Sander, Dr. phil., ist Professor (em.) für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er studierte Sozialwissenschaften, Evangelische Theologie und Erziehungswissenschaft. Sander hatte leitende Funktionen in der Deutschen Vereinigung für politische Bildung (DVPB) und der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) in Deutschland sowie der Interessengemeinschaft Politische Bildung (IGPB) in Österreich inne und ist Mitglied der Herausgeberkreise der zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften (zdg, Frankfurt a. M.) sowie der Informationen zur Politischen Bildung (Wien).
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2022 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Printed in Germany
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.
Gesamtgestaltung: Friederike Arndt · Formenorm, Leipzig
Druck und Binden: CPI books GmbH
ISBN 978-3-374-07019-0 // eISBN (PDF) 978-3-374-07020-6 // eISBN (EPUB) 978-3-374-07153-1
www.eva-leipzig.de
»Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede.«
(Jürgen Habermas: Zeit der Übergänge. Kleine Politische Schriften IX, Frankfurt a.M. 2001, 174 f.).
»Europa wird christlich, oder es wird überhaupt nicht mehr sein.«
(Romano Guardini: Der Heilsbringer in Mythos, Offenbarung und Politik. Eine theologisch-politische Betrachtung, Stuttgart 1946, 46)
»Wenn wir im Westen noch nicht einmal die moralischen Tiefen unserer eigenen Traditionen verstehen, wie sollen wir dann Einfluss auf den Diskurs der Menschheit nehmen können?«
(Larry Siedentop: Die Erfindung des Individuums.
Der Liberalismus und die westliche Welt, Stuttgart 2015, 450)
INHALT
Zur Einführung
1. Wir Europäer:Europäische Identität als Aufgabe und Problem
Die vielen Facetten des Wir: kollektive Identitäten
Die Gefahren der Identitätspolitik
Kollektive Identitätsstrategien der Europäischen Union
Osteuropäische Sichtweisen
Kulturkreise in der Weltgesellschaft als kollektive Identitätsformen
Die Vorläufigkeit von Identität: christliche Perspektiven
2. Herkunft:Die christlichen Wurzeln Europas
Eine moralische Revolution
Bürger zweier Welten: das Reich Gottes und die weltlichen Ordnungen
Lange Linien und ihre Windungen
Dunkle Seiten und antichristliche Ressentiments: Kreuzzüge und Hexenverfolgungen
Eine christlich geprägte Kultur
3. Keine Lösungen:Radikalisierte Aufklärung, religiöse Regression und Vielfalt als Selbstzweck
Aufklärung: keine singuläre Epoche
Radikalisierte Aufklärung: die Französische Revolution und die Pathologien der europäischen Moderne
Die Säkularisierungsthese und ihr Scheitern
Traditionsbruch und religiöse Regressionsphänomene
Das ungelöste Problem der Normativität Europas
4. Zukunft:Eine christliche Renaissance für Europa
Weltverstehen: Glaube, Vernunft und Wissenschaft
Kein richtiges Leben im falschen? Der Geist des Christentums und die normativen Grundlagen Europas
Religiöse Vielfalt in einem christlichen Europa
Ecclesia semper reformanda: die Kirchen und die Erneuerung Europas
Das christliche Europa in der Weltgesellschaft
5. Ausblick:Zur Zukunft der europäischen Einigung
Anhang
Literaturverzeichnis
Endnoten
ZUR EINFÜHRUNG
»Das Neue stürzt und altes Leben blüht aus den Ruinen.«
(Inschrift auf dem Haus Glauburger Hof in der 2018 fertiggestellten neuen Altstadt in Frankfurt am Main)
Gut siebzig Jahre nach dem Schuman-Plan, der 1950 den Anstoß für die Gründung der ersten Europäischen Gemeinschaften gab, steht die daraus erwachsene Europäische Union an einem Scheideweg. Ist der Austritt Großbritanniens der Anfang vom Ende der EU oder wird er im Gegenteil den Zusammenhalt der verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten stärken? Werden sich die Differenzen zwischen ost- und westeuropäischen Mitgliedsstaaten, die durch das aktive Agieren der Visegrád-Gruppe immer sichtbarer geworden sind, verschärfen, oder wird sich daraus gerade eine Erneuerung und Vertiefung des gemeinsamen Selbstverständnisses Europas entwickeln? Waren die Lockdowns, nationalen Alleingänge und Grenzschließungen in der Corona-Krise ein Zeichen für die Schwäche der europäischen Integration, oder werden sich die 750 Milliarden Euro an Corona-Finanzhilfen, die durch gemeinsame Anleihen aufgebracht und bis 2058 zurückgezahlt werden sollen, als Katalysator für eine sehr viel tiefere Integration der EU erweisen? Wird die EU an den strukturellen Mängeln ihrer Institutionen, an der Intransparenz ihrer immer komplexer werdenden Regeln und Verfahren, zugrunde gehen, oder wird ihr bei einem passenden Fenster der Gelegenheit in einem großen Wurf eine grundlegende und überzeugende Reform ihrer eigenen politischen Ordnung gelingen?
Nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte steht die Europäische Union vor schwierigen Alternativen, aber nicht immer waren sie gleichermaßen drängend. Noch Anfang dieses Jahrhunderts gab es viel Anlass zu einer optimistischen Sichtweise auf die Zukunft der europäischen Einigung:1 Die Osterweiterung der EU (und damit, wie es schien, die politische und kulturelle ›Verwestlichung‹ des östlichen Europa) stand bevor, der Euro war eingeführt, eine gemeinsame Verfassung für das geeinte Europa zeichnete sich ab, mit der die älteren Verträge aus den ersten 50 Jahren der europäischen Integration ersetzt werden sollten. Äußere Bedrohungen schienen nicht mehr zu bestehen; die islamistischen Anschläge von 2001 waren zwar schockierend, aber größere Anschläge in Europa gab es noch nicht und die politische und militärische Auseinandersetzung mit dem Islamismus schien sich außerhalb der EU abzuspielen, vor allem im weit entfernten Afghanistan.
Wie wir wissen, ist die Geschichte anders verlaufen. Der Verfassungsvertrag scheiterte bei Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden. An seine Stelle trat 2009 der Vertrag von Lissabon, mit dem zwar eine Reihe von Reformen realisiert werden konnten, um die größer gewordene EU handlungsfähig zu machen, aber auch mit 358 Artikeln, 37 Protokollen und 65 weiteren Erklärungen ein für Laien kaum lesbares textliches Monstrum geschaffen wurde. Die islamistische Bedrohung schlug sich in Europa in einer Reihe von massiven Anschlägen nieder, brachte im europäischen Umfeld und mit Verbindungen in Europa selbst die Terrororganisation »Islamischer Staat« hervor und erwies sich auch in politischer, kultureller, pädagogischer und religiöser Hinsicht als andauernde Herausforderung. Mit der Flüchtlingskrise 2015 spitzten sich Konflikte innerhalb der EU zu, nicht zuletzt zwischen west- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten, und innerhalb vieler Mitgliedsstaaten gewannen populistische und tendenziell EU-feindliche Parteien an Unterstützung.
Heute steht die Europäische Union wohl drängender denn je vor der Frage nach ihrem Selbstverständnis. Welche Sichtweise von der Einheit Europas repräsentiert sie, auf welche Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben und politischer Ordnung kann sie sich dabei stützen und in welchen Traditionen der europäischen Geistesgeschichte wurzeln diese Vorstellungen? Damit stellt sich die Frage nach der europäischen Identität. Gewiss ist die Europäische Union nicht einfach mit Europa gleichzusetzen, und niemand kann heute sagen, welche politischen Ordnungsformen Europa in späterer Zukunft prägen werden. Aber ein realistischer Blick auf die Situation Europas im frühen 21. Jahrhundert führt doch recht zwingend zu dieser Einsicht: »Europa ist mehr als die EU, aber ohne die EU ist es heute nichts.«2
Herfried Münkler hat mit Blick auf die Geschichte der Nationalstaaten konstatiert, die Idee der Nation müsse der Realisierung des Staates vorausgehen.3 Dieser an den europäischen Nationalstaaten gut nachvollziehbare Gedanke lässt sich cum grano salis auch auf die politische Ordnung des künftigen Europas beziehen. Woher aber kann eine solche Idee Europas kommen? Illusionär ist wohl die modische Vorstellung, man könne ein ›europäisches Narrativ‹ gewissermaßen nach Bedarf neu erfinden, um Legitimationsprobleme der EU damit zu beheben.4 Hilfreicher ist die Frage, welche der großen geistesgeschichtlichen, in Europa wirkmächtigen Traditionen auch für eine künftige europäische Identität auf neue Weise fruchtbar gemacht werden können. Es geht also eher darum, aus der Erinnerung an verschüttete, im kulturellen Gedächtnis Europas aber gleichwohl vorhandene Ressourcen Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen.
Tatsächlich hat es solche Formen eines produktiven Rückbezugs auf auch weit zurückliegende Traditionen in der europäischen Geschichte immer wieder gegeben. Herausragendes Beispiel ist der mehrfache Rückgriff auf die Antike, vor allem in der Epoche der Renaissance vom 14. bis zum 16. Jahrhundert in Kunst und Philosophie, die nicht nur die Städte Europas bis heute prägt, sondern in der nachträglichen Deutung als Beginn der ›Neuzeit‹ gesehen wird. Aber auch die Scholastik in der mittelalterlichen Theologie und Philosophie war stark von der Wiederentdeckung der Antike, insbesondere der Schriften des Aristoteles, geprägt. Später, im frühen 19. Jahrhundert, trug der Rückbezug auf die griechische Antike zur neuhumanistischen Bildungstheorie bei, die entscheidende Anstöße zur Entwicklung der höheren Schulen und der Universitäten gab. Ein anderes Beispiel ist die Reformation. Luthers Kritik der kirchlichen Tradition stützte sich auf Paulus und Augustinus, und seine Alternative zur kirchlichen Dogmatik seiner Zeit bestand im Kern im Rückgriff auf die Bibel als einziger normativer Quelle des christlichen Glaubens (›sola scriptura‹). Jürgen Habermas hat erst kürzlich in seiner Geschichte der Philosophie wieder gezeigt, wie wichtig das nur scheinbar rückwärtsgewandte Denken Luthers für die Entwicklung des modernen europäischen Verständnisses des Menschen als Subjekt war.5
Als letztes Beispiel sei auf Karl den Großen verwiesen, dessen Siegel – mehr als 300 Jahre nach dem Untergang des weströmischen Reiches – die Umschrift »Renovatio Imperii Romani« trug (Erneuerung des Römischen Reiches). Zur politischen Bedeutung dieses Rückbezugs um das Jahr 800 für die europäische Geschichte schreibt Hagen Schulze: »Europa wäre in eine unzusammenhängende Vielfalt primitiv verfaßter Stämme auseinandergefallen, wäre da nicht die einigende Kraft der Kirche gewesen, und die fortdauernde Erinnerung an Rom.«6 Im Reich Karls des Großen tauchte auch der Begriff Europa als Selbstbezeichnung auf, nicht zuletzt in Abgrenzung zu den islamischen Eroberern im Süden. Wie auch immer man die wechselhafte Geschichte der nachfolgenden römischen Kaiser im bis 1806 existierenden »Heiligen Römischen Reich« in Europa beurteilen mag – es ist bemerkenswert, dass das Gebiet der in den 1950er-Jahren gegründeten Europäischen Gemeinschaften mit den sechs Mitgliedsstaaten Frankreich, Italien, Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden weitgehend identisch war mit dem Reich Karls des Großen.
Bekanntlich ist Europa nicht einfach ein Begriff für eine klar abgrenzbare geographische Einheit. Als Kontinent hat Europa keine präzise bestimmbaren natürlichen Grenzen. »Europa wurde nur deswegen zu einem geographischen Begriff, weil es vorher zu einem historischen Begriff geworden war.«7 Europa ist ein geistiges Konstrukt, ein Begriff für einen kulturellen Zusammenhang, der sich durch diese Bezeichnung von anderen kulturellen Zusammenhängen unterscheidet. Zugleich werden damit rund 2500 Jahre wechselvoller, vielfältiger und konflikthafter Ereignisse und Entwicklungen als gemeinsame, eben als europäische Geschichte gedeutet. Die Frage nach der europäischen Identität ist dann im Kern die Frage danach, was den inneren Zusammenhang des Konstrukts Europa ausmacht.
Die Antwort ergibt sich weder allein aus dem Verweis auf den eben nur vage bestimmbaren geographischen Raum, in dem diese Geschichte spielte, noch allein aus der offenkundigen Vielfalt und Wechselhaftigkeit dieser Geschichte. Daher beantwortet auch das Motto »In Vielfalt geeint«, das die EU sich 2000 gab, die Frage nach der europäischen Identität nicht. Vielfalt gibt es auch in anderen Teilen der Welt. Die entscheidende Frage für die europäische Identität ist aber, worin und wodurch Europa »geeint« ist.
Auf einer allgemeinen Ebene und in metaphorischer Form ist auf diese Frage immer wieder mit drei Städtenamen geantwortet worden: Athen, Rom und Jerusalem.8 Athen steht für griechische Kunst, Geschichtsschreibung, Mathematik, Wissenschaft und Philosophie, die auch als Vorläufer der neuzeitlichen Naturwissenschaften und der europäischen Aufklärung angesehen werden. Rom gilt als Quelle des Rechts und des juristischen Denkens sowie der Idee der Republik, aber auch der lateinischen Sprache, die das westeuropäische Wissenschafts- und Bildungswesen stark geprägt hat. Jerusalem schließlich, obwohl geographisch gar nicht in Europa gelegen, repräsentiert das aus dem Judentum hervorgegangene Christentum, dessen Bedeutung für die europäische Identität Gegenstand dieses Buches ist.
Diese drei großen Traditionslinien stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern haben sich intensiv wechselseitig beeinflusst. Aus diesen, wenn auch immer wieder spannungsvollen, Verbindungen entstand die Eigentümlichkeit des kulturellen Konstrukts Europa: aus der Verknüpfung von griechischer Philosophie und christlichem Glauben im frühen Christentum, aus der Christianisierung des Römischen Reiches, aus dem Neben- und Miteinander von Theologie, Philosophie und Wissenschaften.
Die Frage nach der europäischen Identität wird sich auch in unserer Zeit nicht ohne Rückgriff auf diesen Traditionszusammenhang beantworten lassen. Ein künstliches, gewissermaßen im historisch luftleeren Raum entworfenes neues ›Narrativ‹ zur Legitimation der europäischen Integrationspolitik dürfte demgegenüber zum Scheitern verurteilt sein. Notwendig ist vielmehr eine Erneuerung dieses Zusammenhangs vor dem Hintergrund der Fragen und Probleme unserer Zeit. In diesem Sinne braucht Europa eine neue Renaissance.
Die These dieses Buches ist, dass es bei dieser Renaissance nicht – wie in der Frühen Neuzeit – um eine ›Wiedergeburt‹ griechischen oder römischen Denkens geht. Diese beiden Traditionslinien sind in Philosophie und Wissenschaft, in Rechtsstaat und Demokratie durchaus nach wie vor von prägender Wirkung. Anders verhält sich mit ›Jerusalem‹. Die christliche Prägung der europäischen Kultur ist in den beiden letzten Jahrhunderten blasser und besonders im Westen und Norden Europas zunehmend schwächer geworden, bis hin zu massiven Traditionsbrüchen in manchen gesellschaftlichen Teilbereichen, in denen sich Religionsdistanz zu einem dominanten Habitus entwickelt hat. Im weltweiten Vergleich begibt sich Europa damit freilich nicht etwa, wie manche Verfechter dieser Entwicklung meinen, an die Spitze des Fortschritts, sondern in eine in vielen anderen Teilen der Welt kaum vermittelbare Sonderrolle. Eine Entchristlichung Europas wäre nicht Ausdruck einer Modernisierung der europäischen Kultur und Identität, sondern von deren Auflösung. Notwendig dagegen, so die hier vertretene These, ist eine neue Renaissance, die sich auf die christlichen Traditionen Europas bezieht und diese für die Zukunft der europäischen Identität fruchtbar macht. Denn hier sind die geistigen Ressourcen für ein gehaltvolles Verständnis dessen zu finden, was derzeit mit dem Begriff ›europäische Werte‹ oft zu einer plakativen Leerformel zu werden droht.
Schon wegen der Fülle und Breite der mit seinem Thema angesprochenen Aspekte muss sich dieses Buch auf die Form eines Essays beschränken, da es nicht in erster Linie ein Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung, sondern zum öffentlichen Diskurs über die Zukunft Europas sein soll. In den Anmerkungen werden gleichwohl Zitate nachgewiesen und Hinweise auf ausgewählte weiterführende Literatur gegeben.
1. Wir Europäer:
Europäische Identität als Aufgabe und Problem
»Denn niemand von uns erschafft die Welt, in der wir leben, ganz neu. Wir alle gelangen zu unseren Werten und inneren Verpflichtungen nur im Dialog mit der Vergangenheit. Aber ein Dialog ist kein Determinismus.«
(Kwame Antony Appiah)9
Wie sinnvoll ist es, überhaupt von ›europäischer Identität‹ zu sprechen? Tatsächlich gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten, wenn man den Identitätsbegriff auf Europa als kulturelles Konstrukt anwenden will. Sie beginnen aber auch schon bei diesem Begriff selbst. Was also soll unter ›Identität‹ verstanden werden und welche Probleme wirft dieses Konzept auf?
Meist wird dieser Begriff ja zunächst auf die Persönlichkeit von Individuen bezogen – wer ich bin (oder wie ich mich im Verhältnis zu meiner Umwelt sehe), das scheint meine Identität zu sein. In diesem Sinn entspricht der Begriff ›Identität‹ in etwa dem, was in anderen Denktraditionen gemeint ist, wenn Menschen als Personen oder als Subjekte betrachtet werden. Als Begriff gibt es ihn überhaupt erst seit dem 19. Jahrhundert.10 In den Sozialwissenschaften und der Psychologie fand der Identitätsbegriff besonders im Anschluss an Erik H. Eriksons 1950 erstmals erschienene Studie »Kindheit und Gesellschaft« weite Verbreitung, in der die Ausbildung von »Ich-Identität« als einer von mehreren Aspekten der gelungenen Bewältigung von acht Phasen der psychosozialen Entwicklung beschrieben wurde.11
Es gehört zu dieser Vorstellung von Identität, dass diese in Auseinandersetzung der Individuen mit Regeln und Erwartungen aus der gesellschaftlichen Umwelt entsteht. Dass Identität nicht einfach Ausdruck eines von Geburt an gegebenen und unveränderlichen Wesens eines Menschen ist, sondern sich prozesshaft und unter Umständen auch in Konflikten und Brüchen entwickelt, gilt heute in den Wissenschaften als weithin akzeptierte Sichtweise.12 Oft wird in diesem Zusammenhang auch die Ansicht vertreten, dass das Problem der Identität sich überhaupt erst in der Moderne stelle, weil erst hier die Einzelnen mit einer Vielzahl an unterschiedlichen und sich ggf. auch widersprechenden Rollenerwartungen und Identitätsangeboten konfrontiert seien. Francis Fukuyama erläutert dies am Beispiel des fiktiven Bauern Hans, der im 19. Jahrhundert in einem sächsischen Dorf aufwächst und dann in das Ruhrgebiet reist, um in einem Stahlwerk zu arbeiten. In seinem Dorf war sein Leben noch klar geregelt und innerhalb dieser Regeln vorhersehbar: »Er wohnt in demselben Haus wie seine Eltern und Großeltern. Er ist mit einem Mädchen verlobt, das für seine Eltern akzeptabel war. Er wurde vom Ortspfarrer getauft. Und er plant, dasselbe Grundstück zu bestellen wie sein Vater. Es fällt Hans nicht ein zu fragen: ›Wer bin ich?‹, da die Antwort bereits von den Menschen in seiner Umgebung geliefert worden ist.«13 Diese Frage stellt sich, so Fukuyama, für Hans aber in seiner neuen Umgebung, in der er einer Fülle neuer, widerstreitender und nicht leicht zu durchschauender Einflüsse im persönlichen, beruflichen und politischen Umfeld ausgesetzt ist und zu denen er sich verhalten muss.
Manche postmodernen Subjekttheorien gehen noch weiter und betrachten angesichts der Vielfalt sozialer Kontexte, in denen sich Individuen in heutigen westlichen Gesellschaften parallel bewegen, eine kohärente Identität als Illusion. Der Einzelne kann hiernach in unterschiedlichen Umwelten, so etwa in Familie, Beruf, Sport, in einer Interessengruppe, einem sozialen Netzwerk, verschiedene Identitätsmuster ausbilden und dadurch quasi immer auch jemand anderer sein. Hier wird allerdings das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn die sozialpsychologische Forschung bestätigt, was die Alltagserfahrung erwarten lässt: dass Menschen ohne das Gefühl eines kohärenten inneren Zusammenhangs nicht etwa freier, sondern krank werden.14
Es wird weiter unten noch zu fragen sein, ob die Probleme, die mit dem Identitätsbegriff angesprochen werden, tatsächlich alle so neu sind, wie dieser Begriff selbst es ist, ob also in vormoderner Zeit Menschen wirklich durchweg so selbstverständlich wussten, wer sie sind, wie es das zitierte Beispiel des Bauern Hans suggeriert. Festzuhalten ist hier aber zunächst, dass erstens Identitätsfindung für Individuen eine prozesshafte Entwicklungsaufgabe ist und dass zweitens hierbei die Zugehörigkeiten der Individuen zu unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen eine wesentliche Rolle spielen. Es ist offensichtlich, dass soziale Gruppen, Gemeinschaften und Organisationen je eigene Identitätsformen entwickeln und Identitätsangebote offerieren, sei es nun eine Familie oder eine jugendliche Peer-Group, ein Verein oder eine kulturelle Initiative, eine Religionsgemeinschaft oder eine berufliche Profession, eine Stadt oder ein Unternehmen, eine politische Partei oder ein Interessenverband, eine Nation oder eine transnationale NGO. Es sind divergierende Formen und Ebenen kollektiver Identität. Dies führt zu der Frage, wie europäische Identität zu verstehen ist.
Die vielen Facetten des Wir: kollektive Identitäten
Menschen sind soziale Wesen, die seit jeher in kleineren und größeren Verbünden leben. Mit dem Begriff der kollektiven Identität ist nun gemeint, dass diese Zusammengehörigkeit für das Selbstverständnis der Angehörigen eines Kollektivs bedeutsam ist: »Eine Identität zu haben kann Ihnen ein Gefühl davon vermitteln, wie Sie in die soziale Welt hineinpassen. Das heißt, jede Identität bietet Ihnen die Möglichkeit, als ›ich‹ unter mehreren ›wir‹ zu sprechen und damit zu einem ›wir‹ zu gehören.«15 Nicht jede Form von Gemeinsamkeit unter Menschen wird in diesem Sinn zum Anlass einer kollektiven Identitätsbildung. Beispielsweise ist dies bei den Mitreisenden in einem Flugzeug weniger der Fall als bei Fans eines Fußballvereins, bei Brillenträgern weniger als bei Veganern, bei der Augenfarbe weniger als bei der Hautfarbe. Überdies unterliegt die Auswahl von als identitätsstiftend angesehenen Gemeinsamkeiten in der menschlichen Geschichte starken Wandlungen, wie gerade das Beispiel der Hautfarbe zeigt, die erst in der Neuzeit im Zuge des modernen Sklavenhandels, des Kolonialismus und der Rassentheorie zu einem hochgradig relevanten Identitätsmerkmal werden konnte.16
Gleichwohl gehört zum ›wir‹ einer kollektiven Identität immer auch die Unterscheidung vom ›ihr‹, von den anderen also, die die bestimmenden Merkmale der jeweiligen Identität nicht teilen – sei es weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht dürfen. Für politische Ordnungen sind diese Unterscheidungen unvermeidlich, gerade auch wenn sie demokratisch sein sollen: »Ohne eine definitive Vorstellung von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit können weder Partizipation umfassend begründet noch Solidarität formell institutionalisiert werden«.17
Dieses ›Othering‹ hat heute in liberalen Gesellschaften einen schlechten Ruf, weil mit ihm die Abwertung von als ›anders‹ kategorisierten Menschen verbunden sein kann. Dies ist aber nicht zwingend der Fall. Gewiss kann eine wichtige Leistung kollektiver Identitäten, Übersichtlichkeit in die soziale Welt zu bringen und Orientierung zu stiften, nur um den Preis von Vorurteilen erbracht werden. Solche Vorurteile sind unvermeidlich. Niemand könnte sich in komplexen Gesellschaften orientieren, wenn man sich ein Bild von anderen Menschen, auf die man in der Öffentlichkeit stößt, erst machen dürfte oder könnte, wenn man diese Menschen intensiv persönlich kennengelernt hat. Aber es macht für ein gedeihliches Zusammenleben einen entscheidenden Unterschied, ob diese Vorurteile als vorläufige Urteile fungieren, die für Veränderung durch neue Erfahrungen offen sind, oder als dauerhaftes Ressentiment, das sich gegen solche Erfahrungen gerade abschottet.
Kollektive Identitäten können auf sehr verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Dimensionen angesiedelt sein.18 Sie können konkreter oder abstrakter sein, einander ergänzen, sich überschneiden oder wechselseitig ausschließen. Sie können überdies für die Einzelnen von sehr unterschiedlichem Gewicht sein; manche mögen für das eigene Leben als eher peripher bedeutsam erlebt werden, andere ins Zentrum des eigenen Selbstverständnisses rücken. Sie können auch ziemlich kurzlebig sein, wenn sie Menschen verbinden, die sich mit einem modischen Trend identifizieren oder bei Heranwachsenden einen gewissermaßen experimentellen Charakter annehmen; sie können aber auch jahrhunderte- oder jahrtausendealte Kontinuitäten aufweisen. All dies wiederum kann zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich sein.
Es ist deshalb immer problematisch, wenn bestimmte Formen von kollektiver Identität essenzialisiert werden. Dies geschieht, wenn eine solche Identität auf einen unveränderbaren Wesenskern zurückgeführt wird, der die Menschen, die diesem Kollektiv angehören, angeblich prägt. Wenn zum Beispiel Muslime per se als fundamentalistisch, Frauen als sanftmütig oder Deutsche als ordentlich kategorisiert werden, liegen wahrscheinlich solche Essenzialisierungen vor. Allerdings soll damit nicht gesagt werden, dass Religion, Geschlecht oder Nation keine relevanten Formen von kollektiver Identität seien. Sie sind es sehr wohl, aber was es konkret heißen soll, als Muslim, Frau oder Deutscher zu leben, kann sehr unterschiedlich sein.
Das ›Wir‹ hat also sehr verschiedene Facetten. Europäische Identität kann nur eine von ihnen sein. Aber sie ist mit vielen anderen Facetten von Zugehörigkeit verwoben. Keinesfalls lässt sie sich auf die Ebene der europäischen Integrationspolitik nach 1945 und deren Effekte beschränken. Dies wird schon deutlich, wenn man in historischen Rückblicken zunächst nur auf einer beschreibenden Ebene nach Besonderheiten der europäischen Kultur im globalen Vergleich sucht. Max Weber hat schon 1920 eine Aufzählung dieser Besonderheiten in zehn Punkten vorgelegt, Richard Schröder hat diese Liste aufgenommen und um weitere Aspekte ergänzt.19 Viele von ihnen haben sich im Verlauf der Neuzeit von Europa aus in der Welt verbreitet, bleiben aber gleichwohl auch für das heutige Europa prägend. Zu ihnen gehören unter anderem die modernen Wissenschaften, die analytische, also nicht einfach nur als Hofberichterstattung angelegte Geschichtsschreibung seit Thukydides, die politische Theorie seit Platon und Aristoteles, das nicht-religiöse Recht als Grundlage des Staates seit dem Römischen Reich, die Dualität zwischen Kirche und Staat, die Erfindung der Nationen, Kapitalismus und Sozialismus, der christliche Individualismus und sein Niederschlag in kodifizierten Grund- und Menschenrechten. Unschwer lässt sich bei den meisten dieser Stichworte sofort die Verbindung zu den eingangs genannten drei metaphorischen Städtenamen Athen, Rom und Jerusalem herstellen.
Die Gefahren der Identitätspolitik
Der amerikanische Philosoph Michael Walzer hat am Beispiel seines eigenen Lebens die Vielfalt möglicher Facetten von Identität als Chance für ein friedliches Zusammenleben beschrieben:
»Wenn ich mich sicher fühlen kann, werde ich eine komplexere Identität erwerben. […] Ich werde mich mit mehr als einer Gruppe identifizieren; ich werde Amerikaner, Jude, Ostküstenbewohner, Intellektueller und Professor sein. Man stelle sich eine ähnliche Vervielfältigung der Identitäten überall auf der Welt vor, und die Erde beginnt, wie ein weniger gefährlicher Ort auszusehen. Wenn sich die Identitäten vervielfältigen, teilen sich die Leidenschaften.«20
Selbstverständlich ließe sich Walzers Hoffnung auch auf andere Kombinationen von Identitätsfacetten in anderen Biographien an anderen Orten beziehen. Aber zugleich spricht Walzer hier indirekt eine Gefahr von Identitäten an: Sie sind zumindest potenziell mit Leidenschaften verbunden, und diese Leidenschaften lassen sich auch politisch mobilisieren und instrumentalisieren. Je weniger, so lässt sich Walzers Argument auch lesen, es Menschen gelingt, mehrfache soziale Zugehörigkeiten produktiv in ihr Selbstverständnis zu integrieren, also gewissermaßen entspannt mit der Vielfalt von sozialen Erfahrungen umzugehen, desto größer ist die Gefahr, dass das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben von Kämpfen um Identitätsansprüche geprägt sein wird. Das kann innerhalb einer regionalen oder nationalen Gesellschaft der Fall ein, aber auch im globalen Zusammenhang der Weltgesellschaft,21 zum Beispiel als Konflikt zwischen Nationen oder Religionen.
Ein geschichtsmächtiges Beispiel für diese Gefahren von Identitätspolitik ist der Nationalismus. Er folgt zwar nicht zwingend aus der Konstruktion von nationalen Identitäten, wie sie in den beiden letzten Jahrhunderten, von Europa ausgehend, weltweit zu beobachten war. Aber der Nationalismus ist doch die dunkle Seite der globalen Verbreitung des Nationalstaats als politisches Ordnungsmodell. Sein Kern besteht in der Dominanz von nationaler Identität über andere Formen kollektiver Identitäten, und nicht selten wurde diese Dominanz mit repressiven Mitteln oder offener Gewalt durchgesetzt: »Viele der Völkermorde des 20. Jahrhunderts – an den Armeniern in der Türkei, an den Juden Europas und an den Tutsi in Ruanda – wurden im Namen eines Volkes an einem anderen begangen, um eine homogene Nation zu schaffen. Doch sie bildeten nur das äußerste Ende eines Spektrums, zu dem auch Massenvertreibungen, erzwungene Assimilation und die Unterdrückung von Minderheiten gehören.«22 Das jüngste und hoffentlich letzte Beispiel hierfür in Europa ist das Massaker in Srebrenica im Bosnienkrieg, der Teil der Kämpfe um die Bildung von Nationalstaaten auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien in den 1990er-Jahren war.
Nationale Identitäten als Legitimationsgrundlage für Nationalstaaten sind ein historisch junges Phänomen. »Man schaut auf das glänzende Gebäude der Nationalstaaten – und sieht, dass die Farbe noch feucht ist.«23 Im Jahr 1900 gab es in Europa 22 und weltweit 50 Nationalstaaten, im Jahr 2014 waren es in Europa 50 und weltweit 195.24 Vor der Entstehung der Nationalstaaten war die politische Landschaft in Europa über viele Jahrhunderte von multinationalen Reichen wie dem Heiligen Römischen Reich (das am Ende in über 260 Kleinstaaten und andere Herrschaftsgebilde unterteilt war), der Habsburgermonarchie, dem Britischen Empire und dem Osmanischen Reich geprägt. Der Begriff ›Nationen‹ stand vor der Bildung von Nationalstaaten nur für regionale, kulturelle und sprachliche, nicht aber für politische Gemeinschaften; Hamburgern und Bayern wäre es vor dem 19. Jahrhundert wohl kaum in den Sinn gekommen, sich gemeinsam als Teil einer deutschen Nation zu verstehen, so wenig wie Mailändern und Sizilianern als Teil einer italienischen. Wenn der deutsche Kaiser Wilhelm II. noch 1890 vor einer preußischen Schulkonferenz mit einem polemischen Seitenhieb gegen die humanistischen Gymnasien verlangte, diese sollten »nationale junge Deutsche erziehen und nicht junge Griechen und Römer«25, dann zeigt dies, wie wenig selbstverständlich nationale Identität damals noch war.
Die nationalistische Variante von Identitätspolitik hat auch im heutigen Europa in rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Parteien und Bewegungen wieder stärker an Einfluss gewonnen, nachdem sie über Jahrzehnte hinweg im Westen eher ein Randphänomen war und im sozialistischen Mittel- und Osteuropa sich zumindest öffentlich nicht artikulieren konnte. Besonders offensiv zu einer politisch rechten Identitätspolitik bekennt sich derzeit die kleine, aber lautstarke »Identitäre Bewegung«, die ein extrem essenzialistisches Konzept von »ethnokultureller Identität« vertritt.26 Jedes Volk besitze hiernach eine unveränderbare ethnokulturelle Identität, die durch Vermischungen in Folge von Migration bedroht sei. Weltweit solle es zwar eine Pluralität von ethnisch fundierten Kulturen geben, die aber räumlich zu trennen seien. Den Individuen wird letztlich die Unterordnung unter das jeweilige ethnokulturelle Leitbild abverlangt, eine Vielfalt individueller Identitäten gilt nicht als erstrebenswert.
Die politisch rechte Okkupation des Identitätsbegriffs in dieser erst in den 2010er-Jahren entstandenen Bewegung sowie im neuen Rechtspopulismus reagiert gewissermaßen spiegelverkehrt auf identitätspolitische Konzepte, die sich in der politischen Linken in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr durchgesetzt haben. Diese sich links verstehende Identitätspolitik konzentriert sich kaum mehr auf traditionelle Themen (wie soziale Gerechtigkeit) und Adressaten (wie Facharbeiterschaft und mittlere Angestellte) der sozialdemokratischen und sozialistischen Organisationen. Adressaten sind vielmehr eine Vielzahl von Gruppen und Minderheiten, die vor allem durch Geschlecht, sexuelle Orientierungen, ethnische Herkunft und Migration geprägt sind und sich darin benachteiligt sehen. Als Formen der Diskriminierung werden vor allem ›Sexismus‹, ›Homophobie‹, ›Heteronormativität‹, ›Rassismus‹ und ›Islamophobie‹ gebrandmarkt, meist auf der Basis sehr weit gefasster Begriffsverständnisse, mit deren Hilfe oft erst hinreichend große Problemfelder an Benachteiligungen konstruiert werden. Je größer etwa die Zahl der definierten sexuellen Orientierungen ist, als desto problematischer muss die gefühlte Benachteiligung angesichts von einer Mehrheit als ›normal‹ empfundenen Heterosexualität wahrgenommen werden, und sei die Zahl der konkret Betroffenen auch noch so klein (Facebook bot zeitweise die Möglichkeit, im Nutzerprofil zwischen 60 Geschlechtern zu wählen). Und je stärker der Rassismusbegriff sich vom Ressentiment gegenüber Menschen mit bestimmten erblichen körperlichen Merkmalen wie Hautfarbe löst und auf ›Kulturrassismus‹ oder gar ›antimuslimischen Rassismus‹ (eine besonders abwegige Konstruktion, weil Muslime ganz offensichtlich äußerst unterschiedlichen Ethnien angehören) ausweitet, desto größer wird scheinbar das Rassismusproblem.27 Das geht bis zu der in diesem Diskurs verbreiteten Annahme, »dass jede Person, egal welcher sozialen Herkunft und ungeachtet ihrer Intention, nicht rassistisch sein zu wollen, rassismusrelevantes Wissen qua Sozialisation besitzt und sich ein Leben lang damit auseinandersetzen muss, um dieses Wissen zu dekonstruieren«, weshalb es zwar »rassismussensible, aber keine rassismusfreien Räume in unserer Gesellschaft geben kann«.28 In puren Rassismus schlägt antirassistische Identitätspolitik freilich um, wenn unter dem Slogan ›Critical Whiteness‹ gefordert wird, Menschen mit weißer Hautfarbe dürften sich zu einem bestimmten Thema nicht äußern, weil sie wegen ihrer Hautfarbe zu den Privilegierten gehörten, oder wenn die Hautfarbe von Autoren zum Grund dafür wird, ihre Texte nicht mehr zu lesen.29
Deutlich wird auch hier ein essenzialistischer Zug im Verständnis von Identität. Bestimmte Bedürfnisse, Eigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen werden hier nicht mehr als persönlicher Lebensstil verstanden, sondern von Minderheiten als Ausdruck einer besonderen und unveränderbaren kollektiven Identität postuliert, für die in Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft Anerkennung und Einfluss gefordert wird. Dies bedroht nun aber den öffentlichen Raum, der gerade vom Diskurs zwischen Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen lebt und in dem verallgemeinerungsfähige Argumente zählen, die Identitätsgrenzen überbrücken. »Gerade diese Fähigkeit, im öffentlichen Raum das eigene, vermeintlich authentische Selbst hintanzustellen, war die entscheidende Tugend mündiger Bürgerlichkeit. Respekt verdiente man für diese Leistung (das Hintanstellen des Selbst) – und eben nicht, wie die Postmoderne zu suggerieren begann, für dieses Selbst in seiner vermeintlichen Identitätskostbarkeit oder Verletzlichkeit.«30 Dagegen läuft das Pochen darauf, eine bestimmte Frage sei eine der Anerkennung oder Nichtanerkennung von Identität, am Ende auf die Verweigerung diskursiver Verständigung hinaus. Denn in diesem Verständnis von Identitätspolitik sind »Identitäten […] unverträglich mit Kompromissen, sie werden durch sie geradezu kompromittiert«.31 Die Suche nach Kompromissen ist aber ein zentrales Element von guter Regierung wie von demokratischer Politik.
Bevorzugtes Aktionsfeld für diese neue linke Identitätspolitik sind Schulen, Hochschulen, Wissenschaften (vor allem Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften), kulturelle Einrichtungen sowie Medien. In diesen sozialen Feldern wird ein Deutungsund Machtkampf ausgetragen, der vorrangig auf Dominanz in diesen Teilöffentlichkeiten abzielt, um von dort aus Wirkungen in die breitere Gesellschaft hinein zu entfalten. Dies geschieht in der Auseinandersetzung um Sprach- und Schreibregelungen (vor allem um ›gendergerechte Sprache‹), um ›Bereinigung‹ von Texten, auch historischen, von unerwünschten Begriffen und Sprechweisen (z. B. ›Mohr‹), Verdammung von Autoren oder Künstlern aus früheren Epochen wegen selektiv ausgewählter Äußerungen (›Kant war ein Rassist‹), Versuche der Verhinderung von Vorträgen Andersdenkender und Beseitigung unerwünschter kultureller Artefakte (z.B. bestimmte Denkmäler). Spätestens hier wird diese Identitätspolitik zu einer konkreten Bedrohung für die Freiheit.
Zugleich bietet diese Bedrohung dem Rechtspopulismus viele Gelegenheiten, sich selbst als Verteidiger der Freiheit gegen Rede- und Denkverbote zu inszenieren, seine eigenen Konzepte von kollektiver Identität ins Spiel zu bringen und durch polarisierende Abgrenzungen gegen ›politische Korrektheit‹ Aufmerksamkeit und Unterstützung zu gewinnen. Fukuyama weist darauf hin, dass diese Strategie ein Faktor des Erfolgs von Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 war, den er trotz vieler Statements gewann, die »die Karriere jedes anderen Politikers beendet« hätten: »Obwohl vielen seiner Anhänger sicher nicht jedes dieser Statements gefallen hat, gefiel ihnen die Tatsache, dass er sich von dem Zwang, politisch korrekt aufzutreten, nicht einschüchtern ließ.«32
Versteht man kollektive Identität als einen Begriff für das, was eine kleinere oder größere Gruppe von Menschen in einer für diese Menschen bedeutsamen Weise miteinander verbindet, dann sind solche Identitäten unvermeidlich. Problematisch und politisch gefährlich sind sie, wenn sie verabsolutiert werden und damit eine Dominanz im Weltverstehen von Menschen gewinnen, die unweigerlich nicht nur zu Unterscheidungen von anderen Gruppen, sondern zu moralisch und emotional aufgeladenen Ab- und Ausgrenzungen führt. Denn die ultima ratio konsequenter Identitätspolitik ist nicht die Verständigung, sondern der Bürgerkrieg.
Kollektive Identitätsstrategien der Europäischen Union
Die Europäische Union und ihre Vorläufergemeinschaften haben der Frage nach einer kollektiven Identität, die Grundlage des europäischen Integrationsprozesses sein könnte, bislang eher wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Zwar gab es in der Frühzeit dieses Prozesses zahlreiche einschlägige Äußerungen von Repräsentanten der Europäischen Gemeinschaften,33 aber eine offizielle Positionierung zu dieser Frage findet sich erst in einem auf dem Kopenhagener Gipfel der damals neun Mitgliedsstaaten der EG am 14. Dezember 1973 beschlossenen »Dokument über die europäische Identität«.34 Diese Erklärung bezieht sich überwiegend auf das Verhältnis der Gemeinschaften zu den Staaten der Welt und betont, dass die europäische Einigung »gegen niemanden gerichtet« sei und »keinerlei Machtstreben« entspringe. Bekräftigt werden unter anderem das Bekenntnis zur Charta der Vereinten Nationen sowie das Streben nach mehr Gerechtigkeit und besserer Verteilung des Wohlstands in der Welt.
Zum inneren Zusammenhalt der Gemeinschaften werden in sehr allgemeiner Weise das »gemeinsame Erbe« und die Notwendigkeit für die europäischen Staaten betont, »sich zusammenzuschließen, um das Überleben einer Zivilisation zu sichern, die ihnen gemeinsam ist.« Zur weiteren Konkretisierung heißt es dann aber lediglich: »In dem Wunsch, die Geltung der rechtlichen, politischen und geistigen Werte zu sichern, zu denen sie sich bekennen, in dem Bemühen, die reiche Vielfalt ihrer nationalen Kulturen zu erhalten, im Bewußtsein einer gemeinsamen Lebensauffassung, die eine Gesellschaftsordnung anstrebt, die dem Menschen dient, wollen sie die Grundsätze der repräsentativen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit, die das Ziel des wirtschaftlichen Fortschritts ist, sowie der Achtung der Menschenrechte als die Grundelemente der europäischen Identität wahren.« Kulturelle Vielfalt plus Demokratie reichen aber für eine Bestimmung europäischer Identität schon deshalb nicht aus, weil eine solche Kombination von vielen multiethnischen Demokratien außerhalb Europas ebenfalls in Anspruch genommen werden kann, wie beispielsweise Ghana oder Indien. Das Dokument über die europäische Identität erwähnt mit »gemeinsames Erbe« und »gemeinsame europäische Zivilisation« die für sein Thema zentralen Stichworte, füllt sie aber nicht mit Inhalten. Für die Begründung einer europäischen Identität war und ist das zu wenig.
Auch der gescheiterte Entwurf für eine Verfassung der Europäischen Union von 2004 brachte in dieser Hinsicht nicht mehr Klarheit. Immerhin wird hier das »Erbe« mit drei Adjektiven angereichert: »Schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben«, heißt es dort zu Beginn in der Präambel. Diese Formulierung war ein mühsam erreichter Formelkompromiss in einem heftigen Streit über die Frage, ob eine Verfassung der EU einen Gottesbezug enthalten sollte, wie es in einigen Verfassungen der Mitgliedsstaaten der Fall ist, so im deutschen Grundgesetz. Der Streit wie das Formelhafte seines Ergebnisses sind Hinweise auf eine verbreitete Unklarheit in der EU in Bezug auf die Bedeutung von ›Jerusalem‹ für die europäische Identität.
Weitere identitätspolitische Maßnahmen der EU seit den 1980er-Jahren hat Wolfgang Schmale in sechs Säulen zusammengefasst:35 die Schaffung von greifbaren Symbolen (Flagge, Hymne, Europatag), die Einführung der EU-Staatsbürgerschaft mit gemeinsamem Reisepass und die damit verbundenen Wahlrechte, der Euro, die Betonung gemeinsamer Werte (wie schon im oben zitierten Dokument von 1973), die Gemeinsamkeitsstrategien in der EU-Politik (wie z. B. der gemeinsame Binnenmarkt) sowie Ansätze einer eigenen EU-Geschichtspolitik (z. B. mit dem »Haus der europäischen Geschichte« in Brüssel).
So bedeutsam die europäische Einigungspolitik im Rahmen der EU für Gegenwart und Zukunft Europas ist, so bemerkenswert ist in Bezug auf europäische Identität ihre konzeptuelle Schwäche. Erstaunlich ist dies schon deshalb, weil das Nachdenken über ein politisch geeintes Europa ja nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann, sondern sich bis in die Frühe Neuzeit zurückverfolgen lässt.36 Gewiss ist es nicht die Aufgabe politischer Institutionen, der Bevölkerung eine kollektive Identität zu oktroyieren. Dies dürfte in freiheitlichen Gesellschaften auch schwerlich gelingen. Aber die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der europäischen Integration nach der Epoche der souveränen Nationalstaaten teils schon gegeben sind, teils weiterhin angestrebt werden, werden nur dann zu einer auf längere Sicht stabilen neuen Ordnung in Europa führen, wenn sie von hinreichender Akzeptanz und Unterstützung in der europäischen Bevölkerung getragen sind. Pragmatische Erwägungen und ökonomische Vorteile dürften dafür aber kaum ausreichen, denn spätestens in ernsthaften Krisen – und auf längere Sicht gesehen gibt es nach aller Erfahrung kein gesellschaftliches Zusammenleben ohne solche Krisen – stiften reine Nützlichkeitserwägungen keinen hinreichenden Zusammenhalt. Die europäische Integrationspolitik wird deshalb ohne eine Verankerung des ihr zugrunde liegenden Verständnisses von Europa in tieferliegenden Schichten geteilter Erinnerungen und Traditionen auf Dauer nicht erfolgreich sein können.
Osteuropäische Sichtweisen
Die europäische Integration in der EU war bis zum Beitritt von zehn mittel- und osteuropäischen Staaten im Jahr 2004 für mehr als ein halbes Jahrhundert ein rein westeuropäisches Projekt. Schon der Begriff der ›Osterweiterung‹, der sich für diesen Beitritt in der EU etablierte, verweist auf diesen Hintergrund: Ein erfolgreicher Prozess wird erweitert, muss sich dadurch aber nicht verändern, weil die neuen Mitglieder sich in ihn einfügen werden. In rechtlicher Hinsicht ist dies zweifellos auch der Fall, aber in vielen anderen Hinsichten zeigte sich nach dem Beitritt bald, dass der ›Osten‹ sich nicht einfach nur ›verwestlichen‹ wird, weil in diesem Teil Europas, in Polen oder Ungarn etwa, auch andere historische Erfahrungen und Traditionen wirksam sind als in Frankreich oder Italien.
Die EU ist bekanntlich unter den Bedingungen der Ost-West-Teilung Europas und des Kalten Krieges nach 1945 entstanden. In den westlichen Demokratien war es in diesem Kontext sehr plausibel, dass ein freiwilliger Zusammenschluss unter mindestens teilweiser Aufgabe nationaler Souveränität nicht nur eine logische Folge aus den Erfahrungen der beiden Weltkriege war, sondern auch der Selbstbehauptung gegenüber den Bedrohungen durch den Kommunismus, der in einem weltweiten Konflikt mit dem Westen auf Dominanz und von seiner Ideologie her auf die weltweite Durchsetzung seiner autoritären politischen Ordnung zielt. Die Aufgabe des älteren Konzepts uneingeschränkter nationaler Souveränität durch die europäische Integration war daher in Westeuropa Mittel und Ausdruck der Verteidigung der Freiheit. Ganz anders in den Staaten Ost- und Südosteuropas: Hier war die nationale Souveränität durch die Eingliederung in das von der Sowjetunion beherrschte politische und ökonomische System des ›realen Sozialismus‹ zwischen 1949 und 1989 de facto gewaltsam beseitigt worden. Die Bewahrung und Verteidigung nationaler Identität war in diesem Kontext ein Mittel des Widerstands gegen ein diktatorisches System. Ein Beitritt zur EU sollte aus dieser Perspektive nicht nur dem wirtschaftlichen Wohlstand und einer europäischen ›Wiedervereinigung‹ nach der gewaltsamen Teilung im Kalten Krieg dienen, sondern auch der Sicherung einer wiedergewonnenen nationalen Identität gegen potenziell erneute Bedrohungen aus dem Osten, sprich durch Russland.
In der Flüchtlingskrise ab 2015 brachen diese unterschiedlichen Perspektiven als offene Gegensätze auf. Konkret war es der massive und bemerkenswert einheitliche Widerstand der östlichen Staaten gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten aus dem arabischen Raum, der bislang das Haupthindernis für eine einheitliche Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU darstellt. Woher rührt dieser Widerstand, der im Westen der EU, mit Ausnahme der populistischen Bewegungen, weithin auf Unverständnis stößt? Dahinter steht, so Ivan Krastev in seiner eindrücklichen Analyse der in Ost- und Südosteuropa vorherrschenden Sichtweisen auf Europa, ein Solidaritätskonflikt, hinter dem sich wiederum ein Konflikt um das Verständnis von europäischer Identität verbirgt:
»Was wir heute in Europa erleben, ist kein Mangel an Solidarität, wie es Brüssel gerne darstellt, sondern ein Solidaritätskonflikt, bei dem nationale, ethnische und religiöse Solidaritätspflichten mit unseren Pflichten als Menschen in Konflikt geraten. Und dieser Solidaritätskonflikt findet sich nicht nur innerhalb der Gesellschaften, sondern auch im Verhältnis zwischen Nationalstaaten. […] Die Flüchtlingskrise hat deutlich gemacht, dass Osteuropa gerade jene kosmopolitischen Werte als Bedrohung empfindet, auf denen die Europäische Union basiert, während für viele in Westeuropa ebendiese kosmopolitischen Werte den Kern der neuen europäischen Identität ausmachen.«37
Gleichzeitig stellen aber Polen, Ungarn und Tschechien in erheblichem Umfang Aufenthaltstitel für Zuwanderer aus Drittstaaten aus. Im Jahr 2018 waren es in Polen 635.335 und damit fast 100.000 mehr als in Deutschland, in Ungarn 56.000 und in Tschechien 71.000, beides Staaten mit rund 10 Millionen Einwohnern.38