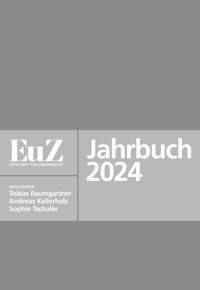
EuZ - Zeitschrift für Europarecht - Jahrbuch 2024 E-Book
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Jahrbuch umfasst die Leitartikel der EuZ – Zeitschrift für Europarecht aus dem Jahr 2024. Die EuZ berichtet in nunmehr 26. Jahrgängen über die jüngsten Entwicklungen im Recht der EU sowie über die Beziehungen der Schweiz zur EU. Im Rahmen wissenschaftlicher Beiträge analysieren renommierte Experten aktuelle Rechtsfragen in allen wirtschaftsrelevanten Bereichen des EU-Rechts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Verlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)Produktion & Vertrieb: buch & netz (buchundnetz.com)ISBN:978-3-03805-759-8 (Print – Softcover)978-3-03805-760-4 (PDF)978-3-03805-761-1 (ePub)DOI:https://doi.org/10.36862/eiz-euzJB2024Version: 1.00 – 20241202
Dieses Werk ist als gedrucktes Buch sowie als Open-Access-Publikation in verschiedenen Formaten verfügbar:https://eizpublishing.ch/publikationen/euz-zeitschrift-fuer-europarecht-jahrbuch-2024/.
1
Vorwort
Das vorliegende Jahrbuch umfasst die Leitartikel der EuZ – Zeitschrift für Europarecht aus dem Jahr 2024. Die EuZ berichtet im nunmehr 26. Jahrgang über die jüngsten Entwicklungen im Recht der EU sowie über die Beziehungen der Schweiz zur EU. Im Rahmen wissenschaftlicher Beiträge analysieren renommierte Expertinnen und Experten aktuelle Rechtsfragen in allen wirtschaftsrelevanten Bereichen des EU-Rechts.
Seit 2022 wird die EuZ als Open Access-eJournal im Fachverlag des Europa Instituts an der Universität Zürich, „EIZ Publishing“, herausgegeben. Sie erscheint zehnmal jährlich und ist auf der Verlagswebseite (eizpublishing.ch) kostenfrei abrufbar. Die einzelnen Ausgaben des eJournals umfassen neben den im vorliegenden Jahrbuch zusammengeführten Leitartikeln Kurzbeiträge zu aktuellen Entwicklungen in allen wirtschafts- und gesellschaftsrelevanten Bereichen des EU-Rechts und der Beziehungen Schweiz-EU.
Wir danken den Autorinnen und Autoren bestens für Ihre Beiträge und das Vertrauen in unser neues Veröffentlichungsformat, mit dem wir den Verbreitungsradius der EuZ enorm vergrössern konnten.
Zürich, Dezember 2024
Tobias Baumgartner Dr. iur., LL.M., RechtsanwaltAndreas Kellerhals Prof. Dr. iur., LL.M., RechtsanwaltSophie Tschalèr MLaw2
Inhaltsübersicht
Wirklich neutral? Die Rechtsprechung des EuGH zu Kopftuchverboten am Arbeitsplatz auf dem Prüfstein der Grundrechte
Prof. Dr. Maya Hertig Randall
Recht und Regieren der EU in Krisenzeiten – das Exempel „Next Generation EU“
Dr. Christina Neier
Digital Regulation in the European Union
Chayanis Aueamnuay / Carmen Berjón / Stella Galehr / Luca Graf / Prof. Dr. Andreas Heinemann
EU Accession Criteria and Procedures: Up for the Challenge?
Assoc. Prof. Dr. Dorian Jano
On the Reform of the EU Stability and Growth Pact
Prof. Dr. Christos V. Gortsos / Assoc. Prof. Dr. Manolis E. Perakis
Die Regelung der EU-Binnenmarkt verzerrenden drittstaatlichen Subventionen auf dem Prüfstand – Überblick, Praxis und Beurteilung aus Schweizer Perspektive
Dr. Livio Bundi
From Strategic Partner to Systemic Rival? EU-China Relations in Recent Times
Prof. Dr. Ralph Weber
Hydrogen: Legal and regulatory challenges for Switzerland in a global context
Dr. Brigitta Kratz / Prof. Dr. Ilaria Espa
Von Laissez-faire zu Regulierung: Grundlagen der EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (CSDDD)
Prof. Dr. Dr. h.c. Yes¸im M. Atamer / Patrick Wittum
Die Unionsbürgerrichtlinie: Rechtliche Tragweite und Bedeutung für die Schweiz
Prof. Dr. Astrid Epiney
3
Autorenverzeichnis
Prof. Dr. Dr. h.c. Yes¸im M. Atamer, LL.M., Inhaberin des Lehrstuhls für Privat‑, Wirtschafts- und Europarecht sowie Rechtsvergleichung an der Universität Zürich; Direktorin des Zentrum für Regulierung und Vertragsrecht, Universität Zürich.
MLaw Chayanis Aueamnuay, Doktorandin und Assistentin, Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Heinemann für Europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Zürich.
MLaw Carmen Berjón, Doktorandin und Assistentin, Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Heinemann für Handels‑, Wirtschafts- und Europarecht, Universität Zürich.
Dr. iur. Livio Bundi, Rechtsanwalt und Partner, Anwaltskanzlei Bratschi AG, Zürich.
Prof. Dr. Astrid Epiney, Professorin für Europa- und Völkerrecht sowie schweizerisches öffentliches Recht, Universität Freiburg; Geschäftsführende Direktorin des dortigen Instituts für Europarecht, Universität Freiburg.
Prof. Dr. Ilaria Espa, Associate Professor of International Economic Law, Law Institute, Università della Svizzera italiana (USI), Lugano; Senior Research Fellow, World Trade Institute, Universität Bern; Secretary, Swiss Energy Law Association (SELA), Lugano.
MLaw Stella Galehr, LLM (UC Berkeley), Doktorandin und Assistentin, Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Heinemann für Handels‑, Wirtschafts- und Europarecht, Universität Zürich.
Prof. Dr. Christos V. Gortsos, Professor of Public Economic Law, School of Law, National and Kapodistrian University of Athens.
MLaw Luca Graf, LLM (King’s College London), Doktorand und Assistent, Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Heinemann für Handels‑, Wirtschafts- und Europarecht, Universität Zürich.
Prof. Dr. Andreas Heinemann, Inhaber des Lehrstuhls für Handels‑, Wirtschafts- und Europarecht, Universität Zürich.
Prof. Dr. Maya Hertig Randall, Inhaberin des Lehrstuhls für schweizerisches, europäisches und vergleichendes Verfassungsrecht, Universität Genf; Mitglied der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und Co-Direktorin, Certificate of Advanced Studies in Human Rights, Universität Genf.
Assoc. Prof. Dr. Dorian Jano, Jean Monnet Lecturer, University of Amsterdam; Research Fellow, University of Genoa.
Dr. Brigitta Kratz, LL.M., Rechtsanwältin und Partnerin, Badertscher Rechtsanwälte AG, Zürich; Vizepräsidentin, Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom, Bern.
Dr. iur. Christina Neier, Bsc., Habilitandin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Universität Zürich; Lehrbeauftragte, FernUni Schweiz und Universität Luzern.
Assoc. Prof. Dr. Manolis E. Perakis, Associate Professor of European Union Law, School of Law, National and Kapodistrian University of Athens.
Prof. Dr. Ralph Weber, Professor for European Global Studies, Universität Basel.
Mag. iur. Patrick Wittum, Wissenschaftlicher Assistent, Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. h.c. Yes¸im M. Atamer für Privat‑, Wirtschafts- und Europarecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Zürich.
Wirklich neutral? Die Rechtsprechung des EuGH zu Kopftuchverboten am Arbeitsplatz auf dem Prüfstein der Grundrechte
Maya Hertig Randall
Inhalt
EinführungÜbersicht über die Rechtsprechung des EuGHDie Urteile Achbita und BougnaouiDas Urteil Wabe und MüllerDas Urteil S.C.R.L.ProblemfelderDirekte oder indirekte Diskriminierung?MehrfachdiskriminierungRechtfertigung von UngleichbehandlungenRechtfertigungsgrundVerhältnismässigkeitsprüfungSchlussgedankenEinführung
Religiöse Symbole und religiös konnotierte Kleidung sind ein Dauerthema. Insbesondere die „Kopftuchdebatte“ leistet Forderungen nach Verboten mit expansiver Tendenz Vorschub.[1] Standen anfänglich Lehrkräfte an öffentlich Schulen im Vordergrund,[2] richtete sich das Augenmerk später auf den ganzen öffentlichen Sektor,[3] auf Schülerinnen[4] und für weiterreichende Verhüllungsverbote auf den ganzen öffentlichen Raum.[5] In jüngster Zeit hat die Kopftuchdebatte auch den privatrechtlichen Arbeitsmarkt erfasst. Dies wirft die Frage auf, inwiefern private Unternehmen Arbeitnehmenden das Tragen religiöser Symbole oder religiös konnotierter Kleidung untersagen dürfen.[6] Der EuGH hat sich mit dieser Problematik erstmals im Jahr 2017 auseinandergesetzt. Die Urteile Achbita[7] und Bougnaoui[8] der Grossen Kammer stiessen auf grosse mediale Resonanz[9] und wurden auch in der Lehre vielfach und vorwiegend kritisch kommentiert.[10] Zwei Urteile aus dem Jahr 2021 und 2022 boten dem EuGH die Gelegenheit, sich erneut mit Kopftuchverboten in privaten Unternehmen auseinanderzusetzen. Dieser Beitrag geht der Frage nach, inwiefern die beiden jüngeren, ebenfalls von der Grossen Kammer gefällten Urteile – Waabe und Müller (2021)[11] und S.C.R.L. (2022)[12] – die geäusserte Kritik aufgegriffen, Unstimmigkeiten korrigiert und Unklarheiten behoben haben. Er tut dies aus einer schweizerischen Perspektive mit rechtsvergleichenden Bezügen.
Der Rechtsrahmen zum Schutz vor Diskriminierungen hat sich in der EU über einen längeren Zeitraum entwickelt. Einem sektoriellen Ansatz folgend hat der EU-Gesetzgeber zur Verwirklichung der primärrechtlichen Diskriminierungsverbote mehrere Richtlinien erlassen, die Diskriminierungen im privaten Arbeitsleben erfassen. Richtlinie (EU) 2006/54[13] regelt Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, Richtlinie (EU) 2000/43[14] Diskriminierungen beruhend auf Rasse und ethnischer Abstammung, und Richtlinie (EU) 2000/78[15] Diskriminierungen aufgrund weiterer Gründe (Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung und der für diesen Beitrag besonders relevante Diskriminierungsgrund der Religion oder der Weltanschauung).
Im Unterschied zum EU-Recht kennt das schweizerische Recht keinen spezifischen Regelungsrahmen, der gegen Diskriminierungen in privaten Arbeitsverhältnissen umfassenden Schutz gewährt. Das Gleichstellungsgesetz (GIG)[16] beschränkt sich auf Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts. Andere Diskriminierungsgründe, wie ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Alter, Religion oder Weltanschauung werden nicht erfasst. Arbeitnehmende müssen sich mit den allgemeinen arbeitsrechtlichen oder privatrechtlichen Bestimmungen behelfen,[17] die im Lichte der in der Bundesverfassung verankerten Grundrechte, namentlich des Diskriminierungsverbots[18] und der Glaubens- und Gewissensfreiheit,[19] auszulegen sind (sogenannte indirekte Drittwirkung[20]). Forderungen nach einem gesetzlichen Ausbau des Diskriminierungsschutzes ist bisher, trotz mehrfacher Kritik seitens internationaler Menschenrechtsorgane, kein Erfolg beschieden.[21] Es ist jedoch zu erwarten, dass sie wieder auf das politische Tapet kommen. Der europäische Regelungsrahmen, einschliesslich dessen Auslegung durch den EuGH, kann in diesem Kontext – sowohl positiv als auch negativ – einen Referenzpunkt für die Weiterentwicklung des Diskriminierungsschutzes in der Schweiz darstellen. Zudem bildet die europäische Rechtsprechung auch ausserhalb einer staatsvertraglichen Berücksichtigungspflicht[22] eine Inspirationsquelle für die schweizerischen Gerichte[23] und kann die Argumentation in arbeitsrechtlichen Diskriminierungsfällen oder in anderen Streitigkeiten im Zusammenhang mit religiösen Symbolen beeinflussen. So hat das Bundesgericht auf das Urteil Müller und Waabe in seinem Urteil vom 23. Dezember 2021 zum Genfer Laizitätsgesetz Bezug genommen,[24] das Staatsangestellten untersagt, ihre Religionszugehörigkeit durch äusserliche Zeichen öffentlich zu bekunden.
Ergänzend zum schweizerischen Recht stellt dieser Beitrag auch rechtsvergleichende Bezüge her. Sie dienen einer besseren Einordnung und kritischen Würdigung der besprochenen Urteile. Dabei wird der Blickwinkel auf die universellen Menschenrechtsabkommen ausgeweitet, die häufig im Schatten der EMRK stehen und in der Literatur zu religiösen Symbolen und Kleidungsstücken auf wenig Widerhall gestossen sind.[25]
Der erste Teil des Beitrags gibt einen Überblick über die relevanten Urteile des EuGH, wobei sich die Zusammenfassung der beiden älteren Urteile Bougnaoui und Achbita auf das Wesentliche beschränkt und der Fokus auf die beiden jüngeren Urteile Waabeund Müller und S.C.R.L. gerichtet wird. Im zweiten Teil werden einige kontroverse Problemfelder näher beleuchtet. Der Beitrag schliesst mit Überlegungen zur europäischen Rechsprechung und zum Diskriminierungsschutz in der Schweiz.
Übersicht über die Rechtsprechung des EuGH
In allen vier Urteilen, in denen sich der EuGH bisher mit Verboten religiöser Symbole und religiös konnotierter Kleidungsstücken am Arbeitsplatz auseinandergesetzt hat, ging es um Arbeitnehmerinnen muslimischen Glaubens, die sich weigerten, am Arbeitsplatz auf das Tragen des Kopftuches zu verzichten. In den ersten drei Urteilen (Achbita, Bougnaoui,Wabe und Müller) betraf die arbeitsrechtliche Streitigkeit die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Im letzten Urteil (S.C.R.L.) wurde eine Diskriminierung bei der Anstellung geltend gemacht. In den verschiedenen Vorabentscheidungsverfahren ging es im Wesentlichen um die Frage, ob die jeweiligen Kopftuchverbote eine Diskriminierung im Sinne der Richtlinie 2000/78 darstellten. Letztere bezweckt die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf und ergänzt den in den anderen oben genannten Richtlinien vorgesehenen Diskriminierungsschutz aufgrund anderer Diskriminierungsgründe, namentlich des Geschlechts sowie der Rasse und der ethnischen Herkunft.[26]
Die Richtline (EU) 2000/78 erfasst sowohl direkte als auch indirekte Diskriminierungen.[27] Die Unterscheidung zwischen den beiden Diskriminierungsformen ist insofern bedeutsam, als an die Zulässigkeit von mittelbaren Ungleichbehandlungen weniger hohe Anforderungen gestellt werden als im Fall von unmittelbaren Ungleichbehandlungen. Im ersten Fall sind die Rechtfertigungsgründe sehr offen formuliert (Vorliegen eines rechtmässigen Ziels),[28] während sie im zweiten Fall abschliessend geregelt und eng gefasst sind.[29] Keine direkte Diskriminierung liegt vor, wenn sich die Ungleichbehandlung auf ein mit einem Diskriminierungsgrund zusammenhängendes Merkmal stützt, das eine „wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt“.[30]
Die Urteile Achbita und Bougnaoui
Im Fall Achbita stütze sich die Kündigung der Arbeitnehmerin, einer Rezeptionistin, auf eine interne Bestimmung, welche das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens am Arbeitsplatz verbietet. Das Neutralitätsgebot galt anfänglich als ungeschriebene Regel und wurde nach Frau Achbitas Weigerung, das Kopftuch abzulegen, als interne Regel verabschiedet. Im Fall Bougnaoui erging die Kündigung infolge von Beschwerden eines Kunden, der sich am Kopftuch der Softwaredesignern gestört hatte. Dabei war es unklar, ob sich die Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf eine analoge interne Regelung wie im Fall Achbita stützen konnte.
Für den Gerichtshof ist das Vorliegen eines internen Neutralitätsgebots massgebend für die Qualifizierung der Diskriminierung. Fehlt eine Neutralitätsgebot (ein mögliches Szenario im Fall Bougnaoui), stellt die Kündigung eine direkte Diskriminierung aufgrund der Religion dar. Im gegenteiligen Fall verneint der Gerichtshof eine direkte Diskriminierung mit der Begründung, das Neutralitätsgebot komme auf alle religiösen, weltanschaulichen und politischen Zeichen unterschiedslos und undifferenziert zur Anwendung, wodurch alle Arbeitnehmenden gleichbehandelt würden. Die entsprechende Neutralitätspolitik könne jedoch eine mittelbare Diskriminierung darstellen, wenn erwiesen sei, dass sie tatsächlich Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung in besonderer Weise benachteiligt. Trifft dies zu, ist die faktische Ungleichbehandlung zulässig, wenn sie ein rechtmässiges Ziel verfolgt, angemessen und notwendig ist.[31] Die Neutralitätsregel wertet der Gerichtshof als ein rechtmässiges Ziel, mit dem Hinweis, der Wunsch, der Kundschaft ein Bild der Neutralität zu vermitteln, gehöre zur unternehmerischen Freiheit, die in Art. 16 der Grundrechtecharta verbrieft ist. Das Erfordernis der Angemessenheit sei erfüllt, sofern die Neutralitätspolitik tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise verfolgt werde. Erforderlich sei die Anwendung der Neutralitätsregel, wenn sie sich auf das unbedingt Erforderliche beschränke. Dies bedingt, dass sie sich nur an Arbeitnehmende richtet, die mit Kundschaft in Kontakt treten, und geprüft wird, ob den betroffenen Angestellten unter Berücksichtigung der unternehmerischen Zwänge und ohne zusätzliche Belastung eine Stelle ohne Kundenkontakt angeboten werden könne, anstatt sie zu entlassen.
Im Fall Bougnaoui hatte der Gerichtshof die Frage zu beantworten, ob der Wille der Arbeitgeber*in, den Wünschen der Kundschaft nachzukommen und Arbeitsleistungen nicht mehr von einer Arbeitnehmerin mit Kopftuch ausführen zu lassen, einer „wesentlichen und entscheidenden beruflichen Anforderung“ entspricht, die eine direkte Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Der Gerichtshof hielt fest, solche Anforderungen seien nur unter sehr begrenzten Bedingungen anzunehmen und müssten von der Art der betreffenden beruflichen Tätigkeit oder den Bedingungen ihrer Ausübung objektiv vorgegeben sein. Subjektive Erwägungen, wie der Wille der Arbeitgeber*in, besonderen Kundenwünschen zu entsprechen, seien nicht erfasst.
Das Urteil Wabe und Müller
Dem Urteil Wabe und Müller lagen zwei arbeitsrechtliche Streitigkeiten zugrunde. Die erste betraf eine in einer Kindertagesstätte angestellte Heilerziehungspflegerin, die zweite eine Kassiererin und Verkaufsberaterin in einer Drogeriemarktkette. In beiden Fällen berief sich die arbeitgebende Partei auf ihre Neutralitätspolitik, die jedoch unterschiedlich ausgestaltet war.
In der Rechtssache Wabe hatte der Arbeitgeber, ein überparteilicher und überkonfessioneller Verein, der Kindertagesstätten betreibt, eine „Dienstanweisung zur Einhaltung des Neutralitätsgebots“ verabschiedet, die es den Mitarbeitenden vorschrieb, gegenüber Eltern, Kindern und Dritten am Arbeitsplatz keine sichtbaren Zeichen ihrer politischen, weltanschaulichen oder religiösen Überzeugungen zu tragen. Das Verbot erstreckte sich gemäss einem internen Informationsblatt auf Symbole wie das christliche Kreuz, das muslimische Kopftuch oder die jüdische Kippa, und war nebst der muslimischen Mitarbeiterin auch auf eine christliche Angestellte angewendet worden, der es nicht mehr gestattet wurde, ein Kreuz als Halskette sichtbar zu tragen. In der Rechtssache Müller erfasst die firmeninterne Weisung nur „auffällige grossflächige“ Zeichen religiöser, politischer oder weltanschaulicher Natur.
Im Zusammenhang mit der Rechtssache Wabe bestätigte der EuGH seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2017, wonach eine unterschiedslos anwendbare Politik religiöser, weltanschaulicher oder politischer Neutralität keine unmittelbare Diskriminierung darstellt. Die Neutralitätsregel könne zwar Arbeitnehmenden, die religiös gebotenen Bekleidungsvorschriften befolgten, „besondere Unannehmlichkeiten bereiten“[32], führe aber grundsätzlich keine untrennbar mit der Religion oder der Weltanschauung verbundene Ungleichbehandlung ein. Diese Schlussfolgerung stützte der EuGH auf eine Auslegung der in der Richtlinie (EU) 2000/78 aufgezählten Diskriminierungsgründe, die auch „Religion oder Weltanschauung“ umfassen. Diese Gründe seien im Lichte des Diskriminierungsverbotes von Art. 21 der Grundrechtecharta und der in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK) auszulegen. Zum einen seien „Religion oder Weltanschauung“ im Einklang mit Art. 21 der Grundrechtecharta als ein einziger und nicht als zwei unterschiedliche Diskriminierungsgründe zu verstehen, wobei der Grund der Weltanschauung von demjenigen der „politischen oder sonstigen Anschauung“ zu unterscheiden sei und sowohl religiöse als auch auf weltanschauliche oder spirituelle Überzeugungen umfasse. Zum anderen erstrecke sich die Gewissens- und Glaubensfreiheit gemäss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch auf Nichtgläubige (Atheist*innen, Agnostiker*innen, Skeptiker*innen und Gleichgültige). Diese Auslegung führt den EuGH zum Schluss, dass die Neutralitätsregel potenziell jede und jeden erfasse, weil nämlich jede Person eine Religion oder eine Weltanschauung haben könne und sich die Richtlinie nicht auf Ungleichbehandlungen zwischen Menschen mit einer Religion oder Weltanschauung gegenüber Menschen ohne Religion oder Weltanschauung beschränke.
Anders würdigte der Gerichtshof die Neutralitätspolitik der Drogeriekette Müller. Er kam zum Schluss, eine solche Regelung könne nicht nur zu einer indirekten, sondern auch zu einer direkten Diskriminierung führen. Als Begründung führte er an, eine auf „auffällige grossflächige“ Zeichen beschränkte Regelung sei geeignet, Anhänger*innen von Religionen, die das Tragen grosser Kleidungsstücke oder Zeichen, wie z.B. einer Kopfbedeckung vorsehen, stärker zu beeinträchtigen, und könne deshalb auf einem Kriterium beruhen, das mit der Religion oder der Weltanschauung untrennbar verbunden sei. In solchen Fällen würden die betroffenen Arbeitnehmenden wegen ihrer Religion oder Weltanschauung weniger günstig behandelt als andere, was eine unmittelbare Diskriminierung darstelle.
Unbeantwortet liess der Gerichtshof die Frage des vorlegenden Gerichts, ob die Neutralitätspolitik eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstelle, weil sie in der weit überwiegenden Anzahl von Fällen Frauen betreffe. Der EuGH führte hierzu an, der Diskriminierungsgrund aufgrund des Geschlechts sei in der Richtlinie 2000/78 nicht vorgesehen, weshalb er die Frage nicht zu prüfen brauche.
Der Gerichtshof wandte sich in der Folge der Rechtfertigung einer auf der Anwendung der Neutralitätspolitik beruhenden mittelbaren Benachteiligung aufgrund der Religion zu. Seine Argumentation bringt den Willen zum Ausdruck, die Anforderungen an die Rechtfertigung zu erhöhen. Der EuGH hielt eingangs fest, die Bedingungen des Vorliegens eines rechtmässigen Ziels und der Angemessenheit sowie Erforderlichkeit seien eng auszulegen. Danach knüpfte er an seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2017 an und bestätigte unter Berücksichtigung der unternehmerischen Freiheit, dass das Verfolgen einer Neutralitätspolitik grundsätzlich ein rechtmässiges Ziel darstelle, insbesondere wenn sie auf Arbeitnehmende mit Kundenkontakt beschränkt sei. Einschränkend präzisierte er, die Neutralitätspolitik müsse, um die Anforderung der Rechtmässigkeit zu erfüllen, einem wirklichen Bedürfnis der Arbeitgeber*in entsprechen, was letztere nachzuweisen habe.
Zum konkretisierungsbedürftigen Erfordernis eines „wirklichen Bedürfnisses“ enthält das Urteil einige Hinweise. Der EuGH greift die in beiden Rechtssachen aufgeführten Ziele auf, welche die Neutralitätspolitik laut der arbeitgebenden Partei verfolgen sollte, und erwähnt exemplarisch drei Zielsetzungen, die einem „wirklichen Bedürfnis“ entsprechen können.
Erstens kann eine Neutralitätspolitik rechtmässig sein, wenn sie darauf abzielt, Rechte und gerechtfertigte Erwartungen der Kundschaft zu berücksichtigen. Dieses Erfordernis konkretisiert der EuGH sowohl positiv als auch negativ: Rechte und gerechtfertigte Erwartungen sind zum Beispiel das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, und ihr Wunsch, dass ihr Nachwuchs von Personen betreut wird, die im Kontakt mit den Kindern nicht ihre Religion oder Weltanschauung zum Ausdruck bringen. Keine gerechtfertigten Erwartungen liegen in einer Konstellation wie im Fall Bougnaoui vor, in welcher die Kündigung wegen einer Beschwerde eines Kunden ausgesprochen wird und keine interne Neutralitätsregel existiert, oder wie in der Rechtssache Feryn,[33] in welcher der Arbeitgeber gestützt auf angebliche diskriminierende Forderungen der Kundschaft öffentlich erklärte, Arbeitnehmende einer bestimmten Herkunft nicht einstellen zu wollen.
Zweitens kann das von der Drogeriekette Müller angeführte Ziel, soziale Konflikte vermeiden zu wollen, einem wirklichen Bedürfnis der Arbeitgeber*in entsprechen.
Drittens erachtet der Gerichtshof für das Vorliegen eines wirklichen Bedürfnisses als besonders bedeutsam, dass die Arbeitgeber*in ohne eine Neutralitätspolitik nachweislich in ihrer unternehmerischen Freiheit beeinträchtigt würde, da sie „angesichts der Art [ihrer] Tätigkeit oder des Umfelds, in dem diese ausgeübt wird, nachteilige Konsequenzen zu tragen hätte.“
Für den Fall, dass ein auf auffällige grossflächige Zeichen beschränktes Verbot unter Berücksichtigung der Umstände nicht als unmittelbare, sondern als mittelbare Ungleichbehandlung einzustufen sei, machte der Gerichtshof deutlich, dass die Anforderungen an die Rechtfertigung kaum je erfüllt sein dürften. Er hielt fest, dass das Tragen jedes noch so kleinen Zeichens die Eignung der Massnahme beeinträchtige und die Kohärenz der Neutralitätspolitik selbst in Frage stelle.
Anschliessend befasste sich der EuGH mit dem Verhältnis zwischen der Richtlinie und den europäischen Grundrechten einerseits, sowie dem nationalen Recht andererseits. Zum ersten Punkt hielt er anknüpfend an die Urteile aus dem Jahr 2017 fest, dass die Richtlinie im Lichte der in der Grundrechtecharta verbrieften Rechte auszulegen sei. Dies bedinge, dass im Rahmen der Angemessenheitsprüfung die verschiedenen in Rede stehenden Rechte und Freiheiten zu berücksichtigen seien. Dabei führte der Gerichtshof klärend an, dass nebst der unternehmerischen Freiheit (Art. 16 Charta) auch die Gedanken‑, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 10 Charta) zu beachten seien.
Die Frage des Verhältnisses zwischen der Richtlinie und dem nationalen Recht formulierte das vorlegende Gericht in Zusammenhang mit Art. 8 der Richtlinie. Laut dieser Bestimmung enthält die Richtlinie Mindestanforderungen und steht günstigeren nationalen Vorschriften nicht entgegen. Das nationale Gericht wollte wissen, ob diese Bestimmung den nationalen Gerichten die Möglichkeit eröffnet, die auf der innerstaatlichen Ebene verbriefte Religionsfreiheit bei der Prüfung der Angemessenheit einer mittelbaren Ungleichbehandlung zu berücksichtigen. Der EuGH antwortete auf diese Frage, dass die Richtlinie einen allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf festlegt und den Mitgliedstaaten angesichts des fehlenden Konsenses auf Unionsebene hinsichtlich der Stellung der Religion Wertungsspielräume belässt. Die Aufgabe, die Gedanken‑, Weltanschauungs- und Religionsfreiheit in Einklang zu bringen mit den rechtmässigen Zielen, die eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermögen, obliegt in erster Linie den Mitgliedstaaten und ihren Gerichten.
Das Urteil S.C.R.L.
Das Urteil S.C.R.L. vom 22. Oktober 2022 ist das jüngste Urteil des EuGH zum Verbot religiöser Symbole und Kleidungsstücke in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen. Die Klägerin im Ausgangsverfahren hatte sich im Rahmen ihrer Berufsausbildung in Bürokommunikation für ein unentgeltliches Praktikum bei S.C.R.L. beworben. Im Rahmen des Vorstellungsgesprächs wurde der kopftuchtragenden Bewerberin mitgeteilt, ihre Bewerbung werde positiv bewertet, und sie wurde gefragt, ob sie bereit wäre, sich an die unternehmensinterne Neutralitätsregel zu halten. Diese verpflichtete die Arbeitnehmenden dazu „darauf zu achten, dass sie ihre religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugungen, welche diese auch immer sein mögen, in keiner Weise, weder durch Worte noch durch die Kleidung oder auf andere Weise, zum Ausdruck bringen“. Die Bewerberin gab zu verstehen, sie sei nicht gewillt, ihr Kopftuch abzulegen, und könne sich dementsprechend nicht an die Neutralitätsregel halten. Daraufhin wurde ihr mitgeteilt, ihre Bewerbung würde nicht angenommen. Sie erneuerte in der Folge ihre Bewerbung und bekundete ihre Bereitschaft, eine alternative Kopfbedeckung zu tragen (Mütze, Bandana). Dieser vermittelnde Vorschlag wurde abgelehnt, mit der Begründung, das Tragen jeglicher Kopfbedeckung sei in den Geschäftsräumen verboten.
Die zahlreichen Fragen des vorlegenden Gerichts zielten im Wesentlich darauf ab, den Gerichtshof zu bewegen, seine bisherige Auslegung und Anwendung des Begriffs der direkten Diskriminierung im Zusammenhang mit Verboten religiöser Symbole am Arbeitsplatz zu überdenken und den Spielraum der nationalen Gerichte für einen stärkeren Diskriminierungsschutz gestützt auf das nationale Recht auszuweiten. Dabei ging das vorlegende Gericht von der Annahme aus, der Ansatz des belgischen Rechts, Religion und Weltanschauung als zwei unterschiedliche Diskriminierungsründe zu behandeln, führe für kopftuchtragende muslimische Arbeitnehmerinnen zu einem besseren Schutz.
Der EuGH bestätigte seine bisherige Rechtsprechung, wonach Verbote, die sich auf eine Neutralitätspolitik stützen, keine direkte Diskriminierung darstellen. Seiner Argumentation im Urteil Wabeund Müller folgend anerkannte er, dass den nationalen Gerichten ein Wertungsspielraum zur Berücksichtigung der im nationalen Verfassungsrecht geschützten Religionsfreiheit zugestanden werde, insbesondere hinsichtlich des Ausgleichs der verschiedenen in Rede stehenden Rechte und Interessen. Die Grenzen dieses Spielraums seien jedoch überschritten, wenn der in der Richtlinie 2000/78 vorgesehene einheitliche Diskriminierungsgrund „der Religion oder der Weltanschauung“ auf nationaler Ebene in zwei unterschiedliche Gründe aufgespaltet würde. Ein solcher Ansatz würde „die praktische Wirksamkeit des allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf beeinträchtigen“[34], weil er dazu führen würde, „Untergruppen von Arbeitnehmern zu schaffen“.[35]
Auf eine Untergruppe von Arbeitnehmende nahm ein Teil der Vorlagefragen Bezug, in denen das nationale Gericht einen Vergleich zwischen verschiedenen Personengruppen vornahm. Es erblickte eine mögliche Benachteiligung einer „Arbeitnehmerin, die ihre Religionsfreiheit durch das sichtbare Tragen eines (konnotierten) Zeichens, hier eines Kopftuchs, ausüben möchte“ gegenüber mehreren Gruppen, unter anderem Menschen anderer Religionszugehörigkeit oder Arbeitnehmern der gleichen Überzeugung, die sich dafür entscheiden würden, „diese durch das Tragen eines Bartes zu bekunden“[36]. Indem das nationale Gericht den Vergleich auf eine kopftuchtragende Muslimin eingrenzte und diese mit Angehörigen anderer Religionen oder einem Muslim mit Bart verglich, lud es den EuGH implizit dazu ein, sich mit einer Mehrfachdiskriminierung beruhend auf Religion und Geschlecht auseinanderzusetzen. Der EuGH äusserte sich nicht zu dieser Problematik, mit der Begründung, das Geschlecht falle nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78.
Problemfelder
Die oben skizzierte Rechtsprechung wirft viele komplexe Fragen auf, weshalb sich eine Auswahl aufdrängt. Im Folgenden werden einige Problemfelder aufgegriffen, die im Nachgang an die Urteile Achbita und Bougnaoui im Zentrum der Kritik standen und die in den Folgeurteilen Wabe und Müller und S.C.R.L. erneut an den EuGH herangetragen wurden.
Direkte oder indirekte Diskriminierung?
Stellt ein Kopftuchverbot, das sich auf eine firmeninterne Politik der religiösen und weltanschaulichen Neutralität stützt, eine direkte oder indirekte Diskriminierung im Sinne der Richtlinie 2000/78 dar? Diese Frage wird seit den Urteilen aus dem Jahr 2007 kontrovers diskutiert.[37] Der EuGH bestätigt in den Urteilen Wabeund Müller und S.C.R.L. die im Urteil Achbita begründete Rechtsprechung und stuft eine alle religiösen und weltanschaulichen Zeichen umfassende Neutralitätspolitik konsequent als indirekte Diskriminierung ein, sofern sie allgemein und unterschiedslos angewandt wird. Eine auf „auffällige grossflächige“ Zeichen beschränkte Neutralitätspolitik, mit der er sich zum ersten Mal im Urteil Wabeund Müller befasst hat, kann laut EuGH demgegenüber eine direkte Diskriminierung darstellen.
Die Frage der Rechtsnatur der Diskriminierung steht in einem engen Zusammenhang mit der Frage der relevanten Vergleichsgruppe, die in Diskriminierungsfällen nicht selten Schwierigkeiten aufwirft. In den Urteilen Wabeund Müller sowie S.C.R.L. stellte der Gerichtshof klar, Religion und Weltanschauung seien zum einen als ein einziger Diskriminierungsgrund zu verstehen und zum anderen dahingehend auszulegen, dass sie auch Menschen ohne Glauben oder Weltanschauung erfassen (Atheist*innen, Agnostiker*innen, etc.). Diese weite Interpretation bekräftigt das Argument des EuGH, die Neutralitätsregel finde auf alle Arbeitnehmenden unterschiedslos Anwendung, da jede Person eine Überzeugung habe und somit keine Vergleichsgruppe auszumachen sei, die de iure bessergestellt wäre.[38]
Die folgenden Überlegungen werden die in der Lehre bereits umfassend thematisierte Frage der relevanten Vergleichsgruppen nicht aufgreifen.[39] Sie werden das Augenmerk zunächst auf die grundsätzlichere Frage richten, inwiefern eine kategorielle Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Diskriminierung sinnvoll ist, und diese Frage zum Anlass nehmen, auf eine Inkohärenz in der Argumentation des Gerichtshofs im Urteil Wabe und Müller hinzuweisen.
Die Kontroverse, ob die Neutralitätsregel eine direkte oder eine indirekte Diskriminierung darstellt, hängt mit der kategoriellen Unterscheidung zusammen, welche die Richtlinie 2000/78 zwischen den beiden Diskriminierungsformen trifft. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Rechtfertigung von unmittelbaren und mittelbaren Ungleichbehandlungen bringt die Auffassung zum Ausdruck, dass direkte Diskriminierungen schwerwiegender sind als indirekte Diskriminierungen. Als mögliche Kriterien, diesen Schluss zuzulassen, bieten sich die bei der Verabschiedung der Regel verfolgte Absicht und/oder die Auswirkungen der Regel an.[40] Wenn der Gesetzgeber, oder eine Arbeitgeber*in, direkt an ein verpöntes Merkmal anknüpft, kann argumentiert werden, dies geschehe mit der Absicht, oder zumindest mit dem Wissen, eine geschützte Personengruppe zu benachteiligen und auszugrenzen. Die explizite Anknüpfung an einen Diskriminierungsgrund, oder an ein mit ihm direkt verbundenes Merkmal,[41] hat zur Folge, dass Menschen, die dieses Merkmal nicht aufweisen, alle verschont bleiben und sich die negativen Auswirkungen auf die direkt betroffene Gruppe konzentrieren: Eine Regel, die Frauen die Ausübung eines bestimmten Berufs untersagt, nimmt wissentlich und willentlich Frauen ins Visier und wirkt sich auch nur auf Frauen aus. Eine Bestimmung, die Teilzeitbeschäftigte gegenüber Vollzeitbeschäftigten schlechterstellt, benachteiligt angesichts der sozialen Wirklichkeit Frauen, doch nicht ausschliesslich: Männer, die Teilzeit arbeiten, sind auch erfasst. Weil die Auswirkungen einer generell abstrakten Norm auf verschiedene Personengruppen nicht immer einfach vorherzusehen sind, kann auch nicht ohne Weiteres eine diskriminierende Absicht gegenüber der betroffenen Gruppe unterstellt werden.
Die Übergänge zwischen diesen beiden Konstellationen sind jedoch fliessend.[42] Dies kann beispielhaft anhand des Verbots der Ganzkörperverhüllung illustriert werden, mit dem sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Urteil S.A.S. gegen Frankreich[43] und der Menschenrechtsausschuss in der Beschwerde Sonya Yeker gegen Frankreich befasst haben.[44] Die französische Regierung unterstrich, das Verbot sei allgemein formuliert und nicht auf den Niqab oder die Burka beschränkt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte diesem Argument eine gewisse Relevanz zugestanden.[45] Demgegenüber unterzog der Menschenrechtsausschuss die französische Bestimmung einer genaueren Prüfung und berücksichtigte nebst ihrem Wortlaut auch den gesamten Kontext. Er unterstrich zum einen, dass das in Rede stehende Gesetz zahlreiche Ausnahmen vorsieht (z.B. für Gesichtsverhüllungen aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen, oder im Zusammenhang mit Sport, künstlerischen oder traditionellen Feiern oder Veranstaltungen) und letztlich de facto kaum mehr als die islamische Vollverschleierung erfasst. Hinzu kommt, dass das Verbot in erster Linie gegenüber Frauen mit voller Gesichtsverhüllung durchgesetzt wird. Die der Verabschiedung des Gesetzes vorangehenden Debatten liessen auch darauf schliessen, dass es bei dem Verbot um den islamischen Vollschleier geht und es sich dementsprechend gegen muslimische Frauen richtet, die diese Form der Verschleierung tragen. Die Analyse des Menschenrechtsausschusses zeigt, dass sich das französische Gesichtsverhüllungsverbot unter dem Blickwinkel der verfolgten Absicht und der Auswirkungen kaum von einer direkten Diskriminierung unterscheiden lässt.
Weil die Übergänge zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen fliessend sind, ist eine kategorielle Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Diskriminierung und den damit einhergehenden unterschiedlichen Anforderungen an die Rechtfertigung, wie sie die Richtlinie 2000/78 vorsieht, nicht unproblematisch. Bestrebungen, den gesetzlichen Diskriminierungsschutz in der Schweiz zu verstärken, sollten diesen Schwierigkeiten Rechnung tragen und die europäische Regelung in diesem Punkt als Inspirationsquelle kritisch hinterfragen. Gefordert sind auch die Gerichte: die pauschalisierende, implizite Annahme, direkte Ungleichbehandlungen seien schwerwiegender als indirekte Ungleichbehandlungen, darf nicht dazu verleiten, dass die Rechtfertigung von mittelbaren Ungleichbehandlungen keiner stringenten Prüfung unterzogen wird. Auf die Frage, inwiefern der Gerichtshof dieses Defizit des Urteils Achbita in den jüngeren Urteilen korrigiert hat, ist später zurückzukommen.[46]
Im Folgenden ist einer weiteren Frage nachzugehen, welche die Folgerechtsprechung aufwirft: Ist die vom Gerichtshof getroffene Unterscheidung zwischen einer alle sichtbaren Zeichen umfassenden Neutralitätsregel und einer, die auf auffällige grossflächige Zeichen beschränkt ist, kohärent? Dem Gerichtshof ist insofern zuzustimmen, dass ein partielles Verbot zahlreiche Fragen aufwirft, die sich auch für analoge staatliche Regelungen stellen (wie das französische Gesetz, welches das Tragen ostentativer religiöser Zeichen oder Kleidungsstücke verbietet[47]). Die Begriffe „auffällig“ und „grossflächig“ sind unbestimmt und dementsprechend unter dem Blickwinkel der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit problematisch. Verstärkend tritt hinzu, dass das, was als „auffällig“ gilt, kulturell geprägt ist und von der Mehrheitsgesellschaft abhängt. Als auffällig wird wahrgenommen, was im Lichte der dominanten Kultur unvertraut ist – das islamische Kopftuch, der Turban des Sikhs, die jüdische Kippa, nicht jedoch das christliche Kreuz. Damit entfaltet ein partielles Verbot gegenüber religiösen Minderheiten ein erhebliches Ausgrenzungspotenzial und ist ähnlich wie das französische Gesichtsverhüllungsverbot unter dem Gesichtspunkt sowohl der Absicht als auch der Auswirkungen problematisch. Eine auf auffällige grossflächige Zeichen beschränkte Regel legt einerseits den Verdacht nahe, dass sie bewusst konzipiert wurde, um religiöse Zeichen der Mehrheitsgesellschaft nicht zu tangieren. Andererseits ist sie in den Worten des EuGH geeignet „Personen, die religiösen oder weltanschaulichen Strömungen anhängen, die das Tragen eines grossen Kleidungsstücks oder Zeichens, wie beispielsweise einer Kopfbedeckung, vorsehen, stärker zu beeinträchtigen.“[48] Aus diesem Grund beruht die Regel laut dem EuGH auf einem Kriterium, das mit dem geschützten Grund – demjenigen der Religion oder der Weltanschauung – „untrennbar verbunden“ ist.[49] Sie ist deshalb „als unmittelbar auf diesen Grund gestützt“[50] anzusehen.
Bei der Argumentation des EuGH stehen die konkreten Auswirkungen des Verbots „auffälliger grossflächiger“ Zeichen im Vordergrund. Die Regel betrifft Angehörige gewisser Religionen überproportional, doch nicht ausschliesslich. Sie würde auch den theoretischen Fall eines Christen oder einer Christin erfassen, die einen überdimensionierten Anhänger eines Kreuzes tragen würden. Die Regel ist in diesem Sinn auch „unterschiedslos“ anwendbar, ein Kriterium, auf welches sich der EuGH gestützt hat, um eine umfassende Neutralitätsregel als mittelbare Diskriminierung zu qualifizieren. Wird auf die Auswirkungen der Regel abgestellt, wie das der EuGH im Urteil Wabeund Müller tut, erscheint eine kategorielle Unterscheidung zwischen einer umfassenden und einer partiellen Neutralitätsregel fragwürdig.[51] Ein alle sichtbaren Zeichen erfassendes Verbot ist auch geeignet, „Personen, die religiösen oder weltanschaulichen Strömungen anhängen, die das Tragen eines [grossen] Kleidungsstücks oder Zeichens, wie beispielsweise einer Kopfbedeckung, vorsehen, stärker zu beeinträchtigen“. Im vorstehenden, zitierten Satz wird eine Unterscheidung getroffen zwischen Religionen, welche für die Gläubigen Kleidervorschriften vorsehen, und solchen, die diese Frage nicht normieren.[52] Nur ein verschwindend kleiner Teil von Menschen christlicher Konfession erachtet das sichtbare Tragen eines Symbols als eine religiöse Vorschrift, im Unterschied z.B. zu muslimischen Frauen, jüdischen Männern oder Sikhs. Hinzu kommt, dass diese religiös vorgeschriebenen Zeichen (Kopftuch, Kippa, Turban) in unserem Kulturkreis als „auffällig“ wahrgenommen werden, so dass die Auswirkungen eines beschränkten Neutralitätsgebots und eines umfassenden, auf alle sichtbaren Zeichen anwendbaren Verbots, praktisch identisch sind. Wird auf die Absicht abgestellt (was der EuGH in seinem Urteil nicht tut), liegt der Schluss nahe, dass die allgemein formulierte Neutralitätsregel im heutigen sozialen Kontext in der Regel auf das islamische Kopftuch abzielt. Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass in allen vom EuGH beurteilten Rechtssachen muslimische Frauen betroffen waren. Eine kontextualisierte Analyse, anstatt eine formalistische Betrachtungsweise, legt auch eine Prüfung des Neutralitätsgebots im Lichte der Mehrfachdiskriminierung nahe.
Mehrfachdiskriminierung
Eine häufig geäusserte Kritik an den Urteilen Achbita und Bougnaoui beanstandet, dass sich die Analyse des Gerichtshofs auf einen einzelnen Diskriminierungsgrund (Religion und Weltanschauung) beschränkt hat und die Neutralitätsregel nicht auch im Lichte anderer Kriterien (Geschlecht und ethnische Herkunft) geprüft hat.[53] Bei einer solchen Prüfung geht es nicht darum, diese Diskriminierungsgründe voneinander losgelöst sukzessive zu analysieren, sondern im Sinne der Theorie der Intersektionalität das Zusammenwirken der verschiedenen Kriterien zu berücksichtigen.[54] Die Interaktion zwischen dem Kriterium der Religion, des Geschlechts und der ethnischen Herkunft produziert spezifische Stereotypen, die sich nicht auf die Summe der mit jedem einzelnen Kriterium verbundenen Vorurteile reduzieren lassen. Kopftuchverbote zum Beispiel gründen auf verschiedenen, miteinander verbundenen Vorstellungen. Sie evozieren das Bild der unterworfenen, rückständigen islamischen Frau, die sich grundlegend von der selbstbestimmten, gleichgestellten Frau unseres Kulturkreises unterscheidet. Das Kopftuch als Symbol für Fundamentalismus und Terrorismus ist auch ein verbreitetes Bild. Diese spezifischen Stereotypen und die mit ihnen einhergehenden Ausgrenzungstendenzen bleiben teilweise im Dunkeln, wenn Neutralitätsgebote sukzessive im Lichte verschiedener Kriterien analysiert werden. Eine isolierte Betrachtungsweise kann auch dazu führen, dass die Diskriminierung gar nicht erkannt wird.[55]
In den Urteilen Wabeund Müller und S.C.R.L. ergriff der Gerichtshof nicht die Gelegenheit, sich mit dem Problemkreis der Mehrfachdiskriminierung auseinanderzusetzen. Im ersten Urteil wich er dieser Fragestellung aus mit der Begründung, die in Rede stehende Richtlinie (EU) 78/2000 sei auf den in einer anderen Richtlinie vorgesehenen Diskriminierungsgrund des Geschlechts nicht anwendbar. In der Lehre wurde aufgezeigt, dass ein sektorieller Regelungsrahmen, wie ihn das Gemeinschaftsrecht kennt, eine intersektionelle Analyse durchaus zulässt.[56] Die Argumentation des Gerichtshofs zeigt jedoch, dass ein sektorieller Ansatz in der Praxis einer holistischen, alle Diskriminierungsgründe erfassenden Prüfung abträglich sein kann,[57] weil es nicht auf der Hand liegt, drei unterschiedliche Richtlinien im gleichen Fall beizuziehen.[58] Diese praktische Schwierigkeit sollte in der Schweiz berücksichtigt werden. Regelungsansätze, den Diskriminierungsschutz im Arbeitsleben durch die Verabschiedung eines neuen, das Gleichstellungsgesetz ergänzenden Gesetzes zu verstärken, wären einer intersektionellen Analyse nicht förderlich.
Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die Gerichte bisher nur zögernd mit Mehrfachdiskriminierungen befasst haben. Dies trifft sowohl auf den EuGH als auch auf das schweizerische Bundesgericht zu. Im Hinblick auf die europäische Rechtsordnung ist dies insofern erstaunlich, als die Problematik bereits stärker thematisiert wurde als in der Schweiz.[59]
Die Rechtsprechung zur Intersektionalität ist zwar spärlich, doch nicht inexistent. Interessante Ansätze finden sich zum Beispiel in der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts und des Menschenrechtsausschusses.[60] In einem Urteil vom 27. Januar 2015 hatten sich die Richter*innen aus Karlsruhe mit der Entlassung von zwei muslimischen, kopftuchtragenden Frauen, einer Lehrerin und einer Sozialpädagogin, auseinanderzusetzen.[61] Sie würdigten die auf ein landesweites gesetzliches Verbot religiöser Bekundungen gestützte Kündigung in beiden Fällen als eine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Dem Diskriminierungsverbot kam letztlich kein über die Religionsfreiheit hinausgehender Schutzgehalt zu. Dennoch ist es nennenswert, dass das Bundesverfassungsgericht festhielt, aufgrund des Verbots würden „derzeit faktisch vor allem muslimische Frauen von der qualifizierten beruflichen Tätigkeit als Pädagoginnen ferngehalten“,[62] weshalb die gesetzliche Regelung „zugleich in einem rechtfertigungsbedürftigen Spannungsverhältnis zum Gebot der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen“[63] steht. Bei Frauenberufen ist eine solche Mehrfachdiskriminierung besonders plausibel. Dazu gehören nebst der Lehrtätigkeit auf der Unterstufe, mit der sich das Bundesverfassungsgericht auseinandergesetzt hat, auch die Kleinkinderbetreuung und -erziehung, um die es im der Rechtssache Wabe ging. Auch bei den Berufen, die in der Rechtssache Achbita (Rezeptionistin) und Müller (Verkäuferin in einer Drogeriekette) betroffen waren, dürften Frauen überproportional vertreten sein.
Einen Schritt weiter als das Bundesverfassungsgericht geht die Analyse des Menschenrechtsausschusses, der in zwei Entscheiden explizit die Problematik der Intersektionalität aufgreift und nebst der Verletzung der Religionsfreiheit auch eine Mehrfachdiskriminierung gegenüber muslimischen Frauen feststellt. In der Entscheidung F.A. gegen Frankreich hatte sich der Menschenrechtsausschuss mit einer ähnlichen Problematik zu befassen wie der EuGH in der Rechtssache Wabe.[64] Es ging auch um eine muslimische Frau, die in einer privaten Kindertagesstätte als Erzieherin angestellt war und deren Arbeitsverhältnis wegen Verstoss gegen die interne Neutralitätsregel gekündigt wurde. Dabei handelte es sich um ein partielles, auf „auffällige“ Symbole beschränktes Gebot. In dieser unter dem Namen „Baby Loup“ stark mediatisierten Rechtssache analysierte der Menschenrechtsausschuss die Kündigung und die ihr zugrundeliegende Neutralitätsregel auch im Lichte des Diskriminierungsverbots. Er folgte den Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach das Neutralitätsgebot das islamische Kopftuch überproportional betreffe und gab der Befürchtung Ausdruck, die Auswirkungen der Regel auf das Gefühl der Ausgrenzung und Marginalisierung der betroffenen Gruppe könnten den angestrebten Zielen zuwiderlaufen. Nach einer Prüfung der vorgebrachten Rechtfertigungsgründe kam es zum Schluss, die Kündigung sei mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit unvereinbar und stelle eine Mehrfachdiskriminierung („intersectional discrimination“) gestützt auf das Geschlecht und die Religion dar. Zum gleichen Befund kam er aufgrund einer analogen Argumentation in der bereits erwähnten Entscheidung zum französischen Gesichtsverhüllungsverbot im öffentlichen Raum.[65]
Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen
Einer der Hauptkritikpunkte der Urteile Achbita und Bougnaoui richtete sich auf die Rechtfertigungsebene. Wie es Eleanor Sharpston in ihrer „Shadow Opinion“ zum Urteil Wabeund Müller hervorhebt, birgt die kategorielle Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Diskriminierungen die Gefahr, dass mittelbare Ungleichbehandlungen, wie sie laut EuGH religiöse und weltanschauliche Neutralitätsregeln darstellen können, keiner stringenten Prüfung unterzogen werden.[66] Dieses Risiko betrifft sowohl den Rechtfertigungsgrund als auch die Verhältnismässigkeitsprüfung. Die Folgeurteile greifen diese Kritik auf. Der Frage, inwiefern es gelungen ist, die von Generalanwältin Sharpston beanstandete Schutzlücke („legal black hole“) zu schliessen, wird im Folgenden nachgegangen.
Rechtfertigungsgrund
Während bei direkten Diskriminierungen laut Richtlinie (EU) 2000/78 nur klar umschriebene, abschliessend aufgeführte Rechtfertigungsgründe in Frage kommen, sind die Anforderungen bei indirekten Diskriminierungen offen formuliert (Vorliegen eines rechtmässigen Ziels).[67] Eine Neutralitätspolitik, wie sie in den besprochenen Urteilen in Rede steht, kommt als Rechtfertigungsgrund für unmittelbare Diskriminierungen nicht in Frage. Sie wurde aber vom EuGH als „rechtmässiges Ziel“ anerkannt, das Arbeitgebende geltend machen können, um eine mittelbare Diskriminierung zu rechtfertigen.
Neutralität ist ein positiv konnotiertes Konzept. Es ist mit Vorstellungen von Objektivität verknüpft und dürfte deshalb intuitiv kaum je mit einer diskriminierenden Praxis assoziiert werden. Die positive Aufladung des Neutralitätsbegriffs hat vielleicht dazu geführt, dass der EuGH dieses Konzept kaum hinterfragt und ohne kritische Analyse als legitimen Rechtfertigungsgrund anerkannt hat. Der Begriff der konfessionellen Neutralität hat seinen Ursprung im Verfassungsrecht und richtet sich gegen den Staat.[68] Die Übertragung auf private Unternehmen ist keine Selbstverständlichkeit und hätte einer Begründung bedurft.[69] Wenn der Neutralitätsbegriff auf private Unternehmen ausgeweitet wird, stellt sich wie bei der staatsbezogenen Neutralitätskonzeption die Frage, was eigentlich unter Neutralität zu verstehen ist. Neutralität ist nämlich nicht nur ein positiv konnotiertes, sondern auch ein komplexes und schwer fassbares Konzept, dessen Inhalt in verschiedenen Rechtsordnungen anders verstanden wird. Dies lässt sich anhand der Rechtslage in Frankreich und Deutschland veranschaulichen.
Gemäss der französischen laizistischen Neutralitätskonzeption, die auf einer strengen Trennung von Kirche und Staat gründet, ist es Staatsangestellten untersagt, religiöse Symbole oder Kleidungsstücke zu tragen. Die Neutralität tendiert zum einen dazu, Religion in der öffentlichen Sphäre unsichtbar zu machen und in die Privatsphäre zu verdrängen.[70] Zum anderen wird von der Annahme ausgegangen, dass das Tragen von religiösen Kennzeichen direkt dem Staat zuzurechnen ist. Angestellte mit Kippa oder Kopftuch bringen demnach ein staatliches Bekenntnis zugunsten dieser Religionen zum Ausdruck.
Anders sieht dies das Bundesverfassungsgericht, ausgehend von einer Neutralitätskonzeption, die „nicht als eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen [ist], sondern als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung“[71]. Neutralität bedingt, dass der Staat grundsätzlich als Arbeitgeber Personen verschiedener Konfessionen offensteht. Wenn er das Tragen konfessioneller Zeichen zulässt, macht sich der Staat laut Bundesverfassungsgericht die damit verbundene Aussage „nicht schon dadurch zu seiner eigenen und muss sie sich auch nicht als von ihm beabsichtigt zurechnen lassen.“[72] Es gilt zu unterscheiden zwischen der Konstellation, in welcher religiöse Zeichen auf Veranlassung des Staates verwendet werden und Fällen, in welchen ein konfessionelles Symbol oder Kleidungsstück aufgrund einer eigenen Entscheidung der einzelnen Person verwendet wird, die sich im Unterschied zum Staat als Individuum auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen kann. Nach dieser Konzeption ist der Staat neutral, wenn er die Ausübung der Religionsfreiheit durch Kleidungsvorschriften grundsätzlich toleriert. Werden diese Überlegungen auf private Unternehmen übertragen, lässt sich durchaus argumentieren, das Neutralitätsgebot erfordere eine für die Ausübung der Religionsfreiheit offene Haltung der Arbeitgebenden. Die Auffassung, das Unternehmen mache sich die Konfession seiner Angestellten zu eigen, wenn es das Tragen religiöser Zeichen erlaubt, dürfte in den meisten Fällen wenig plausibel sein, dies umso mehr, wenn das äussere Erscheinungsbild der Angestellten auf unterschiedliche Religionszugehörigkeiten schliessen lässt und/oder wenn eine religiöse Minderheit betroffen ist. Der Autorin dieses Beitrags ist es jedenfalls nicht in den Sinn gekommen, beim Besuch eines grossen Möbelhauses aufgrund der Anwesenheit einer Kassiererin mit Kopftuch darauf zu schliessen, die internationale Möbelkette habe sich den Islam zu eigen gemacht.
Bei Neutralitätsgeboten am privaten Arbeitsplatz dürften in der Regel andere Beweggründe vorliegen als bei der staatlichen Neutralität. Die Argumentation des EuGH macht dies deutlich, indem er das Neutralitätsgebot mit der unternehmerischen Freiheit in Verbindung bringt. Hier setzen eine erhebliche Anzahl von kritischen Stimmen an.[73] Firmen dürften in den meisten Fällen eine Neutralitätspolitik aus wirtschaftlichen Gründen einführen, um den – realen oder vermeintlichen – Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Unterscheidung, die der Gerichtshof in den Urteilen Achbita und Bougnaoui getroffen hat, erscheint vor diesem Hintergrund formalistisch und wenig kohärent. In Bougnaoui wird unterstrichen, dass eine Kündigung wegen Tragens eines Kopftuches bei Fehlen einer Neutralitätspolitik eine direkte Diskriminierung darstellt, die keiner Rechtfertigung zugänglich ist. Subjektive Erwägungen, namentlich der Wille der Arbeitgeber*in, besonderen Kundenwünschen zu entsprechen, sind irrelevant. Gleichzeitig ist es aber möglich, dieselben, realen oder vermeintlichen Kundenwünsche zu antizipieren und das Tragen eines Kopftuches gestützt auf eine allgemein formulierte Neutralitätsregel zu untersagen, weil letztere nur zu einer mittelbaren Diskriminierung führen kann und deshalb die Rechtfertigungsgründe weiter gefasst sind als bei direkten Ungleichbehandlungen. Wie es Sharpston hervorhebt, drängt sich ein strenger Prüfungsmassstab sowohl für direkte als auch für indirekte Diskriminierungen auf: „To do otherwise risks opening the door too readily to easy claims by shrewd employers that, because they naturally wish to present an image of strict neutrality in order to run their businesses profitably (and have been intelligent enough to formulate this desire as a clearly articulated element of their corporate policy and rule-book for employees), the resulting indirect discrimination is not discrimination at all, because it is objectively justified.“[74]
Im Urteil Wabe und Müller trägt der Gerichtshof diesen Vorbehalten Rechnung, indem er festhält, dass die Neutralitätsregel für sich allein nicht ausreicht, um eine mittelbare Ungleichbehandlung zu rechtfertigen, und verlangt, dass sie einem „wirklichen Bedürfnis“ der Arbeitgeber*innen entspricht. Es obliegt der arbeitgebenden Partei, dieses Bedürfnis nachzuweisen. Diese Auslegung ist in den Worten des Gerichthofs „von dem Bestreben geleitet, grundsätzlich Toleranz und Respekt sowie die Akzeptanz eines größeren Masses an Vielfalt zu fördern und zu verhindern, dass die Einführung einer Neutralitätspolitik innerhalb eines Unternehmens zum Nachteil von Arbeitnehmern missbraucht wird, die religiöse Gebote beachten, die das Tragen einer bestimmten Bekleidung vorschreiben.“[75]
Der Gerichtshof führt beispielhaft einige Konstellationen an, in denen das Erfordernis eines „wirklichen Bedürfnisses“ seiner Meinung nach erfüllt ist. Die verschiedenen Beispiele sind jedoch konkretisierungs- und auslegungsbedürftig, weshalb es nicht einfach abzuschätzen ist, inwiefern die Präzisierung der Rechtsprechung in der Zukunft eine eingrenzende Wirkung entfalten wird.
Der Gerichtshof erkennt zunächst, eine Neutralitätspolitik im Interesse der Rechte und gerechtfertigten Erwartungen der Kundschaft als legitim an. Beispielhaft nennt er das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen. Diese Argumentation ähnelt derjenigen des Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Entscheid Dahlab gegen Schweiz.[76] Sie beruht auf der Annahme, dass kleine Kinder besonders beeinflussbar sind und dass die Konfrontation mit einem religiösen Symbol tatsächlich eine gewisse bekehrende Wirkung hat, oder zumindest haben könnte.[77] Nebst dem Erziehungsrecht der Eltern wird meistens auch die negative Religionsfreiheit der Kinder ins Feld geführt. Dabei wird implizit angenommen, dass das sichtbare Tragen eines religiösen Zeichens einen missionarischen Charakter aufweist. Diese Argumentationslinie ist nicht unbestritten. So hat das deutsche Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass ein effektiver Einfluss des blossen Tragens eines religiösen Symbols empirisch nicht dargelegt ist.[78] Des Weiteren gehen die Meinungen darüber auseinander, wann die negative Glaubens- und Gewissensfreiheit effektiv beeinträchtigt ist. Im Urteil Lautsi gegen Italien[79] legte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schwelle hoch an. Die blosse Präsenz des Kreuzes im Klassenzimmer wertete er als keinen Verstoss gegen die negative Religionsfreiheit. Letztere sei lediglich im Falle einer Indoktrinierung durch die Lehrpersonen tangiert.[80] Demgegenüber sah das Bundesverfassungsgericht in der Pflicht, täglich „unter dem Kreuz“ lernen zu müssen, eine Verletzung der negativen Religionsfreiheit.[81] Für die Güterabwägung zwischen der positiven Religionsfreiheit einer Lehrperson einerseits und der negativen Religionsfreiheit der Schüler*innen andererseits fällt jedoch die blosse Konfrontation mit einem muslimischen Kopftuch nicht genügend ins Gewicht.[82] Erforderlich ist laut Bundesverfassungsgericht eine konkrete Gefährdung der negativen Religionsfreiheit, die lediglich vorliegt, wenn die Lehrperson die Kinder mit anderen Mitteln, namentlich verbal, zu beeinflussen versucht:
Die Einzelnen haben in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt, allerdings kein Recht darauf, von der Konfrontation mit ihnen fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben. (…) Doch ist das Tragen eines islamischen Kopftuchs, einer vergleichbaren Kopf- und Halsbedeckung oder sonst religiös konnotierten Bekleidung nicht von vornherein dazu angetan, die negative Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Schülerinnen und Schüler zu beeinträchtigen. Solange die Lehrkräfte, die nur ein solches äußeres Erscheinungsbild an den Tag legen, nicht verbal für ihre Position oder für ihren Glauben werben und die Schülerinnen und Schüler über ihr Auftreten hinausgehend zu beeinflussen versuchen, wird deren negative Glaubensfreiheit grundsätzlich nicht beeinträchtigt. Die Schülerinnen und Schüler werden lediglich mit der ausgeübten positiven Glaubensfreiheit der Lehrkräfte in Form einer glaubensgemäßen Bekleidung konfrontiert, was im Übrigen durch das Auftreten anderer Lehrkräfte mit anderem Glauben oder anderer Weltanschauung in aller Regel relativiert und ausgeglichen wird. Insofern spiegelt sich in der bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule die religiös-pluralistische Gesellschaft wider.
Eine ähnliche Auslegung der negativen Religionsfreiheit befürwortet das Bundesgericht im Zusammenhang mit einem Kopftuchverbot für Schüler*innen. Es bejahte ein öffentliches Interesse daran, „dass vom Tragen religiöser Symbole einzelner Schüler kein Druck auf Mitschülerinnen und Mitschüler entsteht, solche ebenfalls zu tragen. Umgekehrt reicht der Grundrechtsschutz gegenüber Dritten jedoch nicht so weit, dass er einen Anspruch vermitteln könnte, mit keinen fremden Glaubensbekenntnissen konfrontiert zu werden.“ Analoges gilt für das Erziehungsrecht der Eltern.[83]
Im Urteil Wabeund Müller beschränken sich die Ausführungen des Gerichtshofs zu den Rechten und gerechtfertigten Interessen auf den Sachverhalt des Einzelfalls, d.h. auf das Tragen eines Symbols in einer Kindertagesstätte. Nicht klar ist, inwiefern in anderen Konstellationen die Konfrontation mit einem religiösen Symbol gestützt auf die – weit ausgelegte – negative religiöse Freiheit zulässig wäre. Wäre der Fall einer Privatschule, die ältere Kinder unterrichtet, anders zu beurteilen? Könnte ein Altersheim geltend machen, die Insass*innen seien besonders verletzlich, weshalb es legitim sei, einer Pflegerin das Tragen religiöser Kleidung und Symbole zu untersagen? Ein Argument, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Urteil Ebrahimian gegen Frankreich unter Berücksichtigung des weiten Ermessensspielraums der Mitgliedstaaten nicht hinterfragte.[84]





























