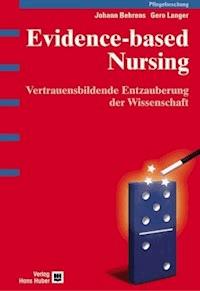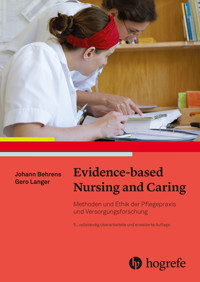
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Evidenzbasierte Pflege anschaulich, verständlich und nachprüfbar. Evidence-based Nursing and Caring (EBN) ist eine Pflegepraxis, die pflegerische Entscheidungen auf wissenschaftlich geprüfte Erfahrungen Dritter ("externe Evidence") und die individuellen Bedürfnisse und Erfahrungen der Pflegebedürftigen und Pflegenden ("interne Evidence") stützt. Sie tut dies aus Respekt vor der Einzigartigkeit des Pflegebedürftigen und schließt die Unterstützung und Förderung pflegebedürftiger Menschen sowie die Sorge um sie (Caring) mit ein. Behrens und Langer zeigen in ihrem erfolgreichen Praxishandbuch, wie Pflegende an evidenzbasiertes Wissen herankommen, wissenschaftliche Ergebnisse beurteilen, nutzen und in die Praxis transferieren können. Sie beschreiben Wege und Verfahren, einschließlich interpretativ-hermeneutischer und statistischer Methoden, und zeigen, wie damit pflegerische Entscheidungen belegt, begründet und ausgeführt werden können. Die fünfte Auflage wurde überarbeitet und erweitert bezüglich der Kapitel Literaturrecherche, Nutzen und Schaden einer Therapie, Hilfen und Verbesserungen durch Digitalisierung sowie der Lösung des Generalisierungsdilemmas. Aus dem Inhalt •Grundlagen - Evidence-based Nursing und die Ethik professionellen eingreifenden Handelns •1. Schritt: Aufträge klären in der Begegnung - Shared Decision Making •2. Schritt: Probleme formulieren •3. Schritt: Literaturrecherche •4. Schritt: Kritische Beurteilung von Studien •5. Schritt: Veränderung der Pflegepraxis (Pflegemanagement-Modell) •6. Schritt: Evaluation von Wirkungsketten - Qualitätsmanagement und Evidence-based Practice.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Johann Behrens
Gero Langer
Evidence-based Nursing and Caring
Methoden und Ethik der Pflegepraxis und Versorgungsforschung
5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Mit Beiträgen von
Gabriele Bartoszek
Doris Eberhardt
Astrid Fink
Julian Hirt
Sylvia Kaap-Fröhlich
Sascha Köpke
Gabriele Meyer
Ralph Möhler
Thomas Nordhausen
Sibylle Reick
Janina Wittmann
Evidence-based Nursing and Caring
Johann Behrens, Gero Langer
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund
Prof. Dr. phil. (habil.) Johann Behrens
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
German Center for Evidence-based Nursing “sapere aude”
Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Magdeburger Strasse 8 – DE 06112 Halle (Saale)
E-Mail [email protected]
PD Dr. rer. medic. Gero Langer
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
German Center for Evidence-based Nursing “sapere aude”
Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Magdeburger Strasse 8 – DE 06112 Halle (Saale)
E-Mail [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z.Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Thomas Sonntag, Martina Kasper, Fabienne Suter
Herstellung: René Tschirren
Umschlag: Martin Glauser, Uttingen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
5., vollst. überarb. u. erw. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag, Bern
© 2004, 2006, 2010, 2016 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96074-6)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76074-2)
ISBN 978-3-456-86074-9
https://doi.org/10.1024/86074-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Dem Andenken von Dorothea und Peter und von Stephan Leibfried, Rainer Müller und Ulrich Oevermann
Für Marlene und Constantin
J. B.
Für Almuth und Fiona.
G. L.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Danksagung
Geleitworte
Evidence-based Nursing im Alltag
Grounded Theory und Evidence-based Practice
Geleitwort zur 3. Auflage
Vorwort zur 4. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Grundlagen: Evidence-based Nursing und die Ethik professionellen eingreifenden Handelns
G.1 Pflege in Verantwortung für ihre Wirkungen
G.1.1 Vertrauen in Zauberkraft, Vertrauen in Wissenschaft
G.1.2 Ethik pflegerischer Problemlösungen und Entscheidungen, interne Evidence und externe Evidence
G.1.3 Problem(an)erkennung und Evaluationsspirale
G.2 Was ist durch Nachprüfung beständig verbessertes Wissen?
G.2.1 Evidenz versus Evidence
G.2.2 Was heißt wissenschaftlich begründet?
G.2.3 Gibt es einen Unterschied zwischen wissenschaftlicher und alltäglicher Nachprüfung?
G.2.4 Argumentieren mit hermeneutisch-interpretativen oder quantitativen Untersuchungsergebnissen
G.2.5 Haben wir einen privilegierten Zugang zum fremden Innersten?
G.2.6 Wissenschaftliche Haltung
G.2.7 Quantitative Verfahren als Teile hermeneutisch-interpretativer Untersuchungen
G.2.8 Handeln nach Gefühl und „tacit knowledge“
G.2.9 Ist Wissenschaft objektiv? Die Bedeutung außerwissenschaftlicher Einflüsse
G.2.10 Schlussbemerkung
G.3 EBN für die Begründung der Pflegewissenschaft als Handlungswissenschaft
G.3.1 Was für eine Wissenschaft ist die Pflegewissenschaft?
G.3.2 Externe Evidence bei Albertus Magnus
G.3.3 Hermeneutische Spirale im Arbeitsbündnis
G.3.4 25 Jahre interne Evidence als gemeinsames Produkt der Begegnung
G.3.5 Zur Kritik an der Evidence-Basierung der Pflege, Therapie und Medizin
G.3.6 Zur Kritik am Aufbau interner Evidence
G.3.7 Erfolge nach 25 Jahren EBP
1 Schritt 1: Auftrag klären in der Begegnung – Shared decision-making
1.1 Der Auftrag Ihrer Einrichtung
1.2 Auftragsklärung mit Ihrem pflegebedürftigen Auftraggeber
1.2.1 „… – und Sie haben Ihre Präferenzen“
1.2.2 Haben wir ausreichend Präferenzen?
1.2.3 Bewältigung der Informationsasymmetrie oder der Angst
1.2.4 Präferenzen und Ziele klären sich in der Begegnung
1.2.5 Beziehungen zum Aufbau interner Evidence – und ihre Gefährdungen
1.3 Ein Beispiel: Zielklärung in der onkologischen Pflege
1.3.1 Die Verwechslung von Mitteln und Zielen: Vier Stufen der Qualität
1.3.2 Verwechslung von interner und externer Evidence
1.3.3 Assessmentinstrumente
2 Schritt 2: Problem formulieren
2.1 Geburtshelferische Fragen interner Evidence/Fragen an die externe Evidence
2.2 Wie kommen wir zu Fragen, die sich auch beantworten lassen?
2.2.1 Wie wir verlernten, zu fragen
2.2.2 Subjektive Fragen – objektive Antworten
2.2.3 Gütekriterien von Frageformulierungen
2.3 Elemente einer Frage
2.4 Beispiel: Schlucktraining bei Apoplexie
3 Schritt 3: Literaturrecherche
3.1 Was veröffentlicht wird
3.2 Woher man Wissen beziehen kann
3.2.1 Bücher
3.2.2 Zeitschriften
3.2.3 Die eigene Sammlung
3.2.4 Das Internet und seine Dienste
3.3 Die „EBHC-Pyramide“ zum Auffinden bester externer Evidence
3.4 Ablauf der LiteraturrechercheUnter Mitarbeit von Julian Hirt und Thomas Nordhausen
3.4.1 Festlegung der Suchkomponenten
3.4.2 Festlegung der zu durchsuchenden Fachdatenbanken
3.4.3 Identifikation von Suchbegriffen
3.4.4 Entwicklung des Suchstrings
3.4.5 Durchführung der Recherche
3.4.6 Dokumentation, Sicherung und Export der Recherche
3.4.7 Ergänzende Recherchemethoden
4 Schritt 4: Kritische Beurteilung von Studien
4.1 Verschiedenheit und Eignung von Studiendesigns
4.1.1 Goldstandards für Studien, Gegenmittel für Verzerrungsgefahren
4.1.2 Angemessenheit von Designs
4.1.3 Welche Art von Selbsttäuschung sollen Studien vermeiden?
4.2 Hermeneutisch-interpretative Forschungsdesigns
4.2.1 Was sollen hermeneutisch-interpretative (qualitative) Designs leisten?
4.2.2 Phänomenologische Grundlagen
4.2.3 Strukturale oder objektive Hermeneutik
4.2.4 Ethnographie
4.2.5 Biographische Verfahren
4.2.6 Grounded Theory
4.2.7 Methoden der Datensammlung
4.2.8 Methoden der Datenauswertung
4.2.9 Beurteilung der beiden Haupttypen hermeneutisch-interpretativer Studien
4.2.10 Beurteilung von hermeneutisch-interpretativen Studien – Einzelfragen
4.2.11 Suche nach hermeneutisch-interpretativen Studien in Medline
4.3 Epidemiologische (quantitative) Studiendesigns
4.3.1 Randomisierte kontrollierte Studie
4.3.2 Kontrollierte klinische Studie
4.3.3 Kohortenstudie
4.3.4 Fall-Kontroll-Studie
4.3.5 Querschnittsstudie
4.3.6 Diagnostische Genauigkeitsstudien
4.3.7 Vorher-Nachher-Studie
4.3.8 Multivariate Analysen von Beobachtungsstudien
4.3.9 Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen
4.4 Interventionsstudien
4.4.1 Wirksamkeit, Kausalität und Validität
4.4.2 Hypothesentestung
4.4.3 Zufallsfehler und systematischer Fehler
4.4.4 Fehler 1. und 2. Art
4.4.5 Häufige Bias-Quellen in klinischen Studien
4.4.6 Randomisierung
4.4.7 Verdeckte Zuteilung
4.4.8 Verblindung
4.4.9 Protokollverletzungen
4.4.10 Statistik in Interventionsstudien verstehen
4.4.11 Reaktion der Therapieeffekte auf Veränderungen der Ereignisraten
4.4.12 Der „Minimale klinisch wichtige Unterschied“
4.4.13 Beurteilung einer Interventionsstudie
4.4.14 Suche nach Interventionsstudien in Medline
4.5 Diagnostische Genauigkeitsstudien/DiagnosestudienUnter Mitarbeit von Astrid Fink und Sylvia Kaap-Fröhlich
4.5.1 Bias-Quellen in diagnostischen Genauigkeitsstudien
4.5.2 Die Vierfeldertafel
4.5.3 Statistik in Diagnosestudien verstehen
4.5.4 Beurteilung von Studien über diagnostische Tests
4.5.5 Beurteilung von systematischen Übersichtsarbeiten oder Meta-Analysen von Diagnosestudien
4.5.6 Suche nach Diagnosestudien in Medline
4.5.7 Bedeutung von diagnostischen Genauigkeitsstudien für andere Gesundheitsberufe
4.6 Studien über Ursachen und Nebenwirkungen
4.6.1 Häufige Designs bei Ursachenstudien
4.6.2 Vergleich der Designs
4.6.3 Beurteilung von Ursachenstudien
4.6.4 Suche nach Ursachenstudien in Medline
4.7 Prognosestudien
4.7.1 Prognostische Faktoren
4.7.2 Follow-up
4.7.3 Beurteilung von Prognosestudien
4.7.4 Suche nach Prognosestudien in Medline
4.8 Studien zu komplexen InterventionenRalph Möhler, Sascha Köpke, Gabriele Bartoszek und Gabriele Meyer
4.8.1 Was ist eine komplexe Intervention?
4.8.2 Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen
4.8.3 MRC-Modell zur Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen
4.8.4 Kritische Beurteilung komplexer Interventionen
4.8.5 Kriterien für eine hochwertige Berichterstattung komplexer Interventionen
4.9 Organisationen als Interventionen
4.9.1 Die systematische Begründung
4.9.2 Der historische Verlauf
4.9.3 Methoden und die Beurteilung der Studiengüte
4.10 Wirtschaftlichkeitsstudien
4.10.1 Verschiedene Methoden der Wirtschaftlichkeitsanalyse
4.10.2 Kostenarten
4.10.3 Beurteilung von Wirtschaftlichkeitsstudien
4.10.4 Suche nach Wirtschaftlichkeitsstudien in Medline
4.11 Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen
4.11.1 Schritte bei der Erstellung einer systematischen Übersichtsarbeit
4.11.2 Besonderheiten bei systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen
4.11.3 Beurteilung einer systematischen Übersichtsarbeit und Meta-Analyse
4.11.4 Suche nach systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen in Medline
4.12 Standards und Leitlinien
4.12.1 Prozess der Entwicklung von Leitlinien
4.12.2 GRADE
4.12.3 Beziehungen zwischen der Stärke der Evidence und Empfehlungsklassen
4.12.4 Beurteilung von Leitlinien
4.12.5 Suche nach Leitlinien in Medline
4.12.6 Mitwirkung an der Erstellung von Leitlinien
4.13 Erzeugt „Künstliche Intelligenz“ externe und interne Evidence aus „Big Data“?
4.13.1 Die Erzeugung externer Evidence durch lernende Maschinen
4.13.2 Erzeugung interner Evidence
4.13.3 Zwischenfazit: Wo Big Data kaum helfen kann, wo vielleicht doch
4.13.4 Digitalisierung erreicht ihr Potenzial nicht
5 Schritt 5: Veränderung der Pflegepraxis (Pflegemanagementmodell)
5.1 Wenn-dann-Entscheidungspfade
5.1.1 Übergang der Erfahrung Dritter auf den Einzelfall
5.1.2 Wenn-dann-Pfade statt Einmalentscheidungen
5.2 Adaptation der Arbeitsorganisation
5.2.1 Ja, Pflegeeinrichtung und EBN sind gut aneinander adaptiert
5.2.2 Nein, Pflegeeinrichtung und EBN sind nicht gut aneinander adaptiert
5.2.3 Implementierungsmodelle
5.2.4 Modelle, die auf Leitlinien, Standards, kontinuierliche Weiterbildung und Qualitätsaudits setzen
5.2.5 Gefahren von Leitlinien und Standards
5.2.6 Modelle, die auf Organisationskontexte und „Facilitatoren“ setzen
5.2.7 Kliniker und Manager
5.2.8 EBN: Verantwortungsübernahme und Verantwortungsteilung im Team
5.3 Möglichkeiten der Implementierung
5.3.1 EinzelpersonenUnter Mitarbeit von Sibylle Reick
5.3.2 Gruppen
5.3.3 Implementierung durch EBN-fördernde BerufsbildungsstrukturenDoris Eberhardt
5.3.4 Exemplarische Implementierungsprojekte im deutschsprachigen Raum
6 Schritt 6: Evaluation von Wirkungsketten – Qualitätsmanagement und Evidence-based Practice
6.1 Drei Ebenen der Evaluation
6.1.1 Ebene 1: Das Ergebnis ist (nicht) wie erwartet
6.1.2 Ebene 2: Das Ergebnis ist wie erwartet, entspricht aber nicht mehr meinen Bedürfnissen
6.1.3 Ebene 3: Das Ergebnis ist wie erwartet, aber es wäre etwas Besseres möglich gewesen
6.2 Die Evaluation von Qualität auf vier Ebenen
6.3 Ergebnisse treten schon zeitgleich mit dem Prozess auf
Literaturverzeichnis
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Sachwortverzeichnis
|13|Danksagung
Wir danken Dr. Almuth Berg für die Durchsicht des gesamten Manuskripts. Ferner möchten wir uns bedanken bei Dr. Steffen Fleischer für die Überarbeitung des Kapitels über Diagnosestudien, bei dem Gesundheitsökonomen Prof. Dr. med. Franz Hessel, MPH, für die Überarbeitung des Kapitels über Wirtschaftlichkeitsstudien, bei der Psychoanalytikerin Christa Sturmfels (DPV) für die Durchsicht weiter Teile des Manuskripts, insbesondere derer zum Anspruch von intersubjektiver Überprüfbarkeit der Gegenübertragung in Fallkolloquien, bei den Ärzten Prof. Dr. med. Dr. phil. Heiner Raspe, Luise Wagner, Prof. Dr. med. Ulrich Deppe und Prof. Dr. med. Reiner Müller für zahllose Anregungen, bei den Pflegewissenschaftler*innen Prof. Juliet Corbin und dem verstorbenen Prof. Anselm Strauss von der School of Nursing San Francisco, Prof. Deborah Stone (Boston), Prof. Andrea Baumann, Prof. Alba DiCenso und Prof. Donna Ciliska (McMaster University, Hamilton, Kanada), Prof. Ted Morone (Yale), Prof. Victor Marshall (Chicago), bei den Kolleg*innen des Netzwerks der Trainer des German Center for Evidence-based Nursing (hier seien stellvertretend Dr. Almuth Berg, Dr. Steffen Fleischer, Dr. Dorothea Groß, Stephanie Hanns, Dr. Astrid Knerr, Anke Kruggel, Dr. Thomas Neubert, Prof. Dr. Karl Reif und Prof. Dr. Michael Schulz genannt), den Schweizer Kolleg*innen Dr. Dr. Silvia Käppeli und Dr. Chris Abderhalden sowie den Kolleg*innen des australischen EBN-Zentrums, Kate Cameron und David Evans, bei den Teilnehmenden unserer EBN-Workshops in Wittenberg und den Studierenden, die mit uns im problemorientierten Lernen die meisten Kapitel durchgingen, bei den Kollegen Fritz Schütze (Magdeburg), Bruno Hildenbrand (Jena), Tilmann Allert (Frankfurt), die mit uns das Mitteldeutsche Zentrum hermeneutischer Methodenwerkstätten bilden, sowie den Kolleginnen des Instituts für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung, bei den Kolleginnen des Pflegeforschungsverbundes Mitte und des Netzwerks Nursing Research mit ihren Sprecher*innen Doris Schaeffer und Stefan Görres, bei Manuela Friede und Daniela Büchner sowie bei Dr. Klaus Reinhardt, Jürgen Georg und Gabrielle Burgermeister vom Hogrefe-Verlag sowie Thomas Sonntag.
|15|Geleitworte
Evidence-based Nursing im Alltag
Pflegende werden heutzutage mit einer Vielzahl von Erwartungen konfrontiert. Es wird erwartet, dass sie in der Lage sind, Gebiete der Kunst und der Wissenschaft der Pflege zu beherrschen. Auch wird von ihnen verlangt, kritisch zu denken, immer mit dem Wissen Schritt zu halten und relevante Forschung anzuwenden und diese Fertigkeiten und Fähigkeiten täglich dabei zu verwenden, Entscheidungen in ihrer Praxis zu treffen – in anderen Worten: Evidence-based Nursing anzuwenden!
Evidence-based Nursing erfordert, Entscheidungen zu treffen, die relevante Forschung, eigene Fertigkeiten, verfügbare Ressourcen und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen berücksichtigen. Das Einbeziehen von praktischen Fertigkeiten, verfügbaren Ressourcen und Vorlieben des Pflegebedürftigen bei der Entscheidungsfindung bedeutet, dass Evidence-based Nursing kein Kochbuch dazu liefert, wie man Forschungsergebnisse bei jedem Pflegebedürftigen mit derselben Diagnose umsetzt, sondern wie Evidence-based Nursing individuell auf jede Situation angewandt wird.
Woher kommt diese Evidence? Diese Frage wird oft gestellt. Sicherlich liefern randomisierte Studien, seit jeher verbunden mit Evidence-based Practice, Informationen über die Wirksamkeit von Interventionen. Jedoch können nicht alle Interventionen – aus ethischen oder praktischen Gründen – mit einer randomisierten Studie getestet werden. Daher müssen andere Studiendesigns ebenfalls berücksichtigt werden. Die qualitative Forschung hat viel zu bieten für die Entwicklung der Kunst zu pflegen und unser Verständnis von der Situation der Patienten und Pflegebedürftigen. Deshalb wird qualitative Forschung in diesem Buch, anders als in den meisten Lehrbüchern der Evidence-based Medicine, besonders hervorgehoben und angemessen und sehr innovativ diskutiert.
Es gibt viele Barrieren, die bei der Anwendung von Evidence-based Nursing zu überwinden sind, egal, ob man direkt am Bett mit dem Pflegebedürftigen arbeitet, an einer Krankenpflegeschule unterrichtet, ein Manager ist, der klare Entscheidungen bei der Entwicklung von Strategien und der besten Nutzung der vorhandenen Ressourcen treffen muss, oder aber als Forscher arbeitet, der die Forschungsfrage definiert.
Dieses Buch ist eine originäre und sehr gelungene Entwicklung, um Pflegenden auf allen Ebenen zu helfen, einige der Barrieren zu überwinden. Es gibt weltweit einen großen Bedarf für diese Arbeit, und dieses Buch deckt etwas von diesem Bedarf nicht nur für die deutschsprachigen Pflegenden in Österreich, der Schweiz und Deutschland.
Prof. Donna Ciliska, RN, PhD
School of Nursing, McMaster University, Canada
Co-Editor, Evidence-Based Nursing
Co-Director, Canadian Centre for Evidence-Based Nursing
Coordinator of the International Network of the Centers of Evidence-Based Nursing
|16|Grounded Theory und Evidence-based Practice
Wir wissen alle, dass es Vorgänge gibt, die auftreten, wenn eine Maßnahme eingeführt wird, die man schlecht messen kann und deren Nebenwirkungen schwer erfassbar sind. Diese unerwarteten Ereignisse können oft nicht gemessen oder quantifiziert werden, aber genauso aufschlussreich wie Statistik sein. Diese Vorstellung des Unerwarteten ist besonders wichtig, wenn es darum geht, Daten für eine evidence-basierte Pflegepraxis zu sammeln.
Eine sehr wichtige Eigenschaft der Methode der Grounded Theory ist ihre unerwartete Effekte entdeckende Natur. Dem, was gerade geschieht, wird ermöglicht, sich aus den Daten herauszubilden, anstatt dass man es sich vorher ausdenkt. Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, Evidence über verschiedene Aspekte von Interventionen zu sammeln, die man nicht vorhersehen kann, die aber eine direkte Auswirkung auf die Pflege haben.
Weiterhin erlaubt Grounded Theory die Entdeckung von ausgeprägten Merkmalen, die eine Auswirkung auf die Wirksamkeit von Interventionen haben, wobei ein vollständigeres Bild dessen entsteht, was gerade vor sich geht, wenn eine Maßnahme neu eingeführt wird. Die Grounded Theory liefert mehr als nur die Antwort auf die Frage, ob etwas wirkt oder nicht – sie macht oft auch verständlich, warum etwas wirkt oder warum nicht.
Die Statistik liefert nur einen Teil unseres Verständnisses, der andere Teil entsteht durch hermeneutisch-interpretative Studien, die zum Beispiel die Methode der Grounded Theory anwenden. Wegen seines umfassenden und grundsätzlichen Ansatzes, Evidence zu sammeln, wird das vorliegende Buch mit seinem ganzen Potenzial erheblich am Aufbau einer evidence-based Pflegepraxis mitwirken.
Prof. Juliet M. Corbin, RN, DNSc
International Institute for Qualitative Methodology
University of Alberta, Alberta, Canada
|17|Geleitwort zur 3. Auflage
Wie alles, was neu ist, so hat auch Evidence-based Nursing vor einigen Jahren einige von uns fasziniert, andere waren skeptisch, wieder andere ignorierten es einfach, wohl denkend, das wäre ein Trend. Nun sind wir (in Südtirol wird seit 2004 an der Umsetzung einer Evidence-basierten Pflege gearbeitet) immer noch dabei und mittendrin; wir erleben viel Positives, begegnen aber auch Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Als wir mit viel Elan begannen, uns intensiver mit Evidence-basierter Pflege auseinanderzusetzen, erahnten wir noch nicht, wie stark wir dadurch mit dem, was wir als Krankenpflege verstehen und praktizieren, konfrontiert werden würden.
Ursprünglich schien EBN eine Methode zu sein, die es zu erlernen galt und mit der es uns gelingen würde, überprüftes Forschungswissen in die Praxis zu transferieren und dadurch die Pflege von Patienten und Patientinnen zu verbessern. Stimuliert auch von einem Professionalisierungsschub, der die Pflege in Italien über Nacht akademisierte, verspürten wir einen großen Aufholbedarf, die Pflegepraxis mit mehr wissenschaftlichen Erkenntnissen anzureichern. EBN schien das richtige Mittel dafür zu sein. Wir konzentrierten uns hauptsächlich auf das Erlernen einer Methode (Recherche, kritische Beurteilung und Zusammenfassung von Studien, Erstellung einer Leitlinie) und riskierten dabei, eine allzu einseitige, ja fast instrumentalisierte Sicht von EBN zu entwickeln.
Die 3. Auflage des Buchs „Evidence-based Nursing and Caring“ erscheint daher für mich zum richtigen Zeitpunkt. Sie ist eine Fundgrube, um sich der Einseitigkeiten (manchmal auch der Irrwege) bewusst zu werden, diesen vorzubeugen oder daraus zu lernen. Gleich zu Beginn stellen die Autoren klar, dass es sich bei Evidence-basierter Pflege gerade nicht um ein Mittel, sondern um ein Ethos der Pflegepraxis handelt. Eine wertvolle Erkenntnis, die anregt, mit dem Thema umfassender umzugehen. Behrens und Langer gelingt es, EBN in einen Gesamtkontext einzubetten, wobei Verknüpfungen zur Praxis, zum Management, zur Wissenschaft und zur Ausbildung hergestellt werden. Das Erkennen und Vertiefen dieser Zusammenhänge sind für mich, die mit der Aufgabe betraut ist, den Prozess einer Evidence-basierten Pflege in der Praxis zu fördern und zu unterstützen, besonders wertvoll.
Praxisinstitutionen bzw. das Pflegemanagement sind derzeit doppelt gefordert, dem Ansatz von EBN gerecht zu werden. Einerseits soll Pflegenden ein erleichterter Zugang zu den derzeit besten wissenschaftlich belegten Erkenntnissen ermöglicht werden. Andererseits müssen Pflegende darin gefördert werden, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um nachvollziehbare interne Evidence aufbauen zu können. In Ermangelung von externer Evidence – sei es, weil es diese entweder nicht gibt oder weil vorhandene Studien nicht zusammengefasst oder in Form von transparenten, qualitativ guten und |18|für die Praxis verständlichen Leitlinien vorliegen – ist die Versuchung groß, sich in erster Linie mit der Erstellung dieser zu befassen. Dies kann auf der anderen Seite eine Vernachlässigung der genauso, wenn nicht noch wichtigeren Voraussetzungen für den Aufbau interner Evidence zur Folge haben. Auch kann die schwerpunktmäßige Beschäftigung mit der Erzeugung anwenderfreundlicher, externer Evidence den Anschein oder Wunsch verstärken, den EBN im Pflegealltag bereits erweckt: nämlich, dass überprüftes Wissen (Erfahrungen Dritter) Unsicherheiten in der Entscheidungsfindung, aber auch hinsichtlich der Wirkung von Pflegeinterventionen auf den einzelnen Betreuten ausräumen könne. Der Pflegebedürftige, der sich Sicherheit erwartet, die Sozialisierung der Pflegenden sowie das Management, das leicht messbare und „standardisierte“ Ergebnisse verlangt, tragen noch ihres zu dieser Erwartungshaltung bei. Behrens und Langer rücken jedoch diese Sichtweisen in ihrem Buch zurecht.
Im gesamten Werk heben die Autoren den Stellenwert, dem die Begegnung und Interaktion zwischen professionell Pflegenden und dem einzelnen Pflegebedürftigen in einer Evidence-basierten Pflege zukommt, hervor und betonen auch das Ureigenste des Berufes. Dabei werden der Unterschied zwischen externer und interner Evidence, deren Bedeutung und Zusammenspiel sehr klar herausgearbeitet. Ich glaube, dass hier auch der Schlüssel zu einer verbesserten Implementierung von EBN zu finden ist, sei es durch die einzelne Krankenpflegerin als auch durch die Arbeitsorganisation. Dieses vertiefte Verständnis der Einflussnahme externer und interner Evidence erlaubt vielleicht einen neuen Ansatz, die wohl bekannten Barrieren des Theorie-Praxis-Transfers durch eine gezielte Vorbereitung der Pflegenden und ihres Umfeldes zu überwinden. Diese Veränderungen brauchen Ressourcen, aber auch Unterstützung der Pflegenden, damit interne Evidence aufgebaut und externe Evidence in der Betreuung der einzelnen Person integriert werden kann.
Dieses Buch liefert für mich eine sehr kritische und stimulierende Auseinandersetzung mit den Grundauffassungen der Pflege als Beruf und als Wissenschaft, den verschiedenen Forschungsansätzen und der Bedeutung, die sie für eine Evidence-basierte Pflege haben. Besonders die Ausführungen zur Veränderung der Pflegepraxis, zu Strategien des Pflege- und des Qualitätsmanagements regen an, alte und oberflächliche Betrachtungen neu zu denken.
Dr. Waltraud Tappeiner, PhD
Südtiroler Sanitätsbetrieb, Bozen, Italien
Koordinatorin des Projektes „Evidence-based Nursing Südtirol“
|19|Vorwort zur 4. Auflage
Liebe Leserin, lieber Leser,
früher als erwartet ist eine vierte, stark erweiterte Auflage fällig geworden. Die ersten Auflagen wurden nicht nur freundlich aufgenommen, sondern zu unserer freudigen Überraschung von vielen auch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen – also alle sechs Schritte und sogar das Kapitel G (= Grundlagen). Manchen Rezensenten erschien es als zu anspruchsvoll, wo es doch nur wissenschaftliche Argumentationen als Spezialfall ganz alltäglichen Probehandelns und menschlicher Selbstvergewisserung in der Begegnung zwischen Professionsangehörigen und einzigartigen Klienten verständlich diskutieren sollte.
Schon der Setzer in der Druckerei hatte Bedenken gehabt und im letzten Augenblick den Untertitel der ersten Auflage „Vertrauensbildende Entzauberung der ‚Wissenschaft‘“ völlig eigenmächtig geändert, wie uns der Verlag schrieb. Der Setzer der Druckerei konnte sich nicht vorstellen, dass jemand etwas so unbestritten Autoritatives wie die Wissenschaft in Anführungszeichen setzen könnte, und weil er im Verlag am Wochenende niemanden erreichen konnte, löschte er die Anführungsstriche eigenmächtig.
Leider hatte der Setzer nicht recht. Wissenschaft kann – und tut es gar nicht selten – zur „Wissenschaft“ verkommen, zu einer für die Klienten undurchschaubaren und unkontrollierbaren Lehre von Expertokraten. Aus ihr leiten Experten unkontrollierbar Schlüsse ab, die gerade nicht auf nachprüfbarerer Evidence, sondern auf Eminenz gründen. Eminenz tritt den Leuten wie Zauberherrschaft gegenüber. Gegen diese Eminenz-basierte „Wissenschaft“ eminenter Expertokraten hilft die Entzauberung durch Wissenschaft, also das Selbstvertrauen und der Anspruch, selbst zu wissen und nachzuprüfen – wozu an unserer Universität vor 500 Jahren Melanchthon jeden (Christen-)Menschen mit einem Zitat aus einem römischen Liebeslied ermutigte: „sapere aude“ (trau’ dich zu wissen!).
Für die Haltung des Sapere aude ist nicht nur Kant hilfreich, sondern auch manches Kinderlied gegen die Eminenz-basierte „Wissenschaft“ der Expertokraten: „Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Margarine Fett enthält…“.
Unsere Leserinnen und Leser haben sich nicht zweimal Sapere aude sagen lassen und diese Haltung auch unserem Buch gegenüber ernst genommen. Mehr als 50 verbesserungswürdige Stellen sind ihnen aufgefallen. Besonders dankbar sind wir denen, die uns dies in Seminaren gesagt oder sogar von weither geschrieben haben: aus Australien (Kate Cameron), aus Indien (Shiney Franz), aus Italien (Markus Badstuber, Elisabeth Gamper, Bernhard Oberhauser, Martin Pflanzer, Klara Ploner, Monika Zihl), aus Österreich (Dr. Susanna Schaffer, Christine Uhl, Richard Weiß), aus der Schweiz, aus den Niederlanden – und aus Dänemark besonders ausführlich (Prof. Dr. Gunnar Haase Nielsen).
|20|Durchaus bewährt und als anschlussfähig erwiesen haben sich dabei unsere sechs Schritte von der internen Evidence zur externen Evidence und zurück, vor allem der erste Schritt, die Auftragsklärung zum Aufbau interner Evidence in der Begegnung zwischen Ihnen und Ihren einzigartigen Klienten. Dieser erste Schritt erschien zunächst etwas ungewohnt und gewöhnungsbedürftig. Aber er hat sich als unverzichtbar erwiesen. Denn ohne diesen ersten Schritt verliert Evidence-based Nursing leicht den entscheidenden Bezug zur Verständigung über individuelle Bedürfnisse und Ziele. Ohne diese Verständigung fehlt der Maßstab für die Beurteilung externer Evidence. Ohne sie wird externe Evidence ein im Einzelfall irrelevantes Sammelsurium klinischen Wissens, das allenfalls noch für Referate taugt. Alle weiteren Schritte des Evidence-based Nursing hängen ohne den ersten Schritt der individuellen Auftragsklärung, ohne interne Evidence, in der Luft.
Denn externe Wirkungsevidence der Erfahrung Dritter liegt, weil Pflegende und Pflegebedürftige verschieden sind, fast immer nur als Häufigkeit für Gruppen, als „Wahrscheinlichkeit“ einer Wirkung vor. Für die Beurteilung der Erfahrungen Dritter benutzen wir Methoden des Wirkungsvergleichs von Mitteln bei gegebenen Zielen. Deren Kenntnis ist aber nur relevant, wenn wir uns über die individuellen Ziele mit unseren einzigartigen Klienten verständigt haben. Auch für das kommunikative Handeln der Verständigung über Ziele bedarf es der Methode. Denn der einzelne Mensch ist kein Mittel, sondern, wie Kant gesagt hat, Zweck. (Nur für Viehzüchter und bevölkerungspolitisch-viehzüchterisch denkende Könige ist das Individuum ein Mittel.)
Daher: Auch wenn die externe Wirkungsevidence der Erfahrungen Dritter in der Regel nur als gruppenbezogene Wirkungshäufigkeiten vorliegt, beschränkt sich das Ziel von Evidence-based Nursing nicht auf den größten Nutzen für eine Gruppe (kollektiver Utilitarismus), sondern bezieht sich gerade auf den Nutzen für den einzigartigen individuellen Klienten. Die Vermittlung zwischen gruppenbezogenen Wahrscheinlichkeiten und individuellen Entscheidungen einzigartiger Individuen ist die Methode der sechs Schritte des Evidence-based Nursing von der internen Evidence zur externen Evidence und zurück. (Man könnte in gewissem Sinne sagen: Sie vermitteln die Traditionen des Utilitarismus und der Romantik [Goethes] in der Heilkunde.)
Der erste Schritt von Evidence-based Nursing, die Auftragsklärung zum Aufbau interner Evidence in der Begegnung zwischen Ihnen und Ihren einzigartigen Klienten, erlaubt auch, die unsinnige Entgegensetzung von Nursing und Caring zu berichtigen. Zu den Schönheiten der deutschen Sprache gehört, dass das Wort „pflegen“ nicht zwischen Nursing und Caring unterscheidet. Für das Kümmern wie für das Behandeln benutzen wir dasselbe Wort „pflegen“. Unsere schöne deutsche Sprache schert sich nicht einmal darum, wer sich kümmert und behandelt, ob geschulte Fachkräfte und Professionen oder Eltern, Kinder, Freunde: Sie alle pflegen. Das stört einige Fachkolleginnen, die gerne schon im Verb herausgestellt sähen, ob es eine examinierte Nurse ist oder nicht und ob sie Behandlungspflege oder Grundpflege macht. Kluge Soziologen fürchten, aus der Pflege könne nie etwas werden, solange sie nicht ein neolateinisch-griechisches Kunstwort wie Physiotherapie oder ein anglizistisches wie Care/Case Manager als Berufsbezeichnung zur Betonung der feinen Unterschiede zu den Laien und Quacksalbern wählte.
Wir sind mit dieser Diffusität des Wortes „pflegen“ recht glücklich. Nicht nur, weil ein Nursing ohne Caring schnell inhuman würde. In unserer Berufsbezeichnung ist beides enthalten. Auch nicht nur, weil das Caring genauso kritischer Reflexion bedarf wie das Nursing, weil auch im Caring viel vermeidbares Leid zugefügt wird. Vor allem erscheint es uns als ein Vorteil des diffusen Begriffs Pflege, dass der in der Tat entscheidende Unterschied zwischen Pflege als Profession und Pflege als Familienmitglied im|21|mer genau herausgearbeitet werden muss und nicht schon in der Berufsbezeichnung selbstverständlich ist (Behrens, 2005b). Pflege als Beruf leitet sich in weiten Teilen Europas offenbar von der Zauberin und dem Kreuzritter-Mönch ab. Aber gerade dies gilt es zu reflektieren. Deswegen hat dieses Buch Evidence-based Nursing und Evidence-based Caring zum Gegenstand.
Nach dem Erscheinen der 1. Auflage unseres Buchs haben einige Kritiker, die die Argumentation durchaus originell und weiterführend fanden, bezweifelt, dass unser Buch überhaupt etwas mit Evidence-based Nursing zu tun habe. Es sei so originell, dass es sich weit weg von dem entwickelt habe, was Evidence-basierte Praxis im Alltag ausmache. Sie fragten sich, ob das Buch überhaupt noch Evidence-based Nursing sei oder nicht vielmehr eine Kritik an ihr.
Wir können Sie beruhigen. Vielleicht waren einige Positionen, als das Buch geschrieben wurde, wirklich durchaus originell, kontrovers und zum Teil sogar etwas abweichend randständig. Nach zwei Jahren Verteidigung unserer Position in vielen einschlägigen Gremien dürfen wir jede Originalität dementieren. Was Sie in diesem Buch lesen, ist Mainstream geworden – oder doch kurz davor. Wie auch der Pflegeforschungsverbund Mitte-Süd gezeigt hat, in dem dieses Buch erarbeitet wurde, ist unsere Position ganz normal geworden.
|23|Vorwort zur 1. Auflage
Evidence-based Nursing and Caring ist etwas Selbstverständliches, das alle unsere Klienten und Patienten erwarten, nämlich die Integration der derzeit besten wissenschaftlichen Belege in die tägliche Pflegepraxis unter Einbezug des theoretischen Wissens und der praktischen Erfahrungen der Pflegenden, der Vorstellungen des Patienten und der vorhandenen Ressourcen.
Wenn wir uns als Pflegebedürftige überhaupt an Mitglieder der Pflegeprofession wenden, vertrauen wir weniger in ihre Zauberkraft als in ihre wissenschaftlich erwiesenen Verfahren, die uns überflüssige Qual ersparen sollen. In einem langen Prozess der Entzauberung hat sich der Pflegeberuf aus dem Urberuf der Zauberin entwickelt. Aber tritt uns nicht auch Wissenschaft, die an die Stelle der Zauberei trat, doch wie Zauberei gegenüber – nicht nachprüfbar, apodiktisch, Berufsgeheimnis einer Gruppe, deren Interessen verborgen bleiben? EBN ist ein Programm zur Entzauberung und zur Demokratisierung von Wissenschaft – zur Nutzung nachprüfbarer fremder Erfahrung aus Respekt für den jeweils einzigartigen Klienten.
Dieses Buch führt nicht nur in sogenannte quantitative, sondern auch in „qualitative“ Verfahren bei alltäglichen Pflegeentscheidungen ein. Diese „qualitativen“ Methoden hat die Pflege zuerst in den Kreis der evidence-based Zeitschriften eingebracht. Das Buch ist elementar und einfach: Es nimmt seinen Ausgang bei alltäglichen Pflegeentscheidungen unter Zeit- und Entscheidungsdruck, die die Professionsangehörigen im Arbeitsbündnis mit ihren individuierten Klienten fällen. Es bedarf keiner besonderen wissenschaftlichen Vorkenntnisse, um dieses Buch zu verstehen. Es setzt nicht bei der Wissenschaft, sondern bei der Unterscheidung von zwischenmenschlich nachprüfbarem Wissen und individueller Offenbarung ein. Es folgt keinem naiven Induktivismus: ohne Theorie keine Erfahrung und ohne Erfahrung keine gegenstandsbezogene, situationsspezifische Theorie.
Das vorliegende Buch versteht sich als ein Handbuch für Pflegende und ist für den täglichen Gebrauch konzipiert. Die Idee für dieses Buch entstand aus einem einstündigen Vortrag, der bei der Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Pflegewissenschaft 1998 an der Fachhochschule Fulda und, erweitert, im Mai 1999 bei der Eröffnung des 1. Workshops des gerade international anerkannten deutschsprachigen „German Center“ im internationalen Network of Centers for Evidence-based Nursing, dem Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, zur Diskussion gestellt wurde. So wenig Zeit seit 1998/1999 vergangen ist, so viel hat sich in der Aufnahme der Ideen von Evidence-based Nursing seitdem geändert – mit zum Teil bedenklichen Nebenwirkungen: Damals noch galten Evidence-based Nursing und allgemein wissenschaftlich zergliederndes Vorgehen manchmal als eine eher abseitige, dem Wesen der Pflege durchaus fremde Handlungsweise. Pflege solle besser auf Glauben, Intuition und |24|dem Mitgefühl mit dem ganzen Menschen zu begründen sein denn auf Wirkungsnachweisen aus komplizierten klinischen Studien, die den eigenen Erfahrungen widersprachen. Mit solchen Studien habe sich doch gerade die Medizin vom Patienten wegbewegt und sei in ihre Akzeptanzkrise geraten. Außerdem zeigten die widersprüchlichen Ergebnisse der vielen Studien, dass man mit Studien beweisen könne, was man wolle. Warum sollte nun ausgerechnet die Pflege, statt die von den Medizinern dankenswerterweise gelassene Lücke ganzheitlicher menschlicher Zuwendung auszufüllen, der Medizin auf ihrem Irrweg folgen oder gar den gesundheitsökonomischen Sparkommissaren in die Hände arbeiten, die im „Managed Care“ oder „Disease Management“ mit „Critical Pathways“ die individuelle Entscheidungsfreiheit unter Druck setzten?
Diese kritischen Vorbehalte kamen keineswegs nur aus der Pflege. Unvergessen ist uns der eindrucksvolle Auftritt des Dekans einer medizinischen Fakultät auf einer Tagung zu Pflegeforschung und Pflegewissenschaft. Er unterstrich zwar vehement die Notwendigkeit von Pflegeforschung; mit derselben Vehemenz gab er aber seiner Überzeugung Ausdruck, dass für Pflegeforschung Pflegende prinzipiell ungeeignet und nur Ärzte und Ärztinnen geeignet seien. Ärztinnen und Ärzte nämlich würden sich in ihrem beruflichen Werdegang den analytischen Blick und das kalte Herz antrainieren, die für kritische Entscheidungen und für die wissenschaftliche Arbeit nötig seien. Sache der Pflege seien hingegen Warmherzigkeit, Mitgefühl, Ganzheitlichkeit und Mitleiden. Wissenschaft, Entscheiden und Patientenführen seien mit diesen Haltungen unvereinbar. Als Leser mögen Sie vermuten, aus dieser Rede des Dekans spräche auch das Interesse, seiner Berufsgruppe ein Monopol zu erhalten. Aber bedenkenswert ist seine Ansicht trotzdem.
Zweieinhalb Jahre später sind solche Stimmen – leider – kaum noch zu hören. Überall will die Pflege „ihre Leistungen evidence-basiert unter Beweis stellen“. Florence Nightingale höchstselbst wird – selbstverständlich zu Recht – als eigentliche Begründerin von Evidence-based Nursing entdeckt. Evidence-based Nursing wird geradezu als der Kern der von Florence Nightingale neu begründeten beruflichen Identität der Pflege, als zeitgemäß berufliche Form der alten Caritas, herausgestellt (McDonald, 2001). Seit dem Gutachten des Sachverständigenrates der konzertierten Aktion im Gesundheitswesen von 2001 scheint es keine Pflegestation mehr zu geben, die die langfristige Anpassung an Evidence-based Nursing – was immer das heißen mag – nicht für notwendig hält. Zwei Jahre vorher galt Evidence-based Nursing noch als Spielwiese von Theoretikern.
Das ging uns dann doch zu schnell. Vor allem ist uns die Bedeutung sehr suspekt, die das Argument der notwendigen Einsparungen bei dieser schnellen Anpassung spielte. Ein unbegründeter neuer Dogmatismus entwickelt sich. Die beliebte Wendung, die Pflege müsse ihre Leistungen in der ökonomischen Konkurrenz nach außen sichtbar machen, geht an Evidence-based Nursing eigentlich völlig vorbei. Evidence-based Nursing hat im Kern keineswegs die Aufgabe, nach außen das zu präsentieren, was die Pflege ohnehin tut. Es geht Evidence-based Nursing darum, individuelle Pflegebedürftige in deren Auftrag in ihren einzigartigen pflegerischen Entscheidungen besser als bisher zu unterstützen. Wenn etwas eingespart werden soll, dann sind es zuerst überflüssige Nebenwirkungen, Leid durch unwirksame Verfahren und überflüssige Kosten für die Pflegebedürftigen.
Zum Thema „Entscheidungen im individuellen Arbeitsbündnis zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen“ boten die skeptischen Fragen vor fünf Jahren einen weit besseren Zugang als die heutige Bereitschaft, fraglos zu lernen, was in der Statistik als Goldstandard zu gelten hat. Fraglose Anpassungsbereitschaft führt zu einer besonders dogmatischen Spielart des Opportunismus. Deswegen wenden wir uns an die kritischen Leser und halten dieses Buch so elementar, wie wir können. Es setzt nichts voraus außer Neugier und Konzentration. Insbesondere verlangt dieses Buch nicht von Ihnen, dass |25|Sie sich vorab auf einen bestimmten wissenschaftstheoretischen Standpunkt stellen und dort treu verharren. Auch für Leser, die meinen, wissenschaftlich zergliederte Studien vertrügen sich nicht mit den Aufgaben der Pflege und in der Pflegepraxis hätten ganz andere Wissensquellen Relevanz als die zwischenmenschliche Nachprüfung, soll dies das richtige Buch sein.
Sie müssen sich auch keineswegs vorab entscheiden, ob Sie qualitative Studien nach den gleichen Gütekriterien für vertrauenswürdig halten wie quantitative Studien. Auch in einer anderen Hinsicht soll dieses Buch elementar sein. Sie müssen nicht bereits wissen, wie Sie eine Literaturabfrage im Internet durchführen und wie Sie dabei Geld sparen. Dies Buch enthält zahlreiche Tipps dazu. Da solche Tipps schnell veralten, halten wir auf der Homepage des German Center for Evidence-based Nursing (https://www.medizin.uni-halle.de/einrichtungen/institute/gesundheits-und-pflegewissenschaft/leistungsspektrum/wissenswertes/ebn-zentrum) jederzeit Aktualisierungen zu diesen Teilen des Buchs für Sie bereit.
Aus diesen Gründen ist das Buch folgendermaßen aufgebaut: Dem einführenden Grundlagenkapitel „Evidence-based Nursing und die Entzauberung der Wissenschaft“ folgen die sechs Schritte von der internen zur externen Evidence und zurück, die wir Ihnen bei Ihrer mit Ihrem Klienten gemeinsamen Entscheidungspraxis anraten:
Nach der Klärung der Aufgabenstellung oder genauer des Auftrags folgt die
Formulierung einer beantwortbaren Fragestellung, die die Grundlage bildet für die
Literaturrecherche, deren Ergebnisse
kritisch beurteilt und anschließend in die
Praxis implementiert werden, wobei eine abschließende
Evaluation erfolgt.
Aber worauf beruht diese berufliche Fähigkeit? Was ist das spezielle Berufswissen? Lassen Sie uns einen kurzen Blick zurückwerfen auf die lange Geschichte des Pflegeberufs. Wie alle Berufe leitet sich der pflegerische Beruf von einem Urberuf her, und an der Pflege ist dieser Urberuf auch noch gut erkennbar: die mit außeralltäglicher Zauberkraft befähigte Zauberin, die weise Frau (Seyfarth, 1973; Weber, 1976).
Heute vertrauen wir nicht mehr hauptsächlich und ausschließlich auf zauberische Fähigkeiten (nur noch ein bisschen). Das ist nicht nur ein befreiender Fortschritt, sondern auch ein Verlust: Wie oft wünschten wir uns, wir könnten zaubern! An die Stelle des Vertrauens in Zauberkraft trat das Vertrauen in die durch jedes Mitglied der Gesellschaft jederzeit nachprüfbare Wissenschaft. Das lässt sich an den Gesetzen ablesen, die sich die Deutschen gaben. Darin besteht der Gewinn an Freiheit, an Selbstbestimmung, an Vernunft und an ständiger Verbesserung unserer Handlungschancen durch Erkenntnisfortschritt, der durch Entzauberung bewirkt wird.
So gut das klingt, trifft es auch zu? Ist Wissenschaft wirklich nachprüfbar? Tritt sie uns nicht vielmehr entgegen in Gestalt einer Professorenherrschaft, in Gestalt von Normen, Vorschriften, Standards, Leitlinien usw., die uns von unseren eigenen Erfahrungen als Pflegende trennen und enteignen, ohne durch uns selbst nachvollziehbar und überprüfbar zu sein? Daher: Tritt uns nicht die Wissenschaft entgegen wie der alte, durch sein Berufsgeheimnis geschützte Zauberer, dem gegenüber nur Anpassung, Glaube und blinder Gehorsam, aber kein kritisches Nachvollziehen möglich sind?
Die Entzauberung der Pflegepraxis durch Wissenschaft kann ihre Vorteile nur verwirklichen, wenn gleichzeitig die „Wissenschaft“ entzaubert wird. Das ist das – längst nicht erfüllte – Programm von Evidence-based Nursing. Deswegen hat sich das an der Universität Halle-Wittenberg beheimatete deutschsprachige Zentrum im internationalen Netzwerk der Centers for Evidence-based Nursing den lateinischen Namen sapere aude („trau’ dich zu wissen!“) gegeben. Vor annähernd 500 Jahren forderte Melanchthon in seiner Antrittsvorlesung an unserer Universität mit diesem Horaz-|26|Spruch jeden Einzelnen dazu auf, sich nicht auf die Vermittlung von Priestern, Bischöfen und Kardinälen zu verlassen, sondern selbst nachzuprüfen.
Immer noch verdankt sich vieles an Hoffnung, das die Klienten auf uns richten, dem Bedürfnis nach einer nur uns Pflegenden eigenen Fähigkeit, die es im Alltag der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen nicht gibt, die einem entscheidend weiterhilft. Diese Fähigkeit basiert heute auf Wissen und Erfahrung und nicht mehr auf Zauberei oder übernatürlichen Kräften. Insofern könnten wir die Geschichte des Pflegeberufs mit Max Weber zusammenfassen als die Geschichte der Entzauberung der ursprünglichen Zaubererberufe.
Evidence-based Nursing ist nur ein – wenn auch typischer – Schritt in diesem Prozess der Entzauberung oder der Aufklärung. Vertrauen wird umgestellt von Vertrauen in zauberische Kräfte auf Vertrauen in empirisch begründete Verfahren und Fähigkeiten. Daher haben wir diesem Buch den Titel „Evidence-based Nursing and Caring“ und den Untertitel „Interpretativ-hermeneutische und statistische Methoden für tägliche Pflegeentscheidungen“ gegeben.
Noch ein Hinweis für die Leser, die viele Evidence-basierte Bücher gelesen haben und wissen wollen: Was ist anders an dieser Einführung in Evidence-basierte Praxis?
Die Konzentration auf das Arbeitsbündnis Pflege in Kenntnis der Professionsgeschichte der Pflege, die die Geschichte der vertrauensbildenden, aber auch ent-täuschenden Entzauberung eines Zauberinnenberufes ist.
Die Orientierung an der Geschichte der Wissenschaft als Entzauberung einer autoritativen Lehrstuhl-Offenbarung.
Der Nachweis, dass der Aufbau interner Evidence in der Begegnung zwischen individuellen Pflegebedürftigen und Professionsangehörigen vorrangige Voraussetzung dafür ist, externe Evidence aus Erfahrungen Dritter nutzen zu können.
Die Orientierung am Problem-Solving im Sinne von Simon (1960) im Unterschied zum bloßen Decision-Making.
Die Vorgängigkeit „qualitativer“ Ansätze, auf deren Basis „quantitative“ Studien erst sinnvoll sind.
Die Berücksichtigung der multivariaten Verlaufsanalyse als ein Beobachtungsverfahren, das Vorteile gegenüber experimentellen randomisierten kontrollierten Studien bietet.
Sechs statt der üblichen fünf Schritte der evidence-basierten Praxis, um den
Nutzen für die Praxis zu erhöhen.
Daher tragen wir für dieses Buch, trotz des äußerst schmeichelhaften Geleitwortes der Koordinatorin des internationalen Netzwerks der Centers for Evidence-based Nursing, Donna Ciliska von der McMaster University in Kanada, und unserer Arbeit als Gastprofessor bzw. Visiting Scolar an dieser Universität sowie der aufmerksamen und kritischen Diskussion unserer Kollegen in Österreich, der Schweiz und Deutschland allein die Verantwortung. Sie lesen kein offizielles Bulletin. Wie Sie an allen Lehrbüchern zu Evidence-basierter Praxis sehen können, werden diese von Auflage zu Auflage immer besser. Das hoffen wir auch für dieses Buch.
Johann Behrens & Gero Langer
|27|Grundlagen: Evidence-based Nursing und die Ethik professionellen eingreifenden Handelns
G.1 Pflege in Verantwortung für ihre Wirkungen
Evidence-basierte Pflege bezeichnet mehr als eine Methode der Pflegeforschung: Sie bezeichnet ein Ethos der Pflegepraxis, nämlich eine alltägliche professionelle Pflege in Verantwortung für ihre eigenen Wirkungen (Verantwortungsethik), die überhaupt erst Pflegewissenschaft als eigene Handlungswissenschaft begründet. Evidence-based Nursing (EBN) ist spätestens seit Florence Nightingale etwas ganz Selbstverständliches, das alle unsere Klienten und Pflegebedürftigen bei uns erwarten und das bisher trotzdem schwer und nur selten im Alltag zu erreichen war. Evidence-based Nursing ist eine Pflegepraxis, die
die pflegerischen Interessen der individuellen Pflegebedürftigen in ihrem Gesundheitssystem
im Auftrag der einzelnen Pflegebedürftigen und in Zusammenarbeit mit ihnen
auf der Basis eines durch beständige zwischenmenschliche Nachprüfung ständig verbesserten Wissens (derzeit beste Belege)
im pflegerischen und pflegerisch beratenden Entscheidungshandeln zu erfüllen sucht.
Eine kurze Definition für Evidence-based Nursing lautet demnach:
Evidence-based Nursing ist die Nutzung der derzeit besten wissenschaftlich belegten Erfahrungen Dritter im individuellen Arbeitsbündnis zwischen einzigartigen Pflegebedürftigen oder einzigartigem Pflegesystem und professionell Pflegenden.
An dieser kurzen Definition ist wesentlich: Keineswegs beschränkt sich die Aufgabe von Evidence-based Nursing auf die statistische und hermeneutische Beurteilung von Forschungsarbeiten. Vielmehr stellt Evidence-based Nursing die Frage, ob und wie fremde, wissenschaftlich überprüfte Erfahrung in das eigene Arbeitsbündnis zwischen einem einzigartigen Pflegebedürftigen und einem professionell Pflegenden einbezogen werden kann.
Unter den „besten wissenschaftlichen Belegen“ versteht man Forschung mit einem möglichst hohen Grad an externer Validität (Kap. 4.4.1), die in der Praxis am Pflegebedürftigen durchgeführt wurde, mit sehr gutem Design und nur einem geringen Einfluss von verfälschenden Faktoren (Bias). Hierbei ist natürlich die praktische Erfahrung der Pflegenden, also die Fähigkeit, die Probleme und Ressourcen des Pflegebedürftigen richtig einzuschätzen und die Pflegehandlungen adäquat zu planen, die Kunst der Pflege also, Voraussetzung. Genauso wichtig sind die Vorstellungen des Pflegebedürftigen, seine Erwartungen und Bedenken hinsichtlich seines gesundheitlichen Problems und die eigenen vorhandenen Ressourcen, die sowohl die persönlichen Fähigkeiten der Pflegenden als auch die von der Institution bereitgestellten Mittel umfassen.
Evidence-based Nursing ist nicht nur seit Florence Nightingale eine Forderung der Pfle|28|ge, sondern wurde auch in der Gesetzgebung geregelt. So wird sowohl in § 12 Absatz 1 Satz 1 SGB V als auch in § 4 Absatz 3 SGB XI eine „wirksame und wirtschaftliche Pflege“ gefordert, die laut §§ 135 ff. SGB V auf „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ beruhen soll. Dies wird ebenfalls im neuen Krankenpflegegesetz deutlich, denn die Ausbildung soll demnach „entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen […] vermitteln“ (Abschnitt 2: Ausbildung, § 3 Ausbildungsziel, KrPflG).
„Evidence-based Nursing“ ist also das pflegewissenschaftliche Etikett der neueren Versorgungsforschung (Health Service Research, ursprünglich Evaluation von Organisationen), unter dem eine alte Doppelfrage der Pflegeprofession aktuell erörtert wird: Wieweit kann ich unter Handlungsdruck bei pflegerischen Entscheidungen, Managemententscheidungen oder edukativen Entscheidungen auf den „geprüften“ Erfahrungen Dritter (= „externe Evidence“) bauen? Und wieweit muss ich es, bin ich also ethisch gegenüber den Pflegebedürftigen verpflichtet, das beste verfügbare Wissen zu finden und mit meinen einzigartigen Klienten daraus interne Evidence in der individuellen Begegnung aufzubauen? Die erste Frage führt zur skeptischen Erkenntnis der Grenzen, aber auch der Nützlichkeit der wissenschaftlich kontrollierten Erfahrungen Dritter. Die zweite Frage führt zur Reflexion des Arbeitsbündnisses mit Klienten, wie es für Professionen typisch ist. „Evidence-based Nursing“ ist also keine spezielle Forschungsmethode, sondern bezeichnet ein Ethos professionellen Handelns in der Begegnung mit individuellen Klienten – dabei handelt es sich bei diesen individuellen Klienten um individuelle Pflegebedürftige, ihre Familiensysteme oder um Pflegesysteme.
Dabei verdankt sich schon das Etikett „Evidence-based Nursing“ der tiefen Skepsis gegenüber „Eminence-based Nursing“. Eminence-based Nursing ist die Art von Pflegewissenschaft, die Professoren – und andere eminent wichtige Persönlichkeiten – unprüfbar von ihren Lehrstühlen und Chefsesseln herab in Lehrbüchern und Vorschriften verkünden. Evidence-based ist dagegen der Beleg, den jeder Pflegeschüler, jeder Pflegebedürftige selbst nachprüfen kann. Nicht der Lehrstuhl, nicht die hierarchische Position macht die Wahrheit, sondern die zwischenmenschliche Nachprüfbarkeit des Belegs durch jedermann und jedefrau. Diese Vorstellung hat bekanntlich vor 500 Jahren Melanchthon an der Universität Wittenberg vertreten und aus einem Liebesgedicht von Horaz zitiert: „sapere aude“, „trau’ dich zu wissen!“ – prüfe selbst nach, du musst dich nicht auf die Eminenz des Priesters verlassen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Technisch erleichtert wurde dieses „sapere aude“ durch den Buchdruck, der Bibeln in einem vorher unvorstellbaren Ausmaß für eine Prüfung fast allerorten einsehbar machte. Und heute ist Evidence-based Nursing nicht ohne das Internet vorstellbar, das scheinbar alle Behauptungen der Welt überall abrufbar macht – und damit nach Techniken der Nachprüfung und der Auswahl verlangt.
Fragestellungen, Methoden und Antworten des Evidence-based Nursing sind weit älter als der Begriff „Evidence-based Nursing“, der erst seit Anfang der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts, forciert durch antiautoritäre kanadische und britische Pflegestudenten, als grundlegendes Konzept der Versorgung Verbreitung fand. Die inhaltlichen Argumente wurden in Deutschland und in den angelsächsischen Ländern viel früher entfaltet. Der Hallesche Philosoph, Theologe und Pädagoge Schleiermacher hat für die Pädagogik schon fast alle Elemente entwickelt, die wir heute als charakteristisch für EBN ansehen. Für ihn ist die einzige Rechtfertigung jeder pädagogischen Handlung deren tatsächlich mit großer Häufigkeit eintretende Wirkung bei den Schülern, nicht die gute Gesinnung der Lehrenden. Selbst die statistisch-probabilistische Frage nach der „Number Needed to Treat“ – die Zahl |29|derer, die sich einer Be-Handlung unterziehen müssen, damit ein einziger von ihnen Nutzen hat – hat bereits Schleiermacher als ethisch äußerst relevant eingeführt: Da empirisch zu viele Kinder sich der Schule unterziehen müssten, ohne selbst den Nutzen davonzutragen, hielt Schleiermacher eine Schulpflicht für ethisch nicht zu rechtfertigen.1
Bei einer Number Needed to Treat ungleich 1 ist es ethisch umso wichtiger, dass sich der pädagogisch, therapeutisch oder pflegerisch Behandelte freiwillig für die Maßnahme entscheidet. In Großbritannien führte Florence Nightingale die ethische Position Schleiermachers fort, indem sie gegen die Mediziner ihrer Zeit systematische vergleichende Erhebungen der Folgen pflegerischer und medizinischer Handlungen forderte.
Wie in Abbildung G-1 gezeigt, die in Abbildung G-2 (Kap. G.1.2.1) konkretisiert wird, besteht jede pflegerische Einzelfallentscheidung aus mehreren Komponenten: der Expertise der Pflegenden, den Vorstellungen des Pflegebedürftigen, den Umgebungsbedingungen und den Ergebnissen aus der Pflegeforschung, wobei jeder dieser Teile bei jeder Entscheidung in unterschiedlich starkem Ausmaß herangezogen wird. In der ambulanten Pflege scheinen vielleicht alle Elemente gleich stark vertreten, auf einer Intensivstation sind die Vorstellungen des Pflegebedürftigen gezwungenermaßen manchmal deutlich weniger erkennbar. Entscheidend sind immer die Ziele der Pflegenden.
Bisher basiert die Pflegepraxis zu einem sehr großen Teil auf der Expertise der Pflegenden und nur zu einem geringen bis gar keinem Teil auf Ergebnissen der Pflegeforschung – dies kann aber sehr gefährlich sein.
Wenn man die Methode Evidence-based Nursing direkt am Bett anwendet, deckt sich die Definition von Evidence-based Nursing weitestgehend mit den Komponenten der pflegerischen Entscheidung aus Abbildung G-1; Evidence-based Nursing kann aber auch abstrakter gesehen werden, wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben wird.
Was Evidence-based Nursing ist, lässt sich nur verstehen, wenn Sie Evidence-based Nursing auf die alltäglichen pflegerischen Entscheidungssituationen in der Interaktion zwischen professionell Pflegenden und ihren Klienten beziehen. Daher beginnen wir dieses Buch mit der Analyse dieser Entscheidungssituation.
Begännen wir dieses Buch nicht mit der Analyse alltäglicher pflegerischer Entscheidungen, verkäme Evidence-based Nursing schnell zu einem Klippschulkurs in einigen statistischen und hermeneutischen Methoden. Würden wir dabei noch die beliebten Rangfolgen von Evidence auflisten, würde unser Kurs vollends antiwissenschaftlich, nämlich dogmatisch. Was aber zwischenmenschlich („intersubjektiv“) nachprüfbares und durch Nachprüfung beständig verbessertes Wissen ist, davon handelt dieses ganze Buch.
G.1.1 Vertrauen in Zauberkraft, Vertrauen in Wissenschaft
Ist Wissenschaft Zauberei? Worauf vertrauen Pflegebedürftige, die sich an uns Pflegende wenden? Diejenigen Pflegebedürftigen, die sich überhaupt durch ausgebildete, professionell Pflegende pflegen lassen wollen (und das sind bekanntlich längst nicht alle!), tun dies, weil sie darauf vertrauen, dass wir sie nicht unnötigen Qualen und gefährlicher Pflege aussetzen. Aus demselben Grund vertrauen wir, wenn wir der Pflege anderer Professioneller bedürfen, diesen Pflegeprofessionellen. Wir vertrauen also nicht nur den verständnisvollen Augen und den großen und warmen Händen der uns Pflegenden, sondern wir vertrauen dem, was wir hinter diesen verständnisvollen Augen und den warmen und sicheren Händen vermuten: eine spezielle berufliche Fähigkeit, verbunden mit einem speziellen beruflichen Wissen. Denn viele Menschen sehen uns verständnisvoll an und haben schöne warme Hän|30|de. Wir schätzen sie hoch und manche lieben wir, aber wir vertrauen ihnen nicht in exakt derselben Weise, in der wir Pflegeprofessionen vertrauen.
Abbildung G-1: Komponenten einer pflegerischen Entscheidung (Eigendarstellung)
Wenn Pflegebedürftige überhaupt darauf vertrauen, dass wir sie nicht unnötigen Qualen und gefährlicher Pflege aussetzen, dann vertrauen sie, so lässt sich zusammenfassen, auf die beständige Nachprüfung unseres Wissens. Sie vertrauen keineswegs nur auf unsere guten Absichten. Sie vertrauen darauf, dass wir unser Wissen wirklich beständig nachprüfen. Es ist keine Frage, dass wir diesem Vertrauen nicht immer gerecht wurden und auch nicht immer gerecht werden. Dekubitusgefährdete sind – in allerbester Absicht! – geföhnt und geeist worden, obwohl dies eine besonders quälende Form der Körperverletzung ist. Das macht für unsere Klienten das Programm der Wirksamkeitsprüfung umso dringlicher.
In diesem Grundlagenkapitel werden wir uns der Frage widmen, was nachprüfbares Wissen für die Pflegepraxis ist (Kap. G.2). Dies ist zu klären, bevor wir auf die Fülle von Methoden und Techniken kommen, die die Vorstellung nachprüfbaren Wissens umsetzen sollen (Kap. 1, Schritt 1 bis Kap. 6, Schritt 6). Man kann über dieses Wissen nicht reden, ohne sich zuvor die Situation pflegerischer Problemlösung und Entscheidungen zu vergegenwärtigen, in der dieses Wissen ein „externer“ Bestandteil ist (Kap. G.1.2). Gingen wir nicht in diesem ganzen Buch von der grundsätzlichen Entscheidungssituation der Pflegepraxis aus, lieferten wir vielleicht einen kurz gefassten Überblick über Forschungsmethoden, aber trügen keineswegs zum Konzept von Evidence-based Nursing bei.
G.1.2 Ethik pflegerischer Problemlösungen und Entscheidungen, interne Evidence und externe Evidence
G.1.2.1 Die Grundsituation
Evidence-based Nursing versteht man am besten, wenn man die pflegerische Entscheidung sowie ihre idealen und ihre realen Bestimmungsgründe versteht, wie sie in Abbildung G-2 aufgeführt werden.
Vielleicht erwarten Sie von diesem Buch, dass es Sie weitgehend in die Lektüre und Beurteilung von Studien einführt, für die wir gleich das Wort der „externen Evidence“ erklären. Die Erwartung ist natürlich berechtigt, und wir wollen sie nach Kräften zu erfüllen versuchen. Aber diese Erwartung trifft nicht das, was Evidence-based Nursing eigentlich soll. Daher ist es wichtig, dass Sie sich zu Beginn klarmachen, dass sich das ganze Unternehmen Evidence-based Nursing ausschließlich von der gemeinsamen pflegerischen Entscheidungshandlung her be|31|gründet. Diese Situation schematisiert Abbildung G-2, auf die wir uns auf den folgenden Seiten beziehen.
Abbildung G-2: Evidence-basierte pflegerische professionelle Praxis: interne und externe Evidence, moralische und ökonomische Anreize bei pflegerischen Entscheidungen (Eigendarstellung)
Unter „pflegerischer Entscheidungshandlung“ verstehen wir in Anlehnung an Simon (1960) Problem Solving (= Problemlösen). Mit Problemlösung ist jede Handlung gemeint, die ein Problem erkennt (d. h. konstruiert) und Lösungsalternativen sucht, über die dann entschieden wird. Problem Solving ist also mehr als die Entscheidung zwischen bekannten Alternativen. Der als Decision Making bezeichnete Schritt der Entscheidung zwischen bekannten Alternativen ist so einfach, dass er automatisierbar ist, wie Simon mit Recht betont. Schwieriger und entscheidender ist die Aufbereitung einer Situation, die Bewertung verschiedener Alternativen für die Entscheidung.
Dabei ist, wie Sie aus vielfältiger eigener Erfahrung wissen, für unsere praktischen Lebensentscheidungen als Problem Solving typisch, dass wir sie unter Ungewissheit der Folgen unserer Entscheidung treffen müssen. Müssen meint: Wir können die Entscheidung nicht beliebig aufschieben, weil auch eine Nichtentscheidung eine Entscheidung ist. Während der Aufschiebung einer Entscheidung kann sich der Zustand erheblich verschlechtern. Insofern stehen wir unter einem unabweisbaren Entscheidungsdruck unter Ungewissheit.
Eine Problemlösung kann – im Moment der Entscheidung – nicht aus vollständig bekannten Randbedingungen abgeleitet werden, wie ein Beweis in der Mathematik. Ob die Entscheidung richtig war, zeigt sich erst hinterher, wenn die Folgen der Entscheidung eingetreten sind. Im Moment der Entscheidung können wir noch nicht wissen, ob sie richtig sein wird.
Das berechtigt uns aber keineswegs, auf gut Glück zu entscheiden. Wir bleiben begründungspflichtig für unsere Entscheidungen. Wir begründen unsere Entscheidungen mit Erwartungen. Wir entscheiden uns zum Beispiel für eine pflegerische Maßnahme, weil sie anderen in vergleichbaren Situationen geholfen hat. Diese Erwartung kann sich als falsch erweisen. Dass eine Maßnahme anderen geholfen hat, heißt nicht notwendigerweise, dass sie uns oder unseren Klienten hilft.
Viele hilfreiche Wirkungen werden auch zufällig entdeckt, als Nebenwirkungen ganz anders geplanter Handlungen. Aber wir stehen unseren Klienten gegenüber in der Pflicht, ihre Ziele und das überhaupt Erwartbare so sorgfältig abzuklären, wie es die Zeit erlaubt. Diese Pflicht ist nicht erst dann verletzt, wenn sich |32|eine Entscheidung nachträglich als falsch herausstellt. Sie ist schon dann verletzt, wenn wir nicht sorgfältig genug Probleme und Ziele und das überhaupt verfügbare externe Wissen vorab geprüft haben. Im Alltagsdeutsch gibt es dafür zwei präzise Wendungen, die täglich millionenfach gebraucht werden, sobald uns die Folgen von Entscheidungen sichtbar werden: „Ich hätte es eigentlich wissen müssen“ und „Damit hat niemand rechnen können“.
In Entscheidungsmodellen der neoklassischen Ökonomie und manchen psychologischen Modellen wird oft, um überhaupt zu ableitbaren Ergebnissen zu kommen, die Ungewissheit der Zukunft getilgt durch bewertete Erwartungen und Risikopräferenzen. Dann werden rationale Entscheidungen ableitbar und von irrationalen Entscheidungen abgrenzbar. Solche Modelle sind hilfreich für Klausuren und als Checklisten für Gesichtspunkte eigener Entscheidungen.
Durch ihre Umdeutung von „Ungewissheit“ in „Unsicherheit“ (als eine bekannte und berechenbare Risikokonstellation) treffen diese Modelle die lebenspraktische Situation der Entscheidung unter Ungewissheit aber gerade nicht (Behrens, 1982; Oevermann, 1991). Lebenspraktische Entscheidungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass Probleme durch Infragestellen von Routinen (an)erkannt und Entscheidungen unter Ungewissheit und trotzdem bei Begründungspflicht getroffen werden müssen. Oevermann (1991) nennt deshalb die Lebenspraxis eine widersprüchliche Einheit von Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung.
Abbildung G-3 verdeutlicht drei grundlegende Erkenntnisse:
Abbildung G-3: Das Pflegemodell – pflegerische Entscheidungen als Phase pflegerischer Problemlösungen (Eigendarstellung)
Die pflegerische Entscheidung als Auswahl zwischen bewerteten Alternativen ist ein spätes und ziemlich automatisierbares Stadium im Problemlösungsprozess.
Die (Literatur-)Suche nach pflegerischen Handlungsalternativen folgt der Problem(an)- erkennung nicht nur, Literaturergebnisse wirken auch auf die Problemanerkennung zurück. Denn entdeckte Möglichkeiten spezifizieren Bedürfnisse und präzisieren Problemsichten.
In der Literatur (Illustrierte, Internet) entdeckte Möglichkeiten können dazu führen, sich an einen bestimmten Adressaten mit der Bitte um Beratung zu wenden.
|33|Im Kern dieser Situation steht in der Pflege typischerweise die Kommunikation zwischen zwei Personen, nämlich dem professionell Pflegenden auf der einen Seite und dem sich selbst als pflegebedürftig ansehenden Klienten auf der anderen Seite. Selbstverständlich kann der Klient auch eine Gruppe sein bis hin zum Bundestag. Da die Pflegeprofession nicht Organe behandelt, sondern Personen unterstützt, ist für die Wirksamkeit der Pflege einschließlich der pflegerischen Beratung ein Arbeitsbündnis zwischen Professionsangehörigen und Klienten in der Regel unerlässlich.
Im Folgenden gehen wir zunächst kurz darauf ein, in welcher Eigenschaft sich die beiden hier begegnen und kooperieren. Vor diesem professionstheoretischen Hintergrund führen wir die entscheidende Unterscheidung zwischen externer Evidence und interner Evidence ein.
Externe Evidence liegt in Datenbanken über die erwiesene Wirksamkeit von Interventionen oder diagnostischen Verfahren vor, also in Aussagen, welche Wirkung eine Intervention auf eine bestimmte Population im Durchschnitt wahrscheinlich hatte. Extern nennen wir diese Evidence, weil sie unabhängig von der pflegenden Person und ihren Klienten existiert. Dieses Wissen existiert auch außerhalb (= extern) von deren Kommunikation (s. Kasten links in Abb. G-2).
Das Gegenteil gilt für die interne Evidence. Sie umfasst die Überzeugungen, die an die kommunizierenden Personen und ihre Kommunikation gebunden sind (s. Kasten rechts in Abb. G-2). Das gilt nicht nur für die persönlichen Erfahrungen beider, sondern auch für die individuell-biographische Zielsetzung und die individuelle Diagnose in den Dimensionen des Impairments, der Aktivitäten des täglichen Lebens und der individuellen Realisierung der gewünschten Partizipation in den individuell bedeutsamen sozialen Zusammenhängen, wie sie die internationale diagnostische Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation („ICF“) erfasst.
Zwar können die Kategorien und die Methoden der Diagnose allgemein verbreiteten Regeln folgen, aber das Ergebnis der Diagnose ist an die Personen gebunden. Auch die persönliche Erfahrung, die Intuition, die „Nase“ sind möglicherweise nichts anderes als individuell angeeignete, zur Selbstverständlichkeit (tacit knowledge) herabgesunkene externe Evidence. Aber als eben schweigendes Wissen sind sie an die Person gebunden.
Daraus wird klar: Niemals kann die externe Evidence die persönliche pflegerische Entscheidung der Pflege- und Therapiebedürftigen, die persönliche Zielsetzung und Problemstellung ersetzen. Immer sind eine Bedarfserhebung und eine pflegerische Entscheidung unter Restunsicherheit vorzunehmen. Dass Pflegebedürftige wie im Blutanalyselabor automatisch diagnostiziert und automatisch unter die richtigen Pflegeinterventionen gemäß Stand der externen Evidence subsumiert werden, ist – selbst wenn es überhaupt wünschenswert wäre – ausgeschlossen. Aber je mehr sich pflegerische Problemlösungen auf externe Evidence stützen können, umso mehr überflüssiges Leid und überflüssige Qual können vermieden werden.
Evidence-based Nursing stellt sich also nicht die Frage: „Wie kriege ich Datenbanken mit externer Evidence voll und wie zapfe ich sie an?“ Vielmehr ist Evidence-based Nursing eine Methode der Verknüpfung von externer Evidence und interner Evidence im einzigartigen Einzelfall meines Klienten, bei dem eine pflegerische Entscheidung unter Unsicherheit nicht beliebig bis zur endgültigen Klärung aufgeschoben werden kann. Im Unterschied zur Obduktion in der Gerichtsmedizin, die sich alle notwendige Zeit für die Wahrheitsfindung nehmen kann, stehen wir in der Pflege unter Handlungsdruck – auch eine Unterlassung ist eine Handlung.
Auf das Verhältnis von externer Evidence zu interner Evidence gehen wir auf den folgenden Seiten knapp ein, bevor wir in Kapitel G.2 die Besonderheiten Evidence-basierten, wissenschaftlichen, also vor allem zwischenmenschlich nachprüfbaren Wissens herausarbeiten. Denn auf das Verhältnis von externer Evidence und interner Evidence werden wir in diesem Buch immer wieder zurückkommen müssen.
|34|In Abbildung G-2 finden Sie im dritten Kasten jene Einflüsse, die auf Problemdefinitionen und Entscheidungen wirken, ohne in jedem Fall auf die Bedürfnisse der Klienten oder externe Evidence zurückführbar zu sein. Das sind Kosten und Entgelte oder Erträge pflegerischer Maßnahmen, also ökonomische Anreize. Das sind Anerkennung und Reputation, die mit bestimmten pflegerischen Handlungen verbunden sind. Und das sind gesetzliche und organisationsinterne Vorschriften, ungeschriebene, aber wirksame Faustregeln, Richtlinien und Empfehlungen, die unser Handeln tatsächlich – man mag das bedauern oder nicht – auch dann leiten, wenn sie nicht Evidence-basiert und durch Prioritäten der Klienten begründet sind. Auch diese Wirkkräfte bedürfen des theoretischen Verständnisses in einer soziologischen Theorie ökonomischer und moralischer Anreize und der Entstehung von Leitlinien und Vorschriften.
Es wäre naiv, diese Anreize aus den Organisationsformen pflegerischer Arbeit zu vernachlässigen. Die Welt besteht nicht nur aus Pflegenden, die einem Pflegebedürftigen gerecht werden wollen und dazu ausschließlich auf interne biographische und externe Evidence aus Studien zurückgreifen. Die Pflegenden sind zugleich – um ihre Existenz zu sichern – in arbeitsteiligen Strukturen organisiert. Das gilt für die auf sich gestellte Gemeindeschwester nicht weniger als für die Pflegenden in großen Kliniken. Wenn Evidence-based Nursing für die Praxis relevant sein soll, dann muss sie sich in diesen Organisationsstrukturen bewegen und sie verändern können (s. die Schritte des EBN-Vorgehens, Kap. G.1.3.1).
Auf welche Theorien können wir zum Verständnis der für Evidence-based Nursing typischen Problemlösungssituation zurückgreifen? Für die externe Evidence ist Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, für die interne Evidence die Professionstheorie und für die arbeitsteiligen Strukturen, in denen Arbeitsbündnisse zur Problemlösung organisiert sind, ist eine soziologische Theorie ökonomischer und sonstiger Anreize hilfreich. Diese drei theoretischen Ansätze durchdringen sich wechselseitig.
G.1.2.2 Das professionstypische Arbeitsbündnis: Qualitätssicherung
Zauberinnen, Dienerinnen, Pflegeprofessionelle
Dieses Arbeitsbündnis zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen ist in jedem einzelnen Fall einzigartig. Eine Wiederholung ist extrem unwahrscheinlich. Die Konstellation unterscheidet sich von der kommunikativen Situation eines Pflegebedürftigen mit seinen Angehörigen. Allein dadurch, dass die Pflegende ihm als berufsmäßig Pflegende entgegentritt, ergibt sich eine veränderte Situation. Diese hat zwei hauptsächliche alternative Ausprägungen, die aus der Geschichte der Verberuflichung der Pflege resultieren.
Eine Dienstleistung gegen Geld kann nämlich zum einen eine Leistung sein, die vom jeweiligen Auftraggeber präzise vorgeschrieben werden kann. Diese Art der Dienstleistung wird typischerweise von Dienern erbracht, wenn die Herrschaft mindestens so gut wie die Diener selbst beurteilen kann, was die wesentlichen Qualitätsmerkmale einer Leistung sind. In diesem Sinne sind die meisten von uns in der Lage, selbst beurteilen zu können, wie die Reinigung ihrer Wohnung erfolgen oder Essen gekocht werden sollte, auch wenn sie es nicht selbst tun.
Von dieser Dienstleistung unterscheidet sich zum anderen die Dienstleistung, die sich vom ersten Beruf herleitet. Diese erste Vorform der späteren Berufe ist der „Beruf“ des Zauberers oder Zaubererpriesters. Das heißt, der Dienende verfügt über Fähigkeiten und ein Wissen, das dem Klienten gerade nicht zur Verfügung steht. Genau aus diesem Grunde setzen Klienten geradezu charismatische Erwartungen in den professionell Handelnden.
Es kann hier leider nicht in der nötigen Ausführlichkeit dargestellt werden, warum sich die Pflege diesen Berufen des Zauberers und der späteren weisen Frau in ihrer Geschichte ver|35|dankt. Deutlich hervorheben möchten wir aber, dass das zauberische Wissen (z. B. das der weisen Frau) gerade vor der zwischenmenschlichen Mitteilbarkeit und Nachprüfbarkeit aus Gründen der Verheimlichung geschützt wurde, um Erwerbschancen für die Zauberer und weisen Frauen zu monopolisieren. So hieß es beispielsweise im frühen hippokratischen Eid, dass derjenige, der sein Wissen an Berufsfremde verrät, umgebracht werden soll (Behrens, 2019).
Angehörige der Pflegeprofession hingegen berufen sich nicht auf nur ihnen offenbarte Geheimlehren, sondern auf zwischenmenschlich nachprüfbares Wissen. Im Unterschied zu Dienern tun sie andererseits auch nicht so, als wüssten sie nicht mehr als die einzelnen Pflegebedürftigen und diese seien als auftragserteilende Kunden selbst schuld, wenn sie ihnen den falschen Auftrag gäben (wie in der DIN ISO 9000–9002).
Diese Verantwortung für die Durchführung können Professionen nicht auf ihre Klienten abwälzen, wie etwa Diener auf ihre Herrschaft. Deshalb haben wir große Bedenken, Pflegebedürftige umstandslos als „Kunden“ zu bezeichnen. Ein Kunde ist für seinen Kauf selbst verantwortlich. Der Verkäufer kann sich daher über den Verkauf freuen und ist keineswegs dazu verpflichtet, den Kunden darauf hinzuweisen, wenn der die Ware in dieser Ausführung nach Meinung des Verkäufers gar nicht unbedingt braucht. Genau zu diesem Hinweis sind Angehörige der Pflegeprofession aber verpflichtet. Sie sind nicht nur Verkäufer und Diener, sondern vor allem Angehörige einer Profession.
Denn wenn Pflegebedürftige auch in zahlreichen Situationen wie Kunden handeln können, die die Eignung und Beschaffenheit einer Ware genau beurteilen können, so können sie das doch nicht immer. Sie bedürfen der uneigennützigen Information und Beratung durch die Angehörigen der Pflegeprofession. Es gehört zu den Schwächen der Diskussion über personale soziale Dienste, dass in ihr die Unterscheidung zwischen Dienern und Professionen nicht von den Arbeitsbündnissen mit Klienten (nicht Kunden!) her getroffen wird. Daher ist die Qualitätsdefinition der ISO 9000–9002 für Professionshandeln nicht einfach übertragbar, weil in der ISO-Norm der Kunde die Verantwortung für die Qualitätsdefinition hat.
Dass aber die Pflege als Beruf ihren Ursprung in dem Zaubererberuf der weisen Frauen hat, wird uns in unserer ganzen Arbeit begleiten als gelegentliche Hoffnung der Pflegebedürftigen auf unsere geradezu überirdischen Fähigkeiten. So sind Pflegebedürftige in der Regel verunsichert, eine berufsmäßig Pflegende oder einen Arzt zu sehen, der sich bei ihrem Anblick am Kopf kratzt und erst mal Bücher wälzt. Es besteht eine Erwartung an ärztliche und pflegerische Eleganz (Behrens, 2000), die darin besteht, dass jemand ohne langes Grübeln sofort weiß, was zu tun ist.
G.1.2.3 Ethik interner Evidence
Was ist der Inhalt dieser Kommunikation zwischen Pflegeprofessionen und ihren Klienten? Das lässt sich gut an der pflegerischen Diskussion über Qualitätssicherung und dem Pflegeprozess mit seiner Ausführung in Critical Pathways erörtern, die sich durch Evidence-based Nursing mehr am einzigartigen Patienten oder Pflegebedürftigen orientieren. Inhalte der Kommunikation zwischen Pflegeprofession und den jeweils einzigartigen Klienten sind die Erarbeitung:
des Pflegeziels als eines Teilhabeziels,
des Einverständnisses über den Prozess, mit dem es zu erreichen ist, und daher
die Ableitung der Strukturen aus dem Prozess, die für einen Pflegeprozess nötig sind.
Diese Entscheidungsthemen lassen sich sehr gut mithilfe des Donabedian-Schemas darstellen, das durch uns um eine vierte Stufe erweitert worden ist (Behrens, 1999):
Strukturqualität
Prozessqualität
Qualität des Prozess-Outcomes (Prozessergebnisqualität)
|36|Zusammenhang von Prozess-Outcome und dem eigentlich angestrebten, aber nicht allein durch den Prozess erreichbaren begründenden Ziel (Zielerreichungsqualität) (Abb. G-4).