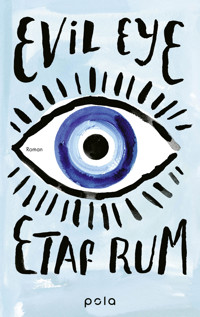
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: pola
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach außen hin führt Yara ein perfektes Leben: Sie hat ein abgeschlossenes Studium, einen guten Job, erzieht parallel die beiden Töchter und bereitet das Abendessen vor, wenn ihr Mann nach langen Arbeitstagen nach Hause kommt. Doch wieso fühlt es sich nicht richtig an? Woher kommen ihre Unzufriedenheit, ihre Wutausbrüche, ihre zunehmende Verzweiflung? Als Yara nach einem Zwischenfall auf der Arbeit gezwungen wird, eine Auszeit und psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, kommt ein Stein ins Rollen und sie beginnt, sich ihren Gefühlen zu stellen. Evil Eye erzählt von der Bedeutung eines erfüllten Lebens und wie unsere unbewältigte Vergangenheit unsere Gegenwart beeinflusst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Danksagung
Triggerwarnung
Über das Buch
Nach außen hin führt Yara ein perfektes Leben: Sie hat ein abgeschlossenes Studium, einen guten Job, erzieht parallel die beiden Töchter und bereitet das Abendessen vor, wenn ihr Mann nach langen Arbeitstagen nach Hause kommt. Doch wieso fühlt es sich nicht richtig an? Woher kommen ihre Unzufriedenheit, ihre Wutausbrüche, ihre zunehmende Verzweiflung? Als Yara nach einem Zwischenfall auf der Arbeit gezwungen wird, eine Auszeit und psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, kommt ein Stein ins Rollen und sie beginnt, sich ihren Gefühlen zu stellen. Evil Eye erzählt von der Bedeutung eines erfüllten Lebens und wie unsere unbewältigte Vergangenheit unsere Gegenwart beeinflusst.
Über Etaf Rum
Etaf Rum wurde in Brooklyn, New York, geboren und wuchs als Kind palästinensischer Einwanderer auf. Ihr Debütroman A WOMAN IS NO MAN war ein NEW-YORK-TIMES-Bestseller. Mit ihrem zweiten Roman EVIL EYE, der von NPR als BESTES BUCH DES JAHRES ausgezeichnet wurde, festigt Etaf Rum ihre Position als führende literarische Stimme, die sich von Herkunft und Lebensgeschichten Einzelner befreit.
Etaf Rum
Evil Eye
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Heike Reissig
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
pola-Verlag
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Evil Eye«
Copyright © 2023 by Etaf Rum
Published by Arrangement with RUMBOOKS, INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Anne Schünemann, Schönberg
Sensitivity Reading: Dina Al-Farhi, Essen
Covergestaltung: Thomas Krämer, Bastei Lübbe, nach Vorlage des Originalumschlags
Coverillustration und -typographie: © Lauren Tamaki
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7596-0015-8
Sie finden uns im Internet unter luebbe.deBitte beachten Sie auch: lesejury.de
FÜRREYANNUNDISAH
نور حياتي
. كل الطرق تؤدي إليك، حتى تلك التي أخذتها لانساك
محمود درويش –
Alle Wege führen zu dir, selbst die, die ich nahm, um dich zu vergessen.
– Mahmud Darwish
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr am Ende eine Triggerwarnung. Achtung, sie enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das beste Leseerlebnis.
Euer pola-Verlag
Prolog
YARAS TAGEBUCH
Ich weiß auch nicht, warum ich das hier schreibe. William hat gemeint, es würde mir helfen, auf diese Weise mit dir zu sprechen und die Gegenwart mit der Vergangenheit in Einklang zu bringen. Ich muss dorthin zurück, muss einen Weg finden, dich zu erreichen, aber ich weiß nicht wie.
Worte sind mir schon immer schwergefallen. Manches lässt sich durch Sprache einfach nicht ausdrücken.
Stattdessen male ich Bilder in meinem Kopf. Ich baue ein weißes Haus mit einem farbenfrohen Garten an einem stillen See, der von smaragdgrünen Seerosenblättern bedeckt ist, und dann versetze ich mich dorthin. Die Räume sind hell und luftig, haben große Fenster, durch die ich die Welt beobachte. Draußen zwitschern Vögel, Blumen blühen, und alles wirkt friedlich unter dem weiten, offenen Himmel. Ich schließe die Augen und male noch mehr Bilder, Pinselstrich für Pinselstrich, von Sonnenblumen und Sonnenuntergängen und Zimmern voller Bücher, damit ich nicht allein sein muss.
Ich gebe mir wirklich Mühe, Williams Rat zu folgen. Er meinte, ich solle die Augen schließen und die Stimmen in meinem Kopf verstummen lassen. Doch wenn ich anfange, Erinnerungen niederzuschreiben, sie in klare Sätze zu fassen, finde ich nicht die richtigen Worte. Wenn ich zurückblicke und nach dir suche, ist mein Gedächtnis wie ausgelöscht. Ich kann es nicht beschreiben, dieses Gefühl, diese unsichtbare Wunde. Aber ich spüre sie, als würde mein ganzer Körper brennen.
William sagt, durch das Schreiben lasse sich das Unaussprechliche in eine Geschichte verwandeln.
Aber ich will keine Geschichte erzählen. Ich will mich befreien.
YARAS TAGEBUCH
Solange du zurückdenken konntest, brachte Teta – deine Mutter und meine Großmutter – dir bei, vorsichtig durchs Leben zu gehen. Teta sagte auf Arabisch oft: »Das Unglück lauert überall.«
Schon als Kind hütest du dich davor, unter Leitern durchzugehen oder Spiegel zu zerbrechen. Wenn du etwas verschüttest, wirfst du dir eine Prise Salz über die linke Schulter, um dich zu schützen. Du hast gelernt, dass man eine juckende Hand nicht kratzen soll, weil man sonst Geld verliert, und dass man einer schwarzen Katze nicht in die Augen schauen darf, weil sonst ein Dschinn von einem Besitz ergreift.
Tetas Lieblingsaberglaube ist Tabseer, Kaffeesatzlesen. Du schaust ihr oft zu, wenn sie das Ritual für Familie, Nachbarn und Freunde durchführt, denn alle sind ganz begierig darauf zu erfahren, was ihnen die Zukunft bringen wird. Oben auf der Dachterrasse sitzt Teta den Leuten gegenüber am Tisch, die Hände um eine mit Blumen bemalte Tasse geschlungen. Eigentlich ist es ein Tässchen, nur fünf Zentimeter hoch, mit kleinem Durchmesser. Teta starrt jedes Mal hinein, holt tief Luft und nickt. Und wenn sie endlich wieder aufblickt, mit wissender Miene, funkeln ihre Augen.
Du verbringst den Großteil deiner Zeit mit Teta auf der Dachterrasse, pflanzt und putzt Gemüse, backst Brot, hängst Wäsche auf und spielst auf deiner Oud. Eure Unterkunft ist klein und beengt, doch oben auf dem Dach, mit dem weiten, offenen Himmel über dir, fühlst du dich frei.
Eines Morgens, als Teta Mokka zubereitet, sagt sie zu dir: »Ich war so alt wie du, als meine Mutter mir das Kaffeesatzlesen beigebracht hat.« Der Duft frisch gemahlener Bohnen liegt in der Luft, während ihr dort oben nebeneinandersitzt, auf dem Dach eurer Unterkunft, in einem überfüllten Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland. Und dann beginnt Teta mit dem Ritual, das in der Familie schon seit vielen Generationen weitergegeben wird.
»Mokka ist vor allem eine Tradition«, sagt sie. »Eine Kunst.«
Im Schneidersitz auf dem Betonboden schaust du zu, wie Teta zwei Löffel fein gemahlenen Kaffee in einen kupfernen Ibrik schaufelt und ihn zur Hälfte mit Wasser füllt. Sie erhitzt den Kaffee langsam über offenem Feuer, um das beste Aroma zu erzielen, und rührt ihn um, bis er köchelt. Sobald sich samtiger Schaum auf dem Mokka gebildet hat, gießt sie die Qahwa in zwei Porzellantassen mit passenden Untertassen und stellt sie auf ein Tablett. Das Kaffeeservice kommt dir wie ein Kunstwerk vor – die verschlungenen Muster, die geschickt in das glänzende Kupfer des Tabletts gehämmert wurden, das von Hand bemalte Porzellan mit den blau-weißen Tulpen und Hamsas, die das Böse abwehren sollen.
Dein Blick ist auf Teta geheftet, als ihr das dunkle, wohlriechende Gebräu in kleinen Schlucken zu euch nehmt. Es schmeckt genauso, wie du dir Qahwa vorgestellt hast – stark und süß, mit einem dunklen bitteren Nachgeschmack.
»Du musst langsam trinken, Meriem«, sagt Teta und schürzt ihre Lippen um den Porzellanrand. »Und nach dem letzten Schluck wünschst du dir etwas.«
Du eiferst ihr nach und nimmst kleine Schlucke von der Seite, denn der Kaffee soll sich erst absetzen, wenn die Tasse leer ist.
Als Teta ihre Tasse ausgetrunken hat, legt sie ihre Untertasse darauf und stellt beides zusammen auf den Kopf. Während ihr darauf wartet, dass der Kaffeesatz trocknet, singst du und spielst auf deiner Oud, zupfst die Saiten dieses uralten Instruments, und Teta summt dazu. Schließlich dreht sie die Tasse wieder um, und ihr schaut beide hinein, um die dunklen körnigen Streifen wie eine Schatzkarte zu lesen.
»Man muss vorsichtig sein«, sagt Teta mit ernster Stimme. »Es bringt Unglück, aus der eigenen Tasse zu lesen, außer man macht es, um jemandem diese Kunst beizubringen.«
Im Laufe der Jahre verbringst du viele Nachmittage mit Teta auf dem Dach, Schulter an Schulter über eine leere Tasse gebeugt, um die Streifen, Spuren und Symbole zu deuten. Allmählich lernst du, den Kaffeesatz selbst zu deuten. Lange Spuren besagen, dass der Wunsch in Erfüllung gehen wird, kurze Spuren stehen für das Gegenteil. Symbole am Tassenrand sagen die Zukunft voraus, Symbole auf dem Boden beziehen sich auf die Vergangenheit. Ein Ring bedeutet Heirat. Eine Blume bedeutet Glück. Kaffeekrümel auf der Untertasse heißen, dass Probleme sich in Luft auflösen werden.
Doch erst an deinem Hochzeitsabend willigt Teta endlich ein, aus deiner Tasse zu lesen.
Als ihr wieder zusammen auf dem Dach sitzt, stellt Teta das Tablett mit dem Kaffeeservice wie gewohnt hin: den Ibrik in die Mitte, die abgegriffenen Tassen links und rechts daneben. Langsam und mit zitternden Fingern trinkst du deine Qahwa, auf dem Porzellan fällt dir ein dünner Riss auf. Nach dem letzten Schluck schwenkst du deine Tasse, damit der Kaffeesatz sich darin verteilt, und stellst sie schließlich kopfüber auf die Untertasse. Teta legt deinen Ehering auf die umgestülpte Tasse und nestelt am Stoff ihres Thobe.
Du schaust sie nervös an, kannst es kaum erwarten, dass die zehn Minuten, bis der Kaffeesatz getrocknet ist, vorübergehen. Du stellst dir dein Leben jenseits des Lagers vor, ein Leben, in dem du endlich deiner Leidenschaft, dem Singen, nachgehen kannst, ohne dass die Nachbarinnen rund um die Uhr darauf lauern, dass du schwanger wirst, während sie Gemüse schnippeln und sich das Maul über dich zerreißen.
»Er müsste nun trocken sein«, sagt Teta endlich und dreht die Tasse um.
Du schiebst deine Träume beiseite und holst tief Luft. Jetzt ist es so weit, denkst du. Ein neuer Anfang.
Aber als Teta auf deine Tasse hinunterschaut, weißt du sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie neigt die Tasse zur Seite, runzelt die Stirn und starrt wortlos auf den Kaffeesatz, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise deutet sie ohne Umschweife die Symbole, doch nun zögert sie, und das macht dir Angst.
»Was siehst du?«, fragst du schließlich. »Werde ich in Amerika als Sängerin berühmt? Werde ich glücklich?«
Tetas Hände zittern. Sie starrt eine Weile mit verzerrter Miene auf ihren Schoß, bevor sie die Fassung zurückgewinnt und dich anschaut.
»Ich sehe viele Nester«, sagt sie schließlich.
»Schwangerschaft?«
»Ja«, sagt Teta. »Viele Kinder. Du wirst eine wunderbare Mutter sein.«
»Mutter.« Als du das Wort wiederholst, klingt es wie eine traurige Melodie. Obwohl du keine Kinder willst, obwohl du dich danach sehnst, frei zu sein, muss es für dich undenkbar sein, dir als Frau ein Leben ohne Mutterschaft vorzustellen.
»Toll«, sagst du schließlich und runzelst die Stirn. »Das trifft auf so gut wie alle Frauen zu. Was noch?«
Teta schluckt, den Blick wieder auf die Tasse gerichtet. Sie rutscht auf ihrem Stuhl herum, neigt die Tasse zur Seite, trommelt mit den Fingern dagegen. »Da sind Berge«, sagt sie schließlich. »Fünf oder sechs.«
»Und was bedeutet das?«
Teta blinzelt mit angespannter Miene. Sie weiß, dass du die Bedeutung kennst, aber sie will es dir leichter machen. »Berge symbolisieren Schwierigkeiten, Hindernisse.« Sie schüttelt den Kopf, ihre Gesichtszüge werden weicher. »Aber das könnte einfach nur heißen, dass es dir schwerfallen wird, dich in Amerika einzugewöhnen.«
»Und wenn es eine Warnung ist, dass mir etwas Schlimmes zustoßen wird?«
»Nein, nein«, sagt Teta, weicht deinem Blick jedoch aus. »Alle Menschen machen schwierige Zeiten im Leben durch, Meriem. Insbesondere Frauen.«
Du schaust sie ungläubig an. »Siehst du noch etwas anderes?«
Teta setzt an, etwas zu sagen, dann schüttelt sie den Kopf. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. »Du musst nicht gehen, ya Binti. Du kannst hier bei mir bleiben, zu Hause, in deinem Land.«
»Ich wünschte, ich könnte, Yumma«, sagst du. »Aber Palästina gehört uns nicht mehr, und mir bleibt hier nichts.« Du sitzt dort, ringst die Hände im Schoß, und plötzlich überkommt dich eine Schwere, eine altvertraute Dunkelheit breitet sich in dir aus, als ob deine Seele in Teer erstickt. Wie sollst du Teta begreiflich machen – es ist unmöglich –, dass die Angst davor, sie zu verlassen und neu anzufangen, nichts ist im Vergleich zu der erdrückenden, überwältigenden Furcht, zurückzubleiben? Du versuchst, das Zittern in deiner Stimme zu unterdrücken, als du weiterredest: »Bitte mach dir keine Sorgen um mich, wenn ich in Amerika bin. Ich komme dich so oft wie möglich besuchen, und wenn wir uns das nächste Mal sehen, bin ich bestimmt schon berühmt!«
Teta versucht zu lächeln, doch dann beginnt sie bitterlich zu weinen. Sie stellt die Tasse ab und vergräbt das Gesicht in den Händen. Du schaust Teta wortlos an und fasst dir an den Hals, deine Finger graben sich so fest in die Haut, dass deinem frisch angetrauten Ehemann Stunden später auf eurem Flug nach Amerika ein blauer Fleck auffallen wird.
Irgendwann holt Teta tief Luft und wischt sich übers Gesicht. Sie schaut dich kurz an, bevor sie sich in den Nacken greift, um ihre Halskette zu lösen. Die Kette ist aus reinem Gold mit einem Hamsa-Amulett als Anhänger, das aus einer Hand und einem blau schimmernden Auge besteht – ein Geschenk, das sie zu ihrer eigenen Hochzeit von ihrer Mutter, deiner Großmutter bekommen hat.
Teta streicht dir das Haar zur Seite und gibt dir einen Kuss auf die Stirn. Dann drückt sie dich fest an sich.
Schließlich lässt sie dich wieder los und legt dir langsam die Kette um den Hals. »Nimm das, meine Tochter«, flüstert sie. »Es wird dich immer beschützen.«
1
Yara war gerade dabei, Basmatireis in der Küchenspüle abzugießen, als es an der Tür klingelte. Hastig schüttete sie den Reis in einen Topf und fügte Knoblauch, Piment, Kurkuma und eine Zimtstange hinzu. Dumm nur, dass sie keine rote Chilischote mehr hatte. Stirnrunzelnd warf sie einen Blick auf den Backofen-Timer, griff nach dem Topf und lauschte ihrem Mann, der in den Flur ging, um die Tür zu öffnen.
»Ahlạn wa-sahlạn«, sagte Fadi. »Kommt rein.«
Yara gab warmes Wasser in den Topf. Sie hörte, wie Fadi seine Eltern auf die Wangen küsste und sie sich an der Haustür die Schuhe auszogen. Als Nächstes kamen ihre beiden Töchter polternd die Treppe heruntergerannt. »Sitti! Seedo!«, riefen sie.
An jedem anderen Wochentag hätte Yara den Kopf aus der Küche gesteckt und zugeschaut, wie Mira und Jude die Wendeltreppe hinunterstürmten, um ihren Vater zu begrüßen, wenn er von der Arbeit heimkam. Fadi brachte neuerdings öfter eine Kiste mit, und ihm blieb kaum genug Zeit, sie im Flur abzustellen und sich die Hände an der Hose abzuwischen, bevor seine Töchter ihm die Arme um die Beine schlangen. Aber sonntags nahm Fadi sich frei, und meistens kamen seine Eltern zum Abendessen vorbei. Yara wuselte dann immer stundenlang durchs Haus, um alles für den Besuch vorzubereiten, schrubbte die Badezimmer und entfernte jeden Schmutzfleck vom Parkett. Und wenn sie damit fertig war, betrat sie ihre Speisekammer, um sich dort zu sammeln und den Duft von Olivenöl, Zatar, Piment und Koriander einzuatmen, der sie in die Küche ihrer Großmutter in Palästina zurückversetzte.
Sie stellte den Reistopf auf den Gasherd und schaltete ihn ein. Als sie aufblickte, stand Fadi in der Tür, seine große Gestalt füllte den Rahmen aus. »Diesmal hast du dich selbst übertroffen«, sagte er. »Es riecht köstlich.«
Yara wischte sich mit dem Schürzensaum über die Stirn. Im Flur hörte sie, wie ihre Töchter den Großvater nach oben führten, damit er mit ihnen spielte. »Danke«, sagte sie, ohne Fadis Blick zu erwidern.
Kaum griff sie nach der großen Flasche Olivenöl in der Speisekammer, spürte sie, dass noch jemand in der Küche war. Als sie sich umdrehte, stand ihre Schwiegermutter neben Fadi.
»Marhaba«, sagte Nadia zur Begrüßung.
»Ahlan Khalto.« Yara zwang sich zu einem Lächeln. Sie griff nach ihrem Schürzenzipfel und atmete langsam aus.
»Überschlag dich bloß nicht vor Begeisterung«, sagte Nadia auf Arabisch, während sie ihren Hidschab abnahm, ordentlich zusammenfaltete und auf den Küchentresen legte. Ihr kurzes Haar war mit Henna gefärbt, ein kräftiges Weinrot, doch an den Schläfen zeigten sich graue Strähnen.
Fadi errötete und hustete verlegen. »Ich sehe mal nach den Mädchen.«
Yaras Herz begann zu hämmern, als er aus der Küche verschwand. Sie öffnete die Flasche Olivenöl und goss einen Spritzer auf den Reis.
»Shu? Kochst du etwa noch?«, fragte Nadia und näherte sich dem Herd. Sie war eine korpulente, pausbäckige Frau mit kleinen Augen, die einen erwartungsvoll anstarrten.
»Ich bin fast fertig«, erwiderte Yara. Ihre Hände zitterten, als sie einen Glasdeckel auf den Reistopf setzte, damit kein Dampf entweichen konnte.
»Was haben wir denn hier?« Nadia ging zum gedeckten Esstisch hinüber und inspizierte die palästinensischen Vorspeisen, die Yara auf der Sufra ausgebreitet hatte: Oliven und Olivenöl, Hummus, Pita, Tomatenscheiben, Gewürzgurken, Zitronen, dazu gehackte Minze und Petersilie von ihren Topfpflanzen auf der Fensterbank.
»Kein Salat?«, fragte Nadia.
»Im Kühlschrank ist Taboulé.«
Nadia nickte vor sich hin und zögerte eine Sekunde, bevor sie zum Herd zurückspazierte und die Alufolien von den abgedeckten Gerichten nahm, so dass der Dampf aus der Shakshuka und den frittierten Kibbeh entwich. Yara wurden die Ohren heiß, doch sie behielt das Wasser auf dem Herd im Auge, das kurz vorm Siedepunkt stand. Sie fügte einen Teelöffel Salz hinzu und setzte den Deckel zurück auf den Topf.
»Was gibt es denn sonst noch?«, fragte Nadia und warf einen Blick in den Backofen.
»Kufta Kebab mit Tzatziki und gelbem Reis.«
»Was ist mit deinem Schwiegervater? Du weißt doch, dass er wegen seines Blutzuckerspiegels keinen Reis mehr essen darf.«
Yara schluckte und bemühte sich, ruhig zu bleiben, was ihr in letzter Zeit immer seltener gelang, besonders wenn ihre Schwiegermutter anwesend war. »Natürlich«, sagte sie und deutete mit dem Kopf auf den Schongarer. »Ich habe Bulgur für ihn gemacht.«
»Gut, gut«, sagte Nadia und fuhr sich mit der Hand durchs Haar, während sie ihre Runde durch die Küche drehte. Sie ließ den Blick über das helle Eichenparkett und die weißen Granit-Arbeitsflächen schweifen, die trotz des Drei-Gänge-Menüs, das Yara gerade zubereitete, makellos sauber waren. Sie wirkte enttäuscht, als sie sich dem Essbereich zuwandte. Ihr Blick wanderte zu einem Spinnennetz am Kronleuchter, und sie zeigte darauf.
Yara seufzte. »Entschuldige, ich vergesse immer, das Ding abzustauben.«
»Das sieht man«, sagte Nadia.
Kaum war ihre Schwiegermutter da, wies sie Yara mal wieder auf alles hin, was sie falsch machte.
»Du kennst ja das alte Sprichwort«, sagte Nadia, fuhr mit dem Zeigefinger über die Fensterbank und nahm ihn unter die Lupe. »Ordnung ist das halbe Leben.«
Als Yara beobachtete, wie Nadia die Küche kontrollierte und alle Schränke auf- und wieder zuklappte, während draußen die Sonne hinter den Bäumen verschwand, wünschte sie sich nichts sehnlicher, als allein zu sein und sich dem verurteilenden Blick ihrer Schwiegermutter zu entziehen. Neuerdings hackte Nadia ständig auf ihr herum. Vielleicht war Yara zu rebellisch, stellte zu viel infrage. Vielleicht ärgerte Nadia sich darüber, dass sie Yara nicht kontrollieren konnte oder dass Yara sich nach all den Jahren noch immer weigerte, die Art von Schwiegertochter zu sein, die Nadia haben wollte.
In den Anfangsjahren ihrer Ehe hatte sie Nadia im Haushalt geholfen, so wie zuvor ihrer eigenen Mutter: Sie hatte den Abwasch erledigt, die Hände bis zu den Ellbogen im Spülwasser, war unter Sofas und Tische gekrochen, um die Essensreste von Fadis jüngeren Brüdern aufzusammeln, hatte die gesamte Wäsche gebügelt und gefaltet, das Bad geschrubbt und Schamhaare vom Toilettenrand gewischt. Von den Putzmitteldämpfen war ihr jedes Mal ganz schwindlig geworden. Yara hatte gehofft, dass ihre Hilfsbereitschaft Nadia und sie einander näher bringen würde, doch aus Sicht ihrer Schwiegermutter tat sie nur, was ohnehin von ihr erwartet wurde.
Eigentlich hatten die Spannungen zwischen ihnen schon neun Jahre zuvor begonnen, am Abend von Yaras Hochzeit, als Nadia sie bat, künftig einen Hidschab zu tragen. Yara war damals neunzehn gewesen, in ihrem ersten Studienjahr, und erst wenige Tage vor der Hochzeit in Fadis Heimatstadt gezogen, wo sie seither lebte. »Nein, das ist nichts für mich«, hatte sie spontan erwidert. Sie standen im Badezimmer, Yara zog ihren Lidstrich nach, den sie schon zweimal verschmiert hatte, weil sie in Tränen ausgebrochen war. »Nichts gegen den Hidschab, wenn eine Frau sich frei dafür entscheidet«, hatte sie gesagt. »Der Koran überlässt die Entscheidung ganz klar mir. Aber ich bin nicht religiös.«
Und dann hatte sie plötzlich die Last von Nadias Blick gespürt, er war so missbilligend gewesen, dass er sie dazu brachte, sich von ihrem Spiegelbild abzuwenden. Sie musste schlucken, ein leiser Schmerz pochte in ihr, wie ein Vogel, der vergeblich versuchte, mit den Flügeln zu flattern. Nadia hatte langsam den Kopf geschüttelt und sie abschätzig gemustert – das war die Last, die Yara gespürt hatte: von Nadia verurteilt zu werden. »Es geht nicht nur um Religion«, hatte Nadia erwidert und verächtlich den Mund verzogen. »Der Hidschab wird aus Sittsamkeit getragen, um haki el-Nas zu verhindern. Wir wollen nicht, dass die Leute tratschen.«
Die Leute, hatte Yara gedacht und geschluckt. Natürlich.
Sie war damals unsicher gewesen, ob sie zu Fadi in die Südstaaten ziehen sollte – diesen Teil von Amerika kannte sie nur durch einige ihrer Lieblingsautorinnen, Flannery O’Connor, Alice Walker und Toni Morrison. Durch ihre Bücher hatte Yara den Eindruck gewonnen, dass die Kultur der Südstaaten viele Parallelen zu ihrer eigenen aufwies: eine Welt voll lärmender, eng verbundener Großfamilien, in der Frauen jung heirateten, zahlreiche Kinder bekamen, sich an konservative Werte wie Religion und Traditionen hielten und Rezepte befolgten, die schon seit vielen Generationen weitergegeben wurden. Sogar die Obsession, bei jedem sich bietenden Anlass Tee zu trinken, war eine Gemeinsamkeit, auch wenn man ihn in den Südstaaten eiskalt bevorzugte und in arabischen Ländern lieber heiß servierte. Yara hatte diese Parallelen tröstlich gefunden, doch sie hatten ihr auch Angst gemacht. Welches Leben würde sie dort führen? Würde sie überhaupt in dieses Umfeld hineinpassen? Oder würde sie sich fühlen wie all die Jahre in Brooklyn: abgeschnitten, rebellisch, einsam?
Hätte sie ihr Zögern damals doch nur ihrer Familie anvertrauen können. Aber es fiel ihr schwer, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, sogar sich selbst gegenüber. Worte verwässerten Dinge nur, machten sie kleiner. Als sie aufwuchs, hatte sie nicht erklären können, wie es sich anfühlte, jeden Abend aus dem Fenster zu schauen und darauf zu warten, dass Baba nach Hause kam. Und sie hatte auch nicht die Angst beschreiben können, die sie jedes Mal packte, wenn sein Geschrei durch die Wände drang und sie sich das Kissen über den Kopf zog, um den Lärm zu ersticken, nur um dann zu erkennen, dass der Tumult aus ihrem Inneren kam.
Irgendwann fand sie heraus, dass Malen ihr half, die Angst in ihrem Inneren zu lindern. Die ständige Gewissheit, dass etwas nicht stimmte, klaffte wie ein finsterer Abgrund in ihrer Brust. Wenn sie allein in dem überfüllten Zimmer war, das sie sich mit ihren Brüdern teilte, malte sie, was sie durchs Fenster sah: eine Reihe roter Backsteinhäuser, den orange- und rosafarbenen Schimmer des Sonnenuntergangs, gelben Löwenzahn, der im goldenen Sonnenschein tanzte, dunkle Gewitterwolken am Abendhimmel – eine Sammlung kleiner Bilder, die sie wie im Rausch erschuf, in einem sonderbaren Zustand emotionaler Wissbegierde, als hätte sich ein Teil ihres Herzens der Welt geöffnet. Damals hatte sie jedes Mal gehofft, dass die Freude, die sie dabei empfand, eine heilende Kraft entfalten und die Dunkelheit in ihrem Inneren verscheuchen, den Krieg in ihrem Kopf beenden würde. Doch inzwischen hatte sie das Gefühl, Lichtjahre von der Person entfernt zu sein, die sie eigentlich sein wollte.
Als Nadia nun auf den Kühlschrank zusteuerte, kam Yara ihr zuvor und öffnete ihn selbst, um sich zu vergewissern, dass die gläsernen Einlegeböden sauber waren. Den Rücken zu ihrer Schwiegermutter gewandt sagte sie: »Es war viel los in letzter Zeit, da komme ich nicht immer hinterher.«
»Das sehe ich«, erwiderte Nadia.
Trotz der kalten Luft, die aus dem Kühlschrank strömte, stieg Yara Hitze ins Gesicht. Am liebsten hätte sie Nadia gestanden, dass sie wirklich ihr Bestes gab, jedoch in letzter Zeit eine überwältigende Dunkelheit spürte, die ihr nicht mehr von der Seite wich, wie ein Schatten.
»Ich weiß, dass du dich schon eine Weile schwertust«, fuhr Nadia fort, als könnte sie Yaras Gedanken lesen. »Aber es wird Zeit, dass du dich zusammenreißt, Liebes. Deiner Familie zuliebe.«
Yara schloss die Kühlschranktür, ging zum Herd zurück und stellte die Flamme unter dem Reistopf kleiner. Sie lehnte sich mit der Hüfte an den Küchentresen und schaute zu, wie ihre Schwiegermutter den Kühlschrank wieder öffnete und einen Behälter nach dem anderen herausnahm, um murmelnd die Verfallsdaten zu prüfen, bis sie endlich einen fand, den sie wegwerfen konnte.
»Komm doch diesen Freitag mit zur Moschee«, sagte Nadia, nachdem sie die leuchtend grüne Taboulé herausgeholt und mit den Fingern davon probiert hatte. »Ein bisschen Gesellschaft wird dich vielleicht aufmuntern.«
Yara runzelte die Stirn und öffnete einen Schrank, um so zu tun, als suchte sie etwas darin.
»Du warst schon eine Weile nicht mehr dort«, fuhr Nadia fort, die Finger voller Olivenöl, Petersilie und Minze. »Und die Frauen fragen ständig nach dir. Es wäre gut, wenn du dich mal wieder blicken lässt.«
»Tut mir leid, ich kann nicht. Morgen beginnt das neue Semester, ich habe viel zu tun.«
»Verstehe. Aber zu Nisreens Babyparty dieses Wochenende kommst du doch, oder? Sie wäre wirklich enttäuscht, wenn du das verpasst.«
Yara schloss die Augen, das Gesicht hinter der Schranktür verborgen. Nadia wusste genau, dass sie kein geselliger Mensch war und lieber allein oder bei ihrer Familie blieb. Trotzdem beharrte sie darauf, Yara zu jeder arabischen Feier in der Stadt einzuladen. In ihrer Kleinstadt gab es sogar eine palästinensische Gemeinde, der etwa zwei Dutzend Familien angehörten. Doch Nadia kannte fast alle arabischen Familien, weil die Frauen oft zusammenkamen, um ihr eigenes kleines Dorf zu bilden. Früher war Yara widerwillig mitgegangen, hatte sich gezwungen, zu lächeln und sich sogar manchmal am Tratsch beteiligt, um zu zeigen, dass sie keine Spielverderberin war. Aber inzwischen sah sie keinen Sinn mehr darin, und verstellen wollte sie sich auch nicht mehr.
»Sorry«, sagte Yara und schaltete den Herd aus. »Mir ist nicht danach, irgendwohin zu gehen.«
Nadia schwieg und griff wieder in die Schüssel mit der grünen Taboulé.
»Du kannst nicht ständig allen ausweichen«, sagte sie schließlich und leckte sich die Finger ab. »Wann warst du das letzte Mal mit mir zusammen auf einer Hochzeit oder hast unsere Freundinnen zum Essen eingeladen?«
Yara zuckte mit den Schultern. Eigentlich waren es nur Nadias Freundinnen. Yaras Freundeskreis bestand nur aus Fadi, aber das machte ihr nichts aus.
»Es ist schlecht für deine Gesundheit, wenn du dich so isolierst«, fuhr Nadia fort. »Aber davon mal ganz abgesehen musst du auch darauf achten, deine gesellschaftliche Stellung zu wahren. Wir leben in einer Kleinstadt, die Leute fangen schon an zu reden.«
Die Leute. Natürlich.
»Worüber reden sie denn? Ich tue doch nichts Unrechtes.«
»Als ob das die Leute je abgehalten hätte«, sagte Nadia. »Sie haben eine wilde Fantasie. Wenn sie längere Zeit nichts von dir hören, malen sie sich alles Mögliche aus – dass du etwas im Schilde führst, dass du krank bist oder schlimmer noch, dass du psychische Probleme hast und von einem bösen Geist besessen bist.«
Yara verdrehte die Augen. »Von einem Dschinn? Ernsthaft? Wie bei Aladin und die Wunderlampe?«
»Glaubst du, ich denke mir das nur aus?«, erwiderte Nadia. »Du bist nicht mehr du selbst, das ist doch offensichtlich, und wir wollen vermeiden, dass jemand die Gerüchteküche anheizt.«
Nadia schaute sie mit ihren stechenden braunen Augen an, die Miene so streng, dass Yara sich abwandte. Sie griff nach ihrem Schürzensaum, um sich noch einmal über die Stirn zu wischen.
»Ich mache mir Sorgen um dich, Liebes«, fuhr Nadia fort. »Deine Augen sind eingefallen, dein Kajal ist verschmiert. Du siehst aus, als wärst du um zehn Jahre gealtert.« Sie musterte Yara von oben bis unten. »Und warum trägst du immer nur Schwarz und Leggings? Du musst dir mehr Mühe geben. Fadi zuliebe.«
Yara lehnte sich gegen den Küchentresen. Wie lange würde sie das noch erdulden müssen? Leider ließ sich die Sache nicht einfach auf ihr Äußeres beschränken. Oder auf ein körperliches Problem, das man reparieren konnte. Das wäre ihr natürlich lieber gewesen als ein seelisches Problem, was wohl eher zutraf. Aber das konnte sie ihrer Schwiegermutter unmöglich sagen.
Stattdessen knackte Yara mit den Fingern und betrachtete Nadia, ihre hängenden Schultern, den gebeugten Rücken. Sie sah aus, als hätte sie ihr eigenes Päckchen zu tragen.
Yara zwang sich, ihren Blick zu erwidern. »Ich fühle mich eben wohl in diesen Sachen.« Sie zögerte kurz, bevor sie hinzufügte: »Wieso sagst du deinem Sohn nicht mal, dass er sich für mich schick machen soll?«
Nadia zog die Braue hoch. »Weil das so nicht läuft. Es ist deine Pflicht, deinem Mann zu gefallen.«
»Ach ja?« Yara fing an zu lachen, sie konnte gar nicht mehr aufhören. Von allen Schwiegermüttern, die sie hätte haben können, war sie an eine geraten, die ihr genau den Lebensweg aufzwingen wollte, vor dem sie geflohen war. Doch selbst wenn sie es vorher gewusst hätte, sie hätte Fadi trotzdem geheiratet. Damals war sie mit anderen Problemen beschäftigt gewesen.
»Du meine Güte«, sagte Nadia pikiert. »Seit Monaten habe ich dich nicht mehr richtig lachen sehen, und ausgerechnet das findest du jetzt lustig? Ist es zu viel verlangt, dass du dich ein wenig anstrengst, deinem Mann zuliebe? Ich habe lange genug versucht, den Mund zu halten, aber jetzt reicht es. Du kannst so nicht weitermachen.«
Yara hörte auf zu lachen und sah Nadia an. »Was soll das denn heißen?«
»Du kannst nicht die ganze Zeit wie ein Trauerkloß herumlaufen. Du musst dich zusammenreißen, Liebes. Deine Familie braucht dich!«
Yara trat vom Küchentresen weg, Adrenalin schoss ihr durch die Adern. »Du tust so, als würde ich den ganzen Tag im Bett liegen«, erwiderte sie, »dabei kümmere ich mich allein um die Mädchen, gehe jeden Tag zur Arbeit, erledige nebenbei den gesamten Haushalt und koche jeden Abend für Fadi! Hätte ich ein wenig mehr Unterstützung mit den Mädchen, könnte ich mich um mein Äußeres kümmern. Aber das ist momentan mein geringstes Problem.«
»Für eure Kinder bist aber nun einmal du verantwortlich«, entgegnete Nadia kopfschüttelnd. »Du kannst nicht erwarten, dass dir jemand ihre Erziehung abnimmt. Wenn du dich so überfordert fühlst, dann arbeite eben weniger.«
»Kommt überhaupt nicht infrage«, sagte Yara wie aus der Pistole geschossen. »Meine Arbeit ist das Einzige, was ich für mich selbst tue. Warum sollte ich das aufgeben?«
»Warum nicht?«, erwiderte Nadia. »Fadi verdient gutes Geld, mashAllah. Er braucht deine Unterstützung nicht.«
Yara musste an sich halten, um nicht loszuschreien. Ihre Schwiegermutter ließ kaum eine Gelegenheit aus, ihr unter die Nase zu reiben, dass Fadi der Brotverdiener war, als wäre Yara diese Rollenverteilung nicht schon aus ihrem Elternhaus gewohnt. Yaras Eltern hatten Palästina unmittelbar nach ihrer Hochzeit verlassen, um nach Amerika auszuwandern. Als sie damals in Brooklyn ankamen, besaßen sie nur ein paar hundert Dollar und sprachen kein Wort Englisch. Dass sie es geschafft hatten, in Amerika zu überleben, verdankten sie der arabischen Gemeinschaft in Bay Ridge und der Tatsache, dass Baba Tag und Nacht schuftete.
Nach Yaras und Fadis Hochzeit hatte Fadi noch einige Monate weiter in der Tankstelle seines Vaters gearbeitet. Er stand dort an der Kasse, seit er siebzehn war. Jeden Abend, wenn Fadi in ihre winzige Wohnung zurückkam, jammerte er über Hasan und schwor, seine nächste Schicht werde die letzte sein. »Ich verstehe nicht, wie ein Vater seinen eigenen Sohn so behandeln kann«, sagte er. »Mein Vater schaut immer nur auf mich herab, nie ein Wort des Danks oder der Anerkennung.«
Erst als Yara mit Mira schwanger wurde, dachte Fadi ernsthaft darüber nach, sich beruflich zu verändern. Da er keinen Uni-Abschluss hatte, beschloss er, sich nicht woanders um eine Stelle zu bewerben, sondern lieber Geld zu sparen, um seine eigene Firma zu gründen. Yara studierte damals, sie hatte Anspruch auf finanzielle Förderung und bekam ein Vollstipendium. Die Studiengebühren wurden ihr bezahlt, Lehrbücher kaufte sie nur gebraucht, und jedes Semester erhielt sie mit der Post einen fetten Scheck, den sie auf Fadi übertrug – er wollte es so. Als sie endlich genug gespart hatten, kündigte Fadi bei seinem Vater und gründete zusammen mit seinem Highschool-Freund Ramy ein Großhandelsunternehmen. Sie kauften große Mengen von Waren des täglichen Bedarfs – Tabakzubehör, Energydrinks, Schmerzmittel, Sonnenbrillen, Handschuhe, Batterien und dergleichen – direkt bei den Herstellern und verkauften sie in kleineren Mengen weiter, an Geschäfte im gesamten Bundesstaat. Schon nach sechs Monaten war ihr Unternehmen in den schwarzen Zahlen, und nur zwei Jahre später warf es bereits recht hohe Gewinne ab. »Mein Vater hat mir ständig eingeredet, dass ich es ohne ihn nicht schaffe«, sagte Fadi. »Er hat mir immer nur Steine in den Weg gelegt. Seinem eigenen Sohn! Aber ich habe es geschafft. Ich habe bewiesen, dass er falschlag.«
Yara hatte sich für ihn gefreut, doch ein Teil von ihr wünschte sich, es ihm gleichzutun. Etwas aus sich zu machen, die Fesseln von Ehe und Mutterschaft zu durchbrechen, nicht darauf reduziert zu sein, die Erwartungen anderer Leute zu erfüllen. Etwas aus dem Nichts aufzubauen, voller Selbstvertrauen und Zuversicht, als wäre sie in einer Welt aufgewachsen, in der Frauen so etwas ebenfalls möglich war.
»Es geht nicht ums Geld«, sagte sie nun und legte die Hände um den Reistopf, bis sie sich beinahe verbrannte. »Ich will etwas aus meinem Leben machen.«
Nadia lachte. »Aber Liebes, das tust du doch längst. Du hast eine Familie und Kinder, für die du sorgen musst.«
»Das sollte aber nicht bedeuten, dass ich nichts anderes machen darf.«
»Aber du wirst deiner Verantwortung doch jetzt schon kaum gerecht.« Nadias Blick wanderte wieder zu den Spinnweben am Kronleuchter. »Du solltest dir eine Auszeit von der Arbeit nehmen und dich auf deine Familie, dein Zuhause konzentrieren.« Sie hielt inne, bevor sie ein wenig sanfter hinzufügte: »Es wird dir sicher guttun, wenn du zu Hause bist, in deinen eigenen vier Wänden, du wirst sehen.«
Yara schwieg. Wenn sie ihre Arbeit aufgab, würde ihr das mitnichten guttun. Aber dafür fehlte Nadia angesichts ihrer eigenen Lebensgeschichte das Verständnis. Ähnlich wie Yaras Eltern war Nadia in einem Flüchtlingslager zur Welt gekommen und aufgewachsen, nachdem ihre Familie 1948 während der israelischen Besetzung Palästinas aus ihrem Haus am Meer in Jaffa vertrieben worden war. Selbstverständlich empfand Yara tiefes Mitgefühl für den Verlust ihrer Schwiegermutter, und ihr war auch bewusst, dass Nadia für ihre Einstellung nichts konnte, denn sie wurzelte ja in der Welt, aus der sie stammte. Natürlich war Nadia davon überzeugt, dass der Platz einer Frau zu Hause war. Natürlich war es ihr wichtig, die Familie zu bewahren, die familiäre Einheit eng verbunden und intakt zu halten, mit einem arbeitenden Vater, der Überstunden machte, um alle zu ernähren, und einer Mutter, die sich um den Haushalt und die Kindererziehung kümmerte. Ihrer Schwiegermutter war das Privileg, ein Zuhause zu haben, lange verwehrt geblieben, und von daher war es nachvollziehbar, dass sie nun, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, alles dafür tat, ihr Zuhause zu bewahren.
Yara starrte auf den Safranreis, der nun fast ausreichend lang geruht hatte.
Diese Gedanken waren immer da, wie ein Flüstern im Ohr, um sie daran zu erinnern, wie gut sie es hatte und dass alles, was ihr unfair erschien, rein gar nichts war im Vergleich zu den Problemen, mit denen ihre Eltern und Großeltern zu kämpfen hatten. Dennoch kam es immer öfter vor, dass Yaras Verständnis für die schwierige Vergangenheit ihrer Familie sie nicht mehr wie früher dazu brachte, nur zuzuhören, sich zu fügen und zu gehorchen. Und als sie nun in ihrer Küche stand, überkam sie das Gefühl, schon ihr ganzes Leben lang eine Last zu tragen, die sie nicht ablegen konnte. Sie zwang sich, auf den Topf zu schauen und Nadias Blick auszuweichen, um nicht auf die Knie zu fallen und loszubrüllen. Nur weil die Frauen in Nadias Familie es so machten, war Yara doch nicht dazu verpflichtet, ausschließlich für ihre Kinder und ihren Mann zu leben. Warum fiel es Nadia bloß so schwer, das zu begreifen?
Yara spürte eine altvertraute Traurigkeit in sich aufsteigen. Vielleicht lag es an den Opfern, die zig Generationen von Frauen schon gebracht hatten, dass das Ganze sie so mitnahm. Sie hatte ja gesehen, was diese Art zu leben bei ihrer eigenen Mutter angerichtet hatte, hatte miterlebt, wie sie ihr jegliche Lebensfreude genommen hatte, bis nur noch Verbitterung übriggeblieben war, gepaart mit unerfüllter Sehnsucht, Resignation und Angst. Genau deshalb wollte Yara ein Leben, das vollkommen anders war als das Leben ihrer Mutter.
»Du schweigst«, sagte Nadia. »Dann siehst du also ein, dass ich recht habe.«
Yara schüttelte den Kopf. Ihre Wangen glühten. »Nein«, stieß sie hervor.
»Warum nicht? Was könnte denn wichtiger sein als deine Familie?«
Yara spähte durch den Glasdeckel in den Topf und holte die Reisgabel aus der Schublade. Sie hätte Nadia erklären können, welche Folgen sich daraus ergaben, dass ihre Familien nach Amerika gegangen waren, wo Frauen beides haben konnten, Kinder und Karriere. Sie hätte Nadia sagen können, dass sie doch ihren Sohn auffordern solle, weniger zu arbeiten, damit seine Frau beruflich vorankam. Oder sie hätte Nadia sagen können, was ihr schon lange auf der Zunge lag: dass Nadias Versuche, sie zu drängen, daheim bei den Kindern zu bleiben, sie erst recht darin bestärkten, weiter arbeiten zu gehen.
Doch da sie schon seit neun Jahren Nadias Schwiegertochter war, wusste sie, dass sie auf taube Ohren stoßen würde.
»Es wäre keine Schande, zuzugeben, dass dir alles zu viel wird«, sagte Nadia und kam näher. »Aber wenn du weiter so tust, als wäre alles in Ordnung, schadest du nur deinen Töchtern.«
Bei dem Wort »Töchter« stieg Angst in Yara hoch. Sie hielt die Gabel fest umklammert, um das Zittern ihrer Hand zu verbergen.
»Denk an deine Mädchen«, sagte Nadia. »Dir muss doch klar sein, dass dein Verhalten sich auf sie auswirkt.«
Yara schluckte. Sie hätte ihren Töchtern niemals wehtun können. Begriff Nadia denn nicht? Yaras Gedanken kreisten ständig um die Mädchen, um ihre eigene Vergangenheit und um die unerträgliche Sehnsucht, das alles hinter sich zu lassen. Das war inzwischen das Einzige, woran sie denken konnte.
Als sie den Glasdeckel vom Reis nahm, schlug ihr ein Dampfschwall entgegen. Sie fasste sich an die Wange, stand regungslos da, während die Hitze durch ihre Haut sickerte, und fragte sich, warum ihr Leben trotz aller Opfer, die sie gebracht hatte, diesen Verlauf genommen hatte und warum sie nun von einem Gefühl des Verlusts überwältigt wurde.
Der Rest des Abends verlief so wie immer, wenn ihre Schwiegereltern zu Besuch waren. Die Erwachsenen speisten am Esstisch, während Mira und Jude vorm Fernseher Hühnchen und Safranreis mit den Fingern aßen und dabei Encanto schauten. Yaras Schwiegervater erzählte von einem Streit mit seinem Nachbarn. »Der hat mich angesehen, als wäre ich ein Penner!« Hasan war ein lauter, fuchtelnder Mensch, er sprach mit den Händen, als dirigierte er ein Orchester. »Da hab ich dem gesagt: ›Wenn du mich weiter so anstarrst, kriegst du was aufs Auge!‹«
Nadia verzog das Gesicht. »Gibt es eigentlich jemanden in der Stadt, mit dem du kein Problem hast?«
Am anderen Ende des Tischs schaufelte Fadi das Essen in sich hinein, als wollte er vermeiden, sich am Gespräch beteiligen zu müssen. Den Mund voller Taboulé wandte er sich zu Yara. »Schmeckt alles köstlich, Schatz«, sagte er.
Yara nickte, ohne seinen Blick zu erwidern. Sie dachte, was sie immer dachte, wenn Nadia und Hasan anwesend waren: Ihre Schwiegereltern würden sie stets in ihre Schranken weisen, falls sie vergaß, wo sie herkam. Als wäre das überhaupt möglich.
»Um Himmels willen«, sagte Nadia, als Yara Judes Teller auffüllen wollte, ihn dabei aus Versehen umstieß, und die Reiskörner wie kleine Insekten über den Esstisch sprangen. Beim Versuch, das Chaos zu beseitigen, warf Yara dann auch noch ihr Glas um, das Wasser ergoss sich über den Tisch und auf den Boden.
»Genau das meine ich, Yara«, sagte Nadia, als sie aufstand, um einen Lappen zu holen. »Ein weiteres Beispiel dafür, dass es dir nicht so gut geht, wie du uns weismachen willst.«
Yara sank auf ihren Stuhl und schaute zu, wie ihre Schwiegermutter den Tisch saubermachte.
»Das Maß ist voll«, fuhr Nadia fort, als sie fertig gewischt hatte, und nahm wieder Platz. »Du bist eindeutig neben der Spur, und es wird Zeit, dass du etwas dagegen unternimmst.« Sie drehte sich zu Fadi, der aussah, als wollte er am liebsten die Flucht ergreifen. »Warum erzählst du es ihr nicht, Fadi?«, fragte Nadia und wischte sich den Schweiß von der Oberlippe. »Nun sag doch was!«
Fadi wurde knallrot.
»Was soll er mir denn erzählen?«, fragte Yara und spürte Wut in sich aufsteigen.
Fadi schluckte und wich ihrem Blick aus. »Nichts, nichts.« Er wandte sich Nadia zu. »Halt mich da raus, Yumma«, sagte er scharf. »Ich habe schon genug Probleme.«
»Ach ja?«, meinte Hasan, legte seinen Kufta-Spieß ab und schaute seinen Sohn an. »Du warst schon seit Wochen nicht mehr bei mir im Laden, obwohl du dort noch etwas für mich zu erledigen hast.«
Fadi entgegnete etwas, doch Yara hörte nicht zu. Sie sah zu Mira und Jude hinüber aus Angst, dass sie den Streit mitbekamen, aber zu ihrer Erleichterung schienen sie in den Film versunken.
Sie fasste sich an die Wange und sank noch tiefer in den Stuhl. Dann wandte sie sich ab und schaute aus dem Fenster. Draußen drang das sanfte Licht des Sonnenuntergangs durch das Laub der Scharlach-Eichen und Sumpfkiefern. Yara holte tief Luft und wischte sich die Hände an der Schürze ab. Sie spürte eine enorme Spannung in ihrem Innern, als würde sie von allen Seiten zu Boden gedrückt.
Den Rest des Abendessens blieb sie stumm und hörte nur noch die kleine Stimme, die sie flüsternd an alles erinnerte, was sie hätte tun können oder sollen, an alles, was sie falsch machte. Und während sie auf ihren Teller starrte, fragte sie sich, wie es wäre, gar nichts zu fühlen, die Augen zu schließen und nur Stille in ihrem Kopf zu hören.
2
Am Montagmorgen wurde Yara um zwanzig nach sechs von einem ohrenbetäubenden Weckton aus dem Schlaf gerissen. Sie griff nach ihrem Handy, tippte mechanisch auf das Display und schaltete ihn aus. Zweiundzwanzig Benachrichtigungen: elf E-Mails, zwei Kalender-Erinnerungen, neun Instagram-Kommentare. Und schon rasten ihre Gedanken, ihr Kopf war wie ein Browser mit zu vielen offenen Tabs, der mit allem Möglichen und zugleich mit Nichtigkeiten überquoll. Hastig stand sie auf, um zu duschen, wiegte sich unter dem fast unerträglich heißen Wasser hin und her, bis die Wärme ihre Haut betäubte und ihre Schultern lockerte.
Anschließend weckte sie die Mädchen – zuerst Mira, dann Jude – und drängte sie, sich anzuziehen. Sie bürstete ihnen das Haar, machte ihnen Frühstück und gab ihnen die Lunchpakete, die sie am vorigen Abend zubereitet hatte, jedes mit einem Zettel drin. Dann schnappte sie sich ihre Arbeitstasche und scheuchte die Mädchen hinaus.
Im Auto schnallte sie sich an und kontrollierte, dass die Mädchen es ihr gleichtaten. Ihr blieben noch zwanzig Minuten, bis sie auf der Arbeit sein musste. Wenn sie sich beeilte, konnte sie es gerade noch schaffen. Sie schaute in den Rückspiegel und fuhr aus der Einfahrt. Und dann bog sie plötzlich auf den Parkplatz der Uni, an der sie arbeitete, ohne sich an die Fahrt dorthin erinnern zu können.
Sie konnte sich auch nicht mehr daran erinnern, dass sie die Mädchen an der Schule abgesetzt hatte.
Und auch nicht daran, ob sie sich von ihnen verabschiedet hatte. Hatten sie auf der Hinfahrt mit ihr gesprochen? Hatte sie geantwortet?
Sie starrte auf den College-Campus, der sich vor ihr erstreckte, Nadias Worte noch in den Ohren. Zu viele ihrer Tage verliefen so, mit Abschnitten, an die sie sich nur verschwommen oder gar nicht mehr erinnern konnte. Ihr Körper bewegte sich durch Raum und Zeit, ohne dass sie es mitbekam. An manchen Tagen fehlte ihr die Erinnerung daran, dass sie sich morgens angezogen hatte, oder sie wusste nicht mehr, was passiert war, nachdem sie die Mädchen von der Schule oder woanders abgeholt hatte. In solchen Momenten nahm sie ihre Kamera und machte Fotos, eins nach dem anderen, nur um sich zu vergewissern, dass sie noch existierte.
Sie wusste, dass sie sich hetzte und von einer Aufgabe zur nächsten raste. Das Problem war: Wenn sie es langsamer anging, fühlte sich alles noch schlimmer an.
Es war der erste Tag des neuen Semesters, und am College herrschte lebhafter Trubel. Im goldenen Sonnenlicht, das auf die Backsteingebäude fiel, eilten die Studierenden über den Campus zu ihren neuen Kursen, ihren Stundenplan in der Hand oder den Geländeplan auf ihrem Handydisplay vor Augen.
Mit seinen einhundertzwanzig Hektar galt der Campus des Pinewood College als Mittelpunkt der malerischen Kleinstadt. Im Herbst von North Carolina wirkte er besonders schön. Die weitläufigen Gebäude waren von Bäumen eingerahmt – Ahorn und Eichen, deren Laub sich rot und gelb leuchtend vom Grün der Zedern abhob –, und das Gelände war von Wanderwegen durchzogen, von denen einer zum See führte, wo die Studierenden sich gern zum Schwimmen oder Picknicken trafen.
Als Yara die geisteswissenschaftliche Fakultät erreichte und ihr Büro betrat, einen kleinen Raum am Ende des Flurs im Erdgeschoss, war sie erleichtert. Hier würde sie garantiert ihre Ruhe haben. Sie machte sich einen Kaffee und erstellte eine Aufgabenliste: Webseite des Instituts für Krankenpflege überarbeiten, Lehrpläne ausdrucken, Fotos vom Schweißlabor machen, bevor sie die beiden ersten Punkte in Angriff nahm.
Eigentlich hatte sie den Job am College angefangen, um Kunst zu unterrichten, aber bisher durfte sie pro Semester nur einen Einführungskurs geben: »Die Auseinandersetzung mit Kunst: Form, Inhalt und Kontext«. Ansonsten war sie im Grunde die Grafikdesignerin des College: Sie pflegte Termine in Kalender ein, gestaltete Webseiten, tauschte Fotos aus – eine langweilige und monotone Tätigkeit. So eine Zeitverschwendung, dachte sie, bis ihr voller Schreck einfiel, dass Nadia sie dazu bringen wollte, ihre Arbeit aufzugeben.
Drei Jahre zuvor hatte Jonathan, der Dekan der geisteswissenschaftlichen Fakultät, ihr gesagt, dass er ihr mehr Kunstkurse geben würde, sobald eine von den Vollzeit-Lehrkräften kündigte oder in Rente ging. Seither schützte er jedes Mal Budgetkürzungen vor, wenn sie ihn darauf ansprach. Yara wusste, dass sie nicht seiner Vorstellung von einer Künstlerin entsprach, das hatte sie ihm schon beim Vorstellungsgespräch angesehen. »Ich bin genau die Richtige für diese Tätigkeit«, hatte sie fast schon trotzig gesagt, als er sie blinzelnd musterte.
Als sie den Einführungskurs zum ersten Mal gab, hatte Jonathan sich während des Semesters dazugesetzt. Er hatte verblüfft reagiert, weil sie Werke der Afroamerikanerin Philemona Williamson sowie der Libanesin Helen Zughaib besprach und sich weigerte, Weißsein als entscheidenden Faktor der Hochkultur in den Vordergrund zu stellen. In seinem anschließenden »Feedback« hatte er ihr nahegelegt, sich wieder auf Monet und Matisse zu konzentrieren und Werke, die nicht allgemein anerkannt waren, lediglich zu nutzen, um die Präsentation des etablierten Kanons ein wenig aufzupeppen.
Yara legte die ausgedruckten Lehrpläne auf ihren Schreibtisch, um sie zusammenzuheften. Draußen flitzten Kids auf Skateboards vorbei, rauschten unbekümmert den grünen Innenhof entlang. So hatte Yara sich während ihrer eigenen Collegezeit fast nie gefühlt. Als sie sich damals einschrieb, war sie mit Mira schwanger gewesen, später mit Jude. Sie war mit dem Lernen kaum hinterhergekommen und hatte all ihre Kurse auf zwei Tage gelegt, um möglichst viel Zeit zu Hause verbringen zu können.
Plötzlich musste sie an Nadias prüfenden Blick denken und verscheuchte das Bild aus ihrem Kopf. Nein – sie hatte nicht jahrelang geschuftet, das Studium in Rekordzeit absolviert, parallel dazu zwei Kinder aufgezogen, den Haushalt erledigt, ihrer Schwiegermutter Paroli geboten und sich über diese Welt, die ihre Leistungen in keiner Weise würdigte, hinweggesetzt, nur um am Ende in einem Seminarraum zu stehen und festzustellen, dass die Ungerechtigkeiten, mit denen sie schon ihr ganzes Leben lang zu kämpfen hatte, die Oberhand behielten. Ihre Mutter hatte gar nicht studiert, ihr Vater nur ein Semester in Palästina, bevor sie nach Amerika gekommen waren. Yara wusste, wie privilegiert sie als Dozentin war, und sie fühlte sich verpflichtet, die Studierenden zu sensibilisieren. Doch zugleich träumte sie davon, etwas Bedeutsames hervorzubringen und der Welt etwas zu hinterlassen. Tief in ihrem Inneren war sie fest davon überzeugt, dass sie dazu bestimmt war, etwas Schönes zu erschaffen. Sie wusste nur noch nicht so recht, was genau und wie.
Sie schaute wieder auf die Liste, griff nach ihrer Kamera und machte sich auf den Weg zum Schweißlabor.
Draußen stieg die Sonne über den Gebäuden empor, wärmte das Laub, es duftete nach Akazie und Kiefer. Ein sanfter Wind fuhr Yara durchs Haar, als sie den Campus mit ihrer Kamera überquerte, die sie sich um den Hals gehängt hatte. Einmal mehr dachte sie, wie glücklich sie sich schätzen konnte, überhaupt an diesem Ort zu sein.
Ihren Eltern hatte stets mehr daran gelegen, sie zu verheiraten, als ihr ein Studium zu ermöglichen. »Es schadet sicher nicht, zur Uni zu gehen«, hatte ihr Vater gesagt. »Aber studieren kannst du, wenn du bei deinem Mann lebst.«
Doch am Ende der Highschool hatte Yara sich auf eigene Faust ein Vollstipendium an einem College in Brooklyn gesichert. Ihr Vater erlaubte ihr daraufhin, sich dort einzuschreiben, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie in eine Heirat einwilligte.
Als sie während ihres ersten Semesters eines Tages nach Hause kam, saß Baba mit einem jungen Mann und dessen Eltern im Wohnzimmer. Sie hatte diese Leute noch nie zuvor gesehen. Die Bräutigame in spe, mit denen man sie zuvor hatte verkuppeln wollen, waren ihr zu spießig, zu traditionell gewesen. Verglichen mit ihnen kam Fadi ihr wie eine frische Brise vor, und dann ging alles sehr schnell. Ein paar Wochen später war sie bereits verheiratet und fand sich in dieser Kleinstadt in North Carolina wieder. Ihre Studienfächer und Credits hatte sie auf die dortige Uni übertragen, voller Hoffnung auf einen Neuanfang mit einem Menschen, der ihren Träumen nicht im Weg stehen würde.
Ihre Mitstudierenden in den Kunstvorlesungen liefen in bunter Kleidung herum und trugen dicke ledergebundene Skizzenbücher unter dem Arm. In den Seminaren lieferten sie sich leidenschaftliche Diskussionen darüber, wie Geschichte, Philosophie und Kunst miteinander verbunden waren, sagten Dinge wie »Kunst kann die öffentliche Meinung getrost ignorieren, erst recht, wenn sie den Künstler gar nicht tangiert«. Ihnen war es egal, wie die Welt sie wahrnahm, es ging ihnen nur darum, welchen Eindruck sie auf sie hinterlassen würden. Die Erfahrungen, die sie gesammelt hatten, gaben ihnen offensichtlich das Gefühl, ihren Platz in der Welt genau zu kennen, und auch die Gewissheit, dass niemand, der ihren Weg kreuzte, sie schräg ansehen würde. Wenn Yara ihnen zuhörte, wuchs ein unerbittliches Gefühl von Unzulänglichkeit in ihr.
Eigentlich hatte sie gehofft, die ihr gesteckten Grenzen – die strenge Erziehung, ihren Hintergrund als Tochter eingewanderter Eltern, eine Kindheit ohne Zugang zu Kunst –, durch einen Studienabschluss überwinden zu können, und auch das aus diesen Grenzen resultierende Gefühl, dass sie gar kein Recht hatte, Künstlerin zu werden. Doch das Studium hatte kaum etwas in ihr verändert. Wenn überhaupt, bewies die Tatsache, dass sie trotz ihres Abschlusses noch immer nicht als Künstlerin in Erscheinung trat, eigentlich nur, dass es ihr niemals gelingen würde, die Frau zu sein, die sie eigentlich sein wollte – kreativ, ausdrucksstark, frei –, und dass sie ihre Grenzen ganz und gar nicht überwunden hatte.
Trotzdem malte Yara weiter, obwohl ihre Freizeit immer knapper wurde, im Wintergarten ihres Hauses, auf einer Staffelei, die sie dort mit Blick nach draußen aufgestellt hatte. In diesen Momenten der Stille lenkte sie die Arbeit mit den Farben vom Grübeln ab, das sanfte Streichen des Pinsels auf der Leinwand brachte ihr Gedankenkarussell zum Stehen. Wenn sie vor der Staffelei stand, verschwanden ihre Sorgen und Ängste. Dann dachte sie nicht an die Vergangenheit, hörte auf, sich den Kopf zu zerbrechen, führte keine Selbstgespräche mehr darüber, was sie in ihrem Leben bisher erreicht hatte oder noch erreichen musste. Wenn ihr Geist sich selbst überlassen war, wurde er unkontrollierbar, beängstigend. Doch im Wintergarten gab es keine Sorgen, kein Geflüster in ihrem Kopf, das Gefühl der Unzulänglichkeit verschwand. Wie frei sie sich in diesen Momenten fühlte.
Doch außerhalb dieses Raums wurde die Welt wieder düster, und ihr Geist wurde von allem überflutet, was sie vergessen wollte. Es schien, dass sich das niemals ändern würde, egal, was sie tat. Sie würde immer sie selbst bleiben, sie konnte dem nicht entkommen.
Als Yara das Schweißlabor betrat, in dem die Studierenden Schutzmasken trugen und mit modernsten Geräten arbeiteten, hielt sie sich die Kamera vors Auge, überprüfte die Blende und stellte das Bild scharf. Dann drückte sie mehrmals hintereinander auf den Auslöser, um den glühenden Funkenflug um die Studierenden herum einzufangen.
Am Institut für Krankenpflege, ihrem nächsten Halt, begutachtete eine Gruppe Studierende, die hellblaue Kittel und Stethoskope um den Hals trugen, eine Infusionspumpe.
Im Garten des Instituts für Kochkunst leuchteten Minze-, Salbei- und Basilikumsträucher in der Nachmittagssonne, ihre zarten grünen Blätter bedeckt von Tau.
Yara versuchte, unbemerkt dort hineinzuschlüpfen, in der Hoffnung auf Schnappschüsse, die sie auf den Facebook- und Instagram-Konten des College posten konnte. Zu Beginn ihrer Tätigkeit hatte sie sich noch auf das atemberaubende Panorama des Campus konzentriert, um spektakuläre Fotos zu machen. Doch inzwischen interessierte sie sich mehr für die Kleinigkeiten des Alltags, sie wollte das Vertraute im Banalen finden, Bilder, die den Wunsch in ihr weckten, sich zu nähern, um einen besseren Blick zu erhaschen – Verkehrszeichen, ein abblätterndes Plakat, ein Grashalm.
Wenn sie sich die Kamera vors Auge hielt, bliebt die Zeit stehen. Die Welt verstummte, sobald sie sich auf die Gegenwart, auf den Moment konzentrierte. Ähnlich wie im Wintergarten, wenn sie malte, hatte sie zumindest für eine Weile das Gefühl, dass die Welt kein so schrecklicher Ort war, dass vielleicht alles in ihrem Leben passierte, um sie zu diesem einen Moment zu bringen.
Sie atmete tief durch und schoss ein Foto.
3
»Willkommen beim Einführungskurs ›Die Auseinandersetzung mit Kunst‹.« Yara stand in der Mitte des hell erleuchteten, etwas zu stark klimatisierten Seminarraums und lächelte den einundzwanzig frischgebackenen Erstsemestern zu. »Ich bin Yara Murad, Ihre Dozentin. Wir treffen uns zweimal pro Woche hier, montags und mittwochs.«
Sie bat die Studierenden, der Reihe nach ihren Namen, ihr Hauptfach und ihre letzte Bingewatching-Serie zu nennen. Danach erkundigte sie sich jedes Mal zu Beginn eines neuen Kurses, um das Eis zu brechen. Wenn die Studierenden antworteten, schaute sie ihnen lächelnd in die Augen und erwiderte: »Sehr interessant. Schön, dass Sie hier sind.«
»Meine letzte Bingewatching-Serie war Mo auf Netflix«, sagte sie, wenn die Vorstellungsrunde zu Ende war. Sie war mit Serien wie I Love Lucy und Seinfeld aufgewachsen, hatte sich mit deren Alltagsgeschichten identifizieren können, obwohl sie eigentlich das Gefühl hatte, aus einer anderen Welt zu kommen. Doch Mo war die erste Serie gewesen, in der eine palästinensisch-amerikanische Familie im Mittelpunkt stand. »Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, mich selbst auf dem Bildschirm zu sehen«, erklärte sie.
Einige Studierende nickten, doch die meisten schauten sie ausdruckslos an. Yara nahm auf einem der leeren Stühle Platz, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, und sagte: »Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich in diesem Kurs, weil Sie Kunst als Wahlfach belegen müssen, aber mein Ziel besteht darin, Ihnen trotzdem etwas Wertvolles mitzugeben, ganz unabhängig von Ihrem angestrebten Abschluss.«
Die Studierenden schauten sie weiter ungerührt an. Yara räusperte sich und fuhr fort: »Vielleicht denken Sie: Warum Kunst? Was kann mir das überhaupt bringen? Ich kann Sie verstehen. Früher galten die Geisteswissenschaften noch als heiliges Unterfangen mit dem Ziel, im Alltag nach Schönheit zu suchen und sie zu hegen, doch diese Zeiten sind vorbei. Heute leben wir in einer Welt der Massenmedien und Technologie, einer Welt, in der alles eine Funktion haben muss – und vielleicht haben wir es verlernt, Kunst wertzuschätzen oder etwas nur mit dem Ziel zu tun, kreativ zu sein und Freude daran zu haben.«
Einige Studierende rutschten auf ihren Stühlen herum. Andere schauten auf ihre Smartphones. Yara widerstand dem Drang, sich zu erheben und ihnen die Geräte wegzuschnappen. »Kunst gewährt uns Zugang zum Metaphysischen, zum Göttlichen«, erklärte sie weiter. »Und wir brauchen sie in unserem Leben, um eine Verbindung zu etwas zu schaffen, das über die begrenzte Welt unserer Existenz hinausgeht. Daher ermutige ich Sie dazu, bis zum Ende dieses Semesters etwas Schönes zu erschaffen und Ihre Beziehung zur Schönheit dabei auch auf andere Bereiche Ihres Lebens auszuweiten.«
Noch immer kam keine Reaktion. Diese Erfahrung machte Yara oft, vielleicht weil sie ein geisteswissenschaftliches Wahlfach an einem College unterrichtete, dessen Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fächern lag. Sie konnte es den Studierenden kaum verübeln. Sie waren hier, um einen bestimmten Abschluss zu erlangen, den sie für einen bestimmten Beruf brauchten, mit dem sie einen bestimmten gesellschaftlichen Beitrag leisten konnten. Kein Wunder, dass sie Yaras Kurs als Zeitverschwendung betrachteten. Hatte sie in ihrem ersten Studienjahr nicht genauso gedacht, als sie durch ihre Vorkurse geprescht war, um die Ziellinie zu erreichen?
Und trotzdem wollte sie die Hoffnung nicht aufgeben, die Einstellung der Studierenden zur Kunst so weit verändern zu können, dass sie sich am Ende des Kurses vielleicht auf eine ganz unverhoffte Weise für die Welt gewappnet fühlten. An manchen Tagen glaubte sie, dass nicht die Kunst, sondern das Unterrichten ihre Chance war, einen bedeutenden Beitrag in der Welt zu leisten. Wenn sie es nicht schaffte, selbst als Künstlerin Erfolg zu haben, konnte sie vielleicht ihren Studierenden dabei helfen. Dieser Gedanke gab ihr zu Semesterbeginn jedes Mal Hoffnung und brachte die Stimme, die ihr immer wieder zuflüsterte, dass sie niemals etwas wirklich Gutes oder Bedeutendes zustande bringen würde, für eine Weile zum Schweigen.
Nachdem sie den Lehrplan mitsamt den Kursanforderungen durchgegangen war und mehrmals die gleiche Frage zu verspätetet abgegebenen Arbeiten beantwortet hatte, kam sie endlich dazu, den Beamer einzuschalten. Sie schaute die Studierenden an, drückte auf die Fernbedienung und ließ das Bild eines zwölfteiligen Farbkreises erscheinen.
»Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Kunstschaffende und Designprofis die perfekten Kombinationen finden?«, fragte Yara. »Sie nutzen die Farbenlehre. Der Farbkreis wurde 1666 von Isaac Newton erfunden, er stellte das Farbspektrum in der Form eines Kreises dar. Das Wissen darüber, wie Farben richtig kombiniert werden und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, ist für Kunstschaffende ebenso wichtig wie für Design-, Vertriebs- oder Marken-Profis.«
Einige Studierende machten sich Notizen. Andere starrten auf ihren Schoß oder warfen verstohlene Blicke auf ihre Smartphones.
»Was ich auch noch sagen wollte«, fuhr Yara fort und räusperte sich. »Wenn über einflussreiche Malerinnen und Maler gesprochen wird, stehen immer die üblichen Verdächtigen im Fokus: van Gogh, Monet und so weiter. Wir werden in diesem Semester natürlich diverse Meisterwerke besprechen. Aber ich werde Ihnen auch Bilder von einigen Kunstschaffenden of Color zeigen, die Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt sind, obwohl auch sie mit ihren Werken die Welt geprägt haben. Ich hoffe, auf diese Weise Ihr Interesse für Kunstbewegungen und Stilrichtungen zu wecken, die Ihnen noch nicht vertraut sind.« Sie wartete. Niemand reagierte. »Doch schauen wir zunächst, ob Sie erkennen können, wie die Farbtheorie in den folgenden Gemälden angewendet wurde.«
Sie wandte sich dem Whiteboard zu, um eine Reihe von Bildern zu zeigen: Diego Riveras Straße in Ávila mit sanften Variationen von Rot, Orange und Gelb. Amrita Sher-Gils Hungarian Gypsy Girl, eine Explosion aus leuchtenden Grün-, Ocker- und Brauntönen, dazu die dynamische Pinselführung, als würde man auf eine Wiese treten. Safia Farhats Wandteppich Die Braut, eine Kaskade aus strahlendem Gelb, gedämpftem Blau und tiefem Rot, die die Betrachtenden einlädt, näher zu kommen und genauer hinzuschauen.
Während Yara in dem stillen Seminarraum von einem leuchtenden Bild zum nächsten klickte und die Schönheit der Werke bewunderte, hatte sie plötzlich das Gefühl, die Wände würden sich auf sie zubewegen. Als würden alle im Raum sie anstarren und erkennen, was für eine Hochstaplerin sie war: eine, die Kunst unterrichtete und über Werke dozierte, die sie selbst noch nie im Original gesehen hatte, und das auch noch, ohne selbst etwas Bedeutendes erschaffen zu haben.
Bei Vincent van Goghs Caféterrasse am Abend hielt sie inne. Das Gemälde zeigte die Momentaufnahme einer Straße in Arles, kleine Gestalten saßen auf der Terrasse unter einer gelben Laterne, deren Lichtschein das Kopfsteinpflaster wie Münzen flackern ließ. Im Hintergrund türmten sich dunkelblaue Häuser wie Schatten, und über ihnen funkelte der Sternenhimmel.





























