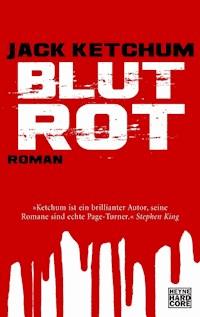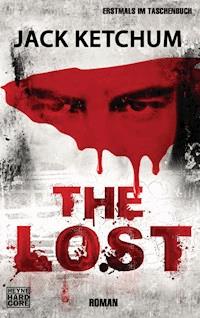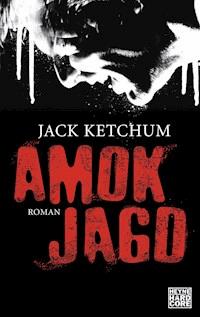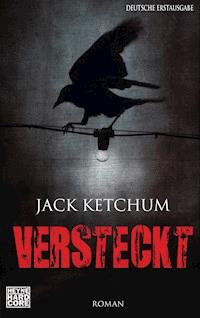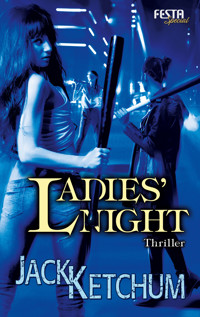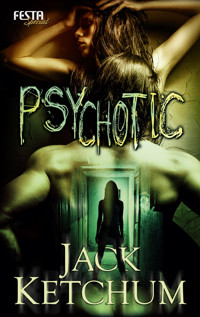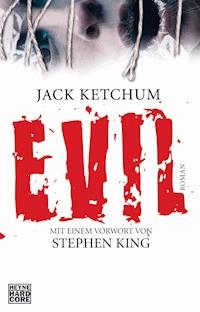
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jack Ketchums beunruhigender, grenzüberschreitender Horrorthriller gilt unter Experten als eines der großen Meisterwerke des Genres. Die Geschichte eines Jungen, der inmitten einer amerikanischen Vorstadtidylle mit unvorstellbaren Grausamkeiten konfrontiert wird, steigt tief hinab in die Abgründe der menschlichen Psyche. Nachdem der brillant geschriebene Roman viele Jahre unter der Hand als geheimer Klassiker die Runde gemacht hatte, erhält er jetzt nicht zuletzt dank Stephen King, der zu diesem Werk auch eine ausführliche Einleitung verfasst hat, die verdiente Aufmerksamkeit und erscheint nun endlich auch als deutsche Erstausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ZUM BUCH
Eine Vorstadt in den USA der Fünfzigerjahre. Kein schlechter Ort, um seine Jugend zu verbringen – weitab von McCarthys Kommunistenjagd, dem Kalten Krieg und der Atombombe. Doch dieser Ort hat auch seine düsteren Seiten, wie der junge David bald erfahren wird. Denn in der kleinen ruhigen Sackgasse, in der er und seine Freunde wohnen, geschehen in einem Keller Dinge, von denen niemand weiß und die auch nicht ans Tageslicht kommen sollen. Was passiert, wenn der Wahnsinn ungebremst seinen Lauf nimmt und das Böse von den Menschen Besitz ergreift?
Jack Ketchums Horrorthriller ist ein Meisterwerk der psychologischen Spannung und gleichzeitig eines der schockierendsten Werke der modernen Literatur.
ZUM AUTOR
Jack Ketchum ist das Pseudonym des ehemaligen Schauspielers, Lehrers, Literaturagenten und Holzverkäufers Dallas Mayr. Seine Horrorromane zählen in den USA unter Kennern neben den Werken von Stephen King oder Clive Barker zu den absoluten Meisterwerken des Genres, wofür Jack Ketchum mehrere namhafte Auszeichnungen verliehen wurden. Weitere Infos zum Autor findet man unter www.jackketchum.net.
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
von Stephen King
In Wirklichkeit gibt es überhaupt keinen Jack Ketchum. Es handelt sich um ein Pseudonym für einen Mann namens Dallas Mayr. Natürlich würde ich so etwas nie verraten, wenn es ein streng gehütetes Geheimnis wäre. Aber so ist es nicht. Bei allen Romanen Ketchums (sieben oder acht sind in den USA erschienen) ist der Name Dallas Mayr auf der Copyright-Seite vermerkt, und wenn er Autogramme gibt, kann es durchaus sein, dass er mit »Dallas« unterschreibt. (Im Seite-2-Text dieser Ausgabe wird er allerdings bestimmt als Jack Ketchum vorgestellt.) Mir kam »Jack Ketchum« ohnehin nie wie ein ernst gemeinter Nom de Plume vor, eher schon wie ein Nom de Guerre. Und ein sehr passender. Schließlich war Jack Ketch über Generationen der Spitzname britischer Henker. Auch in den Romanen seines amerikanischen Namensvetters überlebt eigentlich niemand: Immer klappt die Falltür auf, immer zieht sich die Schlinge zusammen, und auch die Unschuldigen müssen baumeln.
Nach einem alten Sprichwort sind im Leben nur zwei Dinge sicher: der Tod und die Steuern. Dem kann ich noch eine dritte Gewissheit hinzufügen: Disney Studios wird nie einen Roman von Jack Ketchum verfilmen. In Ketchums Welt sind die Zwerge Kannibalen, den Wölfen geht nie der Atem zum Schnaufen und Keuchen aus, und die Prinzessin landet zuletzt an einen Balken gefesselt in einem Atombunker, wo ihr eine Wahnsinnige mit einem Bügeleisen die Klitoris wegsengt.
Ich habe schon einmal einige Sätze über Ketchum geschrieben und dabei festgestellt, dass er für Leser des Genres zu einer Kultfigur und für Autoren von Horrorgeschichten zu einem Helden geworden ist. Im Grunde kommt er einer amerikanischen Antwort auf Clive Barker sehr nahe, allerdings eher im Hinblick auf die Sensibilität als auf den Stoff seiner Romane, da sich Ketchum kaum je mit übernatürlichen Erscheinungen befasst. Das spielt jedoch keine Rolle. Wichtig ist nur, dass sich kein Schriftsteller, der ihn gelesen hat, seinem Einfluss entziehen kann, und dass ihn kein Leser, der seinem Werk zufällig begegnet, so schnell wieder vergessen wird. Er ist zu einem Archetyp geworden. Das gilt schon seit seinem ersten Roman Off Season (eine Art literarische Fassung von Die Nacht der lebenden Toten) und auf jeden Fall für Evil, das wohl als Ketchums definitives Werk angesehen werden kann.
Der Romancier, mit dem er für meine Begriffe die größte Ähnlichkeit hat, ist der sagenumwobene Krimiautor Jim Thompson aus den späten Vierziger- und Fünfzigerjahren. Ketchums gesamtes Œuvre ist wie das von Thompson als Taschenbuch erschienen (zumindest in seiner Heimat; in England sind ein oder zwei gebundene Ausgaben von ihm veröffentlicht worden), er ist nie auch nur in die Nähe der Bestsellerlisten gekommen, er wird nie außerhalb von Genre-Zeitschriften wie Cemetery Dance und Fangoria rezensiert (wo er nur selten wirklich verstanden wird), und er ist für das allgemeine Lesepublikum praktisch ein Unbekannter. Doch wie Thompson ist er ein äußerst interessanter Autor, grimmig und manchmal sogar brillant, ausgestattet mit großem Talent und einer verzweifelten Weltsicht. Sein Werk besitzt eine lebendige Intensität, der das Schaffen mancher seiner weitaus bekannteren Kollegen nicht das Wasser reichen kann – ich denke da an so unterschiedliche Romanciers wie William Kennedy, E. L. Doctorow und Norman Mailer. Von den heute arbeitenden amerikanischen Romanciers bin ich mir eigentlich nur bei einem sicher, dass er bessere und wichtigere Geschichten schreibt als Ketchum: Cormac McCarthy. Das mag hoch gegriffen erscheinen als Lob für einen obskuren Taschenbuchautor, aber es ist keine Übertreibung. Ob es einem nun passt oder nicht (und vielen, die den folgenden Roman lesen, wird es nicht passen), es ist die Wahrheit. Jack Ketchum ist ein ernst zu nehmender Autor. Schließlich sollte man nicht vergessen, dass auch Cormac McCarthy völlig unbekannt und ständig pleite war, bis er All die schönen Pferde veröffentlichte, einen Western ohne große Ähnlichkeit mit seinen anderen Büchern.
Aber im Gegensatz zu McCarthy hat Ketchum kein Interesse an einer dichten, lyrischen Sprache. Er schreibt eine direkte amerikanische Prosa, in der gelegentlich ein spitzer, halb hysterischer Humor aufblitzt – zum Beispiel wenn Eddie, der verrückte Junge aus Evil, »mit nacktem Oberkörper und einer lebenden schwarzen Schlange zwischen den Zähnen« daherkommt. Kennzeichnend für Ketchums Werk ist allerdings nicht der Humor, sondern der Horror. Wie Jim Thompson vor ihm (siehe die Bücher Grifters und Der Mörder in mir, die beide fast von Jack Ketchum stammen könnten) fasziniert ihn das existentielle Grauen des Lebens, eine Welt, in der ein Mädchen gnadenlos gefoltert wird, und zwar nicht nur von einer psychotischen Frau, sondern von einer ganzen Nachbarschaft; eine Welt, in der sogar der Held zu unentschlossen, zu schwach und innerlich zu zerrissen ist, um das Unheil abzuwenden.
Evil ist ein eher kurzes Buch. Dennoch ist es ein ambitioniertes Werk mit Tiefgang. Im Grunde finde ich das gar nicht so überraschend. Abgesehen von Lyrik war der Spannungsroman in den Jahren nach Vietnam für Amerika die fruchtbarste Form des schöpferischen Ausdrucks (künstlerisch gesehen waren es keine besonders guten Jahre; zum größten Teil war die Entwicklung in der Kunst genauso erbärmlich wie in den Bereichen Politik und Sex). Wahrscheinlich ist es immer einfacher, gute Kunst zu produzieren, wenn es weniger kritische Zuschauer gibt. Für den amerikanischen Spannungsroman gilt dies schon seit McTeague von Frank Norris – ein weiterer Roman, der von Jack Ketchum stammen könnte (allerdings hätte Ketchums Fassung bestimmt viel von dem ermüdenden Gerede weggelassen und wäre deutlich kürzer geworden).
Evil beginnt als eine Art Archetyp der fünfziger Jahre. Wie bei fast allen solchen Geschichten (man denke an Der Fänger im Roggen, Ein anderer Frieden, meine eigene Erzählung Die Leiche) ist der Erzähler ein Junge, und das Buch beginnt (nach einem Kapitel, das eine Art Prolog ist) in wunderbarer Huck-Finn-Manier: Ein barfüßiger Junge mit braun gebrannten Wangen liegt in der Sommersonne auf einem Bachstein und fängt mit einer Blechbüchse Flusskrebse. Dort findet ihn die hübsche Meg mit Pferdeschwanz, die vierzehn und natürlich neu im Ort ist. Sie und ihre jüngere Schwester Susan wohnen bei Ruth, einer alleinerziehenden Mutter mit drei Jungs. Einer dieser Jungs ist (natürlich) Davids bester Freund. Zusammen verbringt die ganze Horde Kinder die Abende in Ruth Chandlers Wohnzimmer vor dem Fernseher und schaut sich Komödien wie Vater ist der Beste und Westernserien wie Cheyenne an. Mit sparsamer Präzision ruft Ketchum die Erinnerung an die fünfziger Jahre wach: die Musik, die Isolation des Vorstadtlebens, die durch den Bunker im Keller der Chandlers symbolisierten Ängste. Dann packt er diese erlesen blöde Vorstellung einer idyllischen Vergangenheit und zerpflückt sie mit atemberaubender Leichtigkeit.
Zum einen ist der Vater in der Familie des jungen David sicherlich nicht der Beste, sondern ein zwanghafter Schürzenjäger, dessen Ehe an einem seidenen Faden hängt. Und David weiß das auch. »Mein Vater hatte viele Gelegenheiten zu Affären, die er auch nutzte«, berichtet er. »Er traf sie spät, und er traf sie früh.« Es ist nur ein leichter ironischer Peitschenschlag, aber die Spitze ist mit Schrot beschwert; man hat schon weitergelesen, bevor man merkt, dass es ein wenig brennt.
Meg und Susan sind im Haus der Chandlers gestrandet, weil ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind (irgendjemand sollte mal einen Aufsatz schreiben über den allzeit beliebten Autounfall und seine Auswirkungen auf die amerikanische Literatur). Zunächst hat es den Anschein, als würden sie sich gut einleben bei Ruths Jungs – Woofer, Donny und Willie junior – und bei Ruth selbst, einer unbekümmerten Frau, die gern Geschichten erzählt, viel raucht und anderen Jungs schon mal ein Bier aus dem Kühlschrank anbietet, wenn sie versprechen, dass sie es nicht ihren Eltern verraten.
Ketchum hat schöne Dialoge zu bieten und gibt Ruth eine wunderbar kantige Stimme, die für den Leser einen leicht kratzigen Nachhall bekommt. »Merkt euch eins, Jungs«, sagt sie an einer Stelle. »Das ist wichtig. Bei einer Frau müsst ihr nur immer nett sein – dann tut sie euch jeden Gefallen … Davy war nett zu Meg und hat dafür ein Bild gekriegt … Mädels sind einfach gestrickt … Ihr müsst ihnen nur ein bisschen was versprechen, dann geben sie euch fast immer, was ihr wollt.«
Das ideale heilsame Umfeld und die ideale erwachsene Autoritätsfigur für zwei traumatisierte Mädchen, möchte man meinen … nur dass wir es hier mit Jack Ketchum zu tun haben, und bei Jack Ketchum läuft die Sache nicht so. Ist noch nie so gelaufen und wird wahrscheinlich auch nie so laufen.
Ruth mag nach außen hin so fröhlich sarkastisch erscheinen wie eine Kellnerin mit rauer Schale, aber weichem Kern, doch in Wirklichkeit verliert sie allmählich den Verstand und versinkt immer tiefer in einer Hölle aus Gewalt und Paranoia. Sie ist eine scheußliche, aber merkwürdig banale Schurkin, die perfekte Besetzung für die Eisenhower-Jahre. Was ihr eigentlich fehlt, erfahren wir nie. Nicht zufällig lautet die von Ruth und allen Kindern, die ihr Haus besuchen, benutzte Zauberformel: nicht der Rede wert. Diese Phrase, die fast wie eine Zusammenfassung der fünfziger Jahre wirkt, nehmen sich alle Figuren des Romans so sehr zu Herzen, dass es irgendwann viel zu spät ist, um das bittere Ende abzuwenden.
Letztlich interessiert sich Ketchum weniger für Ruth als für die Kinder – nicht nur für die Chandler-Jungs und David, sondern auch für all die anderen, die ab und zu hinunter in den Keller der Chandlers steigen, während Meg langsam zu Tode gefoltert wird. Ketchum liegt etwas an Eddie und Denise, an Tony, Kenny, Glen und der ganzen albernen Fünfzigerjahrebande mit ihren Pomadentollen und den vom Baseballspielen aufgeschürften Knien. Manche schauen praktisch nur zu wie David. Andere schrecken schließlich auch nicht davor zurück, Meg mit heißen Nadeln die Worte ICH FICKE FICK MICH auf den Bauch zu nähen. Sie schlendern herein … sie schlendern wieder hinaus … sie sehen fern … sie trinken Cola und essen Erdnussbutterbrote … und niemand sagt ein Wort. Niemand setzt den Ereignissen im Bunker ein Ende. Es ist ein Alptraum-Szenario, eine bizarre Kreuzung aus Happy Days und Uhrwerk Orange, aus Dobie Gillis und Der Sammler. Das Ganze funktioniert nicht nur, weil Ketchum das kleinstädtische Ambiente perfekt einfängt, sondern auch, weil wir gegen unseren Willen zu der Einsicht gezwungen werden, dass so etwas mit der richtigen Mischung aus emotional gestörten Kindern, dem richtigen geistig gestörten Erwachsenen als Führer durch den Schrecken und vor allem der richtigen Geht-mich-nichts-an-Atmosphäre durchaus denkbar wäre. Immerhin war dies die Ära, in der eine gewisse Kitty Genovese in einer New Yorker Seitenstraße über einen Zeitraum von mehreren Stunden hinweg mit Messerstichen zu Tode gequält wurde. Immer wieder rief sie nach Hilfe, und viele Leute sahen, was passierte, aber niemand unternahm etwas dagegen. Nicht einmal die Polizei wurde gerufen.
Auch sie folgten bestimmt dem Motto Nicht der Rede wert … und von dort ist es im Grunde nur noch ein kleiner Schritt bis zu Machen wir doch mit.
Der Erzähler David ist die einzige menschlich anständige Figur des Romans und macht sich als solche sicherlich zu Recht Vorwürfe wegen des schrecklichen Foltermordes in Ruth Chandlers Keller; Anständigkeit ist nicht nur eine Einstellung, sondern auch eine Verantwortung, und als der einzige Zeuge, der begreift, dass die Geschehnisse in diesem Haus böse sind, lädt er letzten Endes größere Schuld auf sich als die moralisch hohlen Kinder, die das Mädchen von nebenan aufschlitzen, verbrennen und sexuell missbrauchen. David beteiligt sich nicht an diesen Dingen, aber er erzählt seinen Eltern nichts von den Vorfällen im Chandlerhaus und meldet sie auch nicht der Polizei. Ein Teil von ihm will sogar mitmachen. Es ist eine Art von Genugtuung für uns, als Davy schließlich doch noch eingreift – der einzige kalte Sonnenstrahl der Hoffnung, den uns Ketchum gestattet –, doch wir hassen ihn auch dafür, dass er es nicht schon früher getan hat.
Wenn Hass alles wäre, was wir für diesen unglückseligen Erzähler empfinden, würde Evil bei seiner moralischen Gratwanderung genauso abstürzen wie American Psycho von Brett Easton Ellis. Doch David ist Ketchums vielleicht gelungenste Figur überhaupt, Lichtjahre entfernt von Ellis’ flachen Pornogestalten, und seine Komplexität verleiht dem Buch eine Tiefe, die in den früheren Romanen des Autors nicht immer anzutreffen ist. Wir empfinden Mitleid mit David, wir verstehen sein anfängliches Zögern, Ruth Chandler zu verpfeifen, die Kinder als Menschen behandelt und nicht als Quälgeister, die einem ständig zwischen die Beine laufen, und wir begreifen auch seine verhängnisvolle Unfähigkeit, die Tragweite der Ereignisse zu erfassen.
»Und manchmal war es … wie diese Filme, die später in den sechziger Jahren kamen«, sagt David. »Ausländische Filme meistens – wo man das Gefühl hatte, dass man in eine undurchdringliche Welt faszinierender, hypnotischer Illusionen eingetaucht war, deren endlos übereinander gehäufte Bedeutungsschichten letztlich nur auf ein völliges Fehlen von Bedeutung verwiesen, Filme, in denen sich Schauspieler mit Pappkartongesichtern völlig emotionslos durch surreale Albtraumlandschaften treiben ließen.«
Für mich ergibt sich die Qualität von Evil letztlich aus der Tatsache, dass ich David als gültigen Teil meiner Weltauffassung akzeptiert habe – genauso gültig und in mancher Hinsicht auch unliebsam wie der psychotische Sheriff Lou Ford, der sich lachend, prügelnd und mordend seinen Weg durch die Seiten von Jim Thompsons Der Mörder in mir bahnt.
Natürlich ist David viel anständiger als Lou Ford.
Das macht ihn auch so schrecklich.
Jack Ketchum ist ein brillanter, bewegender Romanautor, mit dessen düsterer Auffassung der menschlichen Natur wahrscheinlich nur Frank Norris und Malcolm Lowry wetteifern können. Seinem Publikum wurde er als Schöpfer spannender Reißer präsentiert (die Warner-Taschenbuchausgabe von Evil erschien mit einer dürren Cheerleaderin als Titelbild, die rein gar nichts mit der Handlung zu tun hat; das Buch sieht aus wie ein Schinken von V. C. Andrews oder ein Kindergruselroman von R. L. Stine). Und seine Bücher sind tatsächlich spannend und mitreißend, aber die Titelbilder und Werbetexte geben genauso ein Zerrbild von ihm, wie dies bei Jim Thompsons Romanen der Fall war. Evil besitzt eine Lebensnähe, die kein Roman von V. C. Andrews je hatte und die für die meisten Werke der Unterhaltungsliteratur unerreichbar bleibt; das Buch verheißt den Schrecken nicht nur, sondern löst sein Versprechen auch ein. Aber es ist auch ein Reißer, daran kann kein Zweifel bestehen. Der Leser wird mitgerissen, selbst wenn er sich davor fürchtet, mitgerissen zu werden. Ketchums thematischer Ehrgeiz ist groß, hält sich jedoch im Hintergrund und behindert nicht die Hauptaufgabe eines Romanciers, die darin besteht, den Leser mit allen Mitteln in seinen Bann zu ziehen, seien sie fair oder fies. Bei Ketchum sind die Mittel meistens fies … doch dafür funktionieren sie umso besser.
Evil ist weit entfernt von dem dümmlichen Schmalz in Die Liebenden von Cedar Bend oder den harmlos heroischen Faxen in Der Regenmacher, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Leute, die ihre Lektüre auf die Bestsellerlisten der New York Times beschränken, keine Ahnung von Ketchum haben. Dennoch scheint es mir, dass unsere literarische Erfahrung ärmer wäre ohne ihn. Er ist ein echter Bilderstürmer, ein wirklich guter Schriftsteller, einer der wenigen außerhalb des Kreises von Auserwählten, die tatsächlich wichtig sind. Jim Thompsons Bücher haben immer wieder neue Leser gefunden, lange nachdem der Kreis von Auserwählten seiner Zeit in Vergessenheit geraten war. Ganz bestimmt wird das auch bei Jack Ketchum der Fall sein – nur wünsche ich mir, dass das im Gegensatz zu Thompson noch vor seinem Tod passiert. Eine Ausgabe wie diese, die sicherlich Aufsehen erregen wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Bangor, Maine
24. Juni 1995
You got to tell me brave captain Why are the wicked so strong? How do the angels get to sleep When the devil leaves the porch light on?
– Tom Waits
I never want to hear the screams Of the teenage girls in other people’s dreams
– The Specials
Eine Seele unter der Last der Sünde kann nicht fliehen
– Iris MurdochThe Unicorn
TEIL EINS
1
Ihr glaubt, ihr wisst, was Schmerz ist?
Fragt meine zweite Frau. Sie weiß es. Oder glaubt es zumindest.
Als sie neunzehn oder zwanzig war, ist sie zwischen zwei kämpfende Katzen geraten – die eine gehörte ihr, die andere einem Nachbarn. Eine ging auf sie los, kletterte an ihr hoch wie an einem Baum und riss ihr dabei tiefe Wunden an Schenkeln, Bauch und Brüsten. Die Narben sieht man heute noch. Sie erschrak dermaßen, dass sie nach hinten gegen das antike Buffet ihrer Mutter knallte, die gute Kuchenplatte aus Keramik zerbrach und sich fünfzehn Zentimeter Haut von den Rippen schürfte, während sich die fauchende Katze mit Zähnen und Klauen wieder einen Weg an ihr herunterbahnte. Mit sechsunddreißig Stichen mussten sie sie zusammennähen, hat sie erzählt. Und mehrere Tage lag sie mit Fieber im Bett.
Das ist Schmerz, meint meine zweite Frau.
Sie hat nicht die geringste Ahnung.
Evelyn, meine erste Frau, ist der Sache vielleicht schon ein Stück näher gekommen.
Sie wird von einer Erinnerung verfolgt.
An einem warmen Sommermorgen ist sie mit einem Leihwagen auf der regennassen Autobahn unterwegs, neben ihr sitzt ihr Freund. Sie fährt langsam und vorsichtig, weil sie genau weiß, wie rutschig der heiße Asphalt bei Regen sein kann. Da überholt sie ein VW und schiebt sich schlingernd auf ihre Spur. Die hintere Stoßstange mit dem New-Hampshire-Motto »Frei leben oder sterben« auf dem Nummernschild berührt nur leicht den Kühlergrill ihres Volvos. Fast zärtlich. Den Rest besorgt der Regen. Der Volvo kommt ins Schleudern und schießt über die Böschung. Einen Moment lang schweben sie und ihr Freund schwerelos durch die Luft, und auf einmal ist oben unten, dann wieder oben und zuletzt wieder unten. Irgendwann bricht sie sich dabei am Lenkrad die Schulter. Der Rückspiegel zerschmettert ihr das Handgelenk.
Dann kommt das Auto zum Stillstand, und sie starrt auf das Gaspedal über sich. Sie schaut sich nach ihrem Freund um, aber er ist nicht mehr da. Verschwunden wie von Zauberhand. Sie findet den Türgriff auf der Fahrerseite und kriecht hinaus auf das nasse Gras. Als sie aufgestanden ist, späht sie durch den Regen. Es ist die Erinnerung an das, was sie dann sieht, die sie für immer verfolgen wird. Vor ihrem Auto liegt inmitten von rot bespritzten Glasscherben ein blutiger Klumpen. Er sieht aus, als wäre ihm bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden.
Der blutige Klumpen ist ihr Freund.
Deshalb weiß sie mehr über Schmerz. Auch wenn sie ihn verdrängt hat und nachts sogar schlafen kann.
Sie weiß, dass Schmerz mehr ist als die alarmierende Reaktion des Körpers auf eine Verletzung.
Schmerz kann auch von außen nach innen dringen.
Manchmal ist Schmerz das, was man sieht. Schmerz in seiner reinsten, grausamsten Form. Schmerz, den weder Drogen noch Schlaf und selbst Schock und Koma nicht lindern können.
Man sieht ihn und nimmt ihn in sich auf.
Man wird zum Wirt eines langen, weißen Wurms, der nagt und frisst und in den Eingeweiden immer fetter wird, bis man eines Morgens hustend aufwacht und sich einem dieser blinde, blasse Kopf aus dem Mund windet wie eine zweite Zunge.
Nein, das kennen meine beiden Exfrauen nicht. Obwohl Evelyn der Sache ziemlich nahe gekommen ist.
Aber ich kenne den Schmerz.
Da müsst ihr mir schon vertrauen.
Ich kenne ihn schon sehr lange.
Mahnend sage ich mir, dass wir damals noch Kinder waren, bloß Kinder. Verdammt, wir hatten doch gerade erst unsere Pfadfinderhüte abgelegt und waren alles andere als erwachsen. Ich weigere mich zu glauben, dass ich immer noch derselbe bin wie damals, dass ich das alles nur unter einer tiefen Schicht begraben habe. Man bekommt immer eine zweite Chance im Leben, und ich habe meine genutzt. An diesen Gedanken klammere ich mich.
Obwohl der Wurm nach zwei schlimmen Scheidungen doch ein wenig an mir nagt.
Dann sage ich mir wieder, dass das alles in den Fünfzigern passiert ist, einer merkwürdigen Zeit der Repression, Geheimniskrämerei und Hysterie. Joe McCarthy fällt mir ein, auch wenn er für mich damals praktisch keine Rolle gespielt hat. Ich wunderte mich nur, dass mein Vater es immer so eilig hatte, nach der Arbeit im Fernsehen die Anhörungen des Ausschusses für antiamerikanische Umtriebe mitzubekommen. Ich erinnere mich an den Kalten Krieg. An die Luftschutzübungen im Schulkeller und an die Filme über Atomtests, in denen Schaufensterpuppen in kulissenartigen Wohnzimmern verbrannten und zerfielen. An Playboy- und Man’s Action-Hefte, die in Wachspapier eingeschlagen unten am Bach versteckt waren. Nach einiger Zeit waren sie so verschimmelt, dass man sie nicht mehr anfassen wollte. Ich erinnere mich daran, wie Elvis in der Grace Lutheran Church von Reverend Deitz attackiert wurde, und an die Rock-’n’-Roll-Krawalle in der Alan Freed Show im Paramount. Da war ich zehn.
Heute denke ich mir, dass sich damals etwas zusammenbraute. Amerika war wie eine Eiterbeule kurz vor dem Platzen. Und diese Dinge passierten überall, nicht nur in Ruths Haus. Überall.
Manchmal wird es durch diesen Gedanken ein wenig erträglicher. Was wir getan haben.
Ich bin jetzt einundvierzig. 1946 geboren, auf den Tag genau sieben Monate, nachdem wir die Atombombe auf Hiroshima geworfen haben.
Matisse hatte gerade seinen Achtzigsten gefeiert.
Ich arbeite an der Wall Street und verdiene hundertfünfzigtausend im Jahr. Zwei Ehen, keine Kinder. Ein Haus in Rye und eine Wohnung in der Stadt, von der Firma gestellt. Wenn ich irgendwo hinmuss, werde ich meistens in einer Limousine chauffiert, nur in Rye sitze ich selbst am Steuer eines blauen Mercedes.
Kann sein, dass ich bald wieder heirate. Die Frau, die ich liebe, weiß nichts von der Sache – genauso wenig wie meine anderen Frauen, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich ihr jemals davon erzählen werde. Warum auch? Ich bin erfolgreich, ausgeglichen, großzügig und ein rücksichtsvoller, aufmerksamer Liebhaber.
Doch mein Leben ist eine Katastrophe. Seit dem Tag im Sommer 1958, an dem Ruth, Donny, Willie und wir anderen Meg Loughlin und ihre Schwester Susan kennen gelernt haben.
2
Ich war allein unten am Bach und lag mit dem Bauch auf dem großen Stein, den wir »den Felsen« nannten. Mit einer Blechdose in der Hand war ich auf der Jagd nach Flusskrebsen. Zwei kleine hatte ich schon erwischt. Sie schwammen in einer größeren Büchse neben mir. Jetzt wollte ich auch noch ihre Mutter fangen.
Das Wasser des Baches wurde durch die starke Strömung aufgewirbelt und spritzte gegen meine nackten Füße. Das Wasser war kalt und die Sonne warm.
Ein Geräusch in den Büschen ließ mich aufblicken. Das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen hatte, stand am Ufer und lächelte mir zu.
Sie hatte lange braun gebrannte Beine und langes rotes Haar, das zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Sie trug eine kurze Hose und eine helle Bluse mit offenem Kragen. Ich war zwölfeinhalb. Sie war älter.
Ich weiß noch, dass ich ihr Lächeln erwiderte, obwohl ich sonst zu Fremden nie besonders freundlich war.
»Flusskrebse.« Ich leerte die kleine Dose aus.
»Wirklich?«
Ich nickte.
»Große?«
»Die nicht. Aber es gibt hier welche.«
»Darf ich mal sehen?«
Ohne sich erst hinzusetzen, stützte sie sich wie ein Junge mit der linken Hand ab und sprang herunter zum ersten großen Stein. Einen Moment lang sah sie sich die Reihe von Steinen an, die im Zickzack über den Bach führte, dann kam sie zu mir auf den Felsen. Ich war beeindruckt. Sie zögerte keine Sekunde und hielt mühelos das Gleichgewicht. Ich rückte ein Stück, und da saß sie auch schon neben mir. Sie hatte grüne Augen und roch gut.
Sie schaute sich um.
Für uns alle hatte der Felsen damals eine besondere Bedeutung. Er lag mitten in der tiefsten Stelle des Baches, vom klaren Wasser umspült. Im Sitzen war für vier Kinder Platz, im Stehen für sechs. Der Felsen hatte unter anderem schon als Piratenschiff, als Nemos Nautilus und als Kanu der Delawaren gedient. An diesem Tag war das Wasser über einen Meter tief, doch das fremde Mädchen wirkte glücklich und zeigte keine Spur von Angst.
»Das hier ist unser Felsen«, sagte ich. »So haben wir ihn jedenfalls genannt, als wir noch klein waren.«
»Schön hier«, antwortete sie. »Kann ich mal die Krebse sehen? Ich heiße Meg.«
»Ich bin David. Klar.«
Sie spähte in die Dose. Eine Weile verging, ohne dass wir etwas sagten. Aufmerksam betrachtete sie die Krebse. Dann richtete sie sich wieder auf.
»Süß.«
»Ich fange sie nur so zum Anschauen. Dann lasse ich sie wieder frei.«
»Beißen sie?«
»Nur die großen. Aber sie können einem nicht wehtun. Und die kleinen versuchen bloß abzuhauen.«
»Sie sehen wie Hummer aus.«
»Hast du noch nie Flusskrebse gesehen?«
»Ich glaube nicht, dass es in New York welche gibt.« Sie lachte, doch es machte mir nichts aus. »Aber Hummer hatten wir schon. Und die können einem wehtun.«
»Wie hatten? Man kann doch einen Hummer nicht halten wie ein Haustier, oder?«
Wieder lachte sie. »Nein, sie werden gegessen.«
»Flusskrebse sind auch keine Haustiere. Sie gehen ein. Nach einem Tag, höchstens zwei. Aber sie werden auch gegessen, habe ich gehört.«
»Wirklich?«
»Ja, aber nur von manchen Leuten. In Louisiana oder Florida oder so.«
Wir schauten wieder in die Dose.
»Ich weiß nicht.« Sie lächelte. »Besonders viel ist nicht an ihnen dran.«
»Komm, wir fangen ein paar große.«
Nebeneinander lagen wir auf dem Felsen. Ich nahm die Dose und ließ beide Arme ins Wasser gleiten. Der Trick bei der Sache war, die Steine einzeln umzudrehen, ganz langsam, damit kein Schlamm aufgewirbelt wurde. Und mit der Dose schnell alles einzufangen, was darunter hervorgekrochen kam. Das Wasser war so tief, dass ich die Ärmel meines T-Shirts bis zu den Schultern hochkrempeln musste. Ich dachte daran, wie lang und dünn ihr meine Arme vorkommen mussten. Zumindest mir kamen sie so vor.
Es war ziemlich seltsam, so neben ihr. Verwirrend, aber auch aufregend. Sie war ganz anders als die Mädchen, die ich kannte – als Denise und Cheryl aus der Nachbarschaft oder die anderen aus der Schule. Erstens war sie ungefähr hundertmal hübscher. Meiner Meinung nach sogar hübscher als Natalie Wood. Außerdem war sie wahrscheinlich auch schlauer als die Mädchen, die ich kannte, und hatte mehr Erfahrung. Immerhin wohnte sie in New York und hatte schon Hummer gegessen. Und sie bewegte sich wie ein Junge. Sie war stark und voll leichter Anmut.
Das alles machte mich so nervös, dass mir der erste Krebs entwischte. Er war nicht riesig, aber doch größer als die, die wir schon hatten. Schnell krabbelte er wieder unter den Felsen.
Sie wollte es auch mal probieren, und ich gab ihr die Dose.
»Aus New York kommst du also?«
»Genau.«
Sie rollte die Ärmel hoch und tauchte die Arme ins Wasser. Da sah ich die Narbe.
»Hey, was hast du denn da?«
Wie ein langer, gekrümmter Regenwurm zog sich die Narbe von ihrem linken Ellbogen hinunter bis zum Handgelenk.
Sie bemerkte meinen Blick. »Ein Unfall. Mit dem Auto.« Dann wandte sie sich wieder dem Wasser zu, auf dem unruhig ihr Spiegelbild schimmerte.
»O Mann.«
Anscheinend wollte sie nicht darüber reden.
»Hast du noch mehr?«
Ich weiß nicht, warum Narben so eine Faszination auf Jungs ausüben, aber so ist es nun mal, und ich war keine Ausnahme. Ich konnte einfach nicht die Klappe halten, obwohl wir uns gerade erst kennen gelernt hatten und ich ihren Widerwillen spürte. Ich sah, wie sie einen Stein umdrehte. Es war nichts darunter. Trotzdem machte sie es genau richtig, ohne den Grund aufzuwirbeln. Ich fand sie wunderbar.
Sie zuckte die Achseln. »Ein paar. Aber das ist die schlimmste.«
»Darf ich mal sehen?«
»Nein, das geht nicht.« Sie lachte und sah mich mit einem vielsagenden Blick an, bis ich verstanden hatte. Dann hielt ich doch eine Weile die Klappe.
Sie drehte noch einen Stein um. Nichts.
»War es schlimm? Der Unfall?«
Sie gab mir keine Antwort, aber ich machte ihr keinen Vorwurf deshalb. Ich wusste genau, wie taktlos und dumm meine Frage war. Zum Glück bemerkte sie nicht, dass ich rot wurde.
Dann fing sie einen Krebs.
Er kam unter dem Stein hervorgeschossen und lief direkt in die Dose.
Sie schüttete etwas Wasser ab und hielt die Büchse ein wenig schräg ins Sonnenlicht, damit wir seine schöne goldene Farbe sehen konnten. Der Krebs hatte seinen Schwanz aufgerichtet. Mit wedelnden Scheren stolzierte er auf dem Boden der Dose hin und her, bereit zum Kampf.
»Du hast ihn!«
»Beim ersten Versuch!«
»Toll! Er ist wirklich toll!«
»Sollen wir ihn zu den anderen stecken?«
Vorsichtig goss sie das Wasser aus der Büchse, um den Krebs nicht zu verschrecken oder zu verlieren. Sie machte es genau richtig, obwohl es ihr niemand gezeigt hatte. Als nur noch ein Fingerbreit Wasser drin war, schüttete sie den Krebs in die größere Dose. Die beiden kleineren hielten respektvoll Abstand. Das war auch gut so, denn es kommt manchmal vor, dass Flusskrebse ihre Artgenossen umbringen. Doch die beiden Kleinen wollten keinen Kampf mit Mama riskieren.
Nach einer Weile beruhigte sich der Neuankömmling, und wir schauten ihn uns an. Er sah urtümlich aus, heimtückisch und schön. Hübsche Farbe und geschmeidiger Körperbau.
Ich steckte den Finger in die Dose, um den Krebs aufzuscheuchen.
»Nicht.« Sie legte mir die Hand auf den Arm. Die Berührung war kühl und weich.
Also zog ich den Finger wieder heraus.
Ich bot ihr einen Wrigleys an und nahm mir auch einen. Eine Zeit lang war nichts anderes zu hören als der Wind, der rauschend durch das hohe, dünne Gras und die Büsche am Ufer fuhr, der vom Regen letzte Nacht angeschwollene, schnell fließende Bach und unser Kauen.
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel
THE GIRL NEXT DOOR
bei Overlook Connection Press
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 01/2006 Copyright © 1989 by Dallas Mayr Copyright © dieser Ausgabe 2005 byWilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: © Toshiaki Tasaki/getty images Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich – München Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
eISBN 978-3-641-14136-3
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de