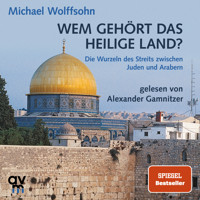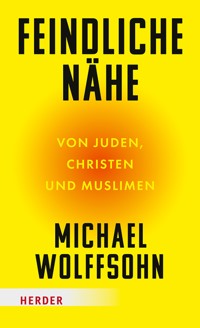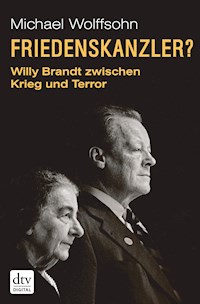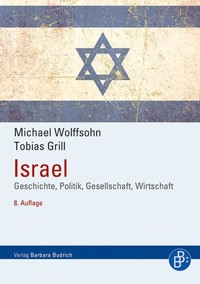19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit einem Essay von Ahmad Mansour. Vor 75 Jahren, am 14. Mai 1948, erfolgte die Proklamation des Staates Israel. Aus Anlass dieses Jahrestages legt Michael Wolffsohn eine selbstkritische und komplett überarbeitete Neufassung seines Grundsatzwerks "Ewige Schuld" vor. Der Optimismus, der 1988 bei der Erstausgabe vorherrschte, ist nunmehr einer ernüchternden Betrachtung gewichen. Von der "Wiedergutmachung" bis zur trügerischen Normalität heute zieht Wolffsohn eine kritische Bilanz der deutsch-jüdisch-israelischen Beziehungen. Der als Deutscher und Jude beiden Seiten verbundene Autor plädiert für einen entkrampften Umgang mit der Geschichte: Weder Verdrängen noch routinierte Sühnerituale helfen den Nachgeborenen, sondern nur die Einsicht in die Besonderheit der Vergangenheit, die beide Seiten aneinander bindet – im Guten wie im Schlechten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Essay von Ahmad Mansour
Antisemitismus: das alte, das neue und das persönliche Gespenst
Vorworte
Vorwort 1988
Vorwort zur fünften Auflage 1993
Vorwort 2023 zur (selbst)kritisch-aktualisierten Neuauflage nach 35 Jahren
Kapitel I. Ohne Hitler kein Israel? Zur historischen Einordnung der Staatsgründung
Kapitel II. Etappen deutsch-jüdisch-israelischer Geschichtspolitik
1. Wiedergutmachung, 1949–1953/55
2. Zwischen Geschichts- und Tagespolitik, 1955–1965
3. Die »Wende« zur »Normalität«, 1965–1973
4. Durchbruch zur demonstrativen »Normalität«, 1973–1984
5. Einbruch auf dünnem Eis: Die Gegenwart der Vergangenheit, 1984–1987
6. Dauerteilung, Mauerfall, Wiedervereinigung, 1988–1990
7. Die Sowjets kommen – nach Deutschland oder Israel? 1990/91
8. Der Golfkrieg und die Folgen, 1991–1998
9. Rot-Grüne Distanz und Nähe, 1998–2005
10. Schutzengel Angela? 2005–2021
11. Politischer Biologismus, politische Mechanik und Antigermanismus
12. Geschichte als Falle
13. Die DDR und Österreich zum Vergleich
Kapitel III. Israelisch-deutsche Geschichtspolitik: Zur politischen Funktion des Holocaust
1. Der Holocaust als Wahrnehmungsfilter der nichtjüdischen Umwelt
2. Der Holocaust als Heiligtum der weltlichen Staatsreligion und seine Funktion als Stifter jüdischer Identität
3. Die Rechtfertigungsfunktion des Holocaust
4. Die Integrationsfunktion des Holocaust
5. Der wirtschaftliche Nutzen des Holocaust als Bumerang
6. Erinnerung spaltet: Holocaust, Kolonialverbrechen und Muslime
7. Das »Land der Mörder« im Spiegel der Umfragen: Härtetest der Geschichtspolitik
Kapitel IV. Deutsch-israelische Rollenwechsel. Oder: Die Legende vom gebückten Gang
Kapitel V. Deutsch-israelische Sprachprobleme: Dieselben Begriffe – verschiedene Inhalte
Kapitel VI. Die Meinung der Öffentlichkeit: Spiegelbild des Generationswechsels
Kapitel VII. Das Verhalten der Öffentlichkeit: Tourismus als Indikator?
Kapitel VIII. Persönlichkeiten
1. Konrad Adenauer
2. David Ben-Gurion
3. Mitgestalter und Nachgestalter
Kapitel IX. Institutionen und Organisationen
Kapitel X. Dreiecksbeziehungen
1. Israel als Störfaktor deutsch-amerikanischer Beziehungen?
2. Ohne Identität – Mit Zukunft? Deutschlands Juden im Spannungsfeld von Diaspora und Israel
3. Ohne jüdische Last? Anmerkungen zum deutsch-arabischen Verhältnis. Oder: der Ausweg als Holzweg
Bilanz: Entkrampfung ohne Entsorgung
Nachworte
Nachwort 1993
Nachwort 2023
Literaturhinweise
Quellenhinweise
Dieses Buch widme ich meinem Freund und Kollegen Thomas Brechenmacher, dem einstigen Mitarbeiter und Schüler, der seinen Lehrer übertrifft. Das schönste Geschenk, das ein Lehrer bekommen kann.
Lesehinweis
Alle meine im Jahre 2023 der Erst- und Zweitfassung von 1988 und 1993 hinzugefügten Ergänzungen sind blau (in der Schwarzweiß-Version grau) hervorgehoben. Auf diese Weise können die Leser Sinn oder Unsinn meiner damaligen Analysen, Bewertungen und Vorhersagen überprüfen. Ohne Kritik und Selbstkritik oder -korrektur demaskiert sich Wissenschaft als Popanz oder Propaganda.
Michael Wolffsohn, im Januar 2023
Essay von Ahmad Mansour
Antisemitismus: das alte, das neue und das persönliche Gespenst
Es gibt viele Theorien, Vermutungen und Analysen dazu, warum Antisemitismus entstanden ist und sich bis heute in den unterschiedlichsten Facetten hartnäckig hält. Doch keine von ihnen findet eine eindeutige Antwort auf die Frage. Auch ich habe keine Antwort – vielleicht ist es einfach nicht möglich, das Irrationale rational zu erklären. Trotzdem dürfen wir uns nicht damit zufriedengeben, sondern müssen uns weiter mit dem Antisemitismus beschäftigen – einerseits, indem wir seine religiösen, kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Ursachen eruieren und seine aktuellen Ausprägungen auf der ganzen Welt betrachten. Andererseits, indem wir persönliche Erfahrungen, Biografien und Erlebnisse heranziehen. Denn durch sie lässt sich Antisemitismus nachempfinden. Das Wissen über Antisemitismus und die Empathie für dessen Leidtragende bilden die Basis, um ihn bekämpfen zu können. Deshalb möchte ich beide Betrachtungsweisen – die historische und meine ganz persönliche – im Folgenden vornehmen.
Im Judentum gibt es ein Fest, das Purim genannt wird. Es wird gefeiert, um an die Rettung der persischen Juden im 5. Jahrhundert vor Christus durch die Königin Ester zu erinnern. Laut Altem Testament wollte Haman, der höchste Regierungsbeamte des persischen Königs, damals alle Juden an einem Tag ermorden. Der Grund: Er war verärgert darüber, dass der Jude Mordechai sich nicht vor ihm verneigt hatte. Was danach geschah, wird im Alten Testament so beschrieben: »Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe; so will ich zehntausend Zentner Silber darwägen in die Hand der Amtleute, dass man’s bringe in die Schatzkammer des Königs.«
Ob diese Geschichte wirklich stattgefunden hat oder nicht, ist erst mal unwichtig. Tatsache ist, dass sie in den jüdischen Narrativen zweieinhalbtausend Jahre überlebt und dazu geführt hat, dass daraus ein Fest entstanden ist, das die Juden jedes Jahr feiern. Diese Geschichte ist entstanden, noch bevor Christen die Juden als Gottesmörder bezeichneten. Noch bevor die Kreuzfahrer bei ihrem ersten Kreuzzug im 11. Jahrhundert rheinländische Juden willkürlich ermordeten. Noch bevor Mohammed die jüdischen Stämme auf der arabischen Halbinsel zunächst versuchte anzuwerben, und sie dann, als sie sich weigerten, bis zur Vernichtung bekämpfen ließ.
Verachtung, Verfolgung, Ablehnung, Hass und Mord, Angst, aber auch Neid und Bewunderung: Juden leben seit Jahrtausenden als die anderen in den unterschiedlichsten Gesellschaften. Egal, in welchem Zeitalter und unter welchen Bedingungen sie lebten; egal, wie sich die Gesellschaft zusammensetzte; egal, was sie getan haben, welche Sprache sie sprachen, ob sie sich anpassten, ihre Namen änderten, reich waren oder arm, religiös oder säkular, sie waren immer die anderen und blieben es. Zudem waren sie diejenigen, die immer wieder für Krisen in der Welt verantwortlich gemacht und denen immer wieder Eigenschaften der Übermacht zugeschrieben wurden, wie heute beispielsweise die heimliche Kontrolle der Medien- und Finanzwelt, ja gar der gesamten Weltordnung.
Betrachtet man die lange Geschichte antisemitischer Taten, sieht man deutlich, dass es für die Ablehnung und den Hass keinen Anlass braucht. Nichts, was ein Jude macht, wird sie mildern. Sollen die Juden schuld daran gewesen sein, dass die Kreuzfahrer sie auf ihren Weg nach Jerusalem ermordeten? Wo soll die Schuld der jüdischen Opfer gelegen haben in dem koscheren Supermarkt in Paris, dem jüdischen Museum in Brüssel, der Synagoge in Kopenhagen oder in Toulouse, Malmö, Göteborg, Berlin? Überall wurden Menschen verletzt oder getötet. Begleitet wurden die Vorfälle von einem steigenden Gefühl der Unsicherheit und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit: schon wieder.
Was verbindet diese so unterschiedlichen Menschen, die an so unterschiedlichen Orten Opfer wurden, als allein die Tatsache, dass sie in den Augen der Täter als Juden wahrgenommen worden waren?
Auch der Täter, der im Oktober 2019 einen Anschlag auf die Synagoge von Halle verübte, hat sich nicht mit dem Judentum auseinandergesetzt, mit Juden Gespräche geführt und sich dann letztendlich für den Anschlag entschieden.
Diese Täter leben in einer Fantasiewelt. Weder Tatsachen noch gute oder schlechte Erfahrungen mit Juden oder gutes oder schlechtes Verhalten von Juden ändern etwas an ihrem Hass.
Auch Versuche, Antisemitismus durch bestimmte Eigenschaften, Persönlichkeitsstrukturen oder Verhaltensweisen von Juden zu begründen – ja, solche Versuche gibt es immer noch! – entbehren jeglicher Grundlage. Denn genauso wenig wie man Menschen pauschal bestimmte Persönlichkeitsstrukturen aufgrund ihrer Hautfarbe zuschreiben kann, gibt es den Juden.
Antisemitismus ist die Pathologie der Antisemiten. Und zwar ausschließlich.
Kommen wir nun zum Nahostkonflikt und meiner ganz persönlichen Geschichte.
Seit ich vor fast zwanzig Jahren als arabischer Israeli nach Deutschland kam, treffe ich hier sehr oft Menschen, die mir erklären wollen, welche Zustände in meiner Heimat Israel herrschen und warum meine Erfahrung und die daraus resultierende Sichtweise auf das ganze Land und den Nahostkonflikt inkorrekt seien. Manchmal reicht es, beim Kennenlernen zu erwähnen, dass ich – ein Araber – aus Israel komme, um Leute dermaßen aufzuregen, dass sie hochemotional reagieren. Die Meinung der Menschen zum Thema Israel scheint so fixiert zu sein, dass die Toleranz für Ambiguität auf der Strecke bleibt. Doch nicht nur der Blick in meine Lebensgeschichte zeigt, wie komplex und fast einmalig die Herausforderungen im Nahostkonflikt sind.
Ich bin jetzt 46 Jahre alt. Meine ersten 28 Lebensjahre verbrachte ich im Zentrum des Nahostkonflikts. Ich war in diese Zustände hineingeboren worden und bin mit ihnen aufgewachsen. In meiner Kindheit verbrachten wir oft die Wochenenden in Gaza am Strand und unsere Einkäufe erledigten wir fast wöchentlich in den palästinensischen Gebieten.
Ich bin mit einem arabischen TV-Sender in der Region großgeworden, auf dem Israel als der Feind dargestellt wurde. Mein Großvater hatte auf der Seite der arabischen Streitkräfte gegen den neu gegründeten jüdischen Staat gekämpft. Bis zu seinem Tod war er stolz auf die Narbe, die eine israelische Patrone ihm zugefügt hatte. Damit konnte er »Allah beweisen«, dass er gegen die Juden gekämpft hatte, sagte er immer. Mein Vater trägt das Trauma des Unabhängigkeitskrieges tief in seiner Seele. Er ist 1946 geboren und musste die ersten drei Jahre seines Lebens viele Male mit seiner Mutter vor dem Krieg in die Berge fliehen. Bis heute bestimmen diese Erfahrungen in vieler Hinsicht sein Dasein.
Jüdische und arabische Israelis leben dicht an dicht und oft zusammen. Geboren wurde ich in Kfar-Saba, etwa 15 Kilometer nordöstlich von Tel-Aviv. Dieser Ort liegt unmittelbar an der grünen Linie des Westjordanlandes. Auf der Geburtenstation des lokalen Krankenhauses lag meine Mutter damals neben vielen jüdischen Müttern und wurde von jüdischen Ärzten und Krankenschwestern betreut. Mein Elternhaus lag 200 Meter Luftlinie entfernt vom nächsten jüdischen Dorf. Mein Vater arbeitete auf Orangenplantagen. Sein Arbeitgeber war ein Jude, der uns häufiger besuchte. Er brachte immer köstliche Schokolade mit und diskutierte stundenlang leidenschaftlich mit meinem Vater über die Palästinenser und Israel. Sie waren nie derselben Meinung, aber sie akzeptierten einander.
Als ich mich im Alter von 13 islamistisch radikalisierte, verbrachte ich jede freie Minute in Jerusalem in der Al-Aqsa Moschee, und zwischen dem täglichen Beten und Falafelessen suchten wir arabischen Jugendlichen der Moschee-Gemeinde Reibung und Konflikt mit den israelischen Streitkräften vor Ort. Meine Schule absolvierte ich auf arabisch mitten in Israel und lernte dort als zweite Sprache auch Hebräisch.
Leid, Freude und Traumata, das alles gehört zu meinen Erinnerungen. Ich erinnere mich an die Schüsse im Jahr 1987 während der ersten Intifada, als wir beim wöchentlichen Einkaufen im Westjordanland waren. Soldaten sehe ich vor mir, wie sie 1991 Gasmasken an uns verteilten, und ich werde nicht vergessen, wie ich ein paar Wochen später mitten in der Nacht vom Heulen der Sirenen aus dem Schlaf gerissen wurde, als von Saddam Hussein geschickte Raketen um uns herum explodierten. Wir versteckten uns damals in abgedichteten Zimmern mit Gasmasken vor dem Gesicht.
Und es gibt eine andere Seite meiner Erinnerungen. Ich weiß noch, wie die Leute aus meinem Dorf auf den Straßen feierten, wie sie weinend jubelten, als der ehemalige israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Jassir Arafat die Hand gab, und auch dann wieder, als später das Oslo-Abkommen unterschrieben wurde. Dieselben arabischen Israelis zeigten sich schockiert und traurig, als Rabin im November 1995 wegen seiner Friedensbemühungen von einem rechtsradikalen Israeli umgebracht wurde. Arafat wählte ein paar Jahre später den Weg der Gewalt und richtete seine Sicherheitskräfte systematisch gegen genau jene Israelis, die ihn damals in Israel begrüßt hatten.
Nach meinem Schulabschluss studierte und arbeitete ich in Tel-Aviv. Unvergessen sind die vielen Checkpoints auf dem Weg zur Arbeit während der zweiten Intifada zwischen 2000 und 2004. Ich erinnere mich an Busse, die in die Luft gejagt wurden und an die Angst der Menschen.
Damals in Israel fuhr ich wie jeden Tag mit dem Auto von der Kleinstadt Tira, dem Wohnort meiner Eltern, in die Großstadt Tel Aviv, in der ich an einer Klinik als angehender Psychologe arbeitete. Plötzlich fiel mir auf, dass viele Menschen aus ihren Autos stürzten. Sie rannten in meine Richtung, an meinem Wagen vorbei. Ihre Gesichter waren von Angst verzerrt, erschüttert, entsetzt. Ein Attentat! Schockartig wurde mir klar, dass ich mitten in einen Anschlag geraten war. Um mich herum waren Menschen in Todesangst, die mich genauso erfasste.
Wieder hatte ein Palästinenser, getrieben von Hass und aufgepeitscht von Ideologie, es darauf abgesehen, Juden zu ermorden, die für ihn und sein Umfeld der Inbegriff des Übels der Welt waren. Dass in dem Korso der Autos auch Palästinenser fuhren, die ebenfalls Opfer des Anschlages wurden, war dem Täter oder den Tätern egal. Wer sich in der Nähe von Juden aufhielt, mit Juden arbeitete, sich mit ihnen anfreundete, der wurde auch zum Feind.
Dieser Tag liegt jetzt achtzehn Jahre zurück, und er ist mir immer noch sehr präsent. Denn er brachte eine Wende in mein Leben: In diesem Land der Verwerfungen, des Hasses und der Verfolgung Unschuldiger wollte ich nicht länger leben. »Ich will von hier weg!« war der Satz, gegen den ich nicht mehr ankam. Mit einem Stipendium für Deutschland, das mir meine israelischen Professoren an der Universität Tel Aviv ans Herz legten, kam ich nach Berlin, lernte Deutsch, setzte mein Studium fort.
Man könnte mir durchaus Naivität vorwerfen, dass ich geglaubt hatte, ausgerechnet in Deutschland würde ich Frieden finden vor der notorischen Ablehnung von Juden und allem Jüdischen, als ich Israel 2004 verließ. Ich hatte gehört, dass gerade in Deutschland die Vergangenheit aufgearbeitet, das Bewusstsein für Antisemitismus stark und der soziale Friede sicher seien. Doch ich erlebe hier und heute einen neuen Albtraum des Antisemitismus. Antisemitismus ist nicht wieder da – er ist noch immer hier, er wird lauter und aggressiver, in nahezu allen Milieus.
Eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen Antisemitismus ist seine schillernde Erscheinung. Er trägt bekanntlich nicht mehr nur Glatze, Springerstiefel, nicht mehr nur salafistische Gewänder am Körper und Baseballschläger in der rechten Hand. Antisemitismus trägt Krawatte und Tweed-Sakko, Hosenanzug, Jeans, T-Shirt und Blaumann, Sommerkleid und Trainingsjacke. Er brodelt bei der Polizei, in Schulen, Banken und auf Baustellen und zeigt sich damit in seinem schwer zu packenden Ausmaß.
Auch und gerade an Hochschulen ist Antisemitismus – verkleidet als »Israelkritik« – intellektuelle Mode, indem durch fragwürdige postkolonialistische Theorien Israel gern zum Hauptakteur gemacht wird, der den Weltfrieden gefährde.
Die alten Zerrbilder wirken fort, welche Juden als Verkörperung des Bösen darstellen. Waren das früher wahlweise Kommunismus oder Kapitalismus oder auch Pest und Seuchen, nutzt man heute Labels wie »Establishment«, »Ostküste Amerikas«, »Zionisten« und »Israel«, um Ressentiments und fatalen Aberglauben auszudrücken. Antisemitismus traut sich wieder ans Licht. In Deutschland, Frankreich und vielen anderen westlichen Staaten wagen es immer mehr Menschen, offen auszusprechen, was sie über Jüdinnen und Juden, Israel und Zionismus »wissen«.
Wieso ist das auch in Deutschland möglich? Bei meiner Arbeit beachte und beobachte ich die Argumente, etwa, wenn ich mit jungen Leuten in Schulen und Berufsschulen diskutiere. Auffällig ist, wie wenig sie sich für das sichtbare und selbstbewusste jüdische Leben im Land interessieren. Ihre Phantasmen kommen aus dem Internet, mit dem realen Leben haben sie wenig Verbindung. Das scheint auch deshalb so, weil an dem Ort, an dem sie es kennenlernen, nämlich meist in der Schule, die Begriffe »Juden« und »Deutschland« fast durchweg von Opfernarrativen geprägt sind.
Zunehmend bemerke ich, wie ähnlich die Kommunikation von deutschen und islamistischen Antisemiten ist, wie sich antisemitische Inhalte ohne Gegenwehr verbreiten – und das trotz verschärfter Gesetze. Kaum jemals wird antisemitische Propaganda strafrechtlich konsequent verfolgt. Darstellungen in Texten und Karikaturen, die Israel als Aggressor markieren, Verschwörungstheorien und Denunziationen meines Landes sind zu einer regelrechten Online-Plage geworden. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung versagt hier auf der ganzen Linie. Ohne Zweifel kann man sich bessere, sympathischere Staatschefs vorstellen als Benjamin Netanjahu. Aber woher kommt diese deutsche Besessenheit von der »Israelkritik«?
Vielleicht ist vor allem die vermessene Erwartungshaltung an die Übermoralität von Juden und des Staates Israel eine Hauptursache für die aktuelle Antihaltung großer Teile der deutschen Gesellschaft gegenüber Israel und jüdischen Menschen. Fälschlicherweise setzen sie sie pauschal mit Israel gleich. Mit der historischen Verantwortung gegenüber den Juden in der Welt haben diese Haltungen nichts zu tun.
Mir persönlich begegnet der Antisemitismus in meinem Job, in Schulen, in Asylheimen oder im Gefängnis. Dieser Hass agiert nicht leise, er versteckt sich nicht mehr, er ist selbstbewusst, deutlich und sichtbar geworden. Meine öffentlichen Statements zum Thema Israel und meine Arbeit im Bereich Antisemitismusbekämpfung haben dazu geführt, dass ich täglich bedroht, diffamiert und sogar des Öfteren auf der Straße angespuckt werde, mitten in Deutschland, hier in Berlin. Ich sei ein Zionist, ein Verräter, ein Agent des Mossads. Ein Rechtsradikaler, ein Onkel-Tom-Araber, der Gefallen finden will bei den Deutschen und bei den Juden. Angriffe, die keinesfalls nur von Palästinensern kommen, sondern und vor allem von Anhängern des linksextremen Spektrums.
Das heutige Israel ist irritierend. Es ist ein Land voller Gegensätze und Widersprüche. Es ist ein quicklebendiger, selbstbewusster Staat, der sich für seine Fortexistenz stark macht und proaktiv, auch militärisch, für seine Rechte kämpft. Das passt nicht in den Rahmen der Opfer-Erzählung. Autonome, kreative Israelis, jüdische und muslimische Staatsangehörige, die ihr Leben meistern, mehr oder minder erfolgreich, wie viele andere auch – all das passt nicht zum Opferlamm, das man bemitleiden und neben dem man sich großzügig fühlen kann. Weil Israels Selbstbehauptung provoziert, weil das alltägliche, selbstbewusste jüdische Leben provoziert, so scheint mir, fühlen sich Europäer – insbesondere Deutsche – zu Israels Feinden in der arabischen Welt hingezogen. Dieser antisemitische Magnetismus gipfelt in der grotesken Phrase, Israelis seien »die neuen Nazis«. Fassungslos höre ich als Psychologe, als israelischer Araber und historisch aufgeklärter Moslem, wie Europäer heute solche Sätze sagen. Und viel schlimmer noch: höchstwahrscheinlich auch daran glauben.
Sich gegen Feinde mit manifesten Auslöschungsfantasien zu verteidigen und dabei Stärke, Autonomie und Selbstvertrauen zu signalisieren, das sind legitime Bedürfnisse des Jüdischen Volkes, resultierend aus einer Geschichte der Pogrome und Verfolgungen, die im Holocaust kulminierte. Dies zutiefst zu verstehen, als israelischer Palästinenser, als Araber, als Muslim und als Mensch, der die Menschenrechte achtet, verstehe ich als meine Pflicht. Als deutscher Staatsbürger übernehme ich Verantwortung, indem ich mich der Aufklärung und dem Kampf gegen jeglichen Antisemitismus widme, egal ob dieser im Namen Allahs, der Kirche, der BDS-Bewegung, im Namen von Neonazis, der AfD oder aus der Mitte der Gesellschaft geschieht. Israel »Apartheid« vorzuwerfen ist historisch wie faktisch schlicht falsch. Mehr noch: Die einzig echte Demokratie im gesamten Nahen Osten einseitig als Täternation darzustellen ist sogar fatal und liefert Rechten und Antisemiten verbale Munition auf dem Silbertablett. Solch irregeleiteten Narrativen muss – vor allem in Deutschland – entschieden entgegengetreten werden.
Die Gegenwart befindet sich nicht in einem Kampf zwischen Religionen oder »Kulturen«. Es ist kein Wettstreit zwischen Juden, Muslimen und Christen. Es ist ein Kampf zwischen Demokraten und Antidemokraten. Auf der einen Seite stehen Rechtsradikale, Neonazis, Antisemiten, Islamisten, Linksradikale, patriarchalische Autoritäten und Ultranationalisten. Auf der anderen Seite stehen Demokraten, Grundgesetzpatrioten – Menschen, die für Frieden, Menschenwürde und Freiheit einstehen.
Ich hoffe, dass die Beschäftigung mit den Inhalten dieses Buches dazu beiträgt, die Demokratie zu stärken und Antisemitismus zu reduzieren. Zum Abschluss möchte ich betonen, dass es mir – gerade vor dem Hintergrund meiner Biografie – eine riesige Ehre ist, das Vorwort für dieses Buch schreiben zu dürfen. Ich hoffe, dass meine Geschichte vielen Menschen als Beispiel dafür dient, dass es möglich ist, sich von extremistischen Ideologien zu befreien und antisemitische Vorurteile abzubauen. Wenn ich mich verändern konnte, können andere das auch!
Berlin, im Januar 2023
Vorworte
Vorwort 1988
Dieses Buch mag den deutschen, den jüdischen oder israelischen Leser bisweilen verletzen, es möchte ihn aber vor allem veranlassen, vertraute Vorstellungen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des deutsch-jüdisch-israelischen Verhältnisses zu prüfen und vielleicht zu ändern.
Innerhalb dieses Verhältnisses zeichnet sich durchaus Neues und Erfreuliches ab: eine Entwicklung, die – von Politikern und Ideologen noch nicht wahrgenommen – auf der Ebene des Alltagshandelns zu mehr Selbstverständlichkeit, zur Entkrampfung im Umgang miteinander führen kann. Dies bietet die Gelegenheit, alte Interpretationsmuster zu untersuchen und daraus für die Gestaltung der Zukunft zu lernen.
Das Sortiment der historisch-politischen Platten in Bezug auf deutsch-jüdisch-israelische Themen soll erweitert werden, damit nicht nur altbekannte neu aufgelegt werden.
Das zarte Pflänzchen des damals Neuen und Erfreulichen, die Möglichkeit einer Entkrampfung, hat sich nicht durchgesetzt, die alten Platten wurden weiter aufgelegt. Aus Überdruss und Trotz wendet sich das Publikum ab. Antijüdischer sowie antizionistischer Extremismus von rechts und links, nicht zuletzt auch islamischer Extremismus ist seit den 1990er-Jahren im Vormarsch. Nicht zu vergessen: Der »gute alte Rischess«, sprich: der diskriminatorische, nicht liquidatorische Antisemitismus der »Feinen Leute« (oder derer, die sich dafür halten), lebt. Wieder oder immer noch? Sichtbarer als zuvor jedenfalls. Ergo: Mehr Verkrampfung, allerdings mehrdimensional.
Die Gegenüberstellung von Deutschen und Juden ist ein Begriffskürzel, das zu Mißverständnissen führen könnte. Es wurde gewählt, um die sprachlichen Ungetüme »nichtjüdische Deutsche« und »jüdische Deutsche« zu vermeiden. Wie Kapitel X/2 allerdings zeigt, kennzeichnet für viele Juden, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, der begriffliche Gegensatz von Deutschen und Juden ihr Selbstverständnis.
Die üblichen deutsch-jüdisch-israelischen Rituale der Schuldzuweisung, -zurückweisung oder -bekenntnisse werden in diesem Buch nicht vollzogen. Aufgrund meiner jüdisch-israelischen Herkunft, der Gnade meiner Geburt, und meiner vornehmlich in der Bundesrepublik Deutschland gesammelten, positiven Lebenserfahrungen wegen habe ich diese Rituale nicht nötig. Meine Umwelt war stets sowohl jüdisch-israelisch als auch nichtjüdisch-bundesdeutsch. Ich kenne beide Seiten und kann weder die eine noch die andere nur preisen oder nur anklagen. Im Gegenteil, ich schätze beide Seiten, und die Ketten, die Deutsche, Juden und Israelis verbinden und gleichzeitig schmerzen, spüre auch ich, weil ich mit allen drei Seiten verbunden bin: den Deutschen, den Israelis und den Diasporajuden.
Ich bin etwas, das es seit 1933 kaum noch gibt: ein in Israel geborener deutsch-jüdischer Patriot, genauer: ein bundesdeutsch-jüdischer Patriot, zu dessen deutschem Wir-Gefühl die DDR oder die ehemals deutschen Ostgebiete nicht gehören. Ein deutsch-jüdischer Patriot ist im Grunde genommen ein wandelnder Anachronismus, und er gefällt weder den ganz Rechten noch den ganz Linken.
Das Bindestrich-Adjektiv »kosmopolitisch-westlich« und »Israel stark verbunden« hätte ich schon damals hinzufügen und bei »deutsch-jüdische« auf den Bindestrich verzichten sollen, um die die Unauflöslichkeit beider in mir hinzuweisen: Also: »Ein in Israel geborener, mit Israel stark verbundener, kosmopolitisch-westlich deutschjüdischer Patriot«. Zugegeben: Sperrig, aber genauer. Da die meisten Menschen in Schubladen denken und Vereinfachungen lieben, müssen bedauerlicherweise mehrere gleichzeitig geöffnet werden. Gegensteuern tut not.
Konzentrieren wollen wir uns auf die Entwicklung der bundesdeutsch-israelischen Beziehungen seit der Errichtung dieser beiden fast gleich jungen Staaten. Am 14. Mai 1948 verkündete David Ben-Gurion die Unabhängigkeit Israels. Durch die Anwendung des jüdischen Mondkalenders fiel der vierzigste Jahrestag auf den 21. April 1988; Anlaß genug, nicht nur die Aufbauarbeit des jüdischen Staates zu würdigen, sondern auch die Höhen und Tiefen zwischen Bonn und Jerusalem zu skizzieren. Glück gehabt, 1988. Einen Tag nach »Führers Geburtstag«. Auch wenn zufällig, lohnt es, über mögliche Inhalte der Zahlensymbolik nachzudenken. Eine in die Einzelheiten gehende Darstellung der deutsch-israelisch-jüdischen Beziehungen ist hier nicht beabsichtigt; vielmehr sei der Versuch unternommen, zeithistorisch-politische Skizzen mit Essays zu verbinden, einen Interpretationsrahmen zu liefern.
Wir betrachten den Wald, weniger die Bäume. Freilich setzt die Beschreibung des Waldes genaue Kenntnisse der Bäume voraus, und diese Kenntnisse glaube und hoffe ich durch jahrelange Studien der Quellen und des Themas erworben zu haben.
Ermöglicht wurde diese Arbeit vor allem durch die großzügige Förderung meines Forschungsvorhabens »Deutsch-Israelische Beziehungen« durch die »Stiftung Volkswagenwerk«.
Eine quellengesättigte, in die Einzelheiten gehende und vornehmlich für die interessierte Fachwelt bestimmte Gesamtdarstellung des Themas ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, wissenschaftliche Einzelstudien liegen bereits vor. In den Literaturhinweisen sind diese Veröffentlichungen erwähnt.
München, im Februar 1988
Vorwort zur fünften Auflage 1993
EWIGE SCHULD? ist in Bezug auf das Wir-Gefühl ein Buch der alten Bundesrepublik Deutschland – wie sie bis zum Fall der Mauer bestand. Das gilt auch für die Mauer in meinem eigenen Kopf. Wer allgemein für die Selbstbestimmung ist, kann und darf sie den Deutschen nicht verweigern. Deshalb gehören inzwischen auch die Neuen Bundesländer zu meinem deutsch-jüdisch-patriotischen Wir-Gefühl, wenngleich die politische Geografie Neudeutschlands uns manche Unerfreulichkeit beschert hat. Jeder weiß: Dort spukt noch mehr Altdeutsches als in der Alt-BRD. Vorsicht, die Statistik zeigt Allgemeines auf der Makroebene, auf der Mikroebene verbietet sich jede Verallgemeinerung.
In EWIGE SCHULD? werden allgemeine Grundgegebenheiten (»Strukturen«) geschildert, die auch heute noch weitgehend gelten. Sie sind auf alle Fälle noch wirksam, denn Strukturen können nicht von heute auf morgen verändert werden.
Ergänzen ließen sich viele Ereignisse und Entwicklungen seit 1988. Weil aber 1988 zugleich das Ende der altbundesdeutschen Epoche war, soll EWIGE SCHULD? als Buch jener Epoche wiedererscheinen. Die Ausstrahlungen in die Zeit nach der Vereinigung mag jeder selbst prüfen.
München, im Januar 1993
Vorwort 2023 zur (selbst)kritisch-aktualisierten Neuauflage nach 35 Jahren
Selbstverliebte Selbstbespiegelung oder Selbstkritik? Diese Frage stellt sich, wenn man die Chuzpe besitzt, das eigene, erstmals vor 35 Jahren veröffentlichte Buch der Öffentlichkeit erneut zuzumuten. Zu meiner Rechtfertigung: Nicht ich selbst habe die Idee hierzu ausgebrütet. Freunde und Verleger haben mich seit 1988 wiederholt gefragt, ob ich »ein Buch wie EWIGE SCHULD heute genauso schriebe wie damals«. Pauschal konnte, kann und will ich diese Frage nicht beantworten. Nur im Detail. Deshalb diese aktualisierte Neuauflage. Vorsicht, Ironie: Besonders freundlich und hartnäckig hat mich hierzu Michael Fleissner ermuntert und ermutigt. Ihn trifft daher diese, wie ich finde, verzeihliche »Schuld«, während ich »meine Hände in Unschuld wasche«.
Aus zwei Gründen wage ich mit dem deutsch-jüdisch-israelischen Thema den neuerlichen Schritt in die buchlesende Öffentlichkeit. Mich reizt Selbstkritik, sie schreckt mich nicht ab. Sie zeigt einem nämlich, bar jeder auch sich täuschenden Taktik, ob, wo, wie und warum man sein Denken und Fühlen verändert hat.
Jenseits dieser Privatangelegenheit, des sowohl persönlichen als auch wissenschaftlich rationalen Abenteuers, ist das deutsch-jüdisch-israelische Thema eine immer noch und immer wieder und vielleicht mehr denn je umstrittene und polarisierende res publica, also eine öffentliche Angelegenheit. Ein Seismograph.
Die geneigten Leser mögen mir deshalb dieses Buch verzeihen. Vielleicht, hoffentlich, verbessert es sogar hier und dort etwas. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, wenngleich (bei mir) Ernüchterung (altersbedingt?) vorherrscht. Mein früherer Optimismus ist verflogen. Weniger altersbedingt, behaupte ich, als vielmehr durch die nüchterne Analyse von Demografie und Ideologie in der neudeutschen Gesellschaft.
Mea culpa 1. Ich gestehe (m)einen Fehler. Ich hätte seinerzeit vor allem die Belegstellen aus den bundesdeutschen, israelischen, US-amerikanischen, britischen und französischen Primärquellen zitieren sollen, verzichtete jedoch (wie auch jetzt) darauf, weil sich dieses Buch eben nicht nur an die Fachwelt im Elfenbeinturm richtet. Wer die Echtheit im Sinne von Belegbarkeit der hier getroffenen Tatsachenaussagen bezweifelt, kann die Primärquellen im Archiv der Heidelberger Hochschule für Jüdische Studien nachprüfen. Alle meine deutsch-jüdisch-israelische Themen betreffenden Unterlagen habe ich jenem Archiv überlassen. Um freundliche Hintergedanken zu entkräften: kostenlos.
Mea culpa 2: Noch eine zweite Schuld habe ich auf mich geladen. Den Begriff »Geschichtspolitik« habe ich in der ersten Auflage, 1988, ins deutsche Vokabular eingepflanzt. Mein von mir sehr und vielen anderen weniger geschätzter Bonner Kollege Konrad Repgen fand diesen Begriff ganz schrecklich. Er bat, ich möge ihn »zurücknehmen«. Zu spät, unmöglich und warum? Längst gehört »Geschichtspolitik« zum etablierten Wort»schatz« im neudeutschen Sprachraum. Das Eingepflanzte hat sich fortgepflanzt. Neugedachtes braucht und erbringt neue Begriffe. Vielleicht ist das meine »Ewige Schuld«?
München, im Januar 2023
Kapitel I. Ohne Hitler kein Israel? Zur historischen Einordnung der Staatsgründung
Ohne Hitler kein Israel! Ohne den Holocaust an den Juden gäbe es keinen Staat der Juden!« Immer wieder hört man diese Behauptung, und sogar der wahrlich unverdächtige Sebastian Haffner wiederholt sie in seinen »Anmerkungen zu Hitler« mehrfach; ja, der einstige Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Nahum Goldmann, verkündete nicht selten: »Ohne Auschwitz kein Israel!« Andere, gegen den altdeutsch-braunen Bazillus nicht Immunisierte, tragen diese These aus ganz anderen Gründen ebenfalls gerne vor.
Aber auch durch ständige Wiederholung wird die Behauptung nicht richtig, bleibt sie Legende. Der Mörder der Juden war nicht der Geburtshelfer des jüdischen Staates.
Doch nicht genug mit der einen Legende: Zu hören ist ebenfalls, daß es ohne die Rolle der einstigen Mandatsmacht über Palästina, also Großbritanniens, dann der Vereinigten Staaten von Amerika und auch der Sowjetunion »niemals« zur Gründung Israels am 14. Mai 1948 gekommen wäre. Eine merkwürdige Koalition scheint sich, diesen Legenden zufolge, zugunsten der Zionisten gebildet zu haben; eine Koalition, in der es kaum einer mit ihnen gut meinte, aber jeder offenbar gut machte: Hitler und Himmler, Chamberlain und Churchill, Attlee und Bevin, Roosevelt und Truman, nicht zuletzt Stalin. In der Tat, eine Groteske; eine Groteske, die Hitler einen Platz einräumt, der ihm weder historisch noch moralisch gebührt.
Über Hitlers Verhältnis zu den Juden erübrigt sich jedes Wort. Das im Sommer 1933 mit den Zionisten geschlossene »Transferabkommen«, das Juden die Ausreise nach Palästina gestattete, sollte ihm helfen, das »arische« deutsche Volk »judenrein« zu machen, das Judengeld als Preis der Auswanderung zu behalten, ohne sich durch tausendfache Judenmorde schon so früh sichtbar beschmutzen zu müssen. Hitler, auch das Auswärtige Amt und das Reichswirtschaftsministerium, erhofften sich außerdem ein Aufpolieren des deutschen Ansehens, das durch den am 1. April 1933 organisierten Boykott jüdischer Geschäfte gelitten hatte. Das bessere Deutschlandbild sollte gleichzeitig psychologische Exportbarrieren im Ausland abbauen. Überzeugt von der »Allmacht des Weltjudentums« wollte Hitler den im westlichen Ausland von Juden und Nichtjuden begonnenen Gegenboykott entschärfen.
Die Zionisten schlossen diesen Pakt mit dem Teufel aus zwei Gründen: Erstens sollte den verfolgten Juden und zweitens dem zionistischen Aufbauwerk in Palästina durch den nun gestatteten Kapitalimport der auswandernden Juden geholfen werden.
Das Abkommen, das bis 1937 recht gut und danach bis 1939 eher schlecht als recht funktionierte, blieb in den Reihen der zionistischen Bewegung stets umstritten. Bemerkenswerterweise wurde dieses Abkommen von den linken Mehrheitszionisten geschlossen, die schon damals von David Ben-Gurion geführt wurden. Die rechtszionistische Opposition der »Revisionisten« hat es von Anfang an kritisiert, jede Zusammenarbeit mit Hitler abgelehnt und einen Boykott des nationalsozialistischen Deutschland gefordert – eine bis in die 50er-Jahre folgenreiche Tatsache. Als nämlich die Regierung Ben-Gurions im Januar 1952 bereit war, mit dem Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, mit der Bundesrepublik Deutschland, über die Wiedergutmachung zu verhandeln, wurde ihm von Menachem Begin vorgeworfen, »wie damals« einen Pakt mit dem deutschen Teufel schließen zu wollen.
Das Transferabkommen des Jahres 1933 verhinderte nicht den Holocaust, die millionenfache Vernichtung von Juden, vor allem von osteuropäischen Juden, die stets weitaus mehr zionistische Begeisterung gezeigt hatten als ihre assimilierten Glaubensbrüder in Westeuropa und Amerika.
Genau hier stoßen wir ins Herz der »Ohne-Hitler-kein-Israel«-Legende: Der Holocaust, so heißt es, habe den Zionismus im Judentum überhaupt erst mehrheitsfähig gemacht, ihm den politischen Rechtfertigungsschub gebracht. Ohne den Holocaust wäre der Zionismus eine bekämpfte Minderheit innerhalb der jüdischen Gemeinschaften der Diaspora geblieben. Der Holocaust, so schrecklich er für die Opfer gewesen sei, habe den Überlebenden, vor allem den Zionisten, geholfen; die zionistische Führung um Ben-Gurion hätte den Holocaust zunächst verschwiegen, als er spätestens im November 1942 in Palästina sowie im westlichen Ausland bekannt war, nichts gegen ihn unternommen, um diese Katastrophe als Beleg für die Richtigkeit zionistischer Warnungen vor den Gefahren des Antisemitismus propagandistisch ausnutzen zu können, heißt es weiter. Hierüber brach Mitte der 80er-Jahre in Israel ein heftiger »Historikerstreit« aus. Die tatsächlichen und vermeintlichen Funktionen des Holocaust in der israelischen und jüdischen Geschichtspolitik werden wir im dritten Kapitel ausführlicher erörtern.
Doch sollten die zionistischen Politiker tatsächlich nicht nur so zynisch, sondern auch so dumm gewesen sein, einfach zuzusehen, wie ihr größtes »Menschenreservoir«, die »Ostjuden«, vernichtet wurde, um dann mit den überlebenden westlichen Juden einen zionistisch verwässerten Staat aufzubauen? Die zionistische Führung in Palästina stammte zudem, wie Ben-Gurion, selbst aus Osteuropa, hatte dort Verwandte und Freunde. Weder politisch noch menschlich sind die Vorwürfe Ben-Gurion und seinen zionistischen Mitstreitern gegenüber stichhaltig.
Hier und da gab es unmittelbar nach der »Machtergreifung« Zionisten, auch deutsche, wie zum Beispiel Kurt Blumenfeld, der im April 1933 meinte, daß durch die antisemitische Politik des nationalsozialistischen Regimes die sonst dem Zionismus gegenüber eher distanzierten deutschen Glaubensbrüder für die jüdische Nationalbewegung gewonnen werden könnten. Er sah seinen Irrtum bald danach ein, erkannte, daß der Nationalsozialismus kein Instrument für, sondern letztlich nur gegen Juden sei, Zionisten wie Nichtzionisten.
Der deutsche Nationalsozialismus wurde im Allgemeinen schon sehr bald von der zionistischen Rechten und Linken als das erkannt, was er tatsächlich war: eine für Juden höchst gefährliche Bedrohung. Wie tödlich diese Bedrohung war, wurde tatsächlich vergleichsweise spät und zögernd, in der Breite Ende 1942, erkannt.
Nach dem Holocaust hätte die Welt zur Gründung eines jüdischen Staates nicht mehr »nein« sagen können, behauptet die Legende weiter. Tatsache ist, daß die Welt auch nach 1945 zunächst durchaus noch »nein« gesagt hat. Vor allem Großbritannien, die Mandatsmacht in Palästina, sagte »nein«. Mehr noch: Sie hielt die Tore Palästinas für die einwanderungswilligen Juden, Überlebende des Holocaust, verschlossen, um sich das Wohlwollen der Araber zu erhalten und um in Palästina später einen arabischen Staat zu gründen, keinen jüdischen.
Zu seiner Rechtfertigung und als Beweis seiner Notwendigkeit benötigte der Zionismus den Holocaust jedenfalls nicht, denn schon seit den Zeiten der Propheten war das jüdische Geschichtsverständnis von der Annahme bestimmt, Diaspora und Judenverfolgungen seien zwei Seiten derselben Medaille, die Geschichte der Juden sei die Geschichte ihrer Verfolgungen. So gesehen ist das Problem der Einzigartigkeit des Holocaust, ist der »Historikerstreit« in Deutschland, für einen traditionsbewußten Juden ebenso unjüdisch wie »unhistorisch«. Für ihn ist der Holocaust ein keineswegs einzigartiger Teil der langen Leidensgeschichte seines Volkes.
Die Grundannahme des Zionismus, daß es immer und überall Judenverfolgungen gäbe, bedeutete daher lediglich eine im späten neunzehnten Jahrhundert entwickelte, modern-verweltlichte Variante des jahrtausendealten jüdischen Welt- und Geschichtsbildes. Sie war zwischen den sonst keineswegs einigen weltlich orientierten Zionisten und den jüdisch-religiösen Traditionalisten auch nicht umstritten. Umstritten waren – und blieben auch nach dem Holocaust – die Schlußfolgerungen, die Juden aus dieser Tatsache zogen: Nur die Minderheit, ob religiös oder nicht, wollte – und will – wegen der Judenverfolgungen in den jüdischen Staat ziehen. Die meisten nichtreligiösen, assimilierten Juden hielten den Antisemitismus nicht für lebensgefährlich und wollten keinen jüdischen Staat; weder als inhaltliche noch örtliche Alternative. Die religiösen bekämpften den Zionismus, weil er in »Gottes Werk«, das heißt in die Geschichte der Juden, also in die Heilsgeschichte, eingriffe.
Die Legende »Ohne Hitler kein Israel« übersieht zudem die grundlegende Tatsache, daß der Zionismus schon vor Hitler in Palästina durchaus aktiv war und seit 1929 immer stärker wurde. Gewiß, der große Einwanderungsstrom setzte erst 1933 ein, doch es kamen damals weit mehr polnische als deutsche Juden. Von den rund 217 000 jüdischen Einwanderern, die zwischen 1932 und 1938 in Palästina eintrafen, stammten 47 Prozent aus Polen und nur 18 Prozent aus Deutschland. Die Juden Polens waren seit der wiedererlangten Unabhängigkeit ihrer Heimat ständigen Drangsalierungen ausgesetzt; man machte sie für die zahlreichen Schwierigkeiten des alt-neuen Staates mitverantwortlich. Viele Juden flohen nach Palästina, weil seit Anfang der 20er-Jahre die Tore der USA verschlossen waren.
Wichtiger noch: Diesen polnischen Juden, von denen viele mit den oppositionellen Rechtszionisten, den »Revisionisten« Jabotinskys, sympathisierten oder ab 1937 dessen militärischem Arm »Etzel« angehörten, stand schon in den beiden Jahrzehnten vor dem Holocaust das Wasser bis zum Hals. Die antijüdische Militanz in Polen nahm ständig zu und schuf damit bei vielen Juden die innere Bereitschaft, selbst gewalttätiger zu werden. Die jüdischen Einwanderer aus Polen waren entschlossen, in Palästina mehr als nur eine jüdische »Heimstätte« (wie von den Engländern 1917 versprochen) oder ein jüdisches »Gemeinwesen« aufzubauen (was die stets gemäßigteren Mehrheitszionisten erst 1942 forderten). Sie strebten einen jüdischen Staat an; mit allen Mitteln, auch mit offensiver Gewalt. Die politisch-militärische Infrastruktur der kleinen jüdischen Gemeinschaft, die bereits vor Hitler in Palästina lebte oder die ohne sein Zutun ins Land eingewandert war, verfolgte dieses Ziel unbeirrt. Unter der Führung Menachem Begins schlug die Stunde der Ungeduldigen und Militanteren 1944 in der »Rebellion« gegen die britische Mandatsmacht.
Wenn man außerdem die Entstehung des israelischen Staates in den welthistorischen Zusammenhang der Entkolonialisierung teilt, vermag man kaum einzusehen, weswegen gerade diese hochmoderne, zu allem entschlossene zionistische Gemeinschaft »ohne Hitler« weniger Bereitschaft zum Kampf um ihre Unabhängigkeit gezeigt haben sollte als die Bevölkerung vieler Kolonien.
Man könnte dieser These entgegenhalten, daß es »ohne Hitler«, also ohne den von ihm ausgelösten Zweiten Weltkrieg, keine Entkolonialisierung und daher auch keinen jüdischen Staat gegeben hätte. Diese Gegenthese übersieht freilich, daß die Entkolonialisierung lange vor Hitler begonnen hatte. Man könnte sie mit der Unabhängigkeit der USA im Jahre 1776 beginnen lassen oder mit der Selbständigkeit der lateinamerikanischen Kolonien im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts. Ein Beispiel für diese Entwicklung im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert ist die wichtigste Kolonie Großbritanniens, Indien, wo sich die Kongreßpartei 1885 formierte. Die Zionistische Weltorganisation wurde annähernd gleichzeitig – 1897 – gegründet, nachdem 1882 bereits eine wenngleich sehr begrenzte Zahl von jüdischen Pionieren nach Palästina gekommen war. Den Zweiten Weltkrieg (und Hitler) können wir deshalb nur als unfreiwilligen »großen Beschleuniger« einer Entwicklung bezeichnen, die schon längst begonnen hatte.
Gegen die Umwandlung Palästinas in die 1917 versprochene jüdische Heimstätte stemmte sich die britische Mandatsmacht in den späten 30er-Jahren immer mehr; dagegen organisierten die zionistischen Gruppierungen den politischen und militärischen Widerstand. Dies bedeutet: Der antibritische Kampf der Zionisten um die Unabhängigkeit wurde durch den Holocaust unterbrochen, nicht aber gefördert.
1944, als sich der Sieg der Alliierten über Hitler, doch keine Kurskorrektur der proarabischen Politik Großbritanniens abzeichnete, verkündete Menachem Begins »Etzel« die »Rebellion« gegen die britische Mandatsmacht. Für einen eher politisch-diplomatischen, doch notfalls auch gewaltsamen Kampf gegen Großbritannien entschied sich Ben-Gurion, der in dieser Auseinandersetzung auf die USA setzte.
Bis 1947 hatten die Gründer Israels schließlich die Briten aus Palästina im wahrsten Sinne des Wortes hinausgebombt, dabei jedoch weitgehend nur militärische Ziele und Soldaten angegriffen, keine Zivilisten. Im Februar 1947 warf die britische Regierung das Handtuch und übergab das von ihr nicht gelöste Problem den Vereinten Nationen.
Die UNO-Vollversammlung stimmte dann am 29. November 1947 für die Teilung Palästinas in je einen jüdischen und einen arabischen Staat.
Wie so oft in der Geschichte Israels rankt sich auch um diese Entscheidung eine Legende: die Legende vom Gewicht dieser Abstimmung, bei der das schlechte Gewissen der meisten Staaten gewiß eine Rolle gespielt haben dürfte. Sie wußten, wie wenig sie seinerzeit zur Rettung der vom Nationalsozialismus bedrohten Juden getan hatten. Die Abstimmung in der UNO-Vollversammlung hat die Gründung Israels jedoch lediglich völkerrechtlich legitimiert. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß der jüdische Staat eher früher als später auch ohne die UNO errichtet worden wäre. Die tatsächliche Entscheidung war in Palästina gefallen, als die Engländer aufgaben, das heißt im Februar 1947.
Und wie verhielten sich die USA, auf die Israels Staatsgründer Ben-Gurion setzte? Auch sie hatten den Holocaust an den Juden nicht ohne moralische Blessuren, zumindest nicht ohne Kratzer, überstanden. Geradezu einladend hatte man sich gegenüber jüdischen Flüchtlingen aus dem Machtbereich der Nationalsozialisten ebenfalls nicht verhalten. Besonders erschütternd war die Zurückweisung des mit deutschen Juden vollbesetzten Schiffes »St. Louis« im Mai 1939. Als kein Staat bereit war, die Flüchtlinge aufzunehmen, kehrte die »St. Louis« nach Europa zurück, die Juden gingen nach Frankreich, Holland, Belgien und Großbritannien. Nur hier blieb ihnen der Weg in die Gaskammern nach 1940 erspart.
Das Drängen jüdischer und zionistischer Bittsteller, Auschwitz und die übrigen Vernichtungslager oder zumindest die Zufahrtswege zu diesem innersten Kreis der nationalsozialistischen Hölle zu bombardieren, war von der Roosevelt-Administration zurückgewiesen worden – mit keineswegs überzeugenden Argumenten. »Wiedergutmachung« in Form einer aktiven Unterstützung der Gründung eines jüdischen Staates wäre dennoch nicht unangebracht gewesen – wollte man moralisch »nach und wegen Hitler« argumentieren.
Darüber hinaus bestand in den USA eine aktive »zionistische Lobby«, und die regierende Demokratische Partei von Präsident Roosevelt, dann Truman, stützte sich seit den dreißiger Jahren nicht zuletzt auf das jüdische Wählerreservoir.
Trotzdem ließ die amerikanische Unterstützung aus der Sicht der Zionisten zu wünschen übrig. Der angeblich von jüdischen Wählerstimmen so abhängige Präsident Roosevelt hatte noch kurz vor seinem Tode, im Februar 1945, dem saudi-arabischen König Ibn Saud gegenüber viel Verständnis für die Haltung der Araber in Palästina bekundet. Ohne die Araber zu befragen, versprach er, würde seine Regierung nichts in Bezug auf Palästina unternehmen. Saudi-Arabien war nämlich die erste wirkliche politisch-wirtschaftliche Bastion der USA im Nahen Osten – und die wollte der US-Präsident ausbauen.
Roosevelts Nachfolger Truman wollte sich zunächst nicht in der Palästina-Frage mit der englischen Regierung anlegen, tat es dann aber doch, als Umfragen ein ungünstiges Abschneiden der Demokraten bei den Kongreßwahlen des Jahres 1946 vorhersagten. Trumans prozionistische Wende vom Oktober 1946 – er verlangte von der britischen Regierung, für einhunderttausend Juden unverzüglich die Einwanderungssperre nach Palästina aufzuheben – sowie seine Befürwortung der Teilung Palästinas und der damit verbundenen Errichtung eines jüdischen Staates blieb im Weißen Haus keineswegs unumstritten; das State Department sowie das Pentagon lehnten sie ab, ja, bekämpften sie. Erfolgreich waren diese beiden Ministerien, als sie Ende 1947 ein amerikanisches Waffenembargo über den Nahen Osten erzwangen, das in erster Linie Israel traf. Sie konnten sich im Frühjahr 1948 erneut durchsetzen, als die Truman-Administration ihre im November getroffene Entscheidung zugunsten der Teilung Palästinas zurücknahm und für eine UNO-Treuhandschaft in diesem Gebiet eintrat. Aber Ben-Gurion und seine Anhänger waren entschlossen, die Unabhängigkeit Israels sofort nach dem Rückzug der Briten, am 14. Mai 1948, zu verkünden. Lediglich das US-Waffenembargo traf die Israelis hart.
Indes, ein anderer Lieferant bot sich an: die Sowjetunion. Mit ihren Waffen konnte Israel seine Existenz im Unabhängigkeitskrieg 1948/49 retten. Einen Tag nach der Unabhängigkeitserklärung, also am 15. Mai 1948, hatten die arabischen Nachbarstaaten Israels versucht, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und den jüdischen Staat zu zerstören.
Seit dem Frühjahr 1947 war die prozionistische, später proisraelische Politik der Sowjetunion erkennbar geworden. Sie überraschte viele – vor allem die Zionisten, die seit Jahrzehnten nur an härteste Kritik aus Moskau gewöhnt waren. Zionismus, so die traditionelle Lesart der Kommunistischen Partei der UdSSR, sei bürgerlich-reaktionär.
Begründet wurde die plötzliche prozionistische Politik der UdSSR unter anderem mit dem Holocaust: Nach allem, was den Juden von Hitler angetan worden sei, könne man ihnen den ersehnten Staat nicht mehr verweigern. Das klang schön und moralisch, verdeckte aber die tatsächlichen Motive.
Moskaus Wende war durch den sich anbahnenden Rückzug Londons aus Palästina bedingt. In das entstehende politische Vakuum hoffte die Sowjetunion eindringen zu können; dies blieb eine Fehlkalkulation, denn trotz ihrer mehrheitlich sozialistischen Weltanschauung lehnten es die Gründungsväter Israels ab, für Moskau die Funktion eines nahöstlichen Sprungbrettes zu übernehmen.
Die Israelpolitik hatte Stalin in eine heikle innenpolitische Situation manövriert, die er zunächst offenbar übersehen hatte: Hilfe für die jüdische Nationalbewegung im Nahen Osten und für den jungen jüdischen Staat entfachte bei den sowjetischen Juden Zionsbegeisterung und verstärkte 1947/48 die jüdisch-sowjetische Eigenidentität. Eine derartige nationale Wiedergeburt innerhalb einer »Volksgruppe« bedeutete Gefahr für das delikate Gleichgewicht der gesamten sowjetischen Nationalitätenpolitik.
Deshalb steuerte Stalin bereits im Winter 1948/49 gegen, indem er zionistische Aktivisten in der UdSSR verhaften ließ, was das sowjetisch-israelische Verhältnis trübte und seit Anfang der 50er-Jahre vergiftete. Im Februar 1953, kurz vor Stalins Tod, brach die Sowjetunion die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab.
Israel ist in erster Linie durch die politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und militärische Leistung seiner Gründer errichtet worden. Natürlich hatten sie dabei Partner, aber – und darauf kommt es an – diese Partner wechselten, waren nicht zuverlässig. Einer war freilich gewiß nicht ihr Partner, weder subjektiv noch objektiv: Adolf Hitler.
Dies zu behaupten, hieße den Verlauf der Geschichte umdrehen, denn schon vor dem Holocaust befand sich Israel auf dem Weg zur Staatsgründung. Die – ungewollte – Funktion einer solchen Geschichtsklitterung liegt darin, daß Hitler damit auf einem Teilgebiet entlastet wird; keineswegs nur von Ewig-Gestrigen, die ihren »Führer« reinwaschen wollen, sondern von völlig unverdächtigen Kronzeugen wie Nahum Goldmann, dem britischen Oberrabbiner Jakobovits oder Sebastian Haffner.
Ende der 70er und Anfang der 80er-Jahre wurde in der Bundesrepublik Deutschland die »Ohne-Hitler-kein-Israel«-Legende um eine bemerkenswerte Variante erweitert. Sie gilt als salonfähig, weil sie nicht zuletzt von Bundeskanzler Helmut Schmidt wiederholt vorgetragen wurde: Ohne Hitler kein Israel, wegen Israel das Flüchtlingsleid der Palästinenser und daher die indirekte deutsche Mitverantwortung am Los der Palästinenser und die Notwendigkeit einer zumindest politischen »Wiedergutmachung« Deutschlands an den Palästinensern durch die Befürwortung ihres Rechtes auf Selbstbestimmung und Staatlichkeit.
Über die Berechtigung dieses Rechtes wurde unter anderem 1981 zwischen Kanzler Schmidt und Ministerpräsident Begin gestritten. Nicht gestritten werden kann jedoch über die Tatsache, daß Deutschland am Leid der Palästinenser unschuldig ist und Israels Mitverantwortung an eben diesem Leid nicht mit der deutsch-jüdischen Geschichte zusammenhängt.
Die Anhänger dieser »indirekten Mitverantwortung« Deutschlands begeben sich mit diesem fragwürdigen historischen Rückgriff wissend oder unwissend auf schlüpfrigem Boden, der zur direkten Verantwortung zurückführt: Von 1936 bis 1943 arbeitete nämlich die Palästinensische Nationalbewegung unter Amin el-Husseini mit Adolf Hitler zusammen und bot Hilfe bei der »Endlösung« an. Damit machte sich Deutschland noch mehr und direkt an den Juden schuldig; von einer deutschen Schuld an den Palästinensern kann keine Rede sein. Die Palästinenser waren nicht Opfer, sondern Komplizen der Täter – aus politisch verständlichen Gründen, die ihre Schuld erklären, jedoch nicht tilgen.
Gemeinsam mit irakischen Nationalisten hatte Amin el-Husseini im Irak 1941 einen antibritischen, von Hitler-Deutschland unterstützten, Aufstand angezettelt, der niedergeschlagen wurde. Kurz danach rächten sich Einheimische durch ein Pogrom an irakischen Juden. Britische Soldaten standen Gewehr bei Fuß, um die Iraker nicht noch mehr zu »provozieren«. Husseini floh nach Deutschland. Im November 1941 wurde er von Hitler empfangen. Danach mobilisierte Husseini in Bosnien und Herzegowina Muslime für die Waffen-SS.
Auch mit arabischen Untergrundaktivisten, zum Beispiel den »Freien Offizieren« Ägyptens, wie Gamal Abdel Nasser, arbeitete Hitler-Deutschland von Anfang an bis zum Zusammenbruch von Rommels Afrikakorps 1942/43 im Zweiten Weltkrieg gegen die Briten zusammen. Nach 1945 fanden NS-Raketenspezialisten sowie hochgestellte Nationalsozialisten in Ägypten sowohl bis 1952 in der Monarchie als auch unter den NS-freien Offizieren, die sich 1952 an die Macht geputscht hatten, Unterschlupf. Wie zuvor sollten »die« Juden bekämpft werden, diesmal im jüdischen Staat. Ähnlich gastfreundlich war man auch in Syrien.
Diese ergänzenden Fakten sind für die sogenannte deutsche Erinnerungs»kultur« von größter Bedeutung. Die bisherige und inzwischen mehr denn je versteinte orientiert sich demografiehistorisch und -politisch irrigerweise an der Vorstellung, die heute in Deutschland Lebenden wären die direkten Nachfahren der damaligen Deutschen. Falsch, total falsch angesichts der Tatsache, dass heute rund ein Viertel aller Deutschen einen Migrationshintergrund aus der Zeit nach 1945 hat. Millionen stammen aus der islamischen Welt. Kaum jemand erwähnt jemals beim Gedenken an die NS-Verbrechen jene deutsch-islamischen Gemeinsamkeiten. Deshalb ist Muslimen in Deutschland nicht vorzuwerfen, wenn sie im Zusammenhang mit dem Dritten Reich »Geht mich nichts an« sagen. Wer in Deutschland »Gegen das Vergessen« wettert (und damit eigentlich »gegen das Verdrängen und Verherrlichen der NS-Megaverbrechen« meint), muss aufgrund jener historischen Verbindungen die Fakten erst einmal vermitteln, bevor sie »vergessen«, verdrängt oder gar verherrlicht werden könnten. Das geschieht bislang nicht. Kein Wunder, dass deutsches Erinnern zunehmend kenntnislos wird. Von »Kultur« ganz zu schweigen.
Meine Literaturempfehlung hierzu: Dan Diners 2021 erschienene Studie über »Das jüdische Palästina im Zweiten Weltkrieg«. Er ist, soweit ich sehe, der einzige Autor, der, wie hier skizziert, die universalhistorischen Zusammenhänge dieses Teilthemas erkennt und vor allem im Schlusskapitel, auf den Seiten 292f., benennt. Der finale Satz: Die jüdischen »Überlebenden und Flüchtlinge, dem politischen Zionismus meist fremd oder agnostisch eingestellt, waren nach dem Geschehen des Holocaust allein von dem Wunsch beseelt, unter Juden zu leben«.
Fazit: Ja, auch ohne Hitler beziehungsweise »Endlösung der Judenfrage« gäbe es, welthistorisch betrachtet, Israel als jüdische Wiedergeburt. Ja, ohne Zionismus kein Israel, doch glühende Zionisten waren nur Israels Staatsgründer, nicht die Mehrheit der Staatsbürger. Zionismus musste (und wurde) ihnen, so der selbstironische hebräisch-israelische Ausdruck, in den ersten Jahrzehnten der Staatsexistenz »eingehämmert«. Der Idealismus des Zionismus hatte Konjunktur. Bis 1973/74, also bis zum Jom-Kippur-Krieg und dessen Nachwehen. Dem Idealismus folgte der Hedonismus, besonders in der urbanen Metropolregion Tel Aviv.
Kapitel II. Etappen deutsch-jüdisch-israelischer Geschichtspolitik
Israels Existenz ist ein Störfaktor der deutschen Außenpolitik, der deutschen Politik schlechthin. Sie konfrontiert nämlich die Deutschen nicht nur mit ihrer nationalen, sondern vor allem mit ihrer nationalsozialistischen Geschichte. Normale, das heißt pragmatisch bestimmte staatliche Interessenpolitik wird im Heute durch das gegenwärtige, nicht vergehende Gestern erschwert, manchmal sogar unmöglich.
Die Politik von Staaten unterscheidet sich auch hinsichtlich ihrer Beziehung zur eigenen Vergangenheit: Sie kann versuchen, die Geschichte nicht zu beachten und sich an den Interessen der eigenen Gegenwart orientieren – wir nennen das im folgenden Tagespolitik; sie kann aber auch ihre geschichtliche Erfahrung ihrem Handeln voraussetzen, sich mit diesem Handeln auf die eigene Geschichte beziehen – wir sprechen dann von Geschichtspolitik. Diese Beziehung auf die Geschichte wird innen- und außenpolitisch wirksam, sie bestimmt die Selbstdarstellung und Identität eines Staates sowie seiner Bürger wesentlich mit.
Obwohl die NS-deutsche Schuldgeschichte inzwischen weiter zurückliegt, hat diese Aussage an Aktualität und Allgemeingültigkeit nichts verloren – sofern man »Israel« durch »die politisch-instrumentellen Nachwirkungen des NS-Regimes auf Bundesdeutschland« ersetzt. Man denke an die wiederholten Reparationsforderungen an Deutschland aus Griechenland oder Polen, die Diskussion über Raubkunst, »Cancel Culture« (Kultur?) und viele, viele andere Beispiele. Wenn Druck auf Deutschland ausgeübt werden soll, bleiben »Hitler-Oberlippen-Bürsten« auf dem Gesicht deutscher Kanzler (männlich ebenso wie weiblich) besonders beliebt. Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, dass es in der jüdischen Welt solche Geschmacklosigkeiten längst nicht mehr gibt. Umgekehrt und bezogen auf Israel sind im neuen Deutschland NS-Vergleiche weit oben auf der Hitliste. Populär ist diese Aussage: »Die israelische Armee benimmt sich im besetzten Westjordanland wie einst Hitlers Wehrmacht.« Es lebe der Unterschied. Wer hört da nicht den christlichen Patriarchen von Jerusalem aus Lessings »Nathan der Weise«? »Tut nichts! Der Jude wird verbrannt.«
Ausgerechnet Israel gegenüber hat sich die deutsche Außenpolitik – abgesehen von Betroffenheitsvokabular und Kranzniederlegungen in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Jad Waschem dieses Störfaktors weitgehend entledigt. Nicht zuletzt die deutsche Beteiligung an antiisraelischen UN-Abstimmungen bezeugt diese Entwicklung.
1. Wiedergutmachung, 1949–1953/55
In den ersten Jahren bundesdeutscher Existenz war diese Begegnung mit der Vergangenheit durch Entschädigung und Wiedergutmachung finanzpolitisch eine Bürde, doch außenpolitisch verlieh sie dem neuen (West-)Deutschland Würde. Das Ansehen der jungen Republik und ihres Kanzlers stieg nicht zuletzt deswegen, weil die Wiedergutmachung freiwillig und ohne amerikanischen Druck geleistet wurde.
Die US-Drucklosigkeit hatte ich auch in diversen wissenschaftlichen Aufsätzen dokumentiert. Unverdrossen versuchten Kollegen, den Gegenbeweis anzutreten. Bis heute sehe ich keinen überzeugenden. Es bleibt dabei: Spätestens seit Ausbruch des Koreakrieges hatten die USA zwar nichts gegen bundesdeutsche Wiedergutmachung an Juden und Israel, aber die (Wieder-)Bewaffnung (West-)Deutschlands war ihnen weltpolitisch, strategisch erheblich wichtiger. Realpolitik versus Moralpolitik. Jene obsiegte. So ist das Leben, der Mensch.
Die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die feine Gesellschaft der westlichen Staaten in den 50er-Jahren war eine Folge des Kalten Krieges, nicht das Ergebnis der Wiedergutmachung an Israel und den Juden. Obwohl also keine Eintrittskarte, erleichterte die Bereitschaft zur Sühne diesen Eintritt zumindest atmosphärisch.
Die Bundesrepublik Deutschland betrat den Salon der internationalen Gemeinschaft keineswegs im gebückten Gang oder im Büßergewand. Betrachten wir den geschichts- und israelpolitischen Aspekt ihres Eintritts kurz: Im Januar und März 1951 hatte die israelische Regierung die vier Siegermächte wissen lassen, daß sie von Deutschland, West ebenso wie Ost, materielle Wiedergutmachung verlange. Direkte Verhandlungen mit den Deutschen lehnte sie ab. Die Sowjetunion reagierte offiziell gar nicht, und die Westmächte verwiesen Jerusalem auf Bonn, das erst aufgewertet und dann aufgerüstet werden sollte; eine geschichtspolitische Provokation des Westens Israel gegenüber. Auch in den folgenden zwei Jahren, bis zur Ratifizierung des Wiedergutmachungsabkommens durch den Bundestag am 18. März 1953, konnte die Bundesregierung erhobenen Hauptes den Israelis und Diasporajuden entgegentreten, denn Interesse und Einsatz der westlichen Regierungen, der Medien und der Öffentlichkeit blieben vor, während und nach den schwierigen Verhandlungen äußerst gering. Vor und nach dem Israel-Vertrag war Westdeutschlands Ansehen so gut, benötigte der Westen das neue Deutschland so sehr, daß es der Wiedergutmachung nicht bedurfte, um gesellschaftsfähig zu werden. Geschichtslegenden, genährt von einer seltsamen Koalition aus deutschen und arabischen Gegnern der Wiedergutmachung sowie israelischen und einigen diasporajüdischen Historikern, behaupten das Gegenteil: Ihnen zufolge hätten besonders die USA Druck auf Bonn ausgeübt. Doch davon kann keine Rede sein. Washington wußte, daß Westdeutschlands Wiederbewaffnung und die Wiedergutmachung viel Geld kosten würden; Geld, das Bonn möglicherweise nicht aufbringen könnte und das die USA schließlich zahlen müssten. Das wollten die Amerikaner verhindern. Wiederbewaffnung und Wiedergutmachung, schien es, waren nicht möglich; die Wiederbewaffnung hielten die USA für wichtiger und deswegen bremsten sie das israelisch-jüdische Wiedergutmachungsdrängen.
Um das für den Aufbau des Staates dringend benötigte Geld trotzdem zu erhalten, mußte Jerusalem dem Willen der Westmächte entsprechen und sich direkt an Bonn wenden.