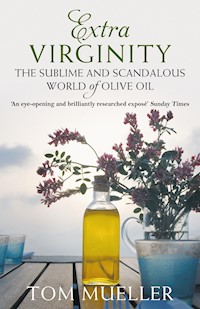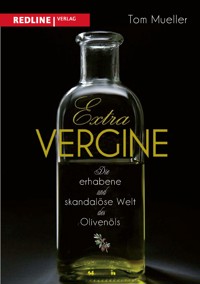
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Olivenöl ist mehr als eine Zutat im Salat, Olivenöl ist Kult in unserer Küche. Bei kaum einem anderen Lebensmittel achten wir so sehr auf erlesene Qualität, Aroma und Herkunft. Doch ob ihr nobles kalt gepresstes Olivenöl aus dem Supermarkt für 3,99 Euro wirklich so jungfräulich ist, wie auf dem Etikett versprochen, und ob es wirklich von glücklichen italienischen Müttern gepflückt und produziert wurde, ist mehr als fraglich. Von wegen »Extra Vergine« und kalt gepresst: Etikettenschwindel ist keine Seltenheit. Nicht selten wird das Vertrauen der Verbraucher skrupellos missbraucht. Mit dieser und vielen anderen Wahrheiten konfrontiert uns der Olivenöl-Experte und Journalist Tom Mueller in diesem Buch. Er erzählt darin die Geschichte des Anbaus und Handels in den verschiedenen Regionen und deckt die Intrigen, Skandale und Mauscheleien auf, die inzwischen die Olivenölproduktion bestimmen. Mueller kennt die Akteure und Profiteure dieser Branche: auf der einen Seite Unternehmen und Konzerne, bei denen Menge über alles geht, auch über Qualität, und auf der anderen Seite die engagierten Kleinbauern, Lebensmittelkontrolleure und Food-Aktivisten, die für ein außergewöhnliches Öl kämpfen, welches das Gütesiegel »Extra Vergine« wirklich verdient. Tom Mueller räumt mit vielen Mythen auf, die sich um das Olivenöl ranken. Dennoch: Es gibt es noch, das qualitativ hochwertige Öl – und Mueller verrät uns, woran man es erkennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2012
© 2012 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Copyright der Originalausgabe © 2012 by Tom Mueller. All rights reserved.
Die englische Originalausgabe erschien 2012 bei W.W. Norton & Company Inc, New York unter dem Titel Extra Virginity.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Petra Pyka, Rednitzhembach
Redaktion: Matthias Michel, Wiesbaden
Umschlagabbildung: Simon Lee, www.simonlee-photography.com
Satz: Carsten Klein, München
Epub: Grafikstudio Foerster, Belgern
ISBN Epub 978-3-86414-288-8
Weitere Informationen zum Verlag finden sie unter
www.redline-verlag.de
•
Doch sobald ein Bewohner der Mittelmeerküsten
diese Heimat verläßt, beginnt er zu klagen und wird unruhig.
So erging es den makedonischen Soldaten Alexanders des Großen,
als sie über Syrien hinaus gegen den Euphrat marschierten,
oder auch den Spaniern des 16. Jahrhunderts,
die in den Niederlanden unter den »nordischen Nebeln« litten.
Für Alonso Vázquez und die Spanier seiner Zeit
(zweifellos für die Spanier aller Zeiten) ist Flandern ein Land,
in dem »kein Lavendel und kein Thymian wachsen,
keine Feigen, keine Oliven, keine Melonen und keine Mandeln;
… wo die Speisen, man sollte es kaum glauben,
mit Kuhbutter statt mit Öl angerichtet werden.«
Fernand Braudel, Das Mittelmeer und die
mediterrane Welt in der Epoche Philipps II.
•
Inhalt
Vorwort – Die reine Essenz
1. Oliven und das Leben
2. Die Ölbosse
3. Oliven – heilig und profan
4. Das liebliche Feuer
5. Industrielles Öl
6. Revolutionen in der Nahrungsmittelbranche
7. Die neuen Welten des Öls
Epilog – Die mythische Seite
Glossar
Anhang – So finden Sie ein gutes Öl
Dank
Über den Autor
Vorwort – Die reine Essenz
Als das Olivenöl die Temperatur von 28 Grad Celsius erreicht hatte, bei der seine Aromastoffe flüchtig werden, hoben die acht Verkoster die Deckel von den Gläsern mit der ersten Ölprobe, versenkten ihre Nasen darin und begannen – manche mit geschlossenen Augen – geräuschvoll zu schnuppern. Sie gehörten zur Prüfergruppe der Corporazione Mastri Oleari in Mailand – der Innung der Olivenmeister, einem der angesehensten privaten Olivenölverbände. Bei der Degustation saß jeder Prüfer für sich in einer Kabine aus weißem Formica, ausgestattet mit einem Spülbecken, einem Stift und einem Stapel Formulare für die Profilbeschreibung sowie einem Joghurtbereiter mit Thermostat, auf dem sechs tulpenförmige Probiergläser mit Ölproben standen. Die Gruppe war bunt gemischt – ein 33-jähriger Landwirt vom Gardasee, eine 47-jährige toskanische marchesa, sonst als private Motivationstrainerin tätig, ein 66-jähriger Mailänder Geschäftsmann. Die ersten Prüfer waren gegen neun Uhr eingetrudelt – unüberhörbar frustriert, weil sie sich den Kaffee und die Morgenzigarette verkneifen mussten. Diese Genüsse sind vor der Degustation verboten, weil sie die Sinneswahrnehmungen verfälschen. Inzwischen saßen die Tester schweigend in ihren Kabinen und wirkten voll konzentriert und versunken, wie Chemiker im Labor oder Professoren in der Bibliothek. Auf den Regalen ringsum an den Wänden standen hunderte Flaschen Olivenöl und daneben sechzehn braune Laborflaschen, die fein säuberlich mit weißen Etiketten versehen waren und Aufschriften trugen wie »modrig-feucht«, »stichig«, »ranzig«, »wein-/essigartig«, »gurkig«, »schlammig« und weitere Adjektive, die unangenehme Geruchserlebnisse verhießen – die offiziellen Mängel von Olivenöl. Die Sinne der acht Prüfer waren darauf trainiert, schon die geringste Spur davon zu entdecken.
Die Verkoster probierten die sechs Öle nach einer strengen Verfahrensvorschrift, die – ebenso wie die Ausstattung des Degustationsraums – von italienischem und europäischem Recht vorgeschrieben war. Mit ihrer Hand umfingen sie die Gläser wie Cognacschwenker, damit das Öl warm blieb, berochen es ausgiebig und notierten jeden wahrgenommenen Dufteindruck. Sie nahmen einen Schluck Öl in den Mund und verfielen prompt der Reihe nach in eine Art Ölkrampf: Durch die Mundwinkel saugten sie heftig Luft an – eine Technik, die strippaggio genannt wird und die Geschmacksknospen mit einer Emulsion aus Öl und Speichel überzieht, sodass die Aromen des Öls in die Nasengänge hinaufziehen können. Nach den ersten heftigen Luftzügen wurden die strippaggi weicher, meditativer und individueller – keuchend, ja beinahe wehmütig bei der marchesa, tief und rasselnd bei dem Mailänder Geschäftsmann, fast als würde er mit Bittersalz gurgeln. Nachdem sie jedes Öl 10 bis 15 Minuten lang wiederholt verkostet und den Gaumen zwischendurch immer wieder mit Mineralwasser gespült hatten, hielten sie ihre Eindrücke von Geschmack, Aroma, Intensität, Beschaffenheit und anderen Merkmalen auf einem Bewertungsbogen fest.
Eineinhalb Stunden lang waren die Verkoster in ihren Kabinen zugange, schnupperten, schlürften und sinnierten über die Öle. Als die letzte Probe bewertet war, erhoben sie sich schließlich, streckten sich, als wären sie gerade aufgewacht, und versammelten sich um den Besprechungstisch in der Mitte des Raums. Dort sogen sie genussvoll an lang ersehnten Zigaretten und nippten an Kaffeetassen, während der Leiter des Gremiums, Alfredo Mancianti, die Profilbeschreibungen auswertete. »Die Verkoster selbst bewerten kein Öl«, erklärte mir der Mailänder Geschäftsmann Flavio Zaramella, seines Zeichens Vorsitzender von Mastri Oleari. »Sie geben nur ihre Eindrücke von den Proben wieder und quantifizieren diese. Die Wertung für das Öl nimmt der Leiter der Prüfergruppe vor, indem er die acht Einschätzungen mit Hilfe belastbarer statistischer Methoden zusammenführt.«
Als ich dem obersten Olivenmeister bei der Arbeit über die Schulter schaute, sah ich, dass die Urteile der acht Prüfer erstaunlich übereinstimmend ausgefallen waren. Sie beschrieben die Beschaffenheit und den Charakter jedes Öls sehr ähnlich und entdeckten dieselben hintergründigen Geschmacks- und Duftnoten darin – Artischocke, frisch gemähtes Gras, grüne Tomaten, Kiwi.
»Das Tonda Iblea aus Südsizilien fiel durch Artischocke und grüne Tomate im Abgang auf«, erklärte Zaramella seinen Kollegen. »Aber das beste, körperreichste Öl war insgesamt wohl Marcinase DOP Terra di Bari aus Apulien, denke ich.« Die anderen nickten beifällig. Eine Dame merkte allerdings an, dass sie das Villa Magra Gran Cru aus der Toskana bevorzuge, weil es ausgewogener und harmonischer sei.
Ich konnte mich kaum zurückhalten. Artischocke? Frisch geschnittenes Gras? Bei aller Liebe, hier ging es doch nicht um erlesene Weine aus dem Bordeaux, sondern um flüssiges Fett. Zweifelsohne waren diese Öle mit großem handwerklichem Geschick hergestellt worden, »kaltgepresst« und all das – aber Artischocke? Grüne Tomate? Kiwi?
Meine Skepsis stand mir offenbar ins Gesicht geschrieben. Zaramella drückte seine Zigarette aus, sprang auf, packte mich am Arm und bugsierte mich in eine der Probierkabinen. »Was über so ein Öl gesagt wird, hört sich komplett hirnrissig an, bis man erstmals ein richtig gutes Öl im Mund gehabt hat«, meinte er. Dann goss er Ölproben in tulpenförmige Gläser und setzte sie zum Erwärmen neben mir auf das Gerät. Dabei deckte er sie mit dünnen Glasdeckeln ab, damit die Aromen nicht entweichen konnten. Als das Licht am Thermostat ausging und damit anzeigte, dass das Öl die gewünschte Temperatur von 28 Grad Celsius erreicht hatte, weihte mich Zaramella in das anerkannte Verfahren zur Prüfung von Olivenöl ein: Er zeigte mir, wie man eine Probe mehrmals intensiv beroch und versuchte, zwischen den Atemzügen den Kopf freizubekommen, wie man einen kleinen Schluck nahm und mit der Zunge im Mund herumrollen ließ, um die Mundschleimhaut zu benetzen, und wie man das geräuschvolle Schlürfen des strippaggio bewerkstelligte. Immer wieder wies er mich an, meinen Gaumen zwischendurch mit Mineralwasser oder durch einen Bissen Granny Smith zu reinigen.
In der nächsten Stunde wagte ich unter Zaramellas Anleitung meinen ersten zaghaften Vorstoß auf das weite, weitgehend unkartierte Feld des Olivenöls der Güteklasse »nativ extra« – wie ein Anfänger, der von einem Meister seines Fachs die erste Ballett-, Yoga- oder Geigenstunde bekommt. Ich erfuhr, dass Öle aus verschiedenen Olivensorten oder Oliven derselben Sorte, die an verschiedenen Standorten angebaut worden waren, genau so unterschiedlich sind wie Wein aus verschiedenen Trauben: Das strohfarbene Casaliva-Öl vom Gardasee schmeckte süßlich und ließ einen Hauch von Pinienkernen und Mandeln erahnen, während das smaragdgrüne Moraiolo aus der mittleren Toskana so pfeffrig war, dass es mir die Tränen in die Augen trieb und wohlig in der Kehle brannte. Und tatsächlich, das Tonda Iblea aus den Hügeln im Südosten Siziliens hatte eindeutig eine Anmutung von grünen Tomaten und Artischocken – genau wie Zaramella und seine Kollegen gesagt hatten. Die Verkostung dieser Öle war wie ein Spaziergang durch einen botanischen Garten, eine Führung durch eine Parfumfabrik und eine ausgedehnte Tour durch Frühlingswiesen im offenen Cabrio – und das alles auf einmal: zu gleichen Teilen wissenschaftliche Analyse und ungenierter, andächtig zelebrierter Hedonismus.
Ich griff nach der letzten Probe, die mir Zaramella eingeschenkt hatte, schnupperte flüchtig und nippte. Nach einem schwindelerregenden Moment der Verwirrung und rasch einsetzendem Ekel spuckte ich das Öl reflexartig in den Ausguss. Damit stimmte etwas ganz und gar nicht. Nach den feinen, intensiv frischen Aromen, die ich zuvor gekostet hatte, fühlte es sich in meinem Mund schleimig und derb an und schmeckte nach verfaultem Obst.
Zaramella lachte schroff. »Das Öl aus dem Supermarkt habe ich als Letztes eingeschenkt«, sagte er, »sonst wäre Ihr Gaumen so sicher für die hochwertigen Öle ruiniert gewesen, als hätte ich Sie mit Katzenpisse gurgeln lassen.«
Er holte die braunen Laborflaschen vom Wandregal und stellte sie in einer Reihe auf dem Besprechungstisch auf. »Jetzt kommt der unterhaltsame Teil«, erklärte er mir. »Sie müssen herausfinden, was mit diesem letzten Öl nicht in Ordnung ist. Wie ein Detektiv – oder ein Pathologe.«
Er öffnete eine Flasche nach der anderen und reichte sie mir, damit ich mir merkte, wie sie roch. Den Flaschen entströmte eine erstaunliche Vielzahl an strengen, unangenehmen und ekelerregenden Gerüchen, denen die Etiketten – »ranzig«, »stichig«, »wein-/essigartig«, »schlammig«, »metallisch«, »espartograsartig«, »modrig-feucht« – kaum gerecht wurden. Dann, nach mehreren Apfelschnitzen und vielen tiefen Atemzügen, um meinen Gaumen zu befreien, kostete ich das Öl erneut, schnupperte, nippte und versuchte, seine Unzulänglichkeiten näher zu bestimmen. Ich meinte, verschiedene Fehlnoten erkannt zu haben, und notierte sie auf einem Bewertungsblatt.
Als ich fertig war, entließ mich Zaramella aus meiner Kabine, setzte mich an den Besprechungstisch und nahm mir gegenüber Platz. Er zündete sich die nächste Zigarette an und nahm einen kräftigen Zug. Dann überflog er meine Notizen. »Gar nicht so schlecht«, brummte er und stieß dabei eine Rauchwolke aus, die kurzfristig den Raum verdunkelte. »›Ranzig‹ und ›stichig‹ stimmt beides. Ein paar Fehler haben Sie nicht erkannt. Die Wein- beziehungsweise Essignote ist sehr ausgeprägt, und das Öl hat auch ganz klar etwas Schlammiges.« Er griff nach der Flasche mit dem Supermarktöl, das ich gekostet hatte. »Wissen Sie, wenn ein Öl auch nur einen dieser Mängel aufweist – eine Spur von ›Stichigkeit‹ oder ›Lake‹ –, dann darf es eigentlich schon nicht mehr als natives Olivenöl extra bezeichnet werden. Und damit basta. Dieses Öl hier müsste wegen seiner Fehler eigentlich als lampante klassifiziert werden – als ›Lampantöl‹. Das darf legal höchstens als Brennstoff verkauft werden: als zum Verzehr ungeeignet. Das Problem ist nur, dass das Gesetz nie konsequent angewendet wird.«
Er ließ die Flasche so heftig auf den Tisch krachen, dass die Kaffeetassen und Aschenbecher hüpften und schepperten. »So was halten die meisten Menschen auf der Welt für natives Olivenöl extra! Das Zeug macht für hochwertiges Öl den Markt kaputt und verdrängt ehrliche Ölhersteller aus dem Geschäft. Beim Wein kann man sich auf das Etikett verlassen. Wenn ›Dom Perignon 1964‹ auf einer Flasche steht, dann ist er auch drin, und nicht Beaujolais Primeur vom letzten Monat. Champagner und Beaujolais unterstützen sich da sogar gegenseitig und verleihen französischem Wein auf jeder Stufe der Qualitätsskala mehr Prestige und Markenerkennungswert. Bei Olivenöl dagegen steht auf jedem Etikett dasselbe, ganz gleich ob die Flasche ein herausragendes Spitzenprodukt enthält oder diese schifezza …« Er richtete den Flaschenhals wie eine Pistole auf mich und schob dann seine Brille auf die Nase, um das Etikett zu lesen. »Hier steht, was auf jedem Olivenöl steht: 100 Prozent italienisch, in der Steinmühle kaltgepresst, aus erster Pressung – jungfräulich, wie der Italiener sagt …«
Er schüttelte den Kopf, als könne er seinen Augen nicht trauen. »Was ist denn an diesem Öl jungfräulich? Nuttig träfe es besser.«
Anschließend listete Zaramella mit der gleichen Gründlichkeit, die er beim Geschmackstest an den Tag legte, die im Ölgeschäft üblichen Delikte auf. Er beschrieb die Desodorierungsanlagen, die er in spanischen Ölmühlen gesehen hatte, vor allem in Andalusien, wo sie illegal eingesetzt werden, um minderwertige Öle von beeinträchtigenden Geschmacks- und Geruchsnoten zu befreien, sodass sie als »nativ extra« verkauft werden können. Er verurteilte die gängige Praxis, stark raffinierte Öle als »rein« zu etikettieren, obwohl sie durch den Raffinationsprozess fast alle ihre gesundheitsförderlichen und sensorischen Qualitäten einbüßten, als »leicht«, obwohl sie ebenso viele Kalorien pro Gramm enthielten wie andere Öle, oder als »biologisch« – aus Oliven, die ohne Einsatz von Unkrautvernichtern oder anderen Chemikalien angebaut wurden –, obwohl sie in Wirklichkeit aus ganz normalen Oliven hergestellt wurden. Kleinkriminelle Ölhersteller färben billiges Soja- oder Rapsöl mit industriell gewonnenem Chlorophyll, geben Betakarotin als Geschmacksstoff hinzu und verkaufen die Mixtur als natives Olivenöl extra – in Flaschen, auf denen italienische Flaggen prangen und die Namen erfundener Hersteller aus berühmten Olivenanbaugebieten wie Apulien oder der Toskana. Es gibt aber auch raffiniertere Betrüger, die im großen Stil arbeiten, wie er mir erklärte. Dazu werden ausgebildete Chemiker benötigt und Laborausrüstung, die viele Millionen kostet. Daran ist ein Netz aus Zollbeamten, Geschäftsleuten und Staatsvertretern beteiligt. Zaramella benannte mir genau die Zentren des Ölbetrugs im Mittelmeerraum, die Raffinerien und Fabriken im schweizerischen Lugano, im spanischen Málaga und in Sfax in Tunesien und weitere Orte rund ums Mittelmeer, an denen falsche »Extra Vergine«-Öle fabriziert wurden. Er listete mir auch die Länder in aller Welt auf, in denen die Plagiate verkauft wurden, und setzte mir auseinander, warum der US-Markt für Ölpanscher das Paradies ist.
Im darauffolgenden Jahr verbrachte ich viel Zeit mit Zaramella, in den Mailänder Büros der Mastri Oleari und auf Öldegustationen und Konferenzen in ganz Italien. Ich erfuhr von seinem Hang zu ehrgeizigen, kreativen Vorhaben mit geringen Gewinnaussichten: Im Laufe seiner Karriere hatte er ein florierendes Modelabel in Mailand gegründet und über ein in Wyoming zugelassenes Offshore-Unternehmen Termingeschäfte mit Erdöl getätigt. An der Wand seines Büros hing eine Karte von Somalia, wo er 1987 als Leiter eines Entwicklungshilfeprojekts den Bau eines hochmodernen Krankenhauses in Baraawe am Indischen Ozean beaufsichtigt hatte. »Ich habe sie alle unter einen Hut gebracht: Kommunisten, katholische Priester, Moslems, Professoren, Analphabeten – eben jeden, der den Willen hatte, etwas zu bewegen«, erinnerte er sich. Zwei Monate nach der Fertigstellung wurde die Klinik im Bürgerkrieg zerstört. »Großzügigkeit ist die reinste Form des Egoismus«, kommentierte er achselzuckend. Zaramella erzählte von seinem Magenkrebs, an dem er schon viermal operiert wurde, und von den erstaunlichen therapeutischen Eigenschaften von nativem Olivenöl extra gegen zahlreiche Erkrankungen, Krebs eingeschlossen. Seine Krankheit, so meinte er, habe ihn besonders sensibilisiert für die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Öls. Und er berichtete, wie er erstmals vor 20 Jahren auf Olivenölbetrug gestoßen war. Da hatte er gerade begonnen, auf einem kleinen Hof, den er in Umbrien übernommen hatte, selbst Olivenöl zu produzieren, und musste feststellen, dass ihn der Landwirt, der den Hof bewirtschaftete, betrog, indem er seinem Olivenöl billigeres Sonnenblumenöl beimischte. In diesem Moment beschloss er, sich für den Rest seines Lebens seinem größten und ambitioniertesten Projekt zu widmen: den Betrügern im Olivenölgeschäft das Handwerk zu legen.
Nach seinen Operationen war Zaramella zwar abgemagert, verfügte aber noch über den sonoren Bariton und das runde, lebhafte Gesicht des 120 Kilo schweren Genussmenschen, der er vor seiner Krankheit gewesen war. »Mein Kampf ist eine Bürgerpflicht«, sagte er mir einmal, »gegenüber den Tausenden ehrlicher Ölerzeuger, die auf diesem verzerrten Markt kaum überleben können, und gegenüber Millionen von Verbrauchern, denen die therapeutischen Eigenschaften von hochwertigem Öl vorenthalten werden. Echtes natives Olivenöl extra enthält wirkungsvolle Antioxidantien und entzündungshemmende Stoffe, die zur Verhütung degenerativer Erkrankungen beitragen, wie auch mein Krebs eine ist. Gepanschtes Öl mit dem Prädikat »nativ extra« ist praktisch frei davon. Gutes Öl ist der Dreh- und Angelpunkt der mediterranen Ernährung. Schlechtes Öl ist nicht nur Täuschung, sondern ein Verbrechen an der öffentlichen Gesundheit.« Doch es ist mehr als nur Zaramellas Gerechtigkeitssinn oder der Wunsch nach Heilung, der ihn dazu bringt, sich für Olivenöl starkzumachen. Einmal standen wir im Frühling in seinem Olivenhain bei Assisi. Zwischen den Ölbäumen blühten gelbe Lilien. Wir blickten über einen der Abhänge, an denen der heilige Franziskus einst Oden an die Vögel, die Sonne und den Himmel gesungen hatte. »Seit alten Zeiten steht Olivenöl für Reinheit, Gesundheit und Heiligkeit«, sagte Zaramella da wie zu sich selbst, mit großer Rührung in der Stimme. »Ich bin kein religiöser Mensch, doch für mich ist Olivenöl heilig.«
Da stand er also, Flavio Zaramella, bekennender Atheist, und sprach über die Heiligkeit von Olivenöl – ein todkranker Bonvivant, der seine letzten Kräfte für die Heilsamkeit von Olivenöl mobilisierte. Dort neben ihm, inmitten der Ölbäume und Lilien des heiligen Franziskus, erkannte ich, dass Olivenöl eine ganz besondere Wirkung auf die Menschen hat. Ebenso wie es als effizientes Lösungsmittel bestimmten Speisen elementare und manchmal unerwartete Aromen entlockt, bringt es auch das Wesen mancher Menschen in aller Deutlichkeit hervor: ihre verborgenen Widersprüche, ihre geheimen Leidenschaften und Träume. Es dringt unter die Haut, durchtränkt den Geist und färbt die Gedanken wie kein zweites mir bekanntes Nahrungsmittel. Je länger ich mich mit dem Thema befasste, desto öfter begegnete mir dieses Phänomen. Ich entdeckte seine Symptome bei achtzigjährigen Olivenbauern und neunzigjährigen Mühlenbetreibern ebenso wie bei jungen Ölmanagern multinationaler Nahrungsmittelkonzerne. Ich gewahrte sie an der Führungsspitze einer Lebensmittelkooperative, die unter größten Risiken Öl aus Olivenpflanzungen herstellte, die man der Mafia abgenommen hatte, und bei Mönchen, die auf ihrem Klostergelände aus tausendjährigen Ölbäumen Öl gewannen. Ich traf Politiker, Gewerkschaftsfunktionäre, Aufsichtsbeamte der Europäischen Union, Historiker, Archäologen, Chemiker, Agrarwissenschaftler und Botaniker, deren Gesichter einhellig aufleuchteten, wenn die Rede aufs Öl kam, und die alle eine Geschichte zu erzählen hatten – mal lustig, mal auch schockierend oder traurig. Selbst fragwürdige Charaktere, die mit Tankerladungen frisierten Öls reich geworden waren, erinnerten sich wehmütig an ihre Kindheit in der Ölmühle und an die Lektionen fürs Leben, die sie dort gelernt hatten. Unweigerlich hatten sie denselben öligen Glanz der unverstellten Faszination mit dieser Substanz im Auge, die ihnen mehr bedeutete als alles andere auf der Welt. Sie alle waren von derselben Krankheit befallen – sie waren besessen vom Öl.
Ich begann, mich näher mit dieser reichhaltigen, geschmeidigen, hintergründig mysteriösen Substanz zu beschäftigen – einem Pflanzenöl, das aus einer Frucht gewonnen wurde, einem frischen Fruchtsaft mit der idealen Mischung an Fetten für den menschlichen Organismus, ein Fett, das die Arterien schmiert und den Geist nährt, einem uralten Lebensmittel mit modernsten Qualitäten, die die Medizin erst ansatzweise erforscht hat. Ich besuchte verschiedene Hersteller, erst in Ligurien, wo ich zu Hause bin, dann in der benachbarten Lombardei, im Piemont und in der Toskana. Bei jedem Produzenten kaufte ich eine Flasche Öl, trug sie nach Hause und verglich dann zwei oder drei verschiedene Produkte, indem ich sie zunächst von Teelöffeln oder aus Schnapsgläschen schlürfte, bevor ich mir richtige Probiertulpen anschaffte, um professioneller vorgehen zu können. Meine Söhne Jeremy und Nicholas, acht und zehn Jahre alt, kosteten mit mir. Beim Nippen erzählte ich ihnen von den Menschen, die die Öle hergestellt hatten – von ihrer Heimat, ihrer Sprache und ihren Eigenheiten. Ich zeigte ihnen Bilder, die beide Jungen aufmerksam betrachteten. Sie musterten die Gesichter der Ölfrauen und -männer, ihre wettergegerbten Züge und die ausdrucksvollen, kräftig anmutenden Hände. Sie machten mich darauf aufmerksam, welche Eigenschaften des Öls an seinen jeweiligen Hersteller erinnerten – die vollmundige Schroffheit des Flos Viridis von Flavio Zaramella, die sonnige Lebensfreude des goldenen Extra Vergine einer Frau vom Gardasee mit lachenden blauen Augen und blonden Zöpfen. Bald schon referierten sie über die Tomaten- und Artischockennoten bestimmter Öle und wussten sogar die pfeffrige Bissigkeit der größeren Anbauer aus der Toskana und Apuliens zu schätzen, ganz als spürten ihre jungen Körper instinktiv, dass ihnen die Schärfe guttat. Ab und zu brachte ich auch minderwertige Erzeugnisse vom Discounter oder von einem wohlmeinenden, aber ahnungslosen Bauern mit nach Hause und sah zu, wie die Jungen schnupperten, zurückzuckten und mit dem gleichen berechtigten Zorn wie Flavio Zaramella »lampante!« fauchten.
Als meine Frau Francesca uns zum ersten Mal Olivenöl schlürfen sah, schaute sie erst ungläubig, dann angewidert. »Da würde ich schon lieber Butterwürfel essen«, meinte sie. Meine Frau stammt aus Mailand, wo traditionell viel mit Butter und Schmalz gekocht wird statt mit Öl. Doch ich blieb hartnäckig. Ich zeigte ihr Artikel ausLancet, aus demNew England Journal of Medicineund anderen namhaften Fachblättern über die unlängst entdeckten gesundheitlichen Vorzüge von Olivenöl bei so unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Herzerkrankungen, Brustkrebs und Alzheimer. Ich machte unsere Salate mit besonderen und exotischen Ölen an – an einem Tag mitBiancolilla, das die Bitterkeit der Rucola (Rauke) betonte, am nächsten mitNocellara del Belice, das sie auf unerklärliche Weise dämpfte. Allmählich gab meine Frau nach. Sie wollte zwar noch immer kein blankes Olivenöl trinken, begann aber, verschiedene Öle auf Rohkost, Salaten und in Saucen auszuprobieren. Und sie verwendete Öl statt Butter für Croissants, Muffins und Kuchen, die dadurch mitunter einen Grünton annahmen, als wären sie nicht im Ofen gebacken worden, sondern im Garten gewachsen. Dabei waren sie knusprig und aromatisch. Inzwischen hält sie mehrere verschiedene Olivenöle in der Küche vor und verwendet sie wie Gewürze, jeweils passend zu dem Gericht, das sie gerade zubereitet. Sie achtet darauf, dass wir alle jeden Tag zwei Esslöffel Öl von bester Qualität zu uns nehmen, was dem Rat führender medizinischer Forscher entspricht. Auch sie ist auf dem besten Weg, der Ölbesessenheit zu verfallen.
Dieses Krankheitsbild ist ein sehr altes. Beim erneuten Durchlesen von Gedichten und geistlichen Texten, die ich gut zu kennen glaubte, fielen mir plötzlich Anspielungen und Untertöne auf, die ich zuvor nie bemerkt hatte – aus einer Zeit, in der Olivenöl nicht nur Grundnahrungsmittel war, sondern auch Katalysator der Zivilisation und maßgebliches Bindeglied zwischen Mensch und Gott. Odysseus, nach dem Schiffbruch ausgemergelt und salzverkrustet, reibt seinen Körper mit Öl ein und erstrahlt plötzlich in göttlicher Schönheit. Die reuige Dirne Maria Magdalena salbt die Füße Christi mit aromatischem Öl, das das Haus mit seinem Duft erfüllt, und reibt sie mit ihrem Haar trocken. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, verwendete Olivenöl so großzügig zur Körperpflege, dass es aus seiner Kopfbedeckung tropfte. Ich las von ägyptischen Pharaonen, die dem Sonnengott Ra zum Dank edelstes Olivenöl opferten, und von der mageren Ration Lampenöl in der heiligen Menora, die eigentlich nur für einen Tag reichte, doch den Tempel von Jerusalem während seiner Wiedereinweihung acht volle Tage lang erleuchtete, bis mehr geweihtes Öl beschafft werden konnte – ein Wunder, das die Juden noch heute als Chanukka oder Lichterfest feiern. Die Taube, die nach der Sintflut mit einem Ölzweig im Schnabel auf die Arche Noah zurückkehrte, symbolisierte nicht nur die Vergebung Gottes – der Ölzweig war schon im antiken Griechenland das Zeichen der Bittsteller –, sondern zeigte auch, dass Noah in einem friedlichen Land gestrandet war: Ölbäume sind niedrige Gewächse, die regelmäßiger Pflege bedürfen, wie sie nur zu Friedenszeiten möglich ist.
Hie und da stieß ich auf Hinweise auf die dunkleren Seiten des Öls. Die Magier des Mittelalters und die Hexen der Renaissance verwendeten Olivenöl für ihre Zauber und Salben, und die unguentarii (Parfumhändler) sollen mit verunreinigtem Öl die Pest verbreitet haben. Kriminelle tummeln sich schon seit mindestens 5.000 Jahren im Ölhandel: Die frühesten überlieferten Dokumente, in denen Olivenöl erwähnt wird, sind in Keilschrift beschriebene Tontafeln, die 2.400 Jahre vor Christus in Ebla entstanden und von Inspektorenteams berichten, die Olivenbauern und Ölmüller auf betrügerische Praktiken hin überprüften. Der warme Glanz des Chanukka-Festes überstrahlte einen blutigen Bürgerkrieg, der 164 vor Christus ausgetragen wurde, im Jahr des berühmten Menora-Wunders, als zwei jüdische Gruppen um die Kontrolle über den Tempel und die religiösen Praktiken der Hebräer rangen. Ölbäume selbst können ebenfalls Unheil bringen. Sophokles schrieb von der unirdischen, beinahe bedrohlichen Kraft eines Baumes, »der selber sich fortpflanzt«. Eine alte christliche Legende erzählt von einem Ölbaum, der aus Adams Grab herauswuchs und in seinem Schädel wurzelte. Auch verschiedene Dichter spürten den kalten Schatten des Ölbaums. Federico García Lorca, der im Spanischen Bürgerkrieg von einem Exekutionskommando der Nationalisten erschossen wurde, beschrieb die Guardia Civil, wie sie in Andalusien unaufhaltsam durch Olivenhaine auf den Schauplatz eines Mordes zumarschierte, während die Ölbäume als schwarze Engel »mit Herzen aus Öl« aus dem westlichen Himmel herniederblickten. In den knorrigen alten Ölzweigen der Provence sah Richard Wilbur Entbehrung in der Fülle der mediterranen Landschaft:
»Even when seen from near, the olive shows
A hue of far away. Perhaps for this
The dove brought olive back, a tree which grows
Unearthly pale, which ever dims and dries,
And whose great thirst, exceeding all excess,
Teaches the South it is not paradise.«
Die Fruchtigkeit und der Duft des herrlichen Öls sind verbrämt mit Bitterkeit – wie alles Schöne im Leben.
Warum, so fragte ich mich, haben Ölzweige und Olivenbäume selbst dort, wo sie gar nicht vorkommen, eine so nachhaltige Symbolkraft? Warum hat sich das Öl über Jahrtausende als universell etabliert und ist in jeden Aspekt des menschlichen Daseins eingedrungen? Und wie war das Leben in dieser öldurchtränkten Welt, in der Tempel, Schlafkammern und Badehäuser im klaren gelben Licht der Öllampen erstrahlten und sich die Menschen verschwenderisch einölten? Wie sah es aus, wie roch es, wie fühlte es sich an? Dieses Einölen war für mich am schwersten vorstellbar. Wie fühlte man sich, wenn der ganze Körper glitschig und glänzend war von duftendem Öl? Wenn wie beim Hohepriester Aaron Salböl aus den Haaren in den Bart troff und das Gewand bis zum Saum durchweichte? Oder wenn einem eine Prostituierte die Füße mit seidigem Öl massierte und mit ihren Haaren trocken rieb? Zugegebenermaßen eine weit hergeholte Vorstellung. Aber nicht ohne Reiz.
Ich startete eine Versuchsreihe. Ich kaufte mehrere Öllampen, Repliken der mittelalterlichen Variante und römische Modelle, zündete sie an und stellte sie im ganzen Haus auf. Ihre Flammen züngelten über dunklen Ölpfützen und sie verströmten eine zarte Süße und badeten die vertrauten Szenen im flackernden bernsteinfarbenen Licht vergangener Zeiten. Ich versuchte es mit Olivenöl als Körperpflegemittel. Es machte trockene Lippen weich, linderte Sonnenbrand und heilte den Windelausschlag meiner kleinen Tochter nach nur einer Anwendung. Ich stellte auf dem heimischen Herd Seifenstücke her, indem ich Olivenöl mit Talg und Lauge mischte und die so hergestellte Paste in Formen strich, die ich aus Olivenholzblöcken geschnitzt hatte. Die Seife produzierte einen rosafarbenen, leicht schleimigen Schaum, der die Haut wunderbar zart machte, zum Geschirrspülen aber zu schlüpfrig war (wie wir nach mehreren zerbrochenen Tellern beschlossen). Ich testete die Eigenschaften von Olivenöl als Lösungs- und Schmiermittel. Ich polierte die Oberflächen und Chromleisten eines alten Toasters damit, bis sie spiegelten. Ich entlockte einer strapazierten Tischplatte aus Walnussholz ganz neue Dimensionen der Maserung. Ich ölte quietschende und knarrende Fenster und Türen im ganzen Haus. Ich goss Öl in kleine Becher und versetzte es mit Knoblauchzehen, Rosmarinzweigen, Orangenschalen und gekochten Eiern. Nach wenigen Tagen stellte ich fest, dass die olfaktorischen Essenzen in das Öl übergegangen waren und ihm jetzt innewohnten, quasi durch Zauberkraft darin gefangen wie ein Flaschengeist. Ich bastelte aus einem Dampfkochtopf eine primitive Destille, um ätherische Öle aus Lavendel, Glyzinie, Jasmin und Bergamotte zu gewinnen, und gab diese Essenzen einer Olivenölbasis bei. So entstanden intensiv duftende Öle, die ich mir ins Gesicht und verstohlen auch in die Haare strich und mir vorstellte, wie es wohl wäre, sich wie der alttestamentarische Priester den ganzen Tiegel über den Kopf zu kippen, bis mein Bart durchzogen wäre und mir das Öl aus den Kleidern tropfte.
Der Ursprung des universellen Reizes von Olivenöl wird erst heute ergründet, von auf vielen Fachgebieten tätigen Forschern, die ich konsultiert habe und die mir immer wieder andere Wege in diese neue weite Welt wiesen. Mit Ernährungswissenschaftlern und Lipidchemikern warf ich einen Blick in die molekulare Struktur von Olivenöl und verschaffte mir einen Eindruck von den natürlichen Antioxidantien und Fettsäuren, die die Menschen einst dazu verleiteten, sich aus einem vagen Gesundheitsinstinkt heraus Kopf und Gesicht mit Öl zu benetzen. Sie benutzten es, um ihre Haut zu reinigen und zu verschönern, weil die primäre Lipidkomponente des Öls, die Ölsäure, ein wirkungsvolles Lösungsmittel ist, das unter anderem dafür sorgt, dass beim Kochen Aromen freigesetzt werden und Parfums Duftstoffe bewahren können. Seine praktische und auch seine mythische Popularität bezog das Öl zumindest zum Teil aus den wundersam anmutenden agronomischen Merkmalen des Ölbaums, der sogar unter wüstenähnlichen Bedingungen gedeiht und nach Zerstörung durch Feuer oder Frost aus dem Wurzelballen grüne Sprosse schießen lässt, die den Baum wiederauferstehen lassen. Auch die Olivenernte ist ein kleines Wunder. Wie mir ein Agrarwissenschaftler mit mehr als einer Spur Ehrfurcht in der Stimme verriet: »Der Ertrag eines Ölbaums verläuft kurvenförmig aufwärts und tendiert gegen unendlich.«
Auf der Suche nach Antworten über Olivenöl reiste ich an Orte, wo besonders gutes Öl produziert wird und wo das Öl bis heute im Alltag eine zentrale Rolle spielt. Am Ende hatte ich das Mittelmeer umrundet, von Südspanien über Nordafrika bis zum Westjordanland und an die Ostküste Kretas. Ich hatte Landschaften im Schatten uralter Haine gesehen und Sitten, Gebräuche und religiöse Riten kennengelernt, die ganz vom Olivenöl geprägt waren. Ich reiste noch weiter und besuchte Ölhersteller in Kalifornien und Chile, an den Hängen des Tafelbergs in Südafrika und im Weizengürtel weit im Westen Australiens – Orte, an denen mir Ölbäume und mediterraner Lebensstil durch die Distanz seltsam fremd und dabei doch so vertraut vorkamen.
Erste Station meiner Olivenölreise und in vieler Hinsicht die wichtigste war aber Apulien am Absatz des italienischen Stiefels. In dieser Region wird ein großer Teil des italienischen Olivenöls hergestellt, und das schon seit Jahrtausenden – seit der Zeit, als die Hügel berühmter Ölanbaugebiete wie der Toskana oder Liguriens, Spaniens oder Nordafrikas noch kahl waren und die Olivenkultur Amerikas und Australiens noch in ferner Zukunft lag. Im heißen trockenen Klima Apuliens gedeihen schon seit der letzten Eiszeit wilde Oliven, die termiti. Sie lieferten die robusten Wurzelstöcke, die von Bauern mit den domestizierten Olivenbäumen veredelt wurden, die phönizische Händler und griechische Kolonisten mitbrachten. Viele pugliesi gießen sich noch heute ein Kreuz aus Olivenöl in ihre Suppe und schlürfen in der Mittagspause am Ofen ein Tässchen warmes Öl – tägliche Rituale der Gesundheit und der Beruhigung. Hier ist Olivenöl schon seit jeher Grundnahrungsmittel und trägt seine schönen und hässlichen Seiten einzigartig deutlich zur Schau.
1 – Oliven und das Leben
»Da standen sie still, und riefen einander,
Führten Odysseus hinab zum schattigen Ufer des Stromes,
Wie es Nausikaa hieß, des hohen Alkinoos’ Tochter;
Legten ihm einen Mantel und Leibrock hin zur Bedeckung,
Gaben ihm auch geschmeidiges Öl in goldener Flasche,
Und geboten ihm jetzt, in den Wellen des Flusses zu baden.
Und zu den Jungfraun sprach der göttergleiche Odysseus:
Tretet ein wenig beiseit’, ihr Mädchen, dass ich mir selber
Von den Schultern das Salz abspül’, und mich ringsum mit Öle
Salbe; denn wahrlich schon lang entbehr’ ich dieser Erfrischung!
Aber ich bade mich nimmer vor euch, ich würde mich schämen,
Nackend zu stehn, in Gegenwart schönlockiger Jungfraun.
Also sprach er, sie gingen beiseit’, und sagten’s der Fürstin.
Und nun wusch in dem Strom der edle Dulder das Meersalz,
Welches den Rücken ihm und die breiten Schultern bedeckte,
Rieb sich dann von dem Haupte den Schaum der wüsten Gewässer.
Und nachdem er gebadet, und sich mit Öle gesalbet;
Zog er die Kleider an, die Geschenke der blühenden Jungfrau.
Siehe da schuf ihn Athene, die Tochter des großen Kronions,
Höher und jugendlicher an Wuchs, und goss von der Scheitel
Ringelnde Locken herab, wie der Purpurlilien Blüte.
Also umgießt ein Mann mit feinem Golde das Silber,
Welchen Hephaistos selbst und Pallas Athene die Weisheit
Vieler Künste gelehrt, und bildet reizende Werke:
Also umgoss die Göttin ihm Haupt und Schultern mit Anmut.
Und er ging ans Ufer des Meers, und setzte sich nieder,
Strahlend von Schönheit und Reiz.
Mit Staunen sah ihn die Jungfrau
Leise begann sie, und sprach zu den schöngelockten Gespielen:
Höret mich an, weißarmige Mädchen, was ich euch sage!
Nicht von allen Göttern verfolgt, die den Himmel bewohnen,
Kam der Mann in das Land der göttergleichen Phäaken!
Anfangs schien er gering und unbedeutend von Ansehn;
Jetzo gleicht er den Göttern, des weiten Himmels Bewohnern.
Würde mir doch ein Gemahl von solcher Bildung bescheret«
– Homer, Odyssee, Sechster Gesang
Aus 10.000 Metern Höhe gleitet die apulische Landschaft vorbei wie ein großer Flickenteppich aus ungleichmäßig geformten Feldern, besprenkelt mit grünen Punkten unterschiedlicher Größe: manche klein wie Stecknadelköpfe und ordentlich aufgereiht, andere größer und in unregelmäßigen Abständen über die Felder verstreut. Wenn das Flugzeug auf 5.000 Meter herabsinkt und zur Landung am Flughafen Bari ansetzt und das Mittelmeer als tiefblauer Streifen in Sicht kommt, kann man erkennen, dass die Punkte in Wirklichkeit Ölbäume sind. Die kleineren sind junge Bäume, die nach den Grundsätzen moderner Landwirtschaft ordentlich in geraden Reihen angepflanzt wurden. Die größeren sind alte Bäume mit riesigen wolkenartigen Kronen, die mehr oder minder zufällig über die Felder gestreut sind, wo sie schon standen, als die Ritter der Kreuzzüge auf dem Weg ins Heilige Land durch Apulien ritten.
Olivenbäume wachsen an der Landebahn und säumen die Straße in die Stadt. Viele sind mächtige alte Exemplare mit knorrigen Korkenzieherstämmen, die direkt einem Märchenwald entsprungen scheinen. Ihre langen Zweige recken sich waagerecht und enden in herabhängenden Hexenfingern – ein Formschnitt, der »Kronleuchter« genannt wird. Auf der Fahrt nach Süden erstrecken sich die Olivenhaine endlos in alle Richtungen, so weit das Auge reicht – bis hin zur flachen sandigen Küste und zum Kalksteinplateau im Landesinneren. Apuliens 60 Millionen Olivenbäume gehören 150.000 pugliesi – im Schnitt also jedem Einwohner 240 Stück – und stehen in Hainen, die im Laufe der Generationen immer kleiner wurden und ausfransten. Da und dort befindet sich im Schatten eines großen Baumes eine Bank oder eine kleine, weiß gekalkte Hütte, die als Schuppen oder Wochenendhaus dient, mit einem separaten Backofen für Pizza oder Brot. Die rote Erde ist mit fahlgelben Feldsteinen durchsetzt, die gesammelt und zu Bruchsteinmauern aufgeschichtet wurden, um die Felder abzuteilen. Oliven mit ihrem flachen großflächigen Wurzelsystem gedeihen auf felsigem, gut entwässertem kalkhaltigem Boden. An sonnigen Flecken entlang der Mauern wuchert Kletterjasmin und es wachsen Kaktusfeigen an hohen, üppigen Pflanzen, auch Stachelbirnen genannt, deren flache, längliche Blätter der Szenerie etwas Wüstenhaftes verleihen.
Sechs große Felder des apulischen Flickenteppichs befinden sich im Besitz der Familie De Carlo, die seit dem Jahr 1600 auf den Kalkböden der Tiefebene von Bitritto südöstlich von Bari aus ihren Olivenhainen Öl gewinnen. Heute wird der Familienbetrieb von Grazia und Saverio geführt, der Matriarchin und dem Patriarchen des De-Carlo-Clans. Sie sind ein ungleiches Paar und wirken wie Herrin und Bauer. Sie ist dunkelhaarig, hübsch, ein bisschen mollig, adrett in Faltenrock und Kaschmirjäckchen gehüllt und trägt goldene Armbänder und eine Reihe große Perlen. Er ist grobknochig und gebeugt, mit dem windgegerbten Gesicht und der mehrschichtigen Flanell- und Fleece-Montur eines Mannes, der sich die meiste Zeit über bei jedem Wetter im Freien aufhält. Grazia fixiert den Besucher mit dunklen Augen, die zwar Wärme ausstrahlen, aber so durchdringend blicken wie die eines Habichts. Sie ist mitteilsam, wortgewandt und unterstreicht ihre Ausführungen mit lebhaften Bewegungen ihrer gebräunten Hände. Saverio spricht leise, mit gesenktem Blick, als wäre er schüchtern oder misstrauisch. Oft umreißt er einen Gedanken mit wenigen Worten, prägnant und gehaltvoll wie ein Gedicht, und verstummt dann. Die nähere Ausführung überlässt er Grazia. »Ein guter Ölmacher braucht Technik und Hacke«, sagt er mit hilfesuchendem Blick zu seiner Frau, die erklärt: »Um die besten Öle herzustellen, kombinieren wir die neueste Mahltechnik mit meisterhaft ausgeführten traditionellen Methoden der Landwirtschaft.«
Wer einen Tag mit Grazia und Saverio verbringt, merkt bald, dass sie trotz ihrer Verschiedenheit – oder vielleicht gerade deshalb – ein ideales Paar sind. Man spürt das an der Art, wie ihre Kinder, Marina und Francesco, beide Mitte 20, still werden und zuhören, wenn einer von beiden spricht, und ihnen liebevolle und komplizenhafte Blicke zuwerfen. Man merkt es, wenn sie sich in einem Moment liebevoll necken und im nächsten unwillkürlich mit dem anderen brüsten: »Schauen Sie nur, wie gesund er ist«, meint Grazia und drückt ihrem Mann mit dem Finger auf den muskulösen, sehnigen Unterarm. »Er hat sein Leben lang Zweizentnersäcke mit Oliven von Lastern gehoben und unglaubliche Mengen Olivenöl vertilgt. Jetzt kann ihm nichts mehr etwas anhaben.« Und Saverio sagt über Grazia: »Erst hasste sie das Olivenölgeschäft, doch ihr Mut und ihre neuen Ideen haben uns Erfolg gebracht – und halten uns über Wasser.«
Grazia entstammt einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie und verfügte vor der Heirat mit Saverio über keinerlei Erfahrung im Ölgeschäft. Doch wie bei vielenpugliesihaben auch ihre frühesten Kindheitserinnerungen mit Oliven zu tun. Sie erinnert sich an einen dunstigen Dezembermorgen, als sie drei oder vier Jahre alt war und mit ihrer Mutter zu Beginn der Erntezeit in die Olivenhaine um Bitritto ging. Die Pflücker, alles Einheimische, feierten diesen bedeutsamen Tag mit einem alljährlichen Ritus: Sie rösteten Brotschreiben über einem Olivenholzfeuer, gossen neues Öl auf das Brot und teilten es mit dem gemessenen Ernst einer sakramentalen Handlung. Saverio seinerseits hat erste Erinnerungen an die väterliche Mühle: Als kleiner Junge saß er nach einem Erntetag mit den Arbeitern am Mühlstein, während das Maultier, das die Mühle angetrieben hatte, in der Nähe aus seinem Futtersack fraß und die Männer in einem Tontopf einen Gemüseeintopf zubereiteten, den siela bombanannten – »die Bombe«. Dabei sangen sie Volkslieder, deren Texte und Melodien Saverio bis heute kennt, obwohl er sie seit 50 Jahren nicht mehr gehört hat.
Ich besuchte die Mühle der De Carlos erstmals über 60 Jahre danach, mitten in einer weiteren Erntezeit. Es war Ende November und die Maschinen liefen Tag und Nacht. Kisten voller Oliven der Sorten Coratina und Ogliarola, von Hand gepflückt, kurz bevor sich ihr Grünton in ein blasses Lila verfärbte, wurden auf Traktoren und Api, den dreirädrigen Kleintransportern, herangekarrt und vor der Mühle zehn Meter hoch gestapelt. Grazia weihte mich in den Ölgewinnungsprozess ein. Ein Arbeiter kippte kistenweise Oliven in einen Edelstahlbehälter, in dem sich große Löffel drehten und die Früchte durch einen warmen Luftstrom von Blättern und Stielen getrennt wurden. Danach rutschten sie weiter in einen Stahltank, in dem sie gewaschen wurden. Die glatten, glänzenden Oliven, die aussahen wie frisch geblasene Glaskugeln, wurden über eine Rutsche in die eigentliche Mühle befördert, wo sich auf einer Granitplatte einer nach dem anderen drei Granitmühlsteine drehten, so groß wie die Räder eines Lasters. Sie zerquetschten die Oliven mitsamt Kern und Fruchtfleisch zu einer pflaumenfarbenen Masse, der Maische oder Pulpe. Saverio, der den Mahlvorgang überwachte, wartete, bis der Brei die richtige Konsistenz hatte. Wie er sagt, hört er das am Geräusch der Mühlsteine. Dann kommt die Maische in ein Rührwerk, das sie laufend umwendet, bis winzig kleine Öltröpfchen aus den Zellmembranen der Oliven austreten und sich zu größeren Tropfen zusammenschließen, die sich leichter abscheiden lassen. Der versierte Ölmacher mischt die Maische nur so lange, bis sich das Öl konzentriert hat, aber nicht zu lange der Luft ausgesetzt ist, denn das lässt die Aromen entweichen und macht es schneller verderblich. Nach 20 Minuten bringt Saverio den Olivenbrei in die Zentrifuge ein, einen Stahlkanister, der an ein kleines Düsentriebwerk erinnert. Die Trommel erzeugt 3.000 Umdrehungen pro Minute, durch die sich das Öl von der Haut, den Kernen und dem Fleisch der Oliven trennt. Schließlich fließt es noch in eine kleinere vertikale Zentrifuge, die ihm das verbleibende Wasser entzieht.
Olivenöl ist das einzige kommerziell relevante Pflanzenöl, das aus einer Frucht gewonnen wird, nicht aus Samen – wie Sonnenblumen-, Raps- oder Sojaöl. Da die Früchte erhebliche Mengen an Wasser enthalten, kann die Extraktion rein mechanisch erfolgen, mit Hilfe einer Zentrifuge oder einer Presse, während Saatenöle generell den Einsatz industrieller Lösungsmittel erfordern, in aller Regel Hexan. Um dem Öl diese Lösungsmittel wieder zu entziehen und die üblichen negativen geschmacklichen und olfaktorischen Nebenwirkungen zu eliminieren, muss es in einer Raffinerie verarbeitet werden, wo es zum Entzug der Lösungsmittel, zur Neutralisierung, Desodorierung, zum Bleichen und zur Entschleimung hoch erhitzt wird. Das Resultat ist geschmack-, geruch- und farbloses flüssiges Fett. Olivenöl dagegen kann direkt gepresst oder aus der Olivenpulpe herauszentrifugiert werden, sodass reiner frischer Fruchtsaft entsteht, mit all seinen natürlichen Geschmacks-, Aroma- und Nährstoffen. Aus dem gleichen Grund ist Olivenöl das einzige Öl, bei dem die Qualität der Rohstoffe – der Oliven also – von grundlegender Bedeutung für die Güte des Öls ist. Um natives Olivenöl extra zu produzieren, braucht man erstklassige Oliven. Branchenübliches Saatenöl kann man genauso gut aus minderwertigen Kernen gewinnen.
Aus einem dünnen Röhrchen am Ende der Zentrifuge schoss in einem feinen smaragdgrünen Bogen das Öl hervor. Grazia fing eine kleine Menge in einem durchsichtigen Plastikbecher auf und reichte ihn mir. Dann füllte sie sich selbst einen zweiten Becher. Sie nippte an dem Öl, runzelte leicht die Stirn und versank in sich, als nehme sie das Rumpeln der Mühlsteine und das Dröhnen der Motoren um uns herum gar nicht mehr wahr. Sie hob ihren Becher, um das Öl im Sonnenlicht zu betrachten, das durch die hohen Fenster hereinfiel – als wolle sie einen Toast ausbringen. Das Öl hatte eine dunkle, erbsensuppengrüne Farbe, war durch die mikrofeinen Schwebstoffe aus dem Olivenbrei trüb und belebend herb. Es war warm und schmeckte – fühlte sich an – wie pures Lebenselixier: wie flüssige Gesundheit. »Das ist jedes Opfer wert«, meinte Grazia. Ihre Verträumtheit wich und sie verzog das Gesicht. »Na gut, sagen wir, manches Opfer.«
Obwohl die Familie De Carlo seit 400 Jahren Öl herstellt, haben ihr die letzten 30 Jahre vermutlich die größten Opfer abverlangt. 1972 gaben sie ein kleines Vermögen aus, um einen Brunnen 3.000 Meter tief in felsigen Boden zu bohren, und legten das erste Bewässerungssystem für Olivenbäume in Apulien an, wodurch sich Ertrag und Qualität ihrer Ernte deutlich verbesserte. (Andere örtliche Produzenten taten es ihnen umgehend nach.) Sieben Jahre später gehörten sie zu den ersten Ölerzeugern Italiens, die eine Zentrifuge einsetzten, um ihren Oliven das Öl zu entziehen, während andere Produzenten noch immer hydraulische Pressen verwendeten, die sich von denen der alten Römer kaum unterschieden. Wiederum gilt, dass die meisten italienischen Ölmacher, die auf Qualität setzen, seither auf Zentrifugen umgestellt haben, die nicht nur effizienter sind, sondern besseres Öl erzeugen. Seinerzeit musste sich Saverio aber sagen lassen, er sei verrückt, den guten Namen der Familie aufs Spiel zu setzen für eine neumodische Technik – vor allem als die ersten Chargen Öl, die er mit der Zentrifuge gewann, verheerend ausfielen.
»Das erste Jahr war eine Katastrophe«, erinnert er sich. »Wir kriegten die Einstellung der Zentrifuge nicht richtig hin. Das Öl war chemisch absolut einwandfrei, enthielt aber zu viel Chlorophyll und war deshalb furchtbar bitter – direkt ungenießbar.« Bauern, die ihre Ernte seit Generationen jedes Jahr zur Mühle der De Carlos gebracht hatten, taten Saverio als hoffnungslosen Exzentriker ab und suchten sich andere Mühlen. Der Techniker von Alfa Laval, der die Zentrifuge entwickelt hatte, war so entsetzt über das augenscheinliche Versagen seiner Maschine, dass er Selbstmord beging. Saverio arbeitete rund um die Uhr mit anderen Ingenieuren von Alfa Laval und mahlte eine Kiste Oliven nach der anderen, um die Anlage richtig einzustellen. Währenddessen gewann er manche seiner Kunden zurück, indem er auch wieder Pressen einsetzte. »Ich schluckte schwer an meinem Stolz, als ich die alten Anlagen wieder in Gang setzen musste. Doch wir hatten keine Wahl. Wir wären sonst untergegangen.«
Zur Erntezeit im Folgejahr lief Saverios Zentrifuge endlich rund und er stellte das beste Öl her, das seine Familie je produziert hatte. »Unsere Kunden beharrten zunächst auf dem Einsatz der Pressen, doch sie schauten herein und kosteten das Öl aus meiner Zentrifuge«, erzählte Saverio. »Sie sagten nichts. Ihre Mienen blieben unergründlich. Sie kosteten das Öl und gingen ihrer Wege. Doch wenn sie ihre nächste Ladung Oliven brachten, wollten sie sie zentrifugiert haben. Dieselben Leute, die mich noch ein Jahr zuvor beschuldigt hatten, mit meinen neumodischen Apparaten und verstiegenen Ideen meine Familie und den guten Namen meines Vaters zu ruinieren!«
Damals gehörten die De Carlos zu der Hand voll pugliesi, die natives Olivenöl extra produzierten. Die große Masse der Produzenten aus der Region stellten Lampantöl (lampante) her – minderwertiges Öl aus überreifen, herabgefallenen Oliven, die vom Boden aufgelesen wurden. Es wurde an Raffinerien verkauft, die unangenehme Geschmacks- und Geruchseigenschaften durch Hitzebehandlung, Aktivkohle und mit Hilfe anderer Verfahren beseitigten und »raffiniertes Olivenöl« lieferten – ein klares, geschmacksfreies, geruchloses Flüssigfett, das unter Zusatz einer kleinen Menge nativen Olivenöls extra im Laden als »Olivenöl« verkauft wurde. Saverio De Carlo löste mit dem Einsatz seiner Zentrifuge einen technischen Boom in der Olivenölproduktion aus, im Zuge dessen italienische Technologieunternehmen wie Pieralisi und Alfa Laval neue Anlagen zum Quetschen und Rühren von Oliven und zur Ölgewinnung entwickelten, mit denen die Produktion von hochwertigem Olivenöl immer leichter wurde. Die Familie De Carlo hat sie alle ausprobiert. Manche, wie die Zentrifuge, hat sie übernommen. Andere Systeme wie den Hammerzerkleinerer aus Edelstahl und die heute von vielen modernen Produzenten anstelle von Mühlsteinen eingesetzten Scheibenmahlwerke erwiesen sich als ungeeignet: Die De Carlos stellten fest, dass sich mit den altmodischen Mühlsteinen aus ihren lokalen hocharomatischen Coratina-Oliven feinere Öle herstellen ließen.
Die De Carlos waren Vorreiter einer regelrechten Renaissance des nativen Olivenöls extra in Italien. In den letzten 30 Jahren wurden fähige italienische Hersteller durch neue Ölproduktionstechniken und botanische und agrarwissenschaftliche Fortschritte im Olivenanbau in die Lage versetzt, die besten und gesündesten Öle aller Zeiten zu erzeugen. Italien ist eine langgezogene, schmale, gebirgige Halbinsel, die von den Alpen bis fast nach Afrika reicht, mit einer erstaunlichen Fülle an Mikroklimata und Bodenbeschaffenheiten und mehr Olivenbauern als jedes andere Land – 700, von denen schätzungsweise 500 weltweit anerkannt sind. Die Ölhersteller nutzen das reiche botanische Erbe heute ebenso wie die Önologen die Vielfalt der Trauben. Sie stellen Öle mit feinen neuen Düften, Aromen, Texturen und lokalem Charakter her. Und die Italiener wissen diese schönen neuen Öle zu schätzen wie nie zuvor: Öffentliche Öldegustationen und Kurse für Öl-Sommeliers gewinnen rasch an Popularität, in Anlehnung an Weinbars schießen »Ölbars« aus dem Boden und immer mehr Restaurants bieten neben einer Weinkarte auch eine Ölkarte an, auf der Öle mit unterschiedlichen Merkmalen passend zum jeweiligen Gericht empfohlen werden. Doch anderswo nimmt der Olivenölboom noch ganz andere Formen an: In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich der Verbrauch in Nordamerika nahezu verdoppelt, in Nordeuropa verdreifacht und in manchen Teilen Asiens sogar versechsfacht.
Trotz dieses florierenden Markts haben die De Carlos und mit ihnen fast alle anderen großen und kleinen Hersteller qualitativ hochwertiger Olivenöle zu kämpfen. In den letzten zehn Jahren ist der Großhandelspreis für italienisches Olivenöl der Güteklasse »nativ extra« – oder jedenfalls als solches eingestuftes – in den Keller gegangen. Auf dem Rohstoffmarkt in Bari wird es derzeit zu 2 Euro pro Kilo gehandelt – ein historischer Tiefststand. Die von den De Carlos beschäftigten Olivenpflücker – Ortsansässige, deren Vorfahren schon seit Generationen die Ernte der Familie einbrachten – werden zu alt für die Arbeit in den Bäumen und die Tätigkeit ist zu anstrengend, als dass sich ihre Kinder dafür interessieren würden. Die seltene Kunst des Olivenschneiders, den Grazia als den »Couturier der Landschaft, den Künstler, der darüber bestimmt, ob Sie in diesem Jahr etwas ernten oder nur am Fenster stehen und zusehen« bezeichnet, gerät in Vergessenheit. Hunderte Olivenölproduzenten haben bereits aufgegeben, und wenn die Preise für hochwertiges Olivenöl nicht bald anziehen, werden das noch viele weitere tun müssen. Francesco und Marina De Carlo sind ihres Wissens die einzigen jungen Leute, die in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und sich dem Olivenölgeschäft widmen. »Man rennt immer wieder gegen Wände – Unrecht, Verwerfungen und schmutzige Geschäfte, wie es sie in anderen Branchen nicht gibt«, erzählt Marina, der ihr rundliches Gesicht mit der kleinen Lücke zwischen den Schneidezähnen eine kindliche Naivität verleiht – die sich aber sofort verliert, wenn sie mit einem Kunden telefoniert. »Wenn ich mich mit Kommilitonen von der betriebswirtschaftlichen Fakultät unterhalte, die in anderen Branchen arbeiten, versteht niemand, warum ich daran festhalte. Manchmal verstehe ich es selbst nicht.« Die Zeit ist reif für die Herstellung der besten Öle in der italienischen Geschichte – doch nur wenige italienische Produzenten können sich diesen Luxus leisten.
Wie Flavio Zaramella glauben auch Grazia und Saverio, dass diese schizophrene Situation auf die zweifelhafte Jungfräulichkeit der meisten Olivenöle zurückzuführen ist – in Italien und anderswo. Um die gesetzlichen Anforderungen an die geschmacklichen und chemischen Eigenschaften der Qualitätsbezeichnung »nativ extra« zu erfüllen, muss ein Öl aus einwandfreien, fachmännisch gepflückten Oliven hergestellt sein, die innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte vermahlen wurden, damit sie aromatisch bleiben und unverdorben sind. Die Produktion ist daher viel aufwendiger, teurer und arbeitsintensiver als bei Lampantöl aus herabgefallenen Oliven. Wenn die Gesetze aber nicht strikt angewendet werden, lässt sich Öl der Qualitätsstufe »nativ extra« leicht mit billigeren Ölen verschneiden, die aus minderwertigen Oliven oder ganz anderen Substanzen bestehen, was für ehrliche Produzenten unfairen Wettbewerb bedeutet. »Wenn ich 8 Euro für einen Liter Öl berechne – ein Preis, der kaum meine Kosten deckt –, bezeichnen das manche Kunden als Diebstahl«, stellt Grazia mit bitterem Lächeln fest. »Sie erzählen mir, sie hätten sich gerade im Supermarkt ein 100 Prozent italienisches Öl der Qualität »nativ extra« für 1,90 Euro gekauft. Mich würde wirklich mal interessieren, was hinter dem eindrucksvollen Etikett steckt, wenn schon miserables falsches Extra-Vergine-Öl im Großhandel 2 Euro der Liter kostet!« Nach unserem Besuch in der Mühle fuhren mich Grazia und Saverio in einem klapprigen Fiat Panda mit Vierradantrieb durch ihre Olivenhaine. Sie wollten mir zeigen, was zur Herstellung von erstklassigem Öl nötig ist – und was sie kostet. Eine Schotterstraße wand sich durch von niedrigen gelben Kalksteinmauern gesäumte Felder. Die über ein Gebiet von 25 Quadratkilometern verstreuten Ländereien der De Carlos werden in tenute unterteilt, die wiederum aus kleineren contrade