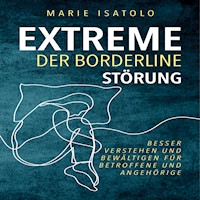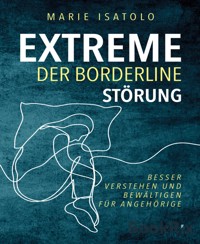
9,99 €
Mehr erfahren.
Borderline besser verstehen
In diesem Ratgeber erfahren Sie nicht nur alles über die Krankheit, sondern auch, wie Sie damit umgehen und was Sie dagegen unternehmen können!
Sind Sie selbst betroffen oder aber durch den (engen) Kontakt zu einem erkrankten Menschen involviert? Viele Leute kennen zwar den Begriff „Borderline“ und haben bereits etwas darüber gehört, aber trotzdem Schwierigkeiten, das Krankheitsbild nachzuvollziehen und mit den Folgen für das tägliche Miteinander umzugehen…
Denn die Borderline-Persönlichkeitsstörung nimmt nicht nur erheblichen Einfluss auf das Leben des Betroffenen, sondern ebenso auf das seines Umfelds. Auch Bezugspersonen oder Angehörige leiden unter der Krankheit.
✓Was genau ist Borderline?
✓Wie geht man mit dieser psychischen Krankheit und davon Betroffenen um?
✓Wie wirkt sich Borderline auf Bezugspersonen aus? Wann wird es Zeit für Sie, die Reißleine zu ziehen?
✓Was kann Positives Denken im Umgang mit Borderline bewirken? Wie lassen sich solche Techniken im Alltag einbinden?
Zahlreiche Tipps und Tricks sowie praktische Übungen werden Ihnen helfen, Ihren Alltag zu meistern und ein unbeschwertes Leben mit Borderline anzustreben. Gerade als Außenstehende können Sie einen erheblichen Teil zum Behandlungsprozess beitragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Extreme der Borderlinestörung
Besser verstehen und bewältigen für Betroffene und Angehörige
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Extreme der Borderline Störung
Besser verstehen und bewältigen für Betroffene und Angehörige
Marie Isatolo
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Extreme der Borderline Störung Copyright © 2020 Marie Isatolo
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Auflage 2020
Vorwort
Millionen von Menschen leben mit der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Hinzu kommt eine Dunkelziffer an (noch) nicht diagnostizierten Fällen. Ebenso wie leider zahlreiche andere psychische Erkrankungen, gehört die Krankheit für viele Menschen inzwischen daher zum Alltag dazu. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht: Borderliner begegnen uns in unserem Umfeld und täglichen Leben weitaus häufiger als gedacht. Für Erkrankte ist es normal, dass die eigene Gefühlswelt Achterbahn fährt. Für ein turbulentes Auf und Ab in ihrem Leben muss es für Borderliner (und deren Angehörige) nicht erst in den Freizeitpark gehen.
Wenn Sie sich für dieses Buch entschieden haben, haben Sie wahrscheinlich bereits erste Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit gemacht. Ihnen ist Borderline zwar ein Begriff; aber damit richtig umgehen können? Wie ich selbst lernen musste, sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe…
Stellen wir uns gemeinsam der herausfordernden Realität, mit der uns Borderline immer wieder konfrontiert. Es bleibt nicht nur theoretisch, sondern auch praktische Übungen und Ratschläge aller Art werden Ihnen helfen, Ihren Lebensalltag zu meistern. Machen Sie sich also bereit und gehen Sie mit dieser Lektüre den ersten Schritt in ein erfülltes Leben – trotz beziehungsweise mit Borderline.
Einleitung
So schwierig die Definition von Borderline auch sein mag, eines lässt sich sicher sagen: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung kann extrem sein. Extreme Stimmungsschwankungen und damit einhergehende impulsive Verhaltensänderungen sorgen nicht nur dafür, dass Erkrankte stark darunter leiden, sondern all dies kann darüber hinaus sehr belastend für ihre Bezugspersonen sein. Dieses Buch richtet sich daher nicht nur an Personen, die selbst an der Borderline-Störung erkrankt sind, sondern in erster Linie an Angehörige und an Sie alle, die – in welcher Form auch immer –involviert sind.
Genauso wie Betroffene lernen müssen, mit der Krankheit umzugehen und zu leben, müssen Sie das auch. Trotz des manchmal schwer nachvollziehbaren Verhaltens und des dadurch kräftezehrenden Umgangs damit, gibt es Mittel und Wege, gut mit Borderline und daraus resultierenden eventuellen Einschränkungen zu leben.
So erwartet Sie neben einer inhaltlichen Einführung und fundiertem Wissen über die Hintergründe der Persönlichkeitsstörung sowie über Therapieansätze genau das: Es gibt immer wieder konkrete Ratschläge und viele praktische Hilfestellungen für den Alltag. Sie erhalten Hilfe zur Selbsthilfe.
Wie gelingt eine Beziehung zu einer Person mit Borderline? Gibt es dafür ein Rezept? Nein, eine genaue Anleitung werden Sie in diesem Buch nicht finden. Das liegt auch speziell an dem Krankheitsbild. Fast ebenso schwierig ist auch die Beschreibung eines „Musterpatienten“, anhand dessen ich Ihnen die Krankheit nahebringen könnte. Trotzdem bekommen Sie einen Einblick in die Psyche eines Betroffenen und erfahren wertvolle Tipps im Umgang mit dieser unberechenbaren Krankheit.
Egal, ob Sie in einem freundschaftlichen oder partnerschaftlichen Verhältnis zu einer erkrankten Person stehen: Ich unterstütze Sie in Ihrer Beziehung und zeige Ihnen, worauf Sie achten, aber auch, auf was Sie sich vorbereiten müssen. Für nicht vermeidbare Konflikte wird es konkrete Konfliktlösungsstrategien geben, die Sie im Alltag anwenden können.
Angehörige sollen in erster Linie auch davor bewahrt werden, in die Krankheit verstrickt zu werden. Selbstfürsorge ist unentbehrlich, um beispielsweise Co-Abhängigkeit zu vermeiden. Das heißt, dass Sie einen gesunden Abstand zu dem Betroffenen einnehmen sollten. Ich möchte Sie aber dennoch dazu ermutigen, als Unterstützung zu fungieren. Denn eine angemessene Distanz bedeutet nicht, dass Sie sich gänzlich zurückhalten sollen. Ihr Einsatz ist genauso notwendig wie der des direkt Betroffenen auch.
Gerade zum Ende dieses Ratgebers finden sich für Sie beide zahlreiche Strategien und Methoden, die sich leicht in Ihr Leben integrieren lassen. Ich möchte Sie ausdrücklich dazu auffordern, diese praktischen Übungen umzusetzen und zumindest einige davon in Ihren Alltag einzuflechten.
Sehen Sie dieses Buch als nützlichen Wegbegleiter und wappnen Sie sich für den Kampf gegen – oder vielmehr für ein Leben mit – Borderline.
Persönlichkeitsstörungen
Um Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen und die Borderline-Störung im Speziellen zu verstehen, möchte ich Ihnen zunächst einmal aufzeigen, wie sich der Begriff der Störung einordnen lässt. Diese sehr negativ behaftete und eingesetzte Bezeichnung kann nicht vollständig beschönigt werden, doch möchte ich die Extremität davon bewusst abschwächen, um zu zeigen, dass es sich hierbei oft nicht um eine ausweglose Krankheit handelt, sondern um einen Zustand, der behoben werden kann.
Störung im eigentlichen Sinne
Denn definiert man den ganz ursprünglichen Begriff der Störung, so bezeichnet dies nichts anderes als eine „Minderung der gewohnten Ordnung“ (siehe Digitales Wörterbuch für Deutsche Sprache). Damit ist gemeint, dass die betroffene Person in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist, eine bestimmte Tätigkeit oder ein als normal betrachtetes Verhalten an den Tag zu legen. Diese Beeinträchtigung kann unterschiedliche Ausmaße haben, sie lässt sich jedoch nicht selten, wenn nicht sogar immer, beheben. Es ist lediglich erforderlich, die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen und dementsprechend zu handeln.
Psychische Störung
Nun ist es aber so – und das möchte ich Ihnen natürlich nicht verheimlichen –, dass die Störung in der Psychologie eine etwas andere, von der hier eingeführten Definition abweichende Bedeutung hat. In der Psychologie spricht man von einer psychischen Störung, wenn es sich um ein Krankheitsbild handelt, das aufgrund psychischer Symptome eine Behandlung erfordert. Aber auch diese kann durchaus als kurzfristig beziehungsweise vorübergehend eingestuft werden.
Wichtig, zu verstehen, ist, dass eine solche Beurteilung umweltbezogen zu betrachten ist. Konkret bedeutet dies, dass anhand des Umfelds klassifiziert wird, was als gesund bezeichnet wird und was nicht. Eine Störung einer wie auch immer gearteten Funktion oder Verhaltensweise wird dann als solche definiert, wenn sie deutlich von dem allgemein anerkannten und erwarteten Verhalten des Menschen abweicht. Das heißt nicht, dass eine solche Einschätzung im Auge des Betrachters liegt, allerdings verstehen Sie dadurch hoffentlich, dass eine psychische Störung nicht als unbehandelbarer Charakterzug eines Menschen zu sehen ist. Eine solche Einschränkung sollte lediglich als genau das betrachtet werden: ein persönliches Hindernis, das (mit Hilfe) überwunden werden kann.
Wie bereits im Namen enthalten, handelt es sich bei einer Persönlichkeitsstörung um eine bestimmte Art der menschlichen Störung. Dafür gibt es basierend auf der allgemeinen Umfeldbetrachtung einige offizielle Merkmale und Kennzeichen. Diese möchte ich Ihnen im Folgenden näher erläutern.
Definition
Der Begriff Persönlichkeitsstörung setzt sich zusammen aus den beiden Begriffen „Persönlichkeit“ und „Störung“. Folglich handelt es sich dabei um ein gestörtes, also von der Norm abweichendes Verhaltensmuster einer Person. Dieses Verhalten zeichnet sich gewöhnlich durch einen fortbestehenden Zustand aus, in dem die betroffene Person es nicht schafft, flexibel und angemessen auf bestimmte (gesellschaftliche) Situationen zu reagieren. Stattdessen wird ihr Agieren geprägt durch scheinbar unveränderliche Reaktionen. Diese werden als unangemessen betrachtet oder weichen von dem ab, was gemeinhin als Normalzustand bezeichnet wird.
Um den Zusammenhang besser zu verstehen, ist es sinnvoll, die sogenannten physiologischen Persönlichkeitszüge zu verstehen. Diese Theorie besagt, dass es möglich ist, eine Persönlichkeit anhand von fünf verschiedenen Faktoren zu beurteilen. Diejenigen Faktoren sind:
Extraversion: gekennzeichnet durch Aktivität, Abenteuerlust, Fröhlichkeit, Herzlichkeit, Geselligkeit und Dominanz; Gegenpol zur Introversion
Gewissenhaftigkeit: gekennzeichnet durch Umsichtigkeit, Ordentlichkeit (in extremer Ausprägung Perfektionismus), Pflichtbewusstsein, Ehrgeiz, Selbstdisziplin und Besonnenheit
Offenheit: gekennzeichnet durch intellektuelle Neugier, Flexibilität, Unkonventionalität, Gefühl für Kunst, Kreativität und liberale politische Einstellungen
Verträglichkeit: gekennzeichnet durch Gutgläubigkeit, Aufrichtigkeit, Großzügigkeit, Versöhnlichkeit, Bescheidenheit und Gutmütigkeit
Neurotizismus oder emotionale Stabilität: Emotionalität bzw. emotionale Labilität, die mit Intensität und Kontrolle von emotionalen Reaktionen und Abläufen zusammenhängt
Dass eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, ist dann der Fall, wenn eines dieser Merkmale stark dominiert und es dadurch zu einem gestörten subjektiven Gesundheitszustand oder zu einem abweichenden Sozialverhalten kommt. Ebenso kann sie sich durch nicht konformes berufliches Verhalten äußern. Außerdem muss diese Störung als beständig und als Beeinträchtigung für das Leben des Betroffenen kategorisiert werden. Wie Sie sehen, lässt sich diese Eigenschaft wieder auf die eigentliche Störungsdefinition zurückführen.
ICD-10 Klassifizierung
Der ICD-Schlüssel findet in der Medizin Anwendung, um Diagnosen systematisch eingruppieren zu können. Veröffentlicht wurde er von der Weltgesundheitsorganisation und wird von dieser auch fortwährend bearbeitet. Die Abkürzung ICD bedeutet „International Classification of Diseases“, lässt sich also übersetzten mit "Internationale Klassifikation von Krankheiten".
Bei der ICD-10 Klassifizierung handelt es sich also so gesehen um ein international anerkanntes Nachschlagewerk beziehungsweise einen Katalog, in dem psychische Krankheiten aufgeführt und gruppiert sind. Die 10 steht dabei für die zehnte Version dieses Schlüssels. Der Aufbau einer jeden Klassifikation ist folgender: Es gibt für jede Diagnose einen fünfstelligen Code mit dem Format X00.00 (X ist hier ein Platzhalter für jegliche Buchstaben des deutschen Alphabets und die Nullen sind Platzhalter für Ziffern zwischen 0 und 9). Anhand der ersten drei Stellen lässt sich die ungefähre Diagnose der Krankheit für Fachleute erkennen, die durch die anderen darauffolgenden Stellen spezifiziert wird – bis auf die letzte Ziffer, die der Lokalisation dient.
Für die Persönlichkeitsstörungen ergibt sich die folgende Liste:
paranoide Persönlichkeitsstörung (F60.0)
schizoide Persönlichkeitsstörung (F60.1)
schizotype Persönlichkeitsstörung (F21)
dissoziale Persönlichkeitsstörung (F60.2)
impulsive Persönlichkeitsstörung (F60.30)
Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31)
histrionische Persönlichkeitsstörung (F60.4)
anankastische Persönlichkeitsstörung (F60.5)
ängstliche Persönlichkeitsstörung (F60.6)
asthenische Persönlichkeitsstörung (F60.7)
andere spezifische Persönlichkeitsstörung (F60.8):
narzisstische Persönlichkeitsstörung
exzentrische Persönlichkeitsstörung
haltlose Persönlichkeitsstörung
unreife Persönlichkeitsstörung
passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
neurotische Persönlichkeitsstörung
kombinierte Persönlichkeitsstörung (F61.0)
Borderline – begriffliche Einordnung
„Borderline“ kommt aus der englischen Sprache und lässt sich übersetzen mit „Grenzlinie“. Entstanden ist die Bezeichnung dadurch, dass die psychische Krankheit sich nach damaligem Kenntnisstand zwischen dem Krankheitsbild einer Neurose und dem einer Psychose angesiedelt hat. Verantwortlich für diese Bezeichnung war der Psychiater C.H. Hughes im Jahr 1884.
Im Lexikon der Psychologie sind die beiden Begriffe „Neurose“ und „Psychose“ wie folgt definiert:
Neurose: Hierbei handelt es sich um eine psychische Störung, deren Ursachen im Unterbewusstsein liegen. Man nimmt an, dass unbewusste Konflikte zu Symptomen führen, für die es keinerlei umweltbedingte oder sonstige äußere Einflüsse gibt. Solche Symptome äußern sich unter anderem in Ängsten, zwanghaftem Verhalten oder in scheinbar unerklärlichen Lähmungen. Es gibt unterschiedliche Formen einer Neurose, beispielsweise Angstneurosen, Charakterneurosen, depressive Neurosen, Hysterie, narzisstische Neurosen oder Zwangsneurosen.
Psychose: Im Gegensatz zur Neurose äußert sich eine Psychose dadurch, dass es sich hierbei um einen tiefgründigeren, wahnhaften psychischen Zustand handelt. Wahnhaft bedeutet, dass es sich um eine schwerwiegende psychische Krankheit handelt, die sich durch Realitätsverlust auszeichnet. Ausgelöst wird dieser ebenfalls ohne erkennbare äußerliche Umstände, aber zum Beispiel können solche Phasen auch durch bewusstseinserweiternde Substanzen wie Drogen oder aber durch Gehirnverletzungen herbeigeführt werden.
Heutzutage ist man sich einig, dass sich die Borderline-Störung als emotional instabile Persönlichkeitsstörung einordnen lässt (siehe die Einordnung in der ICD-10 Klassifizierung).
Ausprägung
Fahren Sie gern Achterbahn? Unabhängig von Ihrer Antwort und Präferenz können Sie sich ganz bestimmt etwas unter einer Achterbahnfahrt vorstellen. Genau mithilfe dieses Bildes möchte ich Ihnen dabei helfen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu verstehen: Dabei fährt nämlich die Gefühlswelt der betroffenen Person sprichwörtlich Achterbahn. Während dieses emotionalen Aufs und Abs scheint ein Entkommen ausweglos – Betroffene können nicht einfach „Stopp“ sagen und aussteigen. Sie sehen sich zu nichts anderem in der Lage, als diesen temporären Hoch- oder Tiefpunkt mitzuerleben. Nicht selten kann dies für Betroffene selbst, aber auch für Angehörige zum Horrortrip werden.
Mehr als nur alltägliches Gefühlschaos
Dadurch wird auch direkt offensichtlich, dass es sich nicht nur um ein alltägliches Chaos in der Gefühlswelt eines Menschen handelt, mit dem man lernen muss, umzugehen. Es ist Betroffenen nicht möglich, sich „einfach einmal zusammenzureißen“, wie es so schön heißt. Es handelt sich hierbei um eine ernstzunehmende psychische Krankheit im Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Auch, wenn man es den meisten Betroffenen gerade durch die verschiedenen (emotionalen) Phasen nicht direkt anmerkt oder ansieht, so ist das Krankheitsbild nicht zu unterschätzen und kann sehr gefährlich sein.
Nichtsdestotrotz kann man lernen, mit der Krankheit zu leben und vor allem in Verbindung mit einer Therapie eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln. Um Ihnen als Angehöriger verständlich zu machen, womit Sie es genau zu tun haben, muss man die Zusammenhänge der Borderline-Persönlichkeitsstörung erkennen und verstehen. In diesem Unterkapitel geht es folglich um die Ausprägung der Krankheit.
Emotionale Labilität
Borderline zeichnet sich dadurch aus, dass die betroffene Person emotional labil und instabil ist. Dazu gehören mitunter extreme Stimmungsschwankungen, instabile (Partner-) Beziehungen und ein verzerrtes und unsicheres Selbstbild, das vielfach zur Selbstverletzung führt. Das beeinträchtigt nicht nur erheblich das Leben der betroffenen Person selbst, sondern hat auch einen negativen Einfluss auf deren persönliches Umfeld und ihre Umwelt.
So leiden Betroffene, aber auch Angehörige unter extremen Ausbrüchen, die nicht selten unvorhersehbar sind. Diese Impulsivität kann sowohl hysterische Momente oder übertriebene Glücksgefühle auslösen als auch Wutausbrüche fördern. So kann es in einem Moment vorkommen, dass die Person (in einer Beziehung) auf Wolke 7 schwebt, im nächsten Moment aber, von Zweifeln oder Frustrationserlebnissen geprägt, dem Mitmenschen – verbal oder im wahrsten Sinne des Wortes – Dinge um die Ohren schmeißt. Oft trägt der streitsüchtige Charakter eines Borderliners dazu bei, dass Konflikte jeglicher Art im alltäglichen Bereich entstehen.
Selbstschädigendes Verhalten
Nicht unbedingt alltäglich, aber ebenfalls charakteristisch für Borderline sind selbstverletzende Handlungen. Grund dafür ist, dass das Selbstbild von Betroffenen gestört ist, aber auch die Tatsache, dass nach wankelmütigen Beziehungen häufig emotionale Leere folgt. Die Konsequenz daraus ist oftmals das Bedürfnis, sich selbst etwas anzutun. Zu einer solch selbstdestruktiven Verhaltensweise gehören unter anderem das Ritzen oder andere parasuizidale Handlungen, im Extremfall sogar Selbstmord. Experten schätzen, dass ungefähr 60 % der betroffenen Patienten mindestens einen Suizidversuch geplant und auch durchgeführt haben.
Parasuizidale Handlungen sind selbstverletzende Handlungen, die scheinbar mit einer suizidalen Intention durchgeführt werden, aber nicht zum Selbstmord führen. Personen, die dementsprechend handeln, beabsichtigen nicht, sich das Leben zu nehmen, sondern verletzen sich nur leicht bis mittelmäßig. Daraus folgen weder lebensgefährliche Verletzungen noch der Tod selbst.
Der Psychologe Theodore Millon hat die Persönlichkeitsstörung und ihre Ausprägung in vier Untergruppen eingeteilt. Diese Einschätzung findet auch heutzutage noch viele Befürworter, wenngleich es dazu keinen wissenschaftlichen Konsens gibt. Um Borderline zu verstehen, hilft es jedenfalls enorm, folgende Typen von Borderlinern zu erkennen und zu durchschauen:
Entmutigt
Impulsiv
Mürrisch
Selbstzerstörerisch