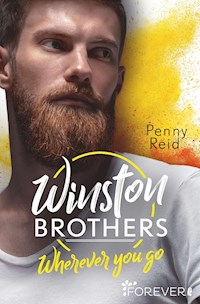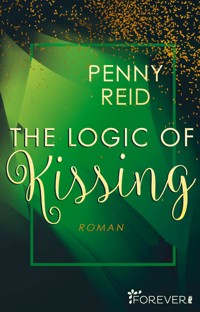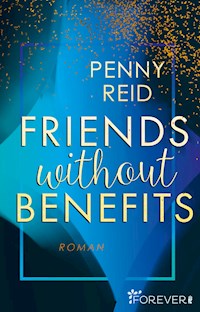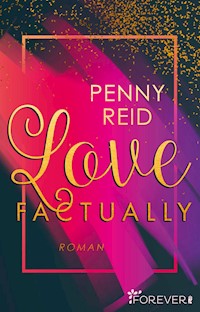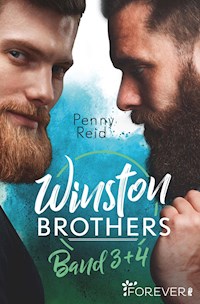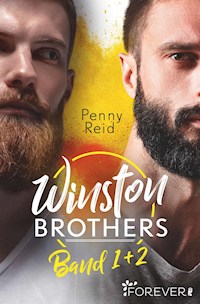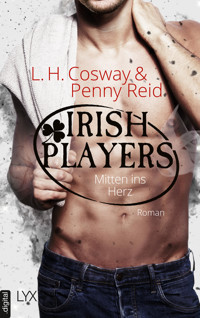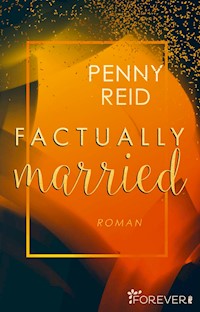
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knitting in the City
- Sprache: Deutsch
Das direkte Sequel zu Band 1 der Reihe! Nach nur fünf Monaten Beziehung ist Quinn bereit, Janie einen Antrag zu machen. Mehr als bereit. Wenn es nach ihm ginge, könnten sie den Antrag, die Hochzeit und das erste Kind gleich am selben Tag abarbeiten. Und damit praktischerweise das ganze Drama, das die vier Phasen des Heiratens - Verlobung, die Schwiegereltern treffen, Junggesellenabschied und nervige Hochzeitsspielchen - mit sich bringt, umgehen. Aber Janie durchkreuzt seine effizienten Pläne und verlangt als Beweis für seine Liebe, dass sie alles, vom Tanzkurs bis zum Fotoshooting, durchziehen. Egal wie banal es scheint. Wird Quinn es bis zum großen Tag durchhalten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Factually married
Die Autorin
Penny Reid ist USA Today Bestseller-Autorin der Winston-Brothers-Serie und der Knitting-in-the-city-Serie. Früher hat sie als Biochemikerin hauptsächlich Anträge für Stipendien geschrieben, heute schreibt sie nur noch Bücher. Sie ist Vollzeitmutter von drei Fasterwachsenen, Ehefrau, Strickfan, Bastelqueen und Wortninja.
Das Buch
Nach nur fünf Monaten Beziehung ist Quinn bereit, Janie einen Antrag zu machen. Mehr als bereit. Wenn es nach ihm ginge, könnten sie den Antrag, die Hochzeit und das erste Kind gleich am selben Tag abarbeiten. Und damit praktischerweise das ganze Drama, das die vier Phasen des Heiratens - Verlobung, die Schwiegereltern treffen, Junggesellenabschied und nervige Hochzeitsspielchen - mit sich bringt, umgehen. Aber Janie durchkreuzt seine effizienten Pläne und verlangt als Beweis für seine Liebe, dass sie alles, vom Tanzkurs bis zum Fotoshooting, durchziehen. Egal wie banal es scheint. Wird Quinn es bis zum großen Tag durchhalten?
Von Penny Reid sind bei Forever erschienen:In der Winston-Brothers-Reihe:Wherever you goWhatever it takesWhatever you needWhatever you wantWhenever you fallWhen it countsWhen it's real
In der Knitting-in-the-City-Reihe:Love factuallyFriends without benefitsFactually married
Penny Reid
Factually married
Roman
Aus dem Amerikanischen von Peter Groth
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juni 2020 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Copyright © 2014. Neanderthal marries Human by Penny ReidTitel der amerikanischen Originalausgabe: Neanderthal marries Human (Penny Reid 2014)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-522-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Die Falle aufstellen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Die Verlobung
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Die Hochzeit planen
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Die Familie treffen
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Viva Las Vegas!
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Die Hochzeit
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Was in Vegas geschieht … die fehlende Szene
Anhang
Leseprobe: Friends without benefits
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Die Falle aufstellen
Die Falle aufstellen
Kapitel 1
Janie
»Ihr habt also Black Rod, den Pförtner des Schwarzen Stabes, und Silver Stick, den Silberstab?«
»Ja, genau.«
»Und was war noch gleich die Aufgabe von Black Rod?«
»Er beordert das Unterhaus, also das Parlament, zum Oberhaus, dem House of Lords.«
»Doch sie schlagen ihm die Tür vor der Nase zu? Die Leute vom Unterhaus?«
»Ja.«
»Und er muss noch einmal anklopfen?«
»Ja.«
Ich rümpfte die Nase, als ich mir das anhörte. Der ganze britische Pomp war in seinem Zauber genauso unergründlich wie die Berühmtheit einer Kim Kardashian. Logisch nachvollziehbar war beides nicht.
Als Quinn letzte Woche erklärt hatte, dass wir nach London reisen würden, war eine meiner ersten Handlungen, mich nach einer Strickgruppe in der Stadt umzusehen. Ich fand die Gruppe Londoner Masche, die für alle Interessenten offen war, die in der Region lebten oder auf der Durchreise waren.
Sie trafen sich an verschiedenen Orten in der Stadt und kamen mehrmals die Woche zusammen. Manchmal trafen sie sich in einer Weinbar in Covent Garden, ein anderes Mal in einem Pub, und manchmal – wie an diesem schönen Donnerstagabend – versammelten sie sich zum Abendessen in einem Restaurant der Markthalle von Spitalfields Market, direkt im Osten der City of London.
Ein weiterer Pluspunkt dieser Strickgruppe: Ihnen war es egal, dass ich nicht strickte.
Ich betrachtete den gelben Schal in Bridgetts Händen – sie war eine schnelle Strickerin –, dann blickte ich in die gewölbeartige Weite der Markthalle hinter ihr. Vor ungefähr einer Stunde waren die Verkäufer gegangen, die normalerweise den Markt bevölkerten, und hatten eine widerhallende gähnende Leere zurückgelassen.
Fasziniert runzelte ich die Stirn. »Aber dann machen sie die Tür doch auf, oder? Um den Black Rod hineinzulassen?«
»Ja«, entgegnete Bridgett.
»Und sie dürfen ihn auch gar nicht draußen lassen, oder?«
Sie nickte, während sich die Haut um ihre Augen kräuselte. Nach den Falten um Augen und Mund zu urteilen, schien Lächeln der natürliche Ausdruck ihres Gesichts zu sein.
»Ja, so ungefähr. Das Unterhaus hat kein Recht, den Mann fernzuhalten. Sie können seine Anwesenheit nur infrage stellen. Indem sie die Türen schließen, lassen sie symbolisch die Muskeln spielen. Das ist eine Erinnerung an die Lords und die Monarchie, dass das Unterhaus nicht vor ihren Launen einknickt.« Bridgett schmunzelte vergnügt, dann kicherte sie los. »Das ist alles ganz schön albern, oder? Wenn man es einem Fremden erzählt, dann klingt es ziemlich albern. Aber wahrscheinlich hören sich alle Traditionen irgendwie albern an, wenn man sie erklärt oder beschreibt.«
Ich nickte über ihre Aussage. Das war ein kluger Gedanke, den man sich für später merken sollte. Ich speicherte ihn in meinem Gedächtnis, um ein anderes Mal darüber nachzugrübeln.
Bridgetts Tochter Ellen lächelte mich über ihre Häkelarbeit hinweg an. »Habt ihr keine Eigenheiten bei der Regierung in den Vereinigten Staaten oder – wie ich sie gern nenne – den abtrünnigen Kolonien?«
»Abgesehen davon, dass sie völlig inkompetent und selbstsüchtig ist? Nicht, dass ich wüsste.«
»Wenn ihr euch einen Black Rod und Silver Stick anschafft, um dem Senat die Tür vor der Nase zuzuschlagen, dann würdet ihr vielleicht herausfinden, dass sich die Kompetenz eurer Regierung auf mysteriöse Weise verbessert.«
»Das wäre eine Überlegung wert«, sagte ich.
Bridgett lächelte ihrer Tochter augenzwinkernd zu, dann wandte sie den Blick zurück zu ihrem Schal, während sie weiter über das Thema sprach. »Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Traditionen – so lächerlich sie vielleicht auch klingen – ihren echten Verdienst haben. Tradition schafft Vertrauen und gibt den Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Wenn du weißt, was du erwarten kannst, dann wirst du Teil des Ganzen, selbst wenn es nur passiv ist. Übergangsriten sind notwendig, und Traditionen überdauern, weil sie ihren Wert haben. Ich glaube, eure Generation unterschätzt die Bedeutung von Traditionen und allem, was ehrwürdig ist.«
Nach der Hälfte ihrer kurzen Rede begann ich zu nicken. Ihre Worte klangen erneut vernünftig. Bevor ich noch die Konsequenzen ihrer Aussage überdenken konnte, vernahm ich ein summendes Geräusch zu meiner Linken, spürte die Vibration an meinem Bein und kämpfte gegen mein anfängliches Verlangen, laut zu murren.
Es war mein Mobiltelefon.
Jemand rief mich an.
Beim Thor!
Da saß ich nun zwischen ungefähr siebzehn bis dreiundzwanzig entzückenden Damen – die genaue Zahl kannte ich nicht, da ein paar von ihnen während der vergangenen zwei Stunden gekommen und andere gegangen waren und ich noch nicht wieder nachgezählt hatte – und genoss unser Gespräch über die Eröffnungszeremonien des Parlaments. Und plötzlich unterbrach so ein Gesprächsquerschläger – wahrscheinlich vom anderen Ende der Welt – meinen angenehmen und zugleich verwirrenden Informationsaustausch.
Ich warf Ellen und Bridgett einen entschuldigenden Blick zu. »Es tut mir leid. Es ist mein Handy. Jemand ruft mich an.«
Bridgett zuckte mit den Schultern, völlig unberührt von der Unterbrechung. »Das ist schon in Ordnung, meine Liebe. Geh und kümmere dich darum.«
Ich griff nach meiner Tasche, wobei ich trotz Bridgetts fehlender Entrüstung noch immer über die Unterbrechung verärgert war. Während ich nach dem Handy suchte, dachte ich über unser Gespräch zum Black Rod nach. Wenn man mich zwei Stunden zuvor danach gefragt hätte, dann hätte ich es wohl für völlig unlogisch gehalten, eine Handlung nur deshalb auszuüben oder zu unterstützen, weil sie schon immer so gemacht wurde, ohne einen Gedanken an ihre Nützlichkeit oder Notwendigkeit zu verschwenden. Ich erkannte, dass diese Unterscheidung die Grenze zwischen Fortschritt und Tradition war.
Ich zog das verfluchte Gerät aus meiner Umhängetasche und stand auf. Stevens Name war auf dem Display zu sehen. Wenn mein Telefon nicht stumm geschaltet wäre, dann hätte ich It’s Raining Men gehört, was Stevens persönlicher Klingelton war. Ich hatte nicht die Fähigkeit – und ehrlich gesagt auch nicht das Verlangen –, es in den Einstellungen des Geräts zu ändern.
Unabhängig von meinen warmherzigen Gefühlen für Steven war die erbitterte Abneigung gegenüber dem Klingeln meines Mobiltelefons fest in meiner DNS verankert – wie auch meine Vorliebe für Cosplay oder mein zwiespältiges Verhältnis zu Reality-TV.
Ich wischte mit dem Daumen über den Screen, während ich zum Ausgang des Restaurants ging. Nur weil man mir das verfluchte Ding aufs Auge gedrückt hatte, hieß das noch lange nicht, dass ich so eine Person war, die sich in Hörweite ihrer Begleitung am Handy unterhielt.
»Hallo?« Ich versuchte, nicht allzu mürrisch zu klingen. Und versagte kläglich.
»Hey, Janie! Wo bist du? Ist Mr Sullivan bei dir?«
»Nein. Ich bin bei einer Strickgruppe. Er ist nicht bei mir.«
»Oh, ich dachte, ihr zwei – Moment mal, du strickst? Warum wusste ich nicht, dass du strickst?«
»Ich stricke nicht.«
»Aber du hast doch gerade gesagt …«
»Steven, gibt es einen Grund für deinen Anruf?« Ich spähte zu Jacob, einem meiner Beschützer, und lächelte kurz, dann ging ich ein paar Schritte in die Halle des Spitalfields Market, wobei meine zehn Zentimeter hohen Absätze laut auf dem Boden hallten. »Denn das ist eindeutig ein Gespräch, das wir auch irgendwann später und persönlich führen können.« Die Ungeduld baute sich in meiner Brust ein Fort aus rostigen Nägeln und splittrigem, arsengetränktem Holz.
»Oh, tut mir leid, Schätzchen. Ich vergesse immer dein HRS – dein Handy-Reiz-Syndrom. Ich werde versuchen, mich kurzzufassen, doch ich muss wirklich mit dir sprechen, deshalb musst du mich noch einen kleinen Moment erdulden. Amüsierst du dich mit dem Boss bei den Briten? Habt ihr schon eine Tea Party besucht? Schon mal einen Krawall gemacht oder die Wände zum Beben gebracht? Die Queen getroffen? Nackt über den Trafalgar Square gelaufen? Ich hoffe, beim Trafalgar Square lautet die Antwort Nein, denn das würde ich gern mit dir machen.«
Ich konnte nicht anders und musste über Stevens Scherze schmunzeln. »Wenn du morgen ankommst, dann werde ich dir sicherlich von all den faszinierenden Momenten erzählen, die wir die letzten zwei Tage in London erlebt haben, und nenn mich nicht Schätzchen.«
In Wahrheit hatte ich Quinn während der letzten zwei Tage kaum gesehen. Ursprünglich hatten wir geplant, etwas früher als Steven und das Team zu fliegen, um etwas Zeit für uns zu haben, bevor das Meeting mit einem großen Geschäftskunden stattfand. Der Kunde hieß Grinsham Banking and Credit Systems, was ein großes Geschäft und großartige Neuigkeiten bedeutete. Eigentlich sollten Quinns Treffen mit seinen Privatkunden pro Tag weniger als zwei Stunden in Anspruch nehmen, doch leider hatten sie seine Vormittage, Nachmittage und Abende ausgefüllt.
Meine Gefühle angesichts dieses gegenwärtigen Zustands von Quinnlosigkeit waren ein wenig verworren, vor allem, da ich – auf Quinns Beharren in dieser verrückten Stadt – ständig drei Begleiter an meiner Seite hatte.
Bestenfalls war ich enttäuscht. Schlimmstenfalls war ich wütend und verstimmt. Ich hatte noch nicht entschieden, welches Gefühl meinen Zustand besser beschrieb, denn ich pendelte noch zwischen den beiden hin und her.
»Schön, schön. Ich freue mich darauf. Sie beginnen jetzt die Vorbereitungen zum Boarding für meinen Flug.« Seine Verärgerung war deutlich zu hören. »Das ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich einen normalen Linienflug nehme. Ich habe schon ganz vergessen, wie sehr ich das hasse, diese seltsamen Nackenkissen und diese … Menschen.«
»Steven, du fliegst Erster Klasse. Weißt du eigentlich, wie viel Prozent der Bevölkerung jemals Erster Klasse fliegt? Weniger als sechs Prozent. Selbst Prinz William fliegt Touristenklasse.«
»Das hast du dir jetzt ausgedacht. Glaub bloß nicht, dass du mich so einfach reinlegen kannst. Siebzig Prozent aller Statistiken werden spontan erfunden.«
Ich versuchte, nicht zu lachen. »Du weißt genau, dass ich mir meine Statistiken niemals ausdenke, und ich glaube, dass du den Flug in der Ersten Klasse gut aushalten kannst, selbst wenn dabei ein paar Leute um dich sind.«
»Ich werde mein Bestes versuchen.« Er schniefte, seufzte, dann seufzte er noch einmal. »Der Boss muss wohl auf mich abfärben. Seine Abneigung gegenüber der menschlichen Rasse ist womöglich ansteckend.«
Hinter meinem Rücken war ein leiser Widerhall von Schritten zu vernehmen. Ich drehte mich ein wenig zu dem Geräusch und blickte suchend in die dunkle Weite. Jacob musste es auch vernommen haben, denn er kam zu mir und legte mir die Hand an den Oberarm.
»Ms Morris, was dagegen, wieder zurück ins Restaurant zu gehen?«
Ich nickte ihm zu und wandte mich zum Eingang des Cluckingham Palace, des Curry-Restaurants, in dem sich meine neuen Strickbekanntschaften versammelt hatten. »Ich muss jetzt los, Steven.«
»Na gut, in Ordnung. Ich sehe dich ja morgen, und dann überprüfen wir, wie lange wir brauchen, um über den Trafalgar Square zu rennen.«
Ich verdrehte die Augen, während ich grinste. »Tschüss, Steven!«
»Tschüss, Schätzchen!« Er beendete den Anruf mit einem Schmatzgeräusch.
Jacob hatte meinen Arm losgelassen, doch er blieb bei mir stehen. Die Schritte klangen jetzt näher, und aus einem unerklärlichen Grund erschauerte ich.
Dann sah ich ihn.
Da er noch immer ungefähr vierzig Meter entfernt war, konnte ich es nicht genau sehen, doch seine blauen Augen schienen zu funkeln und zu blitzen, als sich unsere Blicke begegneten. Zumindest empfanden das meine Zehen, meine Ohren, mein Herz und meine inneren Organe. Seine Schritte waren wie immer ohne jede Eile, und seine Bewegungen wirkten geschmeidig, zeugten von nachlässigem Selbstvertrauen, das an der Grenze zwischen Selbstbeherrschung und Arroganz oszillierte.
Ein schmerzhaft ziehendes Verlangen, gefolgt von Atemlosigkeit, ließen mich auf der Stelle verharren – meine gewohnte Reaktion, wann immer Quinn auftauchte.
Selbst nach den fünf Monaten Beziehung fühlte ich mich bei seiner Anwesenheit noch immer ein wenig wehrlos und durcheinander, als hätte man mich mit verbundenen Augen im Kreis herumgedreht und mir dann mitgeteilt, dass ich jetzt im Jambus-Versmaß eine Lobrede auf Dr. Seuss schreiben müsse.
Ich bemerkte, dass er seine Schritte verlangsamte und den Blick fest auf meine Schuhe gerichtet hatte. Ehrlich gesagt war ich ziemlich stolz auf sie. Sie waren aus rotem Satin und hatten am Zeh eine übergroße Schleife. Die Absätze wirkten bedrohlich spitz, doch wegen der Plateausohlen waren die zehn Zentimeter langen Absätze eigentlich nicht mehr als acht Zentimeter hoch. Ich hatte sie gerade erst am Nachmittag in einem bemerkenswerten Schuhgeschäft in der Geschäftsstraße hinter Liberty of London erstanden.
Ich hatte mich die ganze Zeit über den Kauf gefreut und ein warmes Gefühl im Bauch verspürt. Jetzt hatte ich den Eindruck, unter der gleichbleibenden, zielgerichteten Hitze seines Blickes zu verbrennen.
Er blieb gut zwei Meter vor mir stehen und steckte langsam die Hände in die Taschen. Sein Blick war noch immer fest auf meine Füße gerichtet, als er sagte: »Nette Schuhe.«
Ich ließ seine Aussage und das herrliche Timbre seiner Stimme zwischen meinem Kopf und meinem Herzen tanzen, bevor sie sich – erwartungsgemäß – zwischen meinen Hüftknochen irgendwo in der Nähe meiner Eierstöcke niederließen. Wenn mein Körper eine Karte wäre, dann wäre der Bereich, der gegenwärtig mit verstärkten Nebenwirkungen zu kämpfen hatte, direkt südlich meiner Gebärmutter und nördlich meiner Oberschenkel.
Also: meine Vagina.
Daher meine Hilflosigkeit.
Bevor Quinn in mein Leben trat, waren meine Vagina und ich bereits miteinander bekannt, allerdings waren wir keine echten Freunde. In der Handhabung wirkte es meist wie eine Störung, ein Geheimnis, und es war immer leistungsschwach oder verursachte Schmerzen. Ich nahm an, dass es wahrscheinlich auf Benutzerfehler zurückzuführen war, war mir allerdings auch nicht ganz sicher, wie sie zu bedienen war. Wobei ich zugeben muss, dass ich niemals durch das Labyrinth namens Vulva navigiert war, ganz zu schweigen von der verwirrenden Klitoris.
Doch seit es Quinn gab, war ich bereitwillig machtlos gegenüber meiner Vagina und allen ihren Teilen (ganz zu schweigen von seinen Teilen).
»Danke!« Ich sah zu, wie sein prüfender Blick gemächlich von meinen Knöcheln zu den Unterschenkeln kletterte, dann über meine Oberschenkel glitt und weiter nach oben wanderte. Außer meinen Schuhen trug ich die Klamotten, die er für mich ausgewählt hatte. Sie hatten neben dem Bett gelegen, dazu schwarze Unterwäsche und einen Notizzettel mit dem Hinweis Trag mich.
Das kleine schwarze Kleid mit den weißen Tupfen war wesentlich enger und kürzer als das, was ich gewöhnlich anhatte. Doch er hatte noch nie zuvor ausdrücklich gewünscht, dass ich etwas Bestimmtes trage.
Tatsächlich schien ihn meine gesamte Kleidung zu irritieren, vor allem meine Unterwäsche. Deshalb zog ich an, was er sich wünschte, da es mir egal war.
Schließlich begegneten sich unsere Blicke. Nach der Wildheit in seinen Augen zu urteilen, hatte ich damit die richtige Entscheidung getroffen, die von ihm vorbereiteten Kleider anzuziehen. In meiner Brust fühlte es sich gleichzeitig enger und weiter an. Das Gefühl war verwirrend, seine blauen Augen fesselten meinen Verstand und mein Herz.
»Deine Augen sind blau«, sagte ich.
Er blinzelte kurz, verzog subtil den Mund, und kam unauffällig drei Schritte näher. »Ja, das stimmt.«
»Ich habe braune Augen«, sagte ich, wobei mir die Worte wie unzerkautes Essen aus dem Mund fielen – unbeholfen und mit der Unaufmerksamkeit, die den Zustand begleitete, wenn man hypnotisiert und völlig ohne Verstand war.
Quinn biss sich auf die Oberlippe und spähte über meine Schulter zu Jacob. Ich wusste, dass er gegen ein Grinsen ankämpfte. So reagierte er häufig auf meine seltsamen Äußerungen.
»Wir gehen aus.« Quinn wandte sich an Jacob: »Hol bitte den Wagen.«
»Ja, Mr Sullivan.« Unmittelbar auf die knappe Antwort des Bodyguards folgte das Geräusch seiner sich entfernenden Schritte. Ich bemerkte, dass nur Jacob wegging. Die anderen zwei Begleiter blieben bei uns, dazu womöglich noch weitere, die Quinn folgten.
Es war nicht das erste Mal seit unserer Ankunft in London, dass ich mich über diese umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen wunderte. Doch meine Verstimmung darüber, dass wir permanent von einer ganzen Plage von Männern (wobei Plage der Sammelbegriff war) in gut sitzenden Anzügen belästigt wurden, löste sich in Wohlgefallen auf, je länger ich Quinn ansah.
Ich sah zu, wie er die geräumige Halle prüfend betrachtete, wobei sein Blick für einen kurzen Moment an zwei Stellen über meiner linken Schulter verweilte. Seine Augen wirkten wie eine Lichtquelle, die man trotz der geringen Helligkeit sehr gut erkennen konnte. Sie hatten die Farbe von Gletschereis – wie in dem sehr lehrreichen IMAX-Film von National Geographic über den Rückgang fester Formationen in der Antarktis.
»Warum ist Dan hier? Wo ist Pete?«, fragte er mich, während er weiter über meine Schulter sah.
So aus meinen Gedanken an die Antarktis und Quinns Augen gerissen, blinzelte ich erst zweimal, dann sah ich hinter mich. Ich versuchte, Dan (oder Pete) im Schatten zu erkennen, was mir aber nicht gelang.
»Ist Dan hier? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht.« Ich kniff die Augen zusammen und fragte in die hallende Dunkelheit: »Bist du da, Wachmann Dan?«
Plötzlich legte Quinn seine Hände an meine Taille, sodass ich angesichts des unerwarteten Kontaktes erschrak und zusammenzuckte, bevor ich mich wieder zu ihm drehte. Er stand jetzt ganz nah bei mir. Es war nicht so, dass ich seine geräuschlosen Bewegungen oder die Angewohnheit hasste, dass er plötzlich irgendwo auftauchte, wo ich kurz zuvor noch allein gewesen war. Ich hatte mich einfach noch nicht ganz daran gewöhnt.
Er sah auf mich herab. Ich sah zu ihm auf. Ein leises Seufzen kam mir über die Lippen – wegen seiner Nähe, seiner Wärme, dem Geruch seines Rasierwassers, dem Hauch eines Lächelns um seine Augen.
Dann sagte er auf seine ruhige Art, die mich immer entwaffnete: »Du hast mir heute gefehlt.«
Ich seufzte erneut, diesmal, weil seine süßen Worte mir den Atem raubten. Ich grinste wie eine zufriedene Katze – was überhaupt keinen Sinn ergab, denn kein anderes Tier außer dem Menschen lächelt, um sein Vergnügen anzuzeigen.
Ich presste die Lippen zusammen, um mich davon abzuhalten, ihm diese Tatsache mitzuteilen.
Quinn kniff die Augen zusammen und sah mich an. Er musste bemerkt haben, dass ich einen Gedanken unterdrückte, denn er sagte: »Sprich es aus.«
»Was denn?«
Er hob die Augenbrauen, senkte das Kinn und warf mir einen sehr wirkungsvollen Blick zu, der Du weißt es genau sagte.
Ich schüttelte den Kopf. »Es ist nichts.«
»Erzähl es mir.«
»Das sind völlig überflüssige Informationen.«
»Ich will es aber wissen.« Er senkte die Stimme fast eine ganze Oktave und drückte mich gegen sich, als wollte er damit seine Aussage bekräftigen.
Das erregte mich noch mehr. »Quinn …«, flüsterte ich. Ich wusste gar nicht, warum ich überhaupt flüsterte.
»Janie, alles was du sagst, ist faszinierend.« Er flüsterte jetzt auch.
»Nein, das stimmt nicht. Und die Tatsache, dass du annimmst, dass ich glauben werde, dass du glaubst, dass ich eine so entschieden falsche Aussage glaube, ist etwas, was mir Sorgen macht.«
Er brauchte eine Weile, um sich in dem verknoteten Netz meiner Worte zurechtzufinden, bevor er antwortete. »Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Doch die Tatsache, dass du denkst, ich hätte etwas entschieden Falsches zu dir gesagt, macht mir sehr große Sorgen.«
Wir hielten dem Blick des anderen stand, wie ein Duell aus gespielter Schuld. Er gewann.
»Na gut. Du willst es wissen? Ich habe gerade gedacht, dass ich wie eine zufriedene Katze grinse, doch dann hat mich der Vergleich gestört, da kein anderes Lebewesen als der Mensch bei Vergnügen lächelt. Manche Leute glauben, dass Tiere es tun, vor allem Katzen und Hunde, doch da liegen sie falsch. Das Verziehen des Mundes ist zufällig. Katzen schnurren, um ihr Vergnügen zu zeigen, und Hunde wedeln mit dem Schwanz.«
»Woher wissen wir denn so genau, dass das Schnurren die einzige Art ist, wie Katzen ihr Vergnügen ausdrücken?«
»Die zwei Studien, die ich zu Tierverhalten gelesen habe, hatten andere äußerlichen Anzeichen von Vergnügen nicht endgültig ausgeschlossen. Doch sie bemerkten, dass bei Katzen die einzige zuverlässige Zurschaustellung das Schnurren war.«
»Menschen machen ja auch mehr, als nur zu lächeln, um Freude und Zufriedenheit zu zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass Katzen, Hunde und andere Tiere wahrscheinlich ebenfalls andere äußerliche Anzeichen zur Schau stellen.« Er zuckte mit den Schultern. Wie immer, wenn wir uns über solche Dinge unterhielten – irgendwelche Eingebungen meines Wissens trivialer Dinge –, schien er ernsthaft interessiert und engagiert zu sein.
Das liebte ich an ihm. Niemand hatte sich je für die willkürlichen Themen interessiert, die mir in den Sinn kamen. Er stellte immer Fragen, versuchte, es auf ein anderes Konzept zu beziehen, und ließ die kleinen Fakten groß und wichtig erscheinen.
Ich nickte über seinen exzellenten Einwand, denn das war es. »Du hast vollkommen recht. Ich gebe zu, dass eine Hauptschwäche der beiden Studien war, dass sie sich nur dafür zu interessieren schienen, herauszufinden, ob Tiere lächeln, um Zufriedenheit oder Vergnügen auszudrücken. Als sie das Lächeln ausgeschlossen hatten, stellten sie nur noch wenig zusätzliche Informationen bereit. Vielleicht sollte ich einmal einen der Autoren kontaktieren und fragen, ob es andere äußerliche Anzeichen gab, die manche Spezies im Tierreich gemeinsam hatten.«
»Vielleicht sollten wir aber auch erst einmal alle unsere eigenen äußerlichen Anzeichen von Vergnügen dokumentieren.«
Ich sah ihn zweifelnd an und wollte ihn gerade fragen, was das für einen wissenschaftlichen Wert hätte, klappte aber dann den Mund wieder zu, als ich das hintersinnige Glitzern in seinen üblicherweise eisigen Augen bemerkte.
Ich musste nicht lange darauf warten, dass mir die Wangen rot anliefen. Es waren schon so viele Monate vergangen, und ich wurde noch immer von seiner Fähigkeit beschämt, mich zu verwirren.
Eigentlich war Scham nicht das richtige Wort. Früher hatte ich mich geschämt. Jetzt reagierte ich nur hypersensibel auf ihn, seine Reaktionen, sein Kopfneigen, sein subtiles Mundverziehen.
Wie in diesem Augenblick, als sein Ausdruck plötzlich unglaublich sanft und anerkennend wurde, während sein Blick über meine errötete Haut strich, als wäre ich ein großartiger Schatz oder eine neue Entdeckung. Es verwirrte und erregte mich, und ich war süchtig danach. Natürlich konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass seine Reaktion andauern würde. Niemand konnte für immer dieses Maß an Interesse an meinen Skurrilitäten bewahren. Irgendwann würde ich ihn langweilen oder zu Tode irritieren.
Genauso wenig konnte meine übermäßige Sensibilität bei allen Quinn-Sachen überdauern. Irgendwann würde das – diese Intensität und das, was wir teilten – verschwinden.
Deshalb platzte es aus mir heraus: »Meinst du, dass es jemals aufhören wird?«
»Was meinst du mit es?«
»Glaubst du, dass ich jemals in der Lage sein werde, dich anzusehen, ohne die Fassung zu verlieren?«
Sein Grinsen wurde breiter, die Zärtlichkeit darin intensiver. »Ich hoffe nicht.«
»Du magst es, wenn ich fassungslos bin?«
»Sagen wir einfach, es macht das Spiel ein wenig ausgeglichener.«
Darüber runzelte ich die Stirn. Da ich mich nun auf etwas konzentrieren und über etwas nachdenken konnte, ruhte mein Kopf jetzt wesentlich ausgeglichener auf meinen Schultern. »Du willst damit doch nicht andeuten, dass du fassungslos bist.«
Als Antwort lächelte er stumm und gab mir einen schnellen Kuss, oder was ich als schnellen Kuss erwartete. Denn kaum hatten sich seine Lippen von meinen gelöst, knurrte er missbilligend und legte seinen Mund erneut an meinen. Dann küsste er mich richtig.
Wie immer – wenn wir uns richtig küssten – verlor ich jedes Bewusstsein für meine Umgebung, die Handhabung meiner Gliedmaßen, und die Funktionsfähigkeit meiner Stimmbänder. Womöglich machte ich auch Anstalten, ihn zu besteigen. Nach einer unbestimmbaren Zeitspanne löste sich Quinn von mir, während er meine Oberarme ziemlich fest hielt.
Natürlich fehlte mir sofort etwas, als sein Körper nicht mehr an meinem war. Ich öffnete die Augen und bemerkte, dass er mich mit angespannten Kiefermuskeln betrachtete. Das war nicht ungewöhnlich, vor allem nach einem Kuss in der Öffentlichkeit. Ich wunderte mich nur über seine andauernde, selbst auferlegte Frustration.
Doch in diesem Augenblick blitzte noch etwas anderes in seinen Augen auf, das mich verwunderte. Normalerweise starrte er mich oder einen Teil von mir mehrere Sekunden lang an, wenn wir uns aus der öffentlichen Zurschaustellung unserer Zuneigung lösten. Diesmal wirkte er aber so, als wollte er etwas sagen, hielte sich aber zugleich damit zurück. Seine Lippen waren zu einer schmalen Linie zusammengepresst. Dann schluckte er zweimal. Das leise Geräusch meines angestrengten Atmens wurde von einem Lachanfall im Restaurant unterbrochen. Seine Augenlider zuckten bei dem Geräusch, und ich bemerkte, dass er guckte, ohne etwas zu sehen. Er war in seinen Gedanken verloren, und sie schienen von stürmischer Natur zu sein.
»Quinn?«
»Wir müssen los. Dan holt deine Sachen.« Beim Sprechen wandte er sich wieder zu mir, und ich war überrascht über seinen reservierten Ausdruck. Ohne mir Zeit zum Antworten zu geben, ließ er einen meiner Arme los, drehte sich und zog mich an dem anderen hinter sich her zum Ausgang.
»Warte!« Ich spähte über die Schulter, sah Dan und meinen anderen Begleiter aus dem Schatten kommen, und winkte kurz. »Ich würde mich gern von der Strickgruppe verabschieden, und ich brauche meine Jacke.«
»Er wird deine Jacke holen. Ich habe was reserviert, und wir müssen …« Ich hörte, wie er sich räusperte, bevor er weitersprach, »… uns unterhalten.«
»Wir gehen aus?« Ich blinzelte hinter ihm. Normalerweise gingen wir nach einer solchen Post-Öffentlichkeits-Frustration zurück in seine Wohnung – oder, da wir gerade in London waren, aufs Hotelzimmer –, um für wunderbar lange Stunden aufeinander loszugehen.
»Ja.«
»Öffentlich?«
Er zögerte mit seiner Antwort, doch seine Schritte wurden nicht langsamer. Ich hatte lange Beine. Seine waren jedoch länger. Ich wurde gezwungen, sie doppelt so schnell zu bewegen, um mit ihm Schritt zu halten.
»Mehr oder weniger«, sagte er.
»Mehr oder weniger?«
»Ja. Es ist ein Ort, wohin die Öffentlichkeit geht.«
Ich verzog hinter seinem Rücken das Gesicht. »So hörst du dich an, wenn du absichtlich unklar sein willst.«
Er blieb plötzlich stehen und drehte sich um. Ich stolperte über meine eigenen Füße und fiel mit rudernden Armen wie ein Depp in seine, die er ausbreitete, um mich aufzufangen, als hätte er geahnt, dass meine Bewegungen ausgesprochen ungraziös ausfallen würden.
Ich hatte kaum das Kinn gehoben, um ihn für sein plötzliches Stehenbleiben zu schelten, da strich Quinn erneut mit den Lippen über meine, während seine Hände an dem figurbetonten Kleid seiner Wahl hinabglitten, bis sie auf meinem Hinterteil ruhten. Ich gab ein leises Geräusch von mir, das sich wie ein Wimmern anhörte, als sich seine Finger in meinen Po gruben.
»Manchmal …«, flüsterte Quinn an meinen Lippen, wobei seine Stimme gleichzeitig schmerzhaft verführerisch und süß neckend klang, »… ist es schön, überrascht zu werden.«
Kapitel 2
Ich war überrascht.
Eigentlich hatte ich mit den Händen von Sir McHotpants von Kann-Hände-nicht-bei-sich-behalten gerechnet, als sich die Türen der Limo schlossen. Stattdessen begegnete ich Sir McCoolpants von Rühr-mich-nicht-an.
Nachdem wir eine Minute gefahren waren, folgerte ich, dass er offensichtlich Pläne für unseren Abend hatte, in denen Limofummeln nicht vorgesehen war. Zu dem Ergebnis kam ich, da er keine Anstalten machte, mich zu entkleiden. Tatsächlich saß er von mir abgewandt zum Fenster gedreht auf der Sitzbank und zeigte mir seinen Hinterkopf. Seine Hand lag zwischen uns, und fast die ganze Zeit auf unserem kurzen Weg hielt er den Arm starr und gerade.
Ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt, in Limousinen zu fahren. Ich wusste nicht einmal, ob ich das jemals tun würde. Es fühlte sich extravagant und elitär an. Taxis waren genauso gut oder – noch besser – der öffentliche Nahverkehr. Die U-Bahn war eindeutig die kraftstoffeffizientere Transportart.
Doch ich akzeptierte die Limo, denn es bedeutete, dass ich während der Fahrt Zeit allein mit Quinn hatte. Und das war ein kostbares Gut. Deshalb blickte ich unentwegt zwischen ihm und der Straße hin und her und wartete darauf, dass er etwas tat, ohne meine Verwunderung zu verbergen.
Die Mansell Street wurde zur Shorter Street, und als der Wagen hielt, wusste ich, wo wir waren.
»Der Tower of London?« Ich hüpfte ein wenig auf meinem Platz herum. »Wir gehen zum Tower of London?«
Ein großer schwarzer Vogel schoss in der anhaltenden Dämmerung des späten Frühlings von der Steinmauer nach oben. Ich folgte ihm mit meinem Blick, während er über dem beeindruckenden Gebäude kreiste. Es war ein Rabe.
Das alles war unglaublich aufregend und erklärte, warum mich meine Begleiter bereitwillig an jeden Ort Londons begleitet hatten, nur nicht zum Tower. Dabei stand er neben dem British Museum und dem Globe Theater auf meiner Liste der Pflichttermine während unseres Aufenthalts.
Ich wandte mich wieder zu Quinn, während die Limo langsamer wurde und schließlich stehen blieb, und stellte fest, dass er mich beobachtete. Sein Gesicht war eine teilnahmslose Maske, doch das störte mich nicht. Ich kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, dass dieses teilnahmslose Maskengesicht sein neutraler Ausdruck war. Ich wunderte mich allerdings darüber, dass der übliche Schalk in seinem Blick verhaltener Verstörung gewichen war.
»Geht es dir gut?« Ich legte meine Hand auf seine, da ich ihn berühren wollte. Vor sechs Monaten wäre das noch eine bemerkenswerte Handlung gewesen, da ich früher nie körperliche Berührung als Trost gesucht oder gegeben hatte. Doch mit Quinn fühlte sich das Berühren und Berührtwerden so natürlich und unentbehrlich an wie Atmen oder das Lesen von Comics.
»Ja, gut. Und selbst?« Sein Blick suchte meinen, doch er wirkte dabei verschlossen und distanziert.
Stirnrunzelnd betrachtete ich ihn eine Weile, bevor ich meine Gedanken in Worte fasste. »Ich habe das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt – mit dir – und dass du es mir nicht sagen willst oder dass du auf den richtigen Moment wartest, um es mir zu sagen. Geht es um Arbeit? Hat es damit zu tun, dass ich bei jedem Schritt drei Bewacher an der Seite habe?«
»Warum glaubst du, dass da etwas nicht stimmt?«
»Weil du McCoolpants von Rühr-mich-nicht-an bist, seit wir in die Limo gestiegen sind.«
Er zog eine Augenbraue hoch, und sein cooler Ausdruck wurde brüchig.
»Was ist das denn? Ein neuer Spitzname?«
»Ich hoffe nicht. Doch es scheint mir der passendste Ausdruck, um zu beschreiben, wie seltsam du dich benimmst.«
»Was ist daran seltsam?«
»Du hast keinen einzigen Versuch unternommen, mir die Kleider vom Leib zu reißen. Du hast mir noch nicht einmal unter den Rock gefasst. Auf Grundlage der historischen Daten ist dieses Verhalten sehr seltsam.«
Er zeigte mir sein langsames, sexy Grinsen – was durch unsere fast berührungsfreie Nähe sogar noch imposanter wirkte. »Es war eine kurze Fahrt.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Das hat dich noch nie abgehalten.«
»Das ist aber eine gute Nachricht.« Dabei klang seine Stimme nicht sehr fröhlich.
»Was ist eine gute Nachricht?«
»Offenbar habe ich es geschafft, dass du jedes Mal Sex erwartest, wenn wir mit einer Limo fahren.«
Ich blinzelte ihn mit großen Augen an und dachte über seine Aussage nach, dann nickte ich zustimmend. »Du hast recht. Doch wenn man genau sein will, dann ist es eigentlich nicht Sex, den ich erwarte. Ich erwarte mindestens Fummeln und höchstens einen Orgasmus.«
»Nur einen?«
»Du musst jetzt nicht gleich übertreiben, obwohl es immer angenehm ist, wenn du meine Erwartungen übertriffst.«
»Du weiß, wie sehr ich es liebe, deine Erwartungen zu übertreffen.«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit.«
Für einen Moment lächelten wir einander an, und die ganze verstörte Zurückhaltung, die sich zuvor in seinem Blick und seinem Ausdruck gezeigt hatte, war verschwunden. Wir teilten einen Moment des schweigenden Anblickens, der so schön war, dass mein Verstand aufklarte, ich zu denken aufhörte und nur noch Wärme und Liebe spürte.
Das Geräusch einer Sirene in der Ferne brachte mich zurück in die Gegenwart. Ich schüttelte mich und blinzelte ihn an. »Warte mal, wovon reden wir?«
Sein Lächeln wurde breiter. »Wie du dazu gekommen bist, mindestens Fummeln in der Limo zu erwarten.«
»Ja, genau. Das sind meine Erwartungen. Gratulation. Gut gemacht.«
»Danke schön!« Er senkte den Kopf als Erwiderung auf mein Lob. Ich hatte den Eindruck, dass er sich auch verneigt hätte, wenn wir gestanden hätten.
Die Tür der Limo öffnete sich, und wir lösten unsere Aufmerksamkeit voneinander und blickten hinaus in den kühlen Frühlingsabend. Quinn stieg zuerst aus, dann drehte er sich und reichte mir seine Hand.
Draußen stand Dan und gab Quinn meine Jacke, die dieser mir sofort über die Schultern legte. Solche Sachen machte er immer – hielt mir den Mantel zum Hineinschlüpfen, half mir später, ihn wieder auszuziehen, hielt mir die Tür auf, zog mir Stühle heran –, und ich hatte etwas Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen.
Manchmal fühlte es sich nett an, und manchmal fühlte es sich antiquiert und nervig an. Ich konnte den Grund nicht genau erklären, nicht einmal mir gegenüber, doch seine konsequente Zurschaustellung von Gentlemanverhalten gab mir das Gefühl, eine Heuchlerin zu sein, was mich ärgerte.
Als Frauen in westlichen Gesellschaften das schwache Geschlecht waren, als sie Schutz benötigten, war die Ladys-First-Regel sinnvoll. Es war eine Anerkennung unserer Stellung. Indem wir an erster Stelle kamen, zeigte die patriarchalische Gesellschaft damit den Frauen, dass sie zerbrechlich und unfähig waren und dass die Männer durch ihre guten Manieren unseren Mangel an Fähigkeiten erkannten und uns die Ehre erwiesen, indem sie uns erlaubten vorauszugehen.
Es ist höflich, einem Kind oder älteren Menschen die Tür aufzuhalten. Es sind gute Manieren, wenn man im öffentlichen Nahverkehr seinen Sitz an jemanden abgibt, der körperlich beeinträchtigt ist. Es ist ehrenwert, den Bedürftigen zu helfen.
Die Schwachen zuerst.
Indem ich Quinn gestattete, mir die Tür aufzuhalten und meine Hand zu nehmen und mir in meine Jacke und wieder hinaus zu helfen, gab ich da nicht indirekt zu, dass ich in der Beziehung schwächer war? Gab ich nicht jedes Mal Macht ab, wenn er ritterliches Benehmen zeigte?
Doch verdammt, die meiste Zeit gefiel es mir. Ich mochte es so sehr, dass ich es ihm erlaubte, und ich hatte mit ihm nie über meine innere Unstimmigkeit in dieser Sache gesprochen. Daher kam meine ständige, auf mich selbst gerichtete Irritation und mein Gefühl der Scheinheiligkeit.
Meine ungezügelt umherirrenden Grübeleien wurden von einer sehr angenehmen weiblichen Stimme unterbrochen.
»Hallo und willkommen im Tower! Sie müssen die Sullivan-Gruppe sein.« Die Besitzerin dieser Stimme war eine sehr aufgeweckt wirkende Frau Mitte bis Ende fünfzig. Sie trug ein schwarz-rotes Tourguide-Outfit, ergänzt durch einen lustig aussehenden Hut und eine an die Brust geheftete rote Krone. Ihre Augen waren strahlend blau, und ihr braunes Haar war nach hinten gebunden.
Wir gingen zum Eingang, Quinn hielt mich dabei in seinem Arm an sich gedrückt, während ich weiter in meiner feministischen Schuld schmorte. Doch ihre Stimme und ihr Ausdruck waren so angenehm, dass ich meinen inneren Aufruhr schnell vergaß.
Quinn nickte unserem Guide zu, und ich streckte die Hand aus. Ihr einnehmendes Lächeln ließ mich ebenfalls schmunzeln, während sie mir fest die Hand schüttelte. »Ich bin Emma«, sagte sie. »Es freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ist das Ihr erster Besuch bei uns?«
»Ja«, sagte Quinn.
Ich fügte hinzu: »Ich heiße Janie. Es ist sehr schön, Sie kennenzulernen, und ich freue mich wirklich darauf, die alte Folterkammer zu sehen und auch den Ort, an dem Anne Boleyn hingerichtet wurde.«
Ihr Lächeln wurde breiter, dann ließ sie meine Hand los. »Das ist großartig. Sie müssen aber wissen, dass die meisten Hinrichtungen nicht im Tower selbst durchgeführt wurden.«
Ich nickte und leckte mir begeistert die Lippen. »Ja. Die Historiker stimmen überein, dass es nur sieben Tode im Tower selbst gab, und nur bei denjenigen, wo im Falle einer öffentlichen Hinrichtung ein Aufruhr befürchtet wurde. Die meisten Hinrichtungen fanden auf dem Tower Hill statt.«
Emma schmunzelte bei meiner Wiedergabe, und ich mochte sie gleich noch mehr. »Sie müssen entschuldigen, doch die meisten jungen Damen sind mehr an dem Jewel House interessiert als an der Folterkammer.«
»Ach ja, ich hatte ganz vergessen, dass die Kronjuwelen auch hier sind.« Es war mir tatsächlich entfallen. Ich hatte nichts dagegen, mir das Jewel House anzusehen, doch auf meiner Prioritätenliste stand es nicht ganz oben.
Quinn legte seine Hand in meine und drückte sie, während er sich an unsere Fremdenführerin wandte. »Ich nehme an, dass alle Vorbereitungen getroffen sind?«
Emma erwiderte: »Natürlich, Sir, wie Sie gewünscht haben.«
Ich achtete nur halb auf den Dialog, da ich von den Überresten der Zugbrücke des Lion Tower abgelenkt war.
Emma wandte sich zum Tower, winkte uns weiter und rief über die Schulter: »Lassen Sie uns erst einmal rauskommen aus der Kälte. Es sieht nach etwas Regen aus, nicht wahr? Kommen Sie. Wir haben eine Menge zu besichtigen und nur ein paar Stunden Zeit.«
Quinn war nicht verwirrt, und er war auch nicht verärgert. Doch seine unnahbare Distanziertheit von zuvor war zurückgekehrt, und ich versuchte, es nicht zu bemerken.
Wir befanden uns jetzt im Jewel House und standen auf einer Art Laufband, das sich im Augenblick nicht bewegte. Emma hatte erklärt, dass tagsüber Touristen auf dem Laufband stehen und im Vorbeifahren die glitzernden Juwelen in ihren dickglasigen Vitrinen betrachten würden. Die Laufbänder waren aus verschiedenen Gründen installiert worden, nicht zuletzt deshalb, damit die Leute sich weiterbewegten, anstatt sich um eine Vitrine zu drängen.
Ich war mir darüber nicht ganz sicher, doch meine Versuche, Quinn mit Fakten über die verschiedenen Türme aus der Reserve zu locken, schienen auf taube Ohren zu stoßen. Als letzten Versuch wies ich darauf hin, dass der Beauchamp Tower den ersten Einsatz von Ziegelsteinen als Baumaterial in Großbritannien seit Weggang der Römer im fünften Jahrhundert kennzeichnete.
Er nickte nur.
Ich stand vor der dritten Juwelenvitrine und starrte hinein, ohne etwas zu sehen. Ein Teil des Problems lag womöglich daran, dass sie so voller glänzender Gegenstände war, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auf einen zu konzentrieren.
»Woran denkst du gerade?«
Ich löste den Blick von der Vitrine und stellte fest, dass er mich beobachtete. »Woran ich gerade denke?«
»Ja. Hast du etwas gesehen, das dir gefällt?« Er neigte den Kopf zu der Vitrine.
Ich hob eine Braue angesichts seiner albernen Frage und der Tatsache, dass er endlich etwas sagte. Die halbe Tour hatten wir bereits hinter uns, und er hatte bisher kaum ein Wort gesprochen. Jetzt waren wir im Jewel House – für mich ein nicht unbedingt notwendiger Programmpunkt auf unserer Tour – und auf einmal war er an unserer Umgebung interessiert.
Ich zuckte mit den Schultern. »Nicht so sehr. Es sieht alles ziemlich stachelig und schwer aus.«
»Gar nichts?«
Ich spähte erneut in die Vitrine. Darin lag eine verzierte Krone mit mehrkarätigen Diamanten und einem obszön großen Amethyst in der Mitte. An der Spitze befand sich ein riesiger Saphir, der von vier gleichseitigen Dreiecken in Weißgold und Diamanten umgeben war. Es war einfach zu viel. Als würde man einen perfekten Kuchen mit hundert Kilogramm Zuckerguss bedecken.
Ich verzog den Mund und rümpfte die Nase. »Du weißt, dass der Diamantenhandel die Ausbeutung in Afrika fördert – von Menschen und von Rohstoffen –, und er verstärkt die abscheulichen Verbrechen gegen die Menschheit auf diesem Kontinent.«
Ich wandte den Blick zur Seite, um seine Reaktion auf meine ruhig gesprochene Tirade zu beurteilen, und stellte fest, dass er grinste.
»Das habe ich schon mal gehört.« Er verschränkte die Finger seiner Hand mit meinen und zog mich zur nächsten Vitrine. Ich folgte ihm und warf dabei einen verstohlenen Blick auf meine Uhr. Ich war mir nicht sicher, wie viel Zeit wir noch für die Tour hatten, doch wir waren noch immer nicht bis zu der alten Folterkammer vorgedrungen. Das machte mich ein bisschen kribbelig.
»Was ist mit dieser Vitrine?« Wieder zeigte er mit dem Kopf zu dem Glaskasten, doch sein Blick war dabei auf mich gerichtet.
Auf sein Drängen hin betrachtete ich den Inhalt und sah eine Krone mit dem berühmten Koh-i-Noor-Diamanten aus Indien. »Dieser Diamant hat mehr als einhundert Karat«, bemerkte ich. »Der britische Generalgouverneur der Kolonien hat ihn damals Queen Victoria präsentiert. Manche Leute sind der Ansicht, dass er im Grunde aus Indien gestohlen wurde und zurückgegeben werden sollte, um das schlechte Benehmen der Briten wiedergutzumachen.«
»Meinst du denn, er sollte zurückgegeben werden?«, fragte Quinn.
Ich drehte mich zu ihm und stellte fest, dass er zum ersten Mal seit Beginn der Tour wirklich interessiert wirkte. Ich dachte etwas länger über diese Frage nach und spähte zur Decke, während ich die Vorzüge und Auswirkungen beider Positionen überdachte.
»Ich weiß nicht, ob ich dir auf diese Frage ein einfaches Ja oder Nein geben kann. Rückerstattung ist kein ungewöhnliches Konzept, doch es wird nicht immer – oder nicht oft genug – in den Fällen angewandt, wo es – meiner Meinung nach – offensichtlich angebracht wäre. In diesem speziellen Fall ist der Koh-i-Noor-Diamant Teil der Weltgeschichte und vor allem der britischen Geschichte geworden. Auf der anderen Seite sagt uns die Geschichte, dass er aus Indien gestohlen wurde. Das wiederum liegt schon fast zweihundert Jahre zurück. Die Tatsache, dass wir noch immer über das Eigentumsrecht diskutieren, sagt mehr über den wahrgenommenen Wert eines Objektes aus und weniger über das tatsächlich begangene Fehlverhalten.«
»Dann lass mich die Frage umformulieren.« Er rückte einen Schritt näher zu mir. »Glaubst du, dass das Anbieten eines Objektes von großem Wert etwas Gutes dazu beitragen kann, um vergangene Fehler aufzuwiegen?«
Ich betrachtete ihn eine Weile, bevor ich antwortete. »Manchmal ist eine Entschuldigung ausreichend, vor allem, wenn sie von Herzen kommt.«
»Aber nicht immer.«
»Nein, nicht immer«, gab ich zu, verspürte aber zugleich die dringende Notwendigkeit, mich klarer auszudrücken. »Zwischen Ländern ist eine aufrichtige Entschuldigung normalerweise nicht ausreichend. Doch bei Einzelpersonen, vor allem bei Menschen, die sich lieben, fühlt sich Schadensersatz wie ein schmutziges Wort an.«
Er nickte langsam, und sein Blick strich über mein Gesicht, als würde er es sich genau einprägen wollen. Wie immer verlor ich angesichts seines anhaltenden Blicks ein wenig die Fassung, und mein Verstand sagte mir beiläufig, dass ich seine Augen schöner und kostbarer fand, als es ein makelloser, hundertkarätiger Diamant jemals sein könnte.
»Schauen wir uns die letzte Vitrine an.« Seine Worte brachten mich zurück in die Wirklichkeit, und ich folgte ihm.
Zu meiner großen Überraschung war die letzte Vitrine voller Ringe. Das kam mir mehr als seltsam vor, da die anderen alle Kronen, Zepter und riesige Edelsteine enthalten hatten.
Ich musste schmunzeln, als ich all die Ringe betrachtete. Einige waren ziemlich alt, was ich sofort daran erkannte, dass die Metallfassungen breit und schwer und auf perfekte Weise unperfekt waren. Doch die eingefassten Edelsteine waren alle makellos. Sie glänzten, als wären sie neu oder frisch poliert.
»Oh, sie sind wunderbar!« Ich beugte mich über das Geländer und zu der Vitrine hin, um die Ringe besser sehen zu können. Fast sofort wurde mein Blick von einem Goldring mit einem roten Stein angezogen, und ich rang kurz nach Luft. Ich hob die Hand, um darauf zu zeigen, und musste an mich halten, um nicht die Vitrine zu berühren. »Schau dir den an.«
Quinn legte mir den Arm um die Taille und lehnte sich neben mich. »Welchen?«
»Der ovale – der Granat – mit dem breiten rotgoldenen Ring.« Der Edelstein wurde von einer Krappenfassung gehalten, was den Ring der präviktorianischen Zeit zuordnete. Eigentlich waren alle Ringe wunderschön. Ich bemerkte, dass nur ein oder zwei der insgesamt zwanzig Ringe Diamanten hatten. Die übrigen Edelsteine waren Smaragd, Saphir oder Tansanit, Rubin oder Granat.
Quinn machte unverbindlich: »Hm.«
Mein Blick wurde erneut von dem Ring mit dem roten Edelstein angezogen, und ich bewunderte das rotgoldene Band, das massiv und dick, doch zugleich detailreich und mit filigranen Schnörkeln verziert war.
»Ich kenne mich leider nicht so gut mit altem Schmuck aus, wie ich es gern täte, doch wenn ich raten sollte, dann würde ich sagen, dass dieser so aussieht, als wäre er georgianisch oder noch älter. Denkst du, das ist ein Rubin oder ein Granat? Ich glaube, es ist ein Granat und kein Strassschmuck. Die Rubine jener Zeit waren normalerweise eher fuchsiafarben als rot. Echte rote Rubine waren außerordentlich selten, vor allem in Form und Schliff wie dieser dort – facettiert wie ein Diamant und nicht glatt und geschliffen. Wow …«
»Wow?«
Ich nickte, den Blick noch immer auf den Ring gerichtet. »Ja. Wow! Denk nur an die ganze Geschichte hinter diesem einzelnen Gegenstand. Ich frage mich, wer der ursprüngliche Besitzer war. Ach, wenn Ringe doch reden könnten.«
Ich spürte sein Lächeln mehr, als dass ich es sah, und erwiderte es schüchtern. »Nein, ernsthaft, ich frage mich, was uns dieser Ring über sein Leben erzählen würde, wenn er sprechen könnte.« Ich drehte mich zu ihm und bemerkte an seinem schiefen Mund, dass ich recht gehabt hatte. »Vielleicht sogar eine heimliche Liebschaft – ein solcher Ring wird sicher bei mehr als einem wichtigen Gespräch dabei gewesen sein. Vielleicht hat ihn der Besitzer sogar getragen, als er die Folter oder den Mord an jemandem geplant hat.«
»Oder vielleicht war er auch nur für Hunderte von Jahren in einer Mitgift-Kiste eingesperrt gewesen, ist erst kürzlich entdeckt und jetzt hier für eine Sonderausstellung platziert worden.«
Bei dem Gedanken runzelte ich die Stirn, spähte wieder in die Vitrine und seufzte. »Du bist ein Spielverderber.«
Er rieb mir über den Rücken. »Na gut, du hast recht. Er wurde getragen, um einen Mord vorzubereiten und die Regierung zu stürzen.«
»Ganz genau.« Ich nickte kurz. »Einen solchen Ring würde niemand vergessen und schon gar nicht hundert Jahre wegsperren. Du hast zwar eine große Vorstellungskraft, aber langweilige Einfälle.«
Diese letzte Aussage wurde mit einem Lachen erwidert, und es war ansteckend. Quinn lachte so selten, auch wenn ich ihn für witzig hielt. Er mochte es, todernst irgendwelche Scherze mit mir zu machen, ohne mich vorzuwarnen. Oft merkte ich erst bei der Pointe, dass es ein Witz war.
Zum Beispiel führten wir eines Morgens beim Kaffee folgendes Gespräch, bei dem er die Zeitung las und nicht aufblickte:
Quinn: »Die Kanalisationswerke von Chicago haben nach dir gefragt.«
Ich: »Ach, wirklich? Warum?«
Quinn: »Sie meinten, sie hätten genug von deinem Scheiß.«
Ich brauchte ungefähr sieben Sekunden, bis ich den Scherz bemerkte und verstand.
Mein daraus resultierendes Lachen brachte ihn normalerweise zum Schmunzeln. Wenn ich so heftig lachen musste, dass ich schnaubte, dann lachte er meist leise. Doch nur ganz selten lachte er lauthals, vielleicht einmal die Woche, und nur, wenn ich Glück hatte.
Deshalb verspürte ich jedes Mal, wenn er es tat, die erhitzte Supernova-Explosion einer Sternenformation in meiner Brust und meinem Bauch.
Quinns Hand ruhte an meiner Hüfte und drückte sie. »Na komm schon. Wir müssen weiter.«
Ich warf dem Ring einen letzten Blick zu, dann ließ ich mich von Quinn auf dem unbeweglichen Laufband weiterführen. Wir schlenderten zu Emma, die uns in einem Raum erwartete, der anscheinend voller massiver goldener Servierteller war.
»Wie finden Sie unsere Schätze, Janie?«, fragte sie mich lächelnd.
»Sie sind … zahlreich.« Ich hatte mich schließlich für diesen Begriff entschieden, denn er schien die korrekteste Bezeichnung für die ganzen Schätze zu sein.
Bei meiner Antwort wurde ihr Lächeln breiter, und sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf Quinn. »Ich fürchte, Sie haben einen Anruf erhalten, Sir. Hier unten haben Sie mit dem Mobiltelefon keinen Empfang, deshalb folgen Sie bitte George.« Sie zeigte auf einen Mann im Anzug, der vor einer Tür mit dem Schild Nur für Mitarbeiter stand. »Er bringt sie zum Büro des Towers.«
Ich hatte George kaum gesehen, als mir Quinn einen flüchtigen Kuss auf die Wange drückte und mir ins Ohr flüsterte: »Ich komme nach.« Dann ließ er mich mit Emma allein und eilte durch die geöffnete Tür. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit zu protestieren und zuckte überrascht zusammen, als sich die Tür mit einem Schlag schloss.
Emma stupste mir an den Ellbogen, um meine Aufmerksamkeit von der Stelle zu lösen, wo er verschwunden war, und ich blinzelte in ihr freundlich lächelndes Gesicht.
»Kommen Sie, meine Liebe. Ich zeige Ihnen die alte Folterkammer, nach der Sie gefragt haben.« Sie klang entschuldigend.
Pflichtbewusst folgte ich Emma, obwohl mein Herz ein wenig nach unten sackte, während ich über die letzten Tage in London nachdachte. Im Grunde war ich eine einzelgängerische Natur, doch ich hatte Quinn seit unserer Ankunft in London seltener gesehen als normalerweise in Chicago. Es wäre mir lieber gewesen, wenn Quinn mir vor unserer Abreise gesagt hätte, dass ich den Großteil der Zeit ohne ihn verbringen würde. Wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, hätte ich meine Erwartungen angepasst und vielleicht eine meiner Freundinnen mitgenommen, um mit ihr die Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse zu teilen.
Die Entdeckung eines neuen Ortes war eine der wenigen Ausnahmen in meiner sonstigen Vorliebe für Einsamkeit. Es ist immer schön, jemanden dabeizuhaben, mit dem man seine Beobachtungen und Gedanken vergleichen kann, auf interessante Dinge hinweisen, und über den Tag reden. Ich nahm mir vor, einen Fragebogen zu entwerfen und diesen Quinn vor zukünftigen Geschäftsreisen zum Ausfüllen vorzulegen, wenn ich zur Teilnahme eingeladen werden würde. Ich könnte den Fragebogen mit Punkten bewerten, jeder seiner Antworten eine gewisse Punktzahl zuweisen, um so zu entscheiden, ob ich ihn begleiten wollte und – außerdem – ob ich besser eine Begleitung mitbringen sollte.
Ich fing damit an, eine Liste an Fragen zusammenzustellen, die dieser Fragebogen enthalten würde, was meine Stimmung aufhellte. Obwohl sich der Nebel der Melancholie noch nicht ganz aufgelöst hatte – nicht einmal, als wir in der Folterkammer ankamen –, fühlte ich mich nun weniger niedergeschlagen über mein gegenwärtiges Alleinsein, da ich jetzt einen realisierbaren Plan hatte.
»Ich werde mal nach Ihrem Mann sehen.« Emma machte eine Handbewegung in den Raum. »Schauen Sie sich nur um, und berühren Sie ruhig die Instrumente. Seien Sie nur vorsichtig, da sie ziemlich alt sind und – Sie wissen ja – für die Folter benutzt wurden.«
»Danke, Emma!« Mein zuvor schweres Herz machte einen kleinen Hüpfer, als ich den Raum betrat und die grausamen Gerätschaften erblickte.
Ich zwang mich dazu, mir Zeit zu nehmen und jedes Werkzeug mit detaillierter Gründlichkeit zu betrachten. Ich war zwar keine Sadistin oder Masochistin, doch ich verspürte sowohl eine gewisse Ehrfurcht als auch Widerwille vor ihnen. Es waren im Wesentlichen Mittel der Einflussnahme, der Muskel, durch den eine große Menge an Macht bewegt wurde. Jedes einzelne Instrument war sowohl schrecklich als auch schön – die Ergebnisse früher Ingenieurskunst und eines gestörten Verstandes.
Ich erkannte ein Gerät namens Storch, bei dem man zu einer Kugel zusammengequetscht wurde, was die Knochen zerbrach, wenn es enger gezogen wurde – eine wahrhaft schreckliche Art zu sterben.
Ich bemerkte die Handfesseln, riesige eiserne Handschellen, die an den Wänden angebracht waren. Gefangene wurden an ihren Handgelenken in der Luft aufgehängt. Ich unterdrückte einen kleinen Schauer, der mir über den Rücken fuhr, während ich mir vorstellte, selbst in dieser vollständig wehrlosen Lage zu sein. Es war ein verwirrendes, schwindlig machendes Gefühl.
Mit halbem Ohr hörte ich näher kommende Schritte und drehte mich zur Tür, gerade als Quinn und Emma eintraten.
»Gefällt es Ihnen?« Emmas fröhlicher Tonfall klang ein wenig seltsam angesichts der Umgebung.
Da ich aber Spaß hatte, sagte ich: »Ja. Das ist alles wirklich unglaublich.«
Quinn warf mir einen abwägenden Blick zu. Ich war enttäuscht, dass er wieder sein steinernes Gesicht hatte und unnahbar wirkte.
Unabhängig davon lächelte ich und hob fragend die Brauen. »Alles in Ordnung?«
Er nickte kurz, während sein Blick durch den Raum schweifte. Er schien jede Einzelheit mit seiner typischen schnellen Effizienz einzuordnen.
Ich zeigte auf die Handfesseln hinter mir. »Wenn man in diese Handfesseln gehängt wurde, dann war es so, als würde man gekreuzigt werden. Man stirbt dadurch, dass die Lungen versagen. Sie können sich durch das Gewicht des aufgehängten menschlichen Körpers nicht mehr richtig entfalten.«
Ich sah, wie Quinns Kiefer zuckte. Seine Stimme war völlig ausdruckslos, als er sagte: »Das klingt schrecklich.«
»Das war es auch.« Ich nickte.
»Überhaupt nicht romantisch.«
»Nein.« Ich runzelte über seinen Kommentar die Stirn. »Natürlich ist es nicht romantisch. Das ist Tod durch Kreuzigung und Ersticken. Daran ist nicht mal im Entferntesten etwas romantisch.«
Er schloss die Augen, atmete durch die Nase ein, dann seufzte er. »Du bringst mich hier noch um, Janie.«
Ein hölzerner Apparat direkt hinter Quinn erregte meine Aufmerksamkeit und lenkte mich ab. Ich hatte ihn zuvor bei meiner langsamen Durchsicht des Raums übersehen und zog laut die Luft ein. »Das ist ja eine Streckbank!«
Quinn spähte über seine Schulter und dann wieder zurück in den Raum. »Tatsache.« Seine Antwort klang abgelenkt, ein wenig sarkastisch und vielleicht auch einen Hauch frustriert.
Ich ging mit schnellen Schritten an ihm vorbei und dorthin, dann streckte ich den Arm aus und hielt mich so gerade noch zurück, es zu berühren. Ich sah zu unserem Guide. »Darf ich?«
Emma nickte und sah ganz nach britischer Höflichkeit aus. »Ja, natürlich. Nehmen Sie sich Zeit. Ich komme um halb zurück, um Sie hier abzuholen.«
Nur am Rande hörte ich die sich aus dem Raum entfernenden Schritte. Meine Aufmerksamkeit war jetzt ganz auf die grausame Gerätschaft vor mir gerichtet.
Eine Streckbank.
Eine echte Streckbank.
Sie sah nicht wie eine Nachbildung aus.
»Die Streckbank wurde im dreizehnten Jahrhundert vom Herzog von Exeter in England erfunden. Er war der Burgvogt des Towers. Sie nannten sie Tochter des Herzogs von Exeter. Warum sie Folterinstrumente Tochter nannten, habe ich nie ganz verstanden. Doch die erste nachgewiesene Verwendung einer Streckbank erfolgte in der Antike durch die Griechen.«
»Hm«, war Quinns Erwiderung. Ich konnte nicht erkennen, ob er zuhörte, aber das war auch nicht wichtig.
Ich wurde von einer plötzlichen Inspiration ergriffen.
»Schnell, Quinn, bind mich mal fest.« Ich trat von einem Fuß auf den anderen und versuchte herauszufinden, wie man hinaufkam.
»Was?«
»Bind mich fest – bind mich auf die Streckbank. Ich möchte herausfinden, wie das ist.« Ich beschloss schließlich, mich zunächst auf den Rand zu setzen, um von da zur Mitte zu gelangen.
»Du willst, dass ich dich auf die Streckbank binde?«
»Nur für eine Minute.« Ich überprüfte mein Gewicht, dann hob ich unbeholfen die Beine, um eine liegende Position einzunehmen. Meine Füße baumelten über das Ende des Tisches. Ich war ein bisschen zu groß, doch ich würde einen ganz guten Eindruck bekommen. »Hier, binde jetzt meine Hände fest.« Freiwillig streckte ich die Arme über den Kopf.
»Bist du dir sicher?« Quinn stand plötzlich an meiner Seite und sah mich verwundert an. Trotzdem nahm er ein Ende des Seils, das am Tisch befestigt war, und betrachtete es, als wollte er herausfinden, wie er mich damit am besten festbinden konnte. Ich fand es interessant, dass er sich für das Seil entschied anstatt für die sehr alten Lederriemen mit Schnallen. Er spähte zwischen der Tür, der Streckbank und mir hin und her.
Das Seil schien neuer zu sein als der Rest des Apparates, wahrscheinlich aus Hanf – was in historischer Hinsicht nicht ganz korrekt war –, doch das ursprüngliche Seil hatte sich wahrscheinlich während der letzten siebenhundert Jahre in Staub aufgelöst.
»Damit wird es gehen.« Ich hielt ihm die Handgelenke entgegen, dann richtete ich die Aufmerksamkeit auf meine Füße. »Binde auch die Füße fest. Das ist ja so cool! Und dann mach ein Foto. Ich will es der Strickgruppe schicken.«
Quinn zögerte, sein Ausdruck war eine Mischung aus Überraschung und Unsicherheit. Dann machte er sich plötzlich ans Werk. Er war ganz offensichtlich ein effizienter und gründlicher Knotenbinder, während er schnell meine Handgelenke befestigte und sich dann an die Füße machte. Er wirkte noch immer abgelenkt und angespannt, konzentrierte sich aber jetzt darauf, mich festzubinden. Ich wartete mit den Fingern, um seinen Knoten zu überprüfen. Das Seil schnitt unangenehm in meine Haut, wo meine Arme an die Ecken des Apparates gebunden waren.
Es sah so aus, als ob Quinn Sullivan bei Knoten keinen Spaß verstände.
Es störte mich nicht, dass meine Beine auf nicht sehr damenhafte Weise gespreizt waren – was vor allem auch daran lag, dass mein kurzer Rock nach oben geschoben werden musste. Ich war jedoch zu sehr mit der Tatsache beschäftigt, dass ich auf eine richtige Streckbank gebunden wurde!
»Hey, glaubst du, es ist dieselbe, auf die sie Guy Fawkes gebunden haben? Obwohl ja nur darüber gemunkelt wurde, dass sie bei ihm die Streckbank benutzt haben. Er muss ziemlich klein gewesen sein. Siehst du, dass meine Beine zu lang sind? Ich frage mich, wie groß er wohl gewesen ist. Hast du gewusst, dass die Menschen immer größer werden? Seit der industriellen Revolution wachsen wir tatsächlich im Durchschnitt über einen Zentimeter pro Generation.«
Ich erzählte Quinn noch weitere Fakten, während er seine Aufgabe erfüllte. Ich war so sehr mit dem überschäumenden Brunnen an hervorsprudelnden Informationen beschäftigt, dass ich gar nicht richtig bemerkte, wie er mit seiner Hand meinen inneren Knöchel streichelte, bis ich spürte, wie mir ein Schauer über das Bein raste.
»… sie dachten, es sei … sie … sie …« Ich bebte bei seiner Berührung, blinzelte und fokussierte meinen Blick auf Quinn – sah ihn jetzt richtig an – anstatt auf die Tatsachen, die in meinem Kopf herumschwirrten.
Quinn stand an meiner Wade, die Hüfte gegen den Holztisch gelehnt, im Gesicht ein für ihn typisches, kaum wahrnehmbares Lächeln. Seine Augen, die fast den ganzen Abend sichtbar abgelenkt waren, wirkten in diesem Moment auf einmal durchdringend und erhitzt.
Er wirkte ein wenig diabolisch.
»Quinn?«
»Das gefällt mir. Wir sollten uns auch so eine besorgen.« Er ließ die Finger an der Innenseite meines Beins hinaufwandern, was mich reflexartig zurückzucken ließ, ohne weit zu kommen. Ich war schließlich gebunden und festgehalten … vom Seil.
Er lachte leise – ein hinterhältiges Kichern über meinen hilflosen Zustand.
Ich hob die Augenbrauen und antwortete mit einem atemlosen Lachen: »Ha … haha … ha.« Ich schluckte, als seine Fingerspitzen hinter mein Knie rutschten und die empfindliche Haut dort liebkosten. »Du kannst mich jetzt wieder losmachen.«
Sein kaum vorhandenes Lächeln wurde breiter, bis es zu einem wahrhaft teuflischen Grinsen wurde. »Na ja, also, nicht so schnell …« Er kniff die Augen zusammen, als wäre er in Gedanken vertieft.
Ich lächelte nicht mehr. »Quinn«
»Pst …« Langsam schüttelte er den Kopf und ging ein Stück weiter, bis seine Hüfte neben meinem Knie war. Bevor ich noch protestieren konnte, schob er die Hand mit einer fiebrigen Berührung zur Innenseite meines Oberschenkels unter meinem Rock. Ich schnappte nach Luft. Elektrische Funken schienen aus seinen Fingern zu schießen, und für einen kurzen Augenblick setzte mein Herz aus.